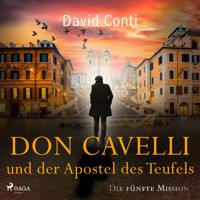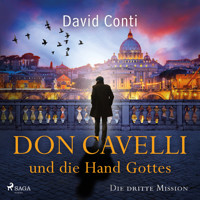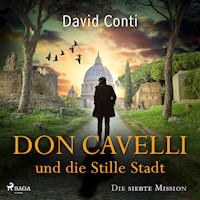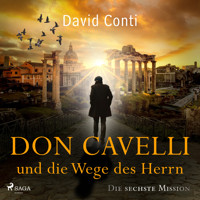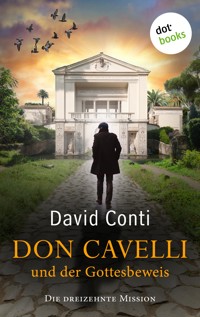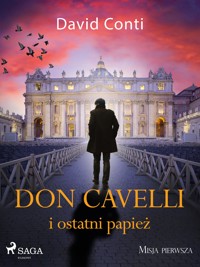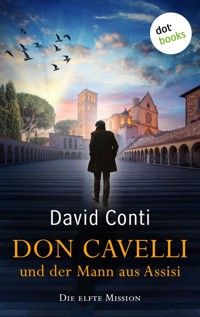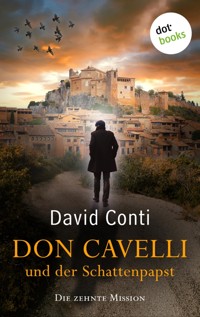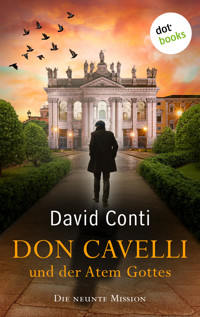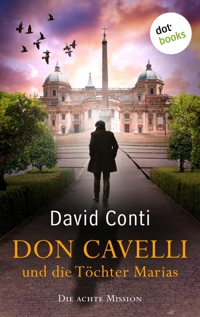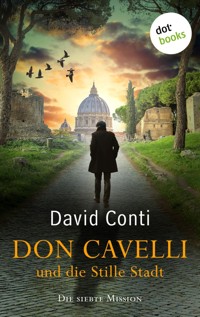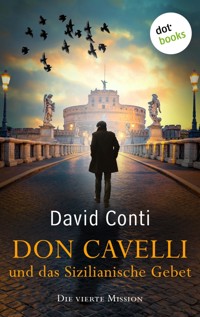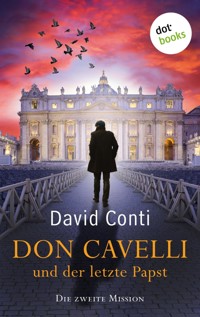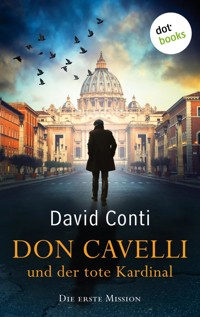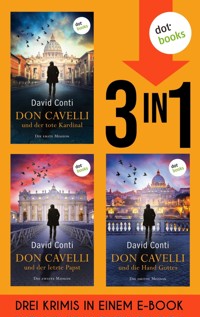
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Er kennt den Vatikan wie seine Westentasche – doch viele Geheimnisse sind ihm noch immer verborgen DON CAVELLI UND DER TOTE KARDINAL: Obwohl er kein Mann der Kirche ist, hat Geschichtsprofessor Don Cavelli im Vatikan lebenslanges Wohnrecht und genießt zahlreiche Privilegien. Vertraute hat er wenige, umso schockierender ist die Nachricht vom Tod seines Freundes Eduardo Fontana: Was trieb den Kardinal dazu, in der israelischen Wüste den Tod zu suchen? Cavelli beginnt nachzuforschen – und kommt einer Verschwörung auf die Spur, die die ganze Welt erschüttern könnte ... DON CAVELLI UND DER LETZTE PAPST: Im Vatikan läuten die Totenglocken: Der Papst ist gestorben, ein neues Konklave muss einberufen werden ... Doch dann geschieht das Unvorstellbare: Ein Kardinal nach dem anderen lehnt die Wahl ab. Ein dunkles Gerücht von Verrat macht sich breit. Doch die Kardinäle sind während des Konklave von der Außenwelt abgeschnitten – die einzige Hoffnung ruht nun auf Don Cavelli … DON CAVELLI UND DIE HAND GOTTES: Ein Kreuzfahrtschiff, das mit Tausenden Passagieren ausläuft – und in Genua als Geisterschiff eintrifft. Ein italienisches Bergdorf, das einen verzweifelten Notruf absetzt – doch jede Hilfe kommt zu spät. Im Auftrag der Kirche beginnt Don Cavelli zu ermitteln – denn hinter diesem Terror verbirgt sich jemand, der sich für die Hand Gottes hält … Kann Cavelli ihn aufhalten, bevor es zu spät ist? Die ersten drei Fälle der actiongeladenen Erfolgs-Spannungsreihe um Don Cavelli.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 819
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Don Cavelli und der tote Kardinal
Erstes Buch
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
Zweites Buch
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
Drittes Buch
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII
LVIII
LIX
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI
LXVII
Nachwort
Don Cavelli und der letzte Papst
Morgendämmerung
Prolog
Erstes Buch
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
Zweites Buch
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
IL
L
LI
LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII
LVIII
LIX
LX
LXI
Drittes Buch
LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI
LXVII
LXVIII
LXIX
LXX
LXXI
LXXII
LXXIII
LXXIV
LXXV
LXXVI
LXXVII
LXXVIII
LXXIX
LXXX
LXXXI
LXXXII
LXXXIII
Epilog
Dichtung und Wahrheit
Don Cavelli und die Hand Gottes
Anmerkung des Autors
Prolog
Erstes Buch
Sechs Tage zuvor
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
Zweites Buch
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
Drittes Buch
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
Dichtung und Wahrheit
Lesetipps
Über dieses Buch:
DON CAVELLI UND DER TOTE KARDINAL: Obwohl er kein Mann der Kirche ist, hat Geschichtsprofessor Don Cavelli im Vatikan lebenslanges Wohnrecht und genießt zahlreiche Privilegien. Vertraute hat er wenige, umso schockierender ist die Nachricht vom Tod seines Freundes Eduardo Fontana: Was trieb den Kardinal dazu, in der israelischen Wüste den Tod zu suchen? Cavelli beginnt nachzuforschen – und kommt einer Verschwörung auf die Spur, die die ganze Welt erschüttern könnte ...
DON CAVELLI UND DER LETZTE PAPST: Im Vatikan läuten die Totenglocken: Der Papst ist gestorben, ein neues Konklave muss einberufen werden ... Doch dann geschieht das Unvorstellbare: Ein Kardinal nach dem anderen lehnt die Wahl ab. Ein dunkles Gerücht von Verrat macht sich breit. Doch die Kardinäle sind während des Konklave von der Außenwelt abgeschnitten – die einzige Hoffnung ruht nun auf Don Cavelli …
DON CAVELLI UND DIE HAND GOTTES: Ein Kreuzfahrtschiff, das mit Tausenden Passagieren ausläuft – und in Genua als Geisterschiff eintrifft. Ein italienisches Bergdorf, das einen verzweifelten Notruf absetzt – doch jede Hilfe kommt zu spät. Im Auftrag der Kirche beginnt Don Cavelli zu ermitteln –
denn hinter diesem Terror verbirgt sich jemand, der sich für die Hand Gottes hält … Kann Cavelli ihn aufhalten, bevor es zu spät
Über den Autor:
David Conti wurde 1964 in Rom geboren und verbrachte dort – unterbrochen von einem mehrjährigen Aufenthalt in München – seine Kindheit und Jugend. Nach einem Studium der Theologie, Geschichte und Germanistik in Perugia, Yale und Tübingen, war er mehrere Jahrzehnte lang in verantwortlicher Position bei einer internationalen Institution in Rom tätig. Seit seinem beruflichen Ausscheiden aus dieser, verbringt er seine Zeit mit Reisen und dem Schreiben der »Don Cavelli«-Reihe. Er lebt abwechselnd in Castel Gandolfo, Zürich und Santa Barbara.
Bei dotbooks erscheint David Contis »Don Cavelli«-Vatikankrimireihe mit bislang zwölf Bänden, die als eBooks und Printausgaben erhältlich sind. Die ersten drei Bände sind auch als Sammelband erschienen.
Die ersten acht Bände der Reihe sowie der Sammelband sind auch als Hörbuch bei Saga Egmont erschienen.
***
Sammelband-Originalausgabe September 2025
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe von »Don Cavelli und der tote Kardinal« 2020 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe von »Don Cavelli und der letzte Papst« 2020 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe von »Don Cavelli und die Hand Gottes« 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: dotbooks GmbH, München
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-824-6
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
David Conti
Don Cavelli und der tote Kardinal, Don Cavelli und der letzte Papst & Don Cavelli und die Hand Gottes
Drei Vatikan-Krimis in einem eBook
dotbooks.
Don Cavelli und der tote Kardinal
Erstes Buch
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
Zweites Buch
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
Drittes Buch
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII
LVIII
LIX
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI
LXVII
Nachwort
Don Cavelli und der letzte Papst
Morgendämmerung
Prolog
Erstes Buch
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
Zweites Buch
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
IL
L
LI
LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII
LVIII
LIX
LX
LXI
Drittes Buch
LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI
LXVII
LXVIII
LXIX
LXX
LXXI
LXXII
LXXIII
LXXIV
LXXV
LXXVI
LXXVII
LXXVIII
LXXIX
LXXX
LXXXI
LXXXII
LXXXIII
Epilog
Dichtung und Wahrheit
Don Cavelli und die Hand Gottes
Anmerkung des Autors
Prolog
Erstes Buch
Sechs Tage zuvor
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
Zweites Buch
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
Drittes Buch
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
Dichtung und Wahrheit
Lesetipps
Don Cavelli und der tote Kardinal
Der Wüstensand fühlt sich an wie glühende Kohlen, die Sonne brennt erbarmungslos herab. Der alte Kardinal hat keine Chance, dieser Hölle zu entkommen ...
Geschichtsprofessor Don Cavelli ist vielen im Vatikan ein Dorn im Auge: Obwohl er kein Mann der Kirche ist, hat er dort genau wie seine Vorfahren lebenslanges Wohnrecht und genießt zahlreiche Privilegien. Cavelli hat nur wenige Vertraute, daher erschüttert die Nachricht vom Tod seines Freundes Eduardo Fontana ihn umso mehr: Was trieb den Kardinal in das Inferno der israelischen Wüste? Als Cavelli eine mysteriöse Botschaft zugespielt bekommt, beschleicht ihn ein dunkler Verdacht. Gemeinsam mit Pia Randall, der Nichte des Kardinals, beginnt er nachzuforschen – und kommt einer Verschwörung auf die Spur, die nicht nur Rom, sondern die ganze Welt erschüttern könnte ...
... In jenen Tagen begingen die führenden Männer
viel Untreue und entweihten das Haus, das der
Herr zu seinem Heiligtum gemacht hatte.
Immer wieder hatte der Herr, der Gott ihrer Väter,
sie durch seine Boten gewarnt; denn er hatte
Mitleid mit ihnen. Sie aber verhöhnten die Boten
Gottes, verachteten sein Wort und verspotteten
seine Propheten, bis der Zorn des Herrn so groß
wurde, dass es keine Rettung mehr gab ...
Erstes Buch
I
Herr, erbarme Dich!
Wenn dies die Hölle war, dann war sie schrecklicher als in seinen qualvollsten Albträumen.
Es musste jetzt um die Mittagsstunde sein. Die Sonne stand im Zenit und brannte erbarmungslos auf ihn nieder. Kein Flecken Schatten im Umkreis von Hunderten von Kilometern, kein Tropfen Wasser. Nur Sand. Glühender Sand. Der alte Mann in der Kardinalsrobe wusste, dass er einen entsetzlichen Fehler begangen hatte. Einen Fehler, der nun nicht mehr korrigiert werden konnte. Ob er umkehrte oder sich weiter voranschleppte – es spielte keine Rolle mehr. Seine Eingeweide hatten sich in loderndes Feuer verwandelt, vor seinen Augen schwirrten dunkle Nebel umher. Ohne dass es ihm bewusst wurde, gaben seine Beine nach, und er fiel vornüber in den Sand.
Herr, erbarme Dich!
Kardinal Eduardo Fontana öffnete seinen ausgetrockneten Mund, um zu beten, aber es kam nur noch ein kraftloses Flüstern heraus. »... vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern ... Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit ...«
Fontanas Augen schlossen sich. Mit einem Mal fühlte er sich von einer nie gekannten Leichtigkeit durchdrungen. In der Ferne erblickte er eine seltsam vertraute Gestalt. Sie stand einfach da und schien geduldig zu warten. Jetzt breitete die Gestalt die Arme aus, und ein strahlendes Licht ging von ihr aus. So überirdisch schön und prachtvoller, als er es sich jemals vorgestellt hatte. Endlich! Endlich war er zu Hause.
II
Der Präsident der päpstlichen Kommission, Kardinalstaatssekretär Ricardo Lombardi, stieß mit einer unwirschen Handbewegung die Fensterflügel seines riesigen Büros auf und zündete sich einen Cigarillo an. Den musste er sich jetzt einfach genehmigen, auch wenn das Rauchen im Governatoratspalast, und auch in allen anderen Räumen des Vatikanstaates, seit Jahren verboten war. Eine Maßnahme, die Lombardi insgeheim entschieden ablehnte. Sicher, das ganze Land stand komplett auf der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO, und natürlich konnte man in Räumlichkeiten wie der Sixtinischen Kapelle schlecht eine Sprinkleranlage installieren, aber dennoch: Was hatte sich die UNESCO in die Interna eines souveränen Staates einzumischen? Lombardi hielt sich weiß Gott nicht für einen rückständigen Menschen, aber früher war es eindeutig besser gewesen: Pius IX., selbst ein starker Raucher, hatte in der Vatikanstadt eine Zigarettenfabrik errichten lassen, Benedikt XIV. hatte die Tabaksteuer abgeschafft, und bis auf den heutigen Tag wurde die Wahl eines neuen Papstes durch weißen Rauch bekanntgegeben. Doch seit 2002 hingen überall diese Schilder Prohibetur Uti Fumo, und Zuwiderhandlungen kosteten dreißig Euro. Es war einfach grotesk.
Lombardi nahm einen tiefen Zug und blies den Rauch mit Nachdruck in die warme Luft der Vatikanischen Gärten.
Dann wandte er sich abrupt um und fasste erneut seinen Sekretär, Monsignore Fabiani, scharf ins Auge, welcher etwas windschief im Zimmer stand und ein unglückliches Gesicht machte.
»Also noch einmal in aller Ruhe. Möglicherweise habe ich mich unklar ausgedrückt, Fabiani ...«
Monsignore Fabiani versuchte sich an einem Lächeln und brachte es fertig, dabei sogar noch unglücklicher auszusehen als zuvor. Er räusperte sich vorsichtig.
»Eminenz, ich stimme Ihnen aus vollem Herzen zu, dass dieses Appartamento aufgrund seiner Größe und seiner herrlichen Lage wie geschaffen wäre, um einen der neu kreierten Kardinäle aufzunehmen, jedoch … Es ist nun einmal nicht möglich ..., da es von Signor Cavelli bewohnt wird.«
Lombardi nahm erneut einen Zug. Das Nikotin beruhigte seine Nerven. Er lächelte. »Aber natürlich ist es möglich. Ich ordne an, dass der Mann umquartiert wird.«
Fabiani schluckte. »Ich fürchte, das steht leider außerhalb Ihrer Macht, Eminenz.«
Kardinal Lombardi starrte seinen Sekretär sprachlos an. War Fabiani von allen guten Geistern verlassen? Lombardi war zwar erst seit elf Tagen im Amt und hatte sicher noch nicht alles, was zu seiner neuen Stellung gehörte, bis in die letzten Feinheiten durchdrungen, aber das änderte nichts daran, dass er der Stellvertreter des Papstes war. Ohne es recht zu bemerken, nahm er einen tiefen Zug, bevor er mit gefährlich leiser Stimme antwortete: »Hören Sie, Fabiani, innerhalb der vatikanischen Mauern kann ich anordnen, was immer ich für geboten erachte, und niemand außer dem Heiligen Vater und Gott selbst haben die Macht, dem zu widersprechen.«
Fabianis bleiche Lippen zitterten leicht. »Völlig richtig, Eminenz. Niemand!« Erneut räusperte er sich, bevor er mit leiser Stimme hinzufügte: »Niemand außer Signor Cavelli.«
III
Im Laufe der Jahrhunderte hat es nur sehr wenige Päpste gegeben, die dem Vatikan so sehr ihren Stempel aufgedrückt haben wie Giuliano della Rovere – besser bekannt als Julius II. Eine seiner ersten Amtshandlungen hatte darin bestanden, unter Androhung schwerster Strafen die Wahl des Papstes durch Bestechung zu verbieten. Eine Praxis, von der er wusste, dass sie bis dato eher die Regel als die Ausnahme gewesen war – schließlich hatte er selbst seine Wahl auf eben diese Weise bewerkstelligt. Er war es auch, der 1506 den Grundstein für den Petersdom legte und die Schweizer Garde zum Schutz des Papstes einführte. Er beauftragte Raffael mit der Schaffung der als Stanzen bekannten berühmten Gemälde in den päpstlichen Gemächern sowie zahlreicher anderer Werke und befahl Michelangelo, die Sixtinische Kapelle auszumalen.
Es wäre allerdings ein Fehler, anzunehmen, dass er ein Freund der Künste gewesen wäre. Mehr noch als ein Mann Gottes war Julius Feldherr, und sein vorrangiges Ziel bestand in der Ausweitung der Macht des Kirchenstaates. Kunstwerke dienten ihm da nur als kostspieliges Symbol dieser Macht. Auch ein Genie wie Michelangelo bekam dies bei mehr als einer Gelegenheit zu spüren. Als er den Papst in einer Statue verewigte, die ein Buch in der Hand hielt, soll Julius gebrüllt haben: »Was soll ich mit einem Buch? Gebt mir ein Schwert!«
Zunächst hatte sich Michelangelo geweigert, den Auftrag zur Ausmalung der Sixtinischen Kapelle anzunehmen – er sah sich als Bildhauer und nicht als Maler –, aber Julius war kein Mann, dem man etwas abschlug. Dies galt selbst für den allseits gefürchteten Cesare Borgia, den Julius bald nach Beginn seines Pontifikats gefangen setzen ließ. Stets trug il terribile, wie man ihn hinter seinem Rücken nannte, einen schweren Stock bei sich, mit dem er auf jeden einprügelte, der das Pech hatte, ihn zu verärgern. Es ist glaubhaft überliefert, dass Michelangelo, der durch das jahrelange Arme-über-den-Kopf-Heben beim Bemalen der Kapellendecke einen Buckel und einen Kropf bekommen hatte, als äußeres Zeichen der Unterwerfung eines Tages mit einem Strick um den Hals vor ihm zu erscheinen hatte. Doch vielen anderen ging es noch schlechter. Die Liste derer, die Julius ohne Bedenken töten ließ, ist lang. Nicht umsonst nannte ihn Martin Luther den Blutsäufer.
Umso erstaunlicher ist die Existenz einer Urkunde, welche seine Heiligkeit am 31. Januar 1513 ausstellen ließ – nur wenige Wochen vor seinem Tod. In dieser Urkunde wurde verfügt, dass ein gewisser Capitano Umberto Cavelli auf päpstlichen Befehl künftig »liberatus ab ullis calamitatibus« – also »frei von allen Nöten« – zu stellen sei. Diese – »in tiefster Dankbarkeit« – ausgefertigte Urkunde galt nicht nur für Umberto Cavelli selbst, sondern auch für seine Familie und alle seine Nachkommen, und sie beinhaltete neben einer geradezu märchenhaft hohen pekuniären Zuwendung auch das Wohnrecht innerhalb des Vatikans sowie eine Reihe weiterer Privilegien. Und obgleich ihre Gültigkeit zwar nicht bis in alle Ewigkeit fortbestehen sollte, sondern lediglich bis zum Jüngsten Gericht, war die Urkunde zweifellos in dem sicheren Glauben ausgestellt worden, dass man nach diesem Ereignis ohnehin keine Verwendung mehr für sie haben würde.
Eingedenk des Umstands, dass sich Julius selbst gegenüber Künstlern vom Range eines Raffael oder Michelangelo überaus knauserig zeigte und dass sein einziges wahres Interesse in der Ausweitung seiner Macht und der Vernichtung seiner Feinde bestand, mag man sich fragen, mit welchen Taten Umberto Cavelli sich so viel päpstliche Gnade verdient haben mochte.
IV
»Signor Cavelli, dio mio!«
Donato Cavelli hörte Schwester Felicia, bevor er sie sah. Wie beinahe jeden Nachmittag hatte er einen Spaziergang durch die Vatikanischen Gärten gemacht. Um diese Tageszeit fand er es dort am schönsten, denn dann war er fast allein. Die Touristengruppen, denen man – zu Cavellis großem Bedauern – seit einigen Jahren während des Vormittages Einlass gewährte, waren längst verschwunden, und der Heilige Vater, der gegen fünfzehn Uhr seinen täglichen Rundgang durch den Park zu machen pflegte – geschützt von etlichen für den Papst nicht sichtbaren, aber sehr wohl vorhandenen Sicherheitsbeamten –, war wieder in den Apostolischen Palast zurückgekehrt. Hier und dort arbeitete noch ein Gärtner, und zuweilen begegnete Cavelli auch dem einen oder anderen Kardinal, was das Gefühl der Ruhe und Abgeschiedenheit jedoch eher noch verstärkte. Selbst auf den Kieswegen des in Form von barocken Buchsbaumhecken angelegten sogenannten Giardino Italiana, einem Abschnitt der Gärten, der gerade mal fünfzig Meter von der hohen Mauer entfernt war, welche die Vatikanstadt umschloss, war nur das Plätschern der Springbrunnen und das Zwitschern der Mönchssittiche zu hören. Es war nur mit Mühe vorstellbar, dass jenseits der Mauer der römische Stadtverkehr seine nie endende Kakophonie von Vespageknatter und ungeduldigem Gehupe verströmte.
Cavelli wandte sich um und blickte in die Richtung, aus der er Schwester Felicias Rufen gehört hatte. Der aufgeregte Klang in der Stimme der alten Frau überraschte ihn. Er konnte sich nicht erinnern, wann er in den Gärten das letzte Mal lautes Rufen gehört hatte.
Wie alle seine Vorfahren seit 1513 hatte er sein ganzes Leben im Vatikan gewohnt. Was genau sein Urahn Umberto Cavelli damals für Julius II. getan hatte, darüber gab es verschiedene Theorien, die alle mehr oder weniger blutrünstig waren. Für Cavelli spielte es keine Rolle, das lag schließlich ein halbes Jahrtausend zurück. Entscheidend war nur, dass die Urkunde, welche der Papst seinerzeit ausgestellt hatte und die sicher verwahrt in einem römischen Banksafe lag, nach wie vor gültig war. Cavelli wusste nur zu gut, dass im Vatikan nicht jedermann darüber glücklich war – um es diplomatisch auszudrücken –, einen Mitbewohner dulden zu müssen, der dort weder ein klerikales noch ein weltliches Amt ausübte, denn normalerweise war die vatikanische Staatsbürgerschaft grundsätzlich an ein Amt gebunden. Gab man das Amt auf, verlor man auch die Staatsbürgerschaft.
Aber was war im Vatikan schon normal? Der Vatikan lebte nach eigenen Regeln. Diese waren nicht, wie in den meisten Staaten, vor wenigen Jahrhunderten von einigen privilegierten Männern erdacht und festgelegt worden, sondern sie standen in der direkten und ununterbrochenen Tradition des Apostels Petrus. In zweitausend Jahren hatte sich eines aus dem anderen entwickelt, und so verwinkelt und unübersichtlich, wie der Vatikan mit seinen elftausend Räumen äußerlich war – mindestens ebenso kompliziert war er auch in seinem Inneren; ein hochkomplexer Mechanismus, welcher von niemandem vollständig überblickt werden konnte. Selbst kleinste Veränderungen hätten unabsehbare Folgen haben können. So hatte der Heilige Stuhl beispielsweise niemals den Mönch Savonarola rehabilitiert, welcher den berüchtigten Borgia-Papst Alexander VI. als zu Unrecht auf dem Stuhle Petri sitzend bezeichnet hatte und dafür von diesem zum Tod durch Verbrennen verurteilt worden war – eine Hinrichtungsart, mit der man dem Umstand Achtung erwies, dass die Bibel jegliches Blutvergießen verbot. Zwar entsprach Savonarolas Anschuldigung der Wahrheit, da Alexander sein Amt nur durch Bestechung etlicher Kardinäle erhalten hatte, jedoch würde die heutige Anerkennung dieses Umstands gleichzeitig auch bedeuten, dass die Kardinäle, die von Alexander kreiert wurden, keine rechtmäßigen Kardinäle gewesen wären und dass somit nicht Alessandro Farnese zu Papst Paul III. hätte gewählt werden können, auf dessen Befehl wiederum von 1545 bis 1563 das Konzil von Trient stattfand, bei dem entscheidende und heute noch gültige Beschlüsse für die Katholische Kirche gefasst wurden. Mit der Rehabilitation von Savonarola müssten diese Beschlüsse im Nachhinein für ungültig erklärt werden, und die Tradition der letzten fünfhundert Jahre würde wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen.
Wahrlich eine komplizierte Angelegenheit.
Es hätte daher auch in Cavellis Fall schon eines außerordentlich guten Grundes bedurft, die Urkunde eines früheren Papstes in Zweifel zu ziehen. Bislang hatte niemand einen solchen gefunden. Ja, nicht einmal gesucht hatte man danach, denn selbst dies wäre den meisten schon als Frevel erschienen. Der amtierende Papst selbst hätte natürlich so eine Entscheidung treffen können, zumal, wenn – wie in Cavellis Fall – keine weiteren Folgen zu erwarten wären. Der Papst war der unumschränkte Herrscher über den Vatikanstaat. Absoluter Monarch, Gesetzgeber und oberster Richter in einer Person, er war niemandem auf Erden Rechenschaft schuldig, und seine Entscheidungen waren unanfechtbar. Das gesamte Vermögen des Vatikanstaates war im Moment seiner Wahl in seinen persönlichen Besitz übergegangen. Er war somit der einzige gewählte Diktator der Welt. Wenn es ihm beliebte, hätte er sich mit dem gesamten Vermögen aus dem Staub machen (was Papst Benedikt V. im Jahre 964 auch getan hat) und sich auf den Bahamas ein schönes Leben machen können. Es wäre völlig legal gewesen. Und seine Macht beschränkte sich nicht nur auf den Vatikanstaat in Rom. Keineswegs. Er stand auf dem ganzen Planeten über jedem weltlichen Gesetz, und selbst, wenn er es irgendwo nicht getan hätte – gemäß des alten Grundsatzes »ubi est papa, ibi est roma« befand sich der Papst, wo immer auf der Welt er sich gerade aufhielt, dort auf vatikanischem Boden, und wenn es ihm in den Sinn gekommen wäre, einen Mord zu begehen, hätte er dies vor aller Augen tun können, ohne juristische Konsequenzen fürchten zu müssen.
Auf der anderen Seite jedoch war der Papst ein Gefangener der Tradition. Seit dem fünften Jahrhundert galt in der Katholischen Kirche der Grundsatz, dass nur geglaubt werden durfte, was »quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est«, also »was überall, immer, von allen geglaubt worden ist«, und das schränkte die päpstliche Entscheidungsgewalt im Bezug auf Neuerungen in hohem Maße ein. Auch sah er sich durch den Umstand behindert, dass seine eigene Unantastbarkeit auf der Unantastbarkeit seiner Vorgänger fußte. Sollte er Entscheidungen eines seiner Vorgänger als falsch bezeichnen, so wären seine eigenen Entscheidungen ebenfalls nicht mehr über jeden Zweifel erhaben.
Aus all diesen Gründen dauerte es sehr lange, bis sich im Vatikan irgendetwas – und sei es die unbedeutendste Kleinigkeit – änderte. Man dachte hier nicht in Tagen oder Monaten, nicht mal in Jahrzehnten. Man dachte in Jahrhunderten und Jahrtausenden.
So sehr Cavelli manchem ein Dorn im Auge war, seine Anwesenheit war dennoch ein Mosaiksteinchen der jahrhundertealten Tradition und immer noch besser als das, was man mehr als alles andere fürchtete: Veränderung.
Aber schließlich gab es auch weniger direkte, elegantere Wege, die man beschreiten konnte, um ein gewünschtes Ziel zu erreichen. Mehr als einmal hatte man Cavelli durchaus verlockende Angebote gemacht, ihm eine Villa extra muros – also außerhalb der Mauern – zu schenken, wobei die angebotenen Objekte von Mal zu Mal prächtiger geworden waren, aber jedes Mal hatte er ohne Zögern abgelehnt und würde dies auch – höflich, aber unmissverständlich – in Zukunft tun. Er liebte dieses Leben. Er war jetzt Anfang vierzig und immer noch ziemlich gut in Form, was er durch Zehn-Kilometer-Läufe entlang des Tibers alle zwei Tage und auch – seit kurzem – durch den völligen Verzicht auf Zucker bewerkstelligte. Gelegentlich wurde er von Menschen auf der Straße angesprochen, die glaubten, ihn aus dem Fernsehen zu kennen. Lange hatte ihn das irritiert, zumal er selbst seinen Fernseher schon vor Jahren abgeschafft hatte und daher auch nicht wusste, was darin vor sich ging, bis sich irgendwann herausgestellt hatte, dass man ihn mit einem französischen Filmschauspieler namens Gérard Philipe verwechselte. Cavelli hatte sich daraufhin Fotos von Philipe angesehen und musste zugeben, dass diese Verwechslungen – abgesehen davon, dass Gérard Philipe schon lange tot war – eine gewisse Berechtigung hatten.
Da die Geldsumme, die Urahn Umberto vor fünf Jahrhunderten überreicht worden war, inzwischen durch Zins und Zinseszins Cavellis Konto beim IOR, dem Istitute per le Opere di Religione – also dem Institut für religiöse Werke, besser bekannt als Vatikanbank –, auf eine buchstäblich astronomische Höhe angewachsen war, würde er sich, genau wie alle seine Vor- und Nachfahren, um materielle Dinge niemals Sorgen machen müssen und konnte sich daher ganz seinen persönlichen Interessen widmen, die hauptsächlich in ausgedehnten Reisen und einer Forschungsarbeit bestand, die sein Großvater begonnen und sein Vater übernommen hatte: eine vollständige Geschichte des Papsttums. Cavelli führte ihr Werk nun seit neun Jahren fort und befand sich inzwischen in der Arbeit zu Band 14. Gelegentlich fragte man ihn, ob es nicht seltsam sei, wo er doch schon im Vatikan wohne, auch noch darüber zu forschen, aber Cavelli zog dann stets überrascht die Augenbrauen hoch und antwortete, dass es auch nicht seltsamer sei, als wenn ein Franzose die Geschichte Frankreichs erforschte. Zumal er aufgrund seiner speziellen Lebenssituationen einen viel besseren Einblick hatte, als Historiker von außerhalb des Vatikans je hätten gewinnen können. Cavelli arbeitete für gewöhnlich sechs Stunden am Tag. Vier Stunden davon widmete er seiner eigenen Forschung, nämlich den Pontifikaten zwischen der Gegenwart und Alexander VIII., der sein Amt 1689 angetreten hatte.
Zwar wurden die geheimen Archive der Päpste üblicherweise erst mehrere Jahrzehnte nach deren Tod für die Forschung geöffnet – zurzeit bis einschließlich Pius XII. –, aber Cavelli war von dieser Regelung nicht betroffen. Auch im Geheimen Archiv hatte er unbeschränkten Zugang, was ihm gegenüber seinen Kollegen einen gewaltigen und allseits geneideten Vorteil verschaffte. Die übrigen zwei Stunden seiner täglichen Arbeitszeit widmete er der Überarbeitung der Texte seines Vaters und seines Großvaters, wobei es inhaltlich nicht allzu viel zu ändern gab, da man, je weiter man in der Zeit zurückging, desto weniger über die damaligen Päpste in Erfahrung bringen konnte, aber der Blickwinkel seines Vaters und mehr noch der seines Großvaters hatte über weite Strecken mehr katholische als wissenschaftliche Züge gehabt.
Zudem hielt er zweimal pro Woche als Gastdozent Vorlesungen über sein Fachgebiet an der La Sapienza, der ältesten Universität Roms. Er ließ sich dafür nur ein symbolisches Gehalt von einem Euro auszahlen, da er keine Lust verspürte, sich auch nur einen Fußbreit in die Welt der italienischen Steuerbehörden zu begeben. Das war ein weiterer Vorteil, wenn man im Vatikan lebte, denn hier war alles steuerfrei. Wenn man ihn fragte, warum er überhaupt unterrichte, da er nichts damit verdiene, erklärte er immer, dass er von seinen Studenten mehr lerne als sie von ihm. Manche Leute lachten dann, weil sie es für einen Scherz hielten, aber es war keiner. Die Diskussionen mit seinen Studenten – er selbst traf eine genaue Auswahl, wer an seinen Seminaren teilnehmen durfte – halfen ihm, seine Gedanken zu ordnen.
»Signor Cavelli!«
Beunruhigt sah Cavelli Schwester Felicia entgegen, die ihn jetzt fast erreicht hatte. Felicia war die Oberschwester der Ordensfrauen von Mater Ecclesiae, einem Kloster, das Papst Johannes Paul II. in den Vatikanischen Gärten hatte einrichten lassen. Die einzige Aufgabe der Schwestern bestand in andauernder Fürbitte und Gebet für den Papst und die Kurie. Ein Leben in Ruhe und Kontemplation. Doch in diesem Moment schien Schwester Felicia völlig außer sich zu sein. Atemlos zerrte sie Cavelli am Ärmel seines Jacketts. »Wissen Sie denn nicht, was geschehen ist?«
Cavelli schüttelte den Kopf. Eine unbestimmte Ahnung sagte ihm, dass er es nicht wissen wollte.
»Seine Eminenz Kardinal Fontana, er ... er ist ...« Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie Cavelli ins Gesicht, unfähig, ein weiteres Wort hervorzubringen.
V
Es lief als Dauerschleife auf fast allen TV-Kanälen.
Der tote Kardinal in der Negevwüste.
Cavelli stand zusammen mit Schwester Felicia und sechs weiteren Schwestern im Fernsehraum von Mater Ecclesiae und schaltete mit der Fernbedienung durch die verschiedenen Sender, bis er bei CNN landete, das soeben mit seinem Bericht wieder von vorn begonnen hatte. Aus dem, was man bisher wusste, ergab sich folgendes Bild: Vor etwa neun Stunden hatte eine israelische Militärpatrouille auf einer Routinefahrt durch die Wüste Negev einen verlassenen Jeep Wrangler entdeckt. Bei der Überprüfung des Wagens hatte man festgestellt, dass der Tank leer und kein Reservekanister vorhanden war. Der Schlüssel steckte noch im Zündschloss. Bei einer sofort veranlassten Hubschraubersuche nach den Insassen des Fahrzeugs hatte man schließlich etwa zwei Kilometer weiter die Leiche des Kardinals entdeckt. Eine später eingeleitete Obduktion hatte bestätigt, was schon vermutet worden war: Der Kardinal hatte einen tödlichen Hitzschlag erlitten. Was den einundsiebzigjährigen Kirchenmann veranlasst hatte, allein und ohne Wasser durch die Wüste Negev zu fahren, war bislang völlig unklar. Offenbar hatte er am Vormittag das American Colony Hotel in Jerusalem verlassen, nachdem er zwei Nächte dort verbracht hatte, war dann mit einem Taxi zur nächsten Hertz-Autovermietung gefahren und hatte einen Geländewagen gemietet. Danach hatte ihn niemand mehr lebend gesehen. Bizarrer als all dies war nur noch die Tatsache, dass Fontana zum Zeitpunkt seines Todes seine Kardinalsrobe getragen hatte. Anhand des vatikanischen Passes, den er bei sich trug, hatte man ihn identifizieren können. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden oder gar ein Verbrechen gab es nicht.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt musste man von einer tragischen Verkettung unglücklicher Umstände ausgehen ...
Cavelli ließ sich auf einen der billigen weißen Plastikstühle fallen, die in mehreren Reihen vor dem Fernseher aufgestellt waren. Hilfesuchend sah er zu den Schwestern auf. Das konnte nicht sein! Eduardo Fontana war ein guter Freund gewesen. Sein Apartment lag direkt unter dem von Cavelli. Oft hatten sie beide abends bei einem Glas Rotwein auf Cavellis riesiger Terrasse gesessen, die untergehende Sonne über dem Petersdom genossen, Schach gespielt und über alles Mögliche diskutiert. Zuweilen über ganz alltägliche, ja geradezu alberne Dinge, aber gelegentlich auch über Fragen des Glaubens. Cavelli war zwar Katholik, aber nicht wirklich religiös. Zumindest nicht vom Kopf her. Er dachte wie ein Agnostiker. Vielleicht hatte die Katholische Kirche mit allem recht – vielleicht aber auch nicht. Wer konnte das wissen? Auch Fontana behauptete nicht, etwas zu wissen, sondern nur, es zu glauben. Allerdings führte er – wie alle religiösen Menschen – sein Leben so, als ob er das, was er glaubte, auch wüsste, während die Agnostiker zwar sagten, sie wüssten nicht, welche Seite recht hätte, aber so lebten, als seien sie Atheisten, und die Atheisten wiederum wussten, dass sie diejenigen waren, die recht hatten, obwohl dieses Wissen auch nur ein Glaube war.
Die entscheidende Frage für Cavelli war: Wie entschied sich, wer an was glaubte? Schließlich konnte man sich seinen Glauben nicht aussuchen. In der Politik war es nicht anders. Die eine Seite war genauso fest von ihrer Wahrheit überzeugt wie die andere. Und dies sogar, obwohl in der Politik das meiste auf nachprüfbaren Fakten beruhte. Trotzdem lag es jenseits der eigenen Kontrolle, auf welcher Seite man stand. Niemand entschied sich absichtlich für ein Lager. Niemand beschloss willentlich, eine bestimmte Sache für wahr zu halten und ihr Gegenteil abzulehnen.
Cavelli beneidete Fontana um seinen Glauben. Tief in seinem Inneren war er überzeugt, dass ein Leben, das von diesem Glauben durchdrungen war, glücklicher war als eines ohne jeden Glauben. Während sein Kopf nur glauben konnte, was er für bewiesen hielt, fühlte er in sich eine Sehnsucht zu glauben.
»Wenn es einen Gott gibt, wie kann er zulassen, dass ein Mensch an ihn glauben möchte, es aber nicht kann?«, hatte er den Kardinal gefragt. Fontana hatte lange nachgedacht und dann mit einer geradezu anrührenden Ratlosigkeit zugegeben, dass dies eine Frage sei, auf die er keine Antwort wisse. Vor allem die schlichte Ehrlichkeit des Kardinals hatte Cavelli immer gemocht. Trotz seines hohen kirchlichen Titels war Fontana von seinem ganzen Wesen her immer ein einfacher Priester geblieben, der für alle da sein wollte, die Hilfe benötigten. Cavelli hatte mehr als einmal erlebt, wie Fontana darüber verzweifelte, dass seiner Zeit und seinen Kräften Grenzen gesetzt waren und er nicht überall helfen konnte, wo es ihm nötig schien. Gelegentlich war ihm anzumerken, dass er seine Ernennung zum Kardinal der Kurie als Unglück ansah. Denn seitdem musste er den größten Teil seiner Zeit auf Verwaltungsangelegenheiten verwenden, deren Notwendigkeit ihm zwar bewusst war, die ihm aber kostbare Zeit für seine seelsorgerischen Aufgaben raubten. Man spürte, dass er ein Mann war, der es sich nicht leicht machte, sondern der sich immer bemühte, das Richtige zu tun, ohne Rücksicht darauf, welche Konsequenzen dies für ihn selbst hatte. Unter den Mitgliedern der Kurie gab es einige, denen er suspekt war mit seiner zupackenden Art, der mehr an praktischer Problemlösung denn an einem geräuschlosen Betrieb des vatikanischen Regierungsapparats gelegen war. Auf der anderen Seite hatte es im Kardinalskollegium nicht wenige gegeben, die ihn durchaus bewunderten für seine Selbstlosigkeit, mit der er die Hilfe für die Bedürftigen anderen Interessen unterordnete.
Man spürte, dass diese Haltung, die man durchaus auch bei anderen Geistlichen finden konnte (da aber nicht selten in einer vordergründig behaupteten und nicht tief empfundenen Art) bei ihm echt war, man schätzte seine offene Art, seinen Sinn für Fairness und nicht zuletzt seinen gelegentlichen Hang zu leicht skurrilem Humor.
Zu Lebzeiten eines Papstes im Kardinalskollegium über einen möglichen Nachfolger zu diskutieren, war offiziell absolut tabu, aber dann und wann ließ man beim Mittagessen in einer gemütlichen Trattoria schon gerne mal die eine oder andere unschuldige Bemerkung fallen oder gab zu verstehen, dass man Sympathien für diesen oder jenen Kardinal hegte – oder eben auch das Gegenteil davon. Einem Mann, der schon als Kardinal seinen Kollegen das Leben schwer machte, würde man kaum Gelegenheit geben, dies – und dann in noch viel erheblicherem Maße – als Papst zu tun.
Als papabile galten nur solche Kollegen, mit denen man gut auskam und die man überdies respektierte. Eduardo Fontana war so ein Mann gewesen. Cavelli hatte dieses Thema eines Abends, als er schon ein Glas zu viel getrunken hatte, angeschnitten. Das Entsetzen auf Fontanas Gesicht war echt gewesen, und er hatte davon gesprochen, wie sehr er darum bete, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen möge. Er fühle sich in jeder Weise zu schwach, diese geradezu übermenschliche Verantwortung auf sich zu nehmen. Cavelli hatte nicht anders gekonnt, als nachzufragen: »Aber was, wenn Sie doch gewählt werden? Was dann? Würden Sie ... ablehnen?«
Fontana hatte ausweichend geantwortet. »Johannes Paul I. hat es getan ...«
»Aber als man ihn drängte, hat er schließlich doch zugestimmt«, widersprach Cavelli.
Fontanas Stimme war kaum hörbar. »Das war sein Unglück!«
Cavelli nickte nachdenklich. Fontana hatte recht. Johannes Paul I. war bereits am dreiunddreißigsten Tag seines Pontifikats völlig unerwartet gestorben. Schnell hatte es Gerüchte gegeben, dass er vergiftet worden sei, aber das hatte sich als haltlose Verschwörungstheorie erwiesen. Albino Luciani – so sein bürgerlicher Name – hatte schon als Kardinal schwere gesundheitliche Probleme gehabt und war einfach von der riesigen Verantwortung als Papst vollkommen überfordert gewesen. Täglich hatte er gegenüber seinen engsten Mitarbeitern darüber geklagt, dass er dieses Amtes nicht würdig sei, und prophezeit, dass sein Pontifikat kurz sein würde, bis er schließlich buchstäblich unter der Last seiner Verantwortung zusammengebrochen war.
Fontana gestand Cavelli an diesem Abend, dass diese Bürde die einzige wirkliche Angst sei, die er im Leben hätte, und dass er zuweilen nachts schlaflos daliege, wenn er sich ausmalte, was ihm unter Umständen bevorstünde.
Die Offenheit, mit der Fontana ihm gegenüber sprach, hatte Cavelli sehr bewegt, zumal er vermutete, dass er der einzige Mensch war, mit dem Fontana so reden konnte. Die Verwandten des Kardinals – es existierten da wohl noch eine jüngere Schwester und deren Tochter – lebten in den Vereinigten Staaten, gegenüber seinen klerikalen Kollegen wäre solche Offenheit nicht angebracht gewesen, und Außenstehende hätten ihn wohl gar nicht verstanden. Nur Cavelli, der metaphysisch gesehen zwischen allen Stühlen saß, der einerseits vielleicht mehr als jeder andere Teil des Vatikans war, andererseits aber völlig unabhängig von der kirchlichen Hierarchie und der keine Berührungsängste gegenüber dem Klerus kannte, hatte genau das Verständnis aufgebracht, das den Kardinal Vertrauen schöpfen ließ. Sicher, der Kardinal war Jahrzehnte älter als er gewesen, aber es war keine Vater-Sohn-Beziehung gewesen. Nein, Donato Cavelli war womöglich der einzige echte Freund, den der Kardinal gehabt hatte.
Und umgekehrt war es vielleicht nicht viel anders.
Cavellis Eltern waren schon vor einigen Jahren verstorben, und außerhalb des Vatikans hatte er nie besonders enge Kontakte gehabt. An der Universität war er zwar bei seinen Studenten beliebt, und auch mit den anderen Dozenten kam er, zumindest oberflächlich, gut aus, aber wirkliche Freundschaften hatten sich daraus nur selten ergeben. Man hatte ihm den – inzwischen fast schon offiziellen – Namen Don Cavelli verpasst, was ihm nicht mal ganz unrecht war. Den Namen Donato hatte er sowieso nie gemocht, und die Bezeichnung Don wurde ja nicht nur für Priester verwendet, sondern war im südländischen Raum allgemein eine respektvolle Anrede für besonders geachtete Männer.
Gelegentlich spürte Cavelli, dass einige Dozenten ihn für einen Exoten hielten, auf den sie mit einer ihnen selbst unbehaglichen Mischung aus Neid und Misstrauen blickten, aber das war ihr Problem, nicht seins. Er war zufrieden, so wie es war.
Bis zu diesem Tag im September vor drei Jahren.
Cavellis Ehefrau Elena war auf der stark befahrenen Straße vor dem Monument für Vittorio Emanuele angefahren und schwer verletzt worden. Man hatte sie noch lebend in die Gemelli-Klinik bringen können, aber noch während der sofort eingeleiteten Notoperation war sie ihren starken inneren Blutungen erlegen. Der Fahrer des BMW, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen war, konnte nie ermittelt werden. Als die Carabinieri Cavelli vom Tod seiner Frau unterrichteten, hatte er zunächst keinen Schmerz empfunden, aber zwei Tage später traf es ihn mit voller Wucht. Die Frau, die er geliebt hatte, mit der er sechzehn Jahre verheiratet gewesen und um die halbe Welt gereist war, würde niemals wiederkommen. In den darauf folgenden Monaten hatte ihn Fontana fast jeden Abend aufgesucht – oft unter irgendeinem nichtigen Vorwand – und ihm in langen Gesprächen geholfen, wieder etwas Halt zu finden. Cavelli war dankbar dafür gewesen, zumindest einen Menschen auf der Welt zu haben, mit dem er seinen Schmerz teilen konnte.
Und nun war dieser Mann tot. In der israelischen Wüste verdurstet. Das ergab einfach keinen Sinn.
Inzwischen hatte die Dämmerung eingesetzt. Er verabschiedete sich von den Schwestern, und dann ging er langsam zurück in Richtung seines Apartments.
VI
Cavelli fand nur wenig Schlaf in dieser Nacht. Unruhig wälzte er sich im Bett hin und her. Aus der Ferne hörte er das Schlagen einer Kirchturmuhr – drei Uhr früh. Er tappte barfuß in die Küche, drehte den Hahn auf und wartete, bis das Wasser aus der uralten Leitung kam. Er füllte ein Glas und trank. Aus dem offenen Fenster blickte er in die Gärten, die im nächtlichen Mondlicht bläulich dalagen und fast schon surreal wirkten. Fontanas Tod ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. Und es war nicht nur Trauer. Wenn er es schon nicht ändern konnte, wollte er es zumindest verstehen. Aber gab es überhaupt etwas zu verstehen? Gewiss, Fontana hatte ein- oder zweimal davon gesprochen, irgendwann einmal das Heilige Land zu besuchen, um mit eigenen Augen die Orte zu sehen, an denen Jesus gelebt und gewirkt hatte, aber der Kardinal war immer ein besonnener Mann gewesen. Diese irrsinnige Aktion, allein und ohne Wasser in eine ihm unbekannte Wüstengegend aufzubrechen, passte in keiner Weise zu ihm. Und dann noch der Umstand, dass er dabei seine Kardinalsrobe getragen hatte ...
Cavellis Gedanken drehten sich im Kreis und fanden nirgendwo Halt.
Um halb sechs hielt er es nicht länger aus. Er brühte sich auf dem alten Gasherd einen doppelten Espresso, zog seine abgetragenen Joggingsachen über und verließ das Haus. Bis zur St. Anna-Pforte ging er im normalen Tempo. Es hieß, das letzte Mal, dass im Vatikan jemand gerannt war, sei im Jahre 1809 gewesen, als Napoleon den Kirchenstaat besetzt hatte. Das war sicherlich etwas übertrieben, aber eben nur etwas. Cavelli grüßte den diensthabenden Hellebardier der Schweizer Garde, der mühsam ein Gähnen unterdrückte und freundlich zurückgrüßte. Kaum hatte er das Tor passiert, verfiel er in einen lockeren Trab, wobei er darauf achtete, die Schultern zu entspannen, wie ihm ein Sportarzt geraten hatte, zu dem er letztes Jahr wegen seiner Rückenschmerzen gegangen war und die im Laufe der Zeit, ohne dass er es bewusst gemerkt hätte, wieder verschwunden waren. Zu einem Gutteil wohl auch deswegen, weil er nun zweimal pro Woche in einem kleinen Kellerstudio zum Ringen ging. Eine Sportart, die einem das Äußerste abverlangte und die – darüber hatte er sich vorher informiert – bei Mixed-Martial-Arts-Turnieren den anderen Kampfsportarten fast immer überlegen war. Schließlich konnte man nie wissen.
Er lief außen an Berninis Kolonnaden entlang, vorbei am Petersplatz, der um diese frühe Uhrzeit noch nicht für die Öffentlichkeit freigeben war, und durch die Via della Conciliazione zum Tiber, wo er das Tempo auf seine übliche Laufgeschwindigkeit steigerte. Um diese Zeit war es dort im Sommer herrlich. Es war bereits hell, aber noch war es ruhig auf den Straßen. Er lief weiter geradeaus, vorbei an der Engelsburg, folgte der Flussbiegung nach links, um schließlich über die Ponte Regina Margherita zur Piazza di Popolo zu laufen. Er überquerte den Platz, erklomm dort die Treppen zu dem Park, der sich Villa Borghese nannte, und joggte dort zu der in einer Senke gelegenen Pferderennbahn Piazza di Siena, wo er dann eine Runde im höchsten Tempo drehte, bevor er sich, nun im gemächlichen Trab, auf den Rückweg machte. Normalerweise machte dieser morgendliche Lauf seinen Kopf frei, aber heute wollte sich dieser Effekt nicht einstellen.
VII
Doug Reardens Stadthaus mit Blick auf den Potomac war vielleicht nicht die größte und bestimmt nicht die schönste Villa in Georgetown, aber wahrscheinlich die sicherste. Und das wollte in dieser Gegend schon etwas heißen. In Washingtons nobelstem Wohnviertel lebten viele hochrangige Regierungsmitglieder, die schon von Berufs wegen erstklassigen Schutz genossen. Doug Rearden allerdings arbeitete nicht für die Regierung. Nicht mehr. Vor Jahrzehnten hatte er sich mit einer zunächst noch kleinen Security-Firma selbständig gemacht. Dank seiner erstklassigen Kontakte war der Betrieb schnell zur führenden Firma in ganz Maryland aufgestiegen und ermöglichte ihm ein Leben, das luxuriöser war, als er je erwartet hatte. Es verstand sich von selbst, dass sein Know-how im Security-Bereich nun auch ihm selbst zugute kam.
Wie jeden Morgen saß Rearden pünktlich um sieben in Anzug und Krawatte am Frühstückstisch. Dass seine Firma seit nun fast sechs Jahren von seinem Schwiegersohn geführt wurde und er nicht mehr so oft aus dem Haus ging, war für ihn kein Grund, sich gehen zu lassen. Semper paratus! Immer noch. Er goss etwas dampfenden Kaffee aus der silbernen Art-Deco-Kanne in seine Tasse, nahm einen kleinen Schluck und griff nach der Tageszeitung, nur um sie im nächsten Augenblick wütend auf den glänzenden Mahagonitisch zu klatschen.
Dieses gottverfluchte mexikanische Mistweib! Es war zum ...! Nein! Das war nicht fair. Rearden rief sich innerlich zur Ordnung. Marciella war fleißig, ehrlich und – das Wichtigste von allem – zutiefst gottesfürchtig. Aus diesem Grund hatte er sie vor über zwanzig Jahren eingestellt und es kaum jemals bereut. Aber das mit der Zeitung wollte einfach nicht in ihren mexikanischen Schädel. Warum konnte sie nicht begreifen, dass Zeitung nicht Zeitung war, sondern dass es gravierende Unterschiede gab? Nicht zum ersten Mal hatte sie ihm nicht die Washington Times besorgt, sondern dieses kommunistische Schmierblatt, das sich Washington Post nannte.
Washington Prawdawäre passender, dachte Rearden verächtlich. Dieses widerliche Propagandaorgan hatte doch kein anderes Ziel, als Tag für Tag Amerika in den Dreck zu ziehen.
Sicher, auch Amerika war nicht perfekt – welches Land war das schon? Aber warum immer nur das Negative breittreten, statt das Positive nach vorn zu stellen? Angefangen damals mit Watergate. Dieser Drecksack Bob Woodward hatte alles ans Licht der Öffentlichkeit zerren müssen und damit letztlich die Amtszeit von Präsident Nixon beendet. Danach redete niemand mehr von Nixons zahlreichen Verdiensten, sondern nur noch von Skandalen, und schließlich musste er seinen Stuhl für den Versager Gerald Ford räumen, einen Mann, von dem es hieß, dass er nicht gleichzeitig geradeaus gehen und Kaugummi kauen konnte. Was für eine Verbesserung! Vielen Dank auch, Bob!
Bob Woodward stand auf der Liste der Personen, die Rearden aus tiefster Seele verachtete, weit oben, und es war eine lange Liste. Woodward! Zu allem Überfluss wohnte der Kerl nur zwei Straßen weiter. Wenn Rearden ihn gelegentlich von weitem erblickte, wechselte er die Straßenseite. Hollywood hatte dann noch einen draufgesetzt und einen Film über diesen Verräter gedreht. Mit Robert Redford als Woodward. Redford! Auch so ein Kommunistenfreund. Was hatten diese Leute bloß gegen Amerika, das großartigste Land auf der ganzen Welt?
God’s own country!
Ein Land, das von mutigen und frommen Siedlern aus dem Nichts aufgebaut worden und zur mächtigsten Nation aller Zeiten aufgestiegen war. Auch jetzt noch war Amerika die stärkste Macht der Welt, aber seit einigen Jahrzehnten ging es stetig bergab, das war unübersehbar. An allen Ecken bröckelte es. In erster Linie durch den rasanten Verfall der christlichen Werte im ganzen Land. Das Christentum geriet zunehmend in die Defensive, man musste sich ja inzwischen schon fast schämen, öffentlich zu seinem Glauben zu stehen.
Rearden wusste, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis man auch das Bekenntnis In God we trust von den Geldscheinen und Münzen entfernen würde. Er hoffte inständig, das nicht mehr miterleben zu müssen, und die Chancen dafür standen gar nicht mal schlecht. Dr. Cooper hatte ihm noch drei Monate gegeben. Bestenfalls. Die 1,4 Millionen Marlboro-Zigaretten, die er in den letzten zweiundsechzig Jahren geraucht hatte, waren nicht spurlos an seiner Lunge vorübergegangen, und jetzt bekam er die Rechnung präsentiert. Und wenn schon! Er hatte sein Leben gelebt und Spuren hinterlassen, auf die er stolz war. Er hatte für sein Land mehr getan als – mit zwei Ausnahmen – jede andere Person, die er in seinem Leben gekannt hatte, und wenn jetzt Schluss war, hatte er damit kein Problem. Rearden zündete sich eine Zigarette an und griff mit spitzen Fingern nach der Washington Post.
VIII
Zurück in seinem Apartment, nahm Cavelli eine lauwarme Dusche – heißes Wasser war zu dieser Tageszeit eine Seltenheit in den alten Gebäuden hier –, rasierte sich nass und brühte sich einen weiteren Espresso. Dann zog er eilig seinen Anzug an und verließ erneut den Vatikan, um sich, ganz entgegen seiner üblichen Gewohnheit, einige Zeitungen zu besorgen. Er hatte schon vor drei Jahren aufgehört, Zeitung zu lesen. Ihm war bewusst geworden, dass sich ihr Inhalt im Wesentlichen in drei Teile gliederte. Den Teil, der ihn deprimierte, den Teil, der ihn wütend machte, und den Teil, der ihn nicht interessierte. Natürlich stand gelegentlich auch mal etwas da, was in keine dieser drei Kategorien fiel, doch das kam zu selten vor, als dass es sich noch lohnte. Von heute auf morgen hatte er dann das Zeitungslesen aufgegeben. Zu Anfang hatte er wie ein Drogensüchtiger noch Entzugserscheinungen verspürt, eine nagende Angst, wichtige Dinge zu verpassen, aber das hatte sich nach einiger Zeit gelegt. Seitdem blickte er bedeutend entspannter in die Welt. Heute jedoch würde er eine Ausnahme machen. Vielleicht konnte er mehr über die näheren Umstände von Fontanas Tod erfahren. Er kaufte die italienische Stampa, den Osservatore Romano, die offizielle Zeitung des Heiligen Stuhls, die alles, was den Vatikan betraf, aus erster Hand erfuhr, und die New York Times, die wie alle amerikanischen Medien auch über Details berichtete, die von den meisten seriösen europäischen Medien, welche meinten, den sensiblen Leser schützen zu müssen, weggelassen oder nur in stark verallgemeinerter Form wiedergeben wurden. Cavelli setzte sich in ein Straßencafe und bestellte ein Tramezzino mit Schinken. Sorgfältig blätterte er die Zeitungen durch, die selbstredend alle über den Vorfall berichteten, aber abgesehen von einem ausführlichen Lebenslauf des Kardinals im Osservatore Romano stand in keinem der Artikel etwas, das er nicht schon wusste. Natürlich wurde über die Umstände, die zu seinem Tod geführt hatten, spekuliert, und einige Prominente, die ihn gut gekannt hatten – oder dies zumindest behaupteten –, priesen ihn als sozial engagierten und integren Mann. Die New York Times verstieg sich zu der These, dass Fontana der heißeste Anwärter auf den Papstthron gewesen und weit und breit niemand in Sicht sei, der ihn auch nur im Entferntesten ersetzen könne, was die Katholische Kirche in ihre schwerste Krise seit dem Attentat auf Johannes Paul II. stürze. Cavelli kaute wütend auf seinem Tramezzino herum. Die New York Times mochte ja eine weltweit angesehene Zeitung sein, aber über das, was hinter den Kulissen des Konklaves vor sich ging, wusste sie genauso viel wie jeder andere, der nicht zum Kardinalskollegium gehörte: Gar nichts.
IX
Doug Rearden stand rauchend am Fenster und sah nachdenklich auf den Fluss. Im ersten Moment hatte er die Zeitungsseite versehentlich überblättert, hatte es aber dann doch noch bemerkt.
Kardinal tot aufgefunden.
Rearden nahm einen tiefen Zug. Das Bild von Kardinal Fontana war offensichtlich ein Archivbild und mindestens fünf Jahre alt, wenn nicht noch älter, aber Rearden hatte ihn sofort wiedererkannt. Ein Blick für Gesichter war Teil seines Berufs gewesen. Er bedauerte den Tod des Kardinals. Ein guter Mann, das hatte er gleich gesehen. Ihr Treffen hatte nicht mehr als zehn Minuten gedauert – vielleicht weniger – aber Rearden hatte sofort Vertrauen zu ihm gefasst. Der Kardinal hatte etwas wahrhaft Heiliges an sich gehabt. Rearden schloss die Augen und sprach ein Gebet für den Kardinal. Als er die Augen wieder öffnete, bemerkte er die Zigarette zwischen den Fingern seiner gefalteten Hände. Unwillkürlich musste er an diesen alten Jesuitenwitz denken.
Darf man beim Beten rauchen?
Nein! Aber beim Rauchen beten.
Rearden stieß ein kurzes Lachen aus, das sogleich in einen heftigen Hustenanfall überging. Er ließ sich hustend in einen Ledersessel fallen und rang keuchend nach Luft. Die Anfälle kamen jetzt noch öfter und dauerten länger. Nur sehr wenige Menschen wussten, wie es um ihn stand. Obwohl er inzwischen über siebzig war, wirkte er nach wie vor topfit und wurde regelmäßig wesentlich jünger geschätzt. Bisher hatte er es zu vermeiden gewusst, dass ihn jemand so sah.
Dieses verfluchte Husten. Endlich wurde es schwächer, und er lag erschöpft da.
Fontana! Was für eine betrübliche Nachricht. Allerdings ... andererseits ... Der Herr geht zuweilen seltsame Wege, dachte Rearden. Vielleicht besser so ...
Er zündete sich eine weitere Zigarette an und blies einen Rauchring in die Luft. Er fragte sich, wie viele Zigaretten ihm wohl noch vergönnt sein würden. Sehr viele hoffentlich, aber das lag – wie fast alles – allein in Gottes Hand.
X
Kardinal Fontana wurde zwei Tage später auf Roms größtem Friedhof beigesetzt – dem Campo Verano in der Nähe der Pilgerkirche San Lorenzo fuori le mura. Hier wurden traditionsgemäß alle verstorbenen Kardinäle beerdigt. Aber auch viele andere bedeutende Persönlichkeiten von Garibaldi bis zu Sergio Leone hatten hier ihre letzte Ruhestätte gefunden.
Cavelli hatte Tag und Uhrzeit der Zeremonie aus der Zeitung in Erfahrung bringen müssen, eine Einladung hatte er nicht erhalten. Sicher, er hatte keine offizielle Funktion innerhalb des Vatikans, andererseits war es kein Geheimnis, dass er und Kardinal Fontana Freunde gewesen waren, aber so liefen nun mal die kleinen Spielchen des Kurienapparats. Auch ohne, dass man etwas tat, ließen sich deutliche Botschaften senden. Cavelli hatte im Laufe der Jahre gelernt, über dergleichen hinwegzusehen. Wichtig war nur, dass er hier war.
Der Andrang der Trauergäste ging weit über das hinaus, was die Friedhofskapelle aufnehmen konnte, und so hatte man entschieden, die Zeremonie ans offene Grab zu verlegen. Die Menschenmenge, die sich hier eingefunden hatte, war in der Tat eindrucksvoll. Cavelli schätzte die Zahl der Gäste auf über vierhundert.
Sämtliche Kurienkardinäle und viele Kardinäle aus ganz Europa waren erschienen, und sogar einige Eminenzen aus Nord- und Südamerika und aus Afrika, erkannte Cavelli.
Einen asiatischen Kardinal vermochte er nicht zu entdecken, was, wie er vermutete, wohl einerseits an der großen Entfernung zu Rom lag, aber möglicherweise auch daran, dass eine Reihe der asiatischen Kardinäle, die aus Ländern kamen, in denen Christen vom Staat verfolgt wurden, vom Papst nur in pectore ernannt worden waren – also im Herzen. Nur sie selbst und der Papst wussten, dass sie Kardinäle waren. Der Heilige Vater gab in solchen Fällen nur bekannt, dass er einen Kardinal in pectore ernannt hatte, und erst wenn – oder falls – sich die politischen Umstände in dem entsprechenden Land verbesserten, wurde die Ernennung der Öffentlichkeit verkündet. Starb der Papst vorher, blieb sie auf ewig geheim.
Cavelli bedauerte, nicht früher gekommen zu sein. Nun musste er sich mit einem Platz ganz hinten begnügen und verstand kaum ein Wort von der Grabrede des Kardinaldekans, dessen müdes Bernhardinergesicht heute noch trauriger aussah als sonst. Cavellis Gedanken begannen, eigene Wege zu wandern.
Was war nur mit Eduardo Fontana geschehen? Was hatte ihn veranlasst, in die israelische Wüste zu fahren? Cavelli versuchte, sich die letzten Treffen mit Fontana ins Gedächtnis zu rufen. Hatte der Kardinal ihm gegenüber irgendeine Andeutung gemacht, die ihm damals bedeutungslos erschienen war? Cavelli konnte sich an nichts dergleichen erinnern. Allerdings, wenn er jetzt darüber nachdachte, wurde ihm bewusst, dass der Kardinal in den letzten zwei Wochen sehr viel in sich gekehrter gewirkt hatte als sonst. Kurz zuvor hatte er seine Schwester in den Vereinigten Staaten besucht. War dort irgendetwas vorgefallen? Von dieser Reise war er jedenfalls irgendwie verändert zurückgekommen.
Er war so freundlich und warmherzig wie immer gewesen, aber er hatte seinen Humor verloren und wirkte irgendwie zerstreut, als wenn er nicht ganz da wäre. Cavelli hatte nicht nachgefragt, weil er den Kardinal nicht bedrängen wollte; jetzt bereute er diese falsche Rücksichtnahme.
Hätte er das Unglück irgendwie verhindern können? Cavelli schüttelte, ohne es zu merken, den Kopf. Es hatte keinen Sinn, darüber nachzugrübeln. Er versuchte, sich wieder auf die Rede des Kardinaldekans zu konzentrieren, aber es war hoffnungslos. Er stand einfach zu weit hinten, und nur dann und wann wehte der Wind einzelne Satzfetzen zu ihm herüber.
Plötzlich kam Bewegung in die Menge. Offenbar war die Rede beendet, und nun trat man ans offene Grab, um dem Kardinal die letzte Ehre zu erweisen.
Cavelli fiel eine zierliche Frau auf, die ihn ein bisschen an die junge Geraldine Chaplin erinnerte und die länger am Grab stehen blieb als die übrigen Trauergäste. Plötzlich kam ihm der Gedanke, dass sie ihn möglicherweise persönlich gekannt hatte. Vielleicht hatte sie eine Erklärung für Fontanas Verhalten. Cavelli war unschlüssig, ob er sie aufgrund einer so vagen Hoffnung ansprechen sollte. Wahrscheinlich würde er sich nur lächerlich machen. Andererseits ...
Zweimal war er drauf und dran, es zu tun, nur um es im nächsten Moment wieder als sinnlos und aufdringlich zu verwerfen. Als er schließlich genug Mut gefunden hatte, war es zu spät. Er sah gerade noch, wie sie sich abwandte, dann verlor sie sich in der Menge. Cavelli versuchte, ihr zu folgen, aber in dem schwarzen Meer der Trauergäste kam er kaum voran. Ein- oder zweimal sah er noch ihren Kopf für Sekundenbruchteile in der Menschenmenge auftauchen, und dann war sie verschwunden.
XI
Mühsam stemmte Alberto Bonetti seinen schwergewichtigen Körper aus dem ledernen Schreibtischsessel hoch und schloss die Knöpfe seines maßgeschneiderten Zweireihers. Langsam trat er an den Wandsafe und starrte auf das metallene Rad zum Einstellen der Zahlenkombination. Eine einzelne Schweißperle rann seine Stirn hinunter und dann über das rechte Glas seiner unmodischen Hornbrille. Seine manikürten Hände zitterten leicht. Die antike Standuhr neben der Tür schlug einmal zur Viertelstunde, und ihm wurde das Groteske der Situation bewusst. Er war schließlich kein Juwelendieb. Dies war sein eigenes Büro. Sein eigener Safe. Wenn er ihn öffnen wollte, würde er ihn einfach öffnen. Andererseits, das, was dort in seinem Safe lag und ihn seit drei Nächten nicht schlafen ließ, gehörte ihm nicht. Er hatte präzise Anweisungen erhalten, was damit zu geschehen hatte. Schon Tausende Male hatte er solche und ähnliche Anweisungen bekommen, und in den letzten vierundvierzig Jahren hatte er sie jedes Mal bis aufs i-Tüpfelchen korrekt ausgeführt.
Aber dieses Mal ...
Das hier war anders.
Bonetti schluckte.
Zögernd stellte er die Kombination ein und öffnete den Safe.
Dort lag er: der dünne weiße Umschlag. Nach wie vor mit einem intakten roten Wachssiegel verschlossen. Die Frage war: Wusste der Empfänger von dem Siegel? Falls ja, konnte Bonetti immer noch behaupten, der Umschlag sei zu Boden gefallen und das Siegel dabei zerbrochen. Das Gegenteil würde sich nicht beweisen lassen. Bonetti nahm den Umschlag heraus und legte ihn behutsam auf seinen pompösen Schreibtisch. Er setzte sich vorsichtig in den ledernen Drehsessel und untersuchte das Siegel. Wenn man ganz vorsichtig ... Erneut rann ihm eine Schweißperle über die Brille, bevor sie auf den Umschlag tropfte. Bonetti zuckte zusammen. Schlagartig war ihm klar geworden, dass es glatter Irrsinn war, überhaupt nur in Erwägung zu ziehen, den Umschlag zu öffnen. Die Kanzlei Bonetti war seit vier Generationen eines der renommiertesten Notariate von Rom. Fast schon so etwas wie eine staatliche Institution. Sein Vater würde sich im Grabe umdrehen, wenn er ihn so sehen müsste. Bonetti richtete reflexartig seine akkurat gebundene Krawatte. Jedes noch so kleine Abweichen vom vorschriftsmäßigen Weg stand doch außerhalb jeder Diskussion. Auch wenn er fast umkam vor Neugierde, was sich in diesem Umschlag befand, er würde ihn korrekt dem rechtmäßigen Empfänger übergeben. Basta!
Entschlossen drückte er den abgeschabten Knopf der Gegensprechanlage. »Gabriella, verbinden Sie mich mit dem Vatikan ... Ein Signor Donato Cavelli ...«
XII
»Nicht am Telefon, Signor Cavelli, nicht am Telefon ...«
Cavelli hatte unwillkürlich grinsen müssen, als die beschwörenden Worte des Notars durch die Telefonmuschel an sein Ohr drangen. Er konnte geradezu hören, wie sein Gesprächspartner dabei entsetzt die Augenbrauen hochriss.
Es gab zwei Arten von Juristen in Italien. Die ganz legeren, die ständig betonten, wie sehr sie die Konventionen – von denen sie lebten – verachteten, und die überaus feierlichen, die es verstanden, aus jedem noch so geringfügigen Verwaltungsvorgang eine derart weihevolle Zeremonie zu machen, dass dagegen selbst eine Papstmesse im Petersdom wie eine ausgeflippte Hippie-Party wirkte. Dottore Bonetti gehörte ganz offensichtlich zur letzteren Gruppe. Um keinen Preis hatte er auch nur den Hauch einer Andeutung darüber machen wollen, um was genau es sich bei seinem Anruf handelte. Nur dass er den hochverehrten Signor Cavelli dringend bäte, ihn in seiner Kanzlei in der Via Condotti aufzusuchen. Terminlich könne er sich dabei voll und ganz nach den Bedürfnissen Signor Cavellis richten, wobei er jedoch keinesfalls verhehlen wolle, dass er ein baldiges Erscheinen für äußerst ratsam und namentlich ein Erscheinen noch heute um Punkt 16.30 Uhr für überaus günstig halten würde.
Cavelli hatte die Augen verdreht und dann höflich zugesagt.
XIII
Wenige Minuten vor dem verabredeten Zeitpunkt erreichte Cavelli den Palazzo in der Via Condotti. Er war trotz der nachmittäglichen römischen Hitze zu Fuß gekommen, und als er die marmorne Empfangshalle betrat, blieb er stehen, um die frische Kühle, die ihn umfing, einen Augenblick lang zu genießen. Ein kaum noch wahrnehmbarer Duft von puderigem Parfüm hing in der Luft. Er betrat den uralten, aber auf Hochglanz polierten Fahrstuhl, schloss die Scherengittertür und drückte auf den Knopf neben dem kleinen Messingschild.
Dott. Bonetti 4
Mit einem müden, aber unbeirrbaren Surren glitt der Fahrstuhl nach oben. Die drei Spiegel an den Wänden der Kabine vervielfältigten Cavelli unzählige Male und zeigten ihn von allen Seiten. Ihm wurde bewusst, dass die wenigen Male im Leben, wo er sich von hinten gesehen hatte, immer in einem Fahrstuhl gewesen waren. Ein echter Selbsterfahrungstrip.