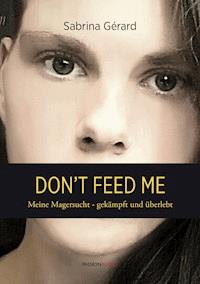
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Schortgen SARL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sabrina G. ist Anfang zwanzig, wiegt noch 36 Kilo und will sterben. Sie ist süchtig, doch nicht nach Drogen, sondern nach ehrlicher Aufmerksamkeit, nach Verständnis für das, was sie innerlich mitmacht, und dafür hungert sie sich fast zu Tode. Die junge Frau fühlt sich unverstanden, sieht sich dem ständigen Druck ? der zum Teil von ihr selbst ausgeht ? nicht mehr gewachsen. Als sie sich endlich, wenn auch unfreiwillig, in Therapie begibt, ist das erst der Anfang eines langen Leidenswegs. In diesem autobiographischen Roman schildert Sabrina Gérard auf ergreifende Weise ihren Kampf gegen sich selbst und die Magersucht ? ein schier auswegloser Teufelskreis. Kein Tabu bleibt unberührt. Don?t feed me ? ein Buch, das aufrüttelt, in seiner Ehrlichkeit schockiert und dem Leser tiefe Einblicke in das zerrissene Innenleben der Schreiberin gewährt, ohne den Alltag in der Nervenanstalt zu beschönigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
I - EIN IRRE-LEBEN
April 2013
Beim Anblick der bräunlich-tristen Mauern des Krankenhauses befiel mich sofort ein unerträglich dumpfes Gefühl; das Atmen fiel mir schwer, die Erinnerung an meinen letzten Aufenthalt schlug mir mit voller Wucht entgegen, erdrückte mich fast. Mein Blick richtete sich auf die hohen Mauern, folgte den riesigen, dunklen Fenstern, die mich trübe anzustarren schienen. Die breite Eingangstür aus Glas ließ bedrohlich die beiden Glasscheiben immer wieder zuschnappen, eine doppelseitige Guillotine, die mich hinein-, aber vielleicht nicht mehr ganz unversehrt hinausspazieren lassen würde. Wäre Petunia nicht bei mir gewesen, ich wäre umgekehrt, panisch nach Luft schnappend, als hätte mir jetzt schon jemand die Kehle zugedrückt.
Ausgerechnet Petunia, meine Pflegemutter, hatte mich in die Klinik gebracht. Sie, die mir, seit ich meinem Kinderkörper entwachsen war, eingeredet hatte, ich sei mollig, ja sogar dick, brachte mich nun an einen Ort, an dem mir regelmäßig wieder Nahrung zugeführt werden sollte! Petunia, die mir jahrelang eingebläut hatte, ich sei genauso hoch wie breit! Sie, die sich vor einiger Zeit beim Abendbrot nicht einmal davor gescheut hatte, meine besten Freundin Cordia mit einem spöttischen „Ihr beide seid doch dick genug“ zu bedenken, als diese etwas Butter haben wollte. Sie, die sich von der Verkäuferin beraten ließ, was ich denn überhaupt tragen könne, bei einer solchen Oberweite. Sie! Sie! Sie!
Während Petunia mit mir im Schlepptau zum vierten Stock hinaufschritt, versuchte ich mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass das vierte Stockwerk, Abteilung geschlossene Psychiatrie, nun für eine Weile meine neue Bleibe sein würde. Die Tage würde ich wieder inmitten verwirrter Gestalten verbringen, die man wegsperrte, da sie alleine auf sich gestellt in der Welt nicht überleben würden und auch hier nicht vor sich selbst sicher waren.
„Warum hast du mir damals nichts von deiner Anorexie gesagt?“, fragte Dr. Callidus, als er am folgenden Morgen mein Zimmer betrat.
„Wenn ich mich recht erinnere, haben wir uns durch die Geschichte deiner Abschiedstour kennengelernt.“
Rückblick: November 2012
„Dubia hat mir gesagt, du seist unterwegs, um allen Lebewohl zu sagen?“
Ich nickte und wandte den Blick nicht von Dr. Reimar ab, der mich teils besorgt, teils verdutzt anschaute.
„Was hat dich zu dieser Entscheidung bewogen?“, erkundigte sich der junge Dorfarzt.
Die Frage verwirrte mich etwas, denn hätte sie nicht lauten sollen, wieso das Leben mich nicht zum Bleiben bewege? Dann bräuchte ich keinen Grund zu gehen, jedoch wenn es nicht mal einen zum Bleiben gab … Die Stimme in meinem Kopf flüsterte mir unentwegt zu, ich solle gehen, sofort, doch ich saß wie festgenagelt auf dem Stuhl, ihm gegenüber, und schaffte es nicht, aufzustehen und das Zimmer zu verlassen, obwohl sich alles in mir gegen ein Gespräch mit Dr. Reimar sträubte.
Ich spürte, wie Dubia mich von der Seite ansah. Sie hoffte sicher, ich würde hier vor Dr. Reimar das wiederholen, was ich ihr am Vorabend unter Tränen gestanden hatte. Sie gehörte zu jenen Personen, denen ich Lebewohl sagen wollte, bevor ich meinem Leben ein Ende setzen würde. Das wiederum wusste niemand von ihnen: Sie hatten keine Ahnung, dass es eine Abschiedstour war. Ich hatte meinen Besuch damit begründet, dass ich sie vermisst hätte und sie einfach hatte sehen wollen.
Für einige hatte ich sogar kleinere Aufmerksamkeiten dabei, selbst gezeichnete Bilder, eine nette Grußkarte und sogar ein von mir komponiertes Lied – ich wollte zu gerne, dass das sie noch lange an mich erinnern würden. Doch bei Dubia war meine Reise zu Ende. Denn kaum hatten wir es uns bei ihr gemütlich gemacht, schoss auch schon alles wie aus einer Pistole aus mir heraus, mein Schmerz, mein Leiden, meine Hoffnungslosigkeit und auch mein Entschluss. Kaum hatte ich geendet, tat es mir auch schon leid, denn Dubia, völlig aufgelöst und schluchzend, griff zum Telefon und so kam es, dass Dr. Reimar uns einen Termin für den folgenden Tag gegeben hatte, obwohl es Samstag war und die Praxis eigentlich geschlossen hatte.
„Ich habe einfach das Gefühl, dass mein Leben hier und jetzt enden soll! So, als gebe es für mich nichts mehr zu tun. So, als sei alles erledigt, denke ich!“
Dr. Reimar zog die Augenbrauen hoch und sah abwechselnd zu mir und zu Dubia.
„Sind Sie die Mutter?“
„Nein, nun …“, erwiderte Dubia etwas zaghaft, „früher, als sie vier Jahre alt war, war sie bei uns in Pflege, für ein par Monate, dann musste ich sie in ein Heim geben, denn ich fühlte mich überfordert.“
Der Arzt murmelte ein verständnisvolles Mmh. Dubia fuhr fort:
„Verstehen Sie mich nicht falsch, ich war nicht überfordert wegen ihr, sondern ganz allgemein. Mein Mann und ich, wir hatten bereits zwei eigene Söhne und dazu noch drei Pflegekinder, Sabrina und ihre beiden Halbgeschwister! Ich litt zudem unter schrecklichen Depressionen, was ich den Kindern nicht mehr zumuten wollte.“
„Wie alt bist du jetzt, Sabrina?“
„Zweiundzwanzig ist sie jetzt“, antwortete Dubia an meiner Stelle. „Jedenfalls, was ich noch sagen wollte, irgendwann wurde uns der Kontakt zu den Kindern nicht mehr gestattet, da wir sie, wenn wir sie zu Besuch zu uns nach Hause holten, angeblich damit durcheinanderbrächten.“
„Scheint eine recht komplexe und schwierige Vergangenheit gewesen zu sein“, bemerkte Dr. Reimar.
Ich sah zu Boden und vergaß langsam aber sicher, weshalb ich überhaupt mit zum Arzt gekommen war.
„Wir haben uns ganz aus den Augen verloren, bis vor ungefähr vier Jahren, da hat die Älteste uns durch ein soziales Netzwerk kontaktiert, so fanden wir uns allmählich alle wieder.“
„Wo wohnst du denn jetzt?“
Ich war so in meine Gedanken vertieft, dass ich zuerst gar nicht mitbekommen hatte, dass Dr. Reimar mit mir sprach. Erst als es plötzlich still im Zimmer wurde, blickte ich zu ihm hinüber. Glücklicherweise wiederholte er noch einmal seine Frage, doch seine klaren Augen verrieten mir, dass er meine Geistesabwesenheit sehr wohl bemerkt hatte.
„Ich habe seit April dieses Jahres eine eigene Wohnung im Süden des Landes, aber davor, seit meinem sechsten Lebensjahr, habe ich bei den Rafflints, bei Petunia und Lloyd Rafflint, gelebt.“
„Die Rafflints waren oder sind eine weitere Pflegefamilie, nehme ich an? Ebenfalls im Süden lebend?“ Ich nickte.
„Warum bist du denn nicht dort zu einem Arzt gegangen?“
„Nun, bin ich doch … aber …“. Ich blickte ihn an in der Hoffnung, er würde mir den Rest ersparen, und tatsächlich versuchte er, meinen Satz zu vervollständigen.
„Die sind nicht so nett, nein? Nun, jetzt kennst du wenigstens einen netten Arzt im Norden.“
Er kniff mir ein Auge zu und ich lächelte. Dieser Arzt war wirklich sehr einfühlsam.
„Nur der Vollständigkeit halber: Was ist mit deinen leiblichen Eltern?“
„Meine Mutter, Genia Gérard, starb, als ich sieben Jahre alt war; meinen Vater kenne ich nicht.“
„Gehst du noch zur Schule?“
„Letztes Jahr habe ich die dreizehnte Klasse abgeschlossen, ich habe die Fachhochschulreife im Bereich Finanz- und Handelswesen. Doch ich wollte ein höheres Fachdiplom. Im Gegensatz zu meinen Pflegeeltern, die sich nicht für diese Idee begeisterten, waren die Direktion und das Lehrpersonal meiner Schule sehr erfreut darüber. Dazu musste ich dann aber wieder in der zwölften Klasse beginnen, was ich auch tat und schaffte!“
„Ja, das hat sie, trotz der Fächer, die sie Jahre vorher nicht hatte … Während ihre Klassenkameradinnen den Stoff seit der Zehnten kannten, musste sie das alles in der Zwölften nachholen!“, fügte Dubia stolz hinzu. „Sie ist ein echt schlaues Köpfchen.“
Ich rutschte tiefer in den Sessel; das Lob war unangebracht, denn meiner Meinung nach tat ich im Großen und Ganzen nicht mehr als das Nötigste, und das, was ich machte, machte ich meiner Ansicht nach nicht gut genug. Es gab noch sehr viel Luft nach oben.
„Ehrgeizig und zielstrebig!“ Der Arzt lächelte, doch dann verschwand das Lächeln wieder, und Falten legten sich auf seine Stirn: „Vielleicht das Grundproblem! Deine Pflegeeltern hießen dein Vorhaben also nicht gut?“ Ich schüttelte den Kopf.
„Dieser Wunsch war der Grund für den Umzug in eine eigene Wohnung. Man fand mein Vorhaben unterstützenswert, und so habe ich eine Wohnung bekommen.“
„Bedeutet das, dass deine Eltern dich rausgeschmissen haben?“
„Nicht direkt. Sie glaubten nicht daran, dass ich es schaffe, und meinten, dass sie nicht daran denken, mir meine Schule, es ist eine Privatschule, weiterhin zu bezahlen, geschweige denn die Schulbücher. Und da ich ja bereits einen Schulabschluss hatte und auch noch volljährig war, bekamen sie kein Pflegegeld und auch kein Kindergeld mehr für mich. Eigentlich hätte ich mein Vorhaben vergessen können, doch die Lehrer standen alle auf meiner Seite und gaben mir ihr Wort, mich nicht fallenzulassen.“
„Also doch eine Art Rausschmiss!“
Ich schwieg, denn ich war mir plötzlich selbst nicht mehr sicher, was es eigentlich gewesen war. Sicher war nur, dass sie nicht an mich glaubten; und da sie kein Geld mehr für mich bekamen, wollten sie mich auch finanziell nicht mehr unterstützen. Also musste eine Alternative her, und die fand ich auch, nur musste ich ausziehen, um meine Pläne umsetzen zu können.
Andere Mütter wären stolz auf eine solche Tochter gewesen, hatten viele der Lehrer gemeint und versucht, den Grund für das Verhalten meiner Pflegeeltern herauszufinden. Hatten sie Angst, ich würde ihnen zeigen, dass ihre Meinung von mir ungerechtfertigt war, und es schaffen? Befürchteten sie, ich könnte entgegen ihrer Meinung doch besser sein als andere? Erschien es ihnen sinnlos, Geld in mich zu investieren? Warum unterstützten sie mich nicht?
„Du hast die 12. Klasse zwar gemeistert, trotz fremder Fächer und trotz Umzug, aber fühltest du dich nicht irgendwie überfordert?“, wollte Dr. Reimar wissen.
Nicht die Schule, sondern diese Frage überforderte mich: Die doppelten ‘Trotz’ ließen es wie eine Frage klingen, in der bereits die Antwort mitschwang.
„Es gibt noch mehr, was du mir sagen solltest, nicht wahr?“
Es wunderte mich, dass ich nicht sofort rot anlief, denn ich fühlte mich ertappt und wäre am liebsten im Erdboden versunken. Ich wurde nervös, aber ich wusste, dass heute der Moment gekommen war, um damit aufzuhören, im Stillen zu leiden. Wenn ich diese Gelegenheit verstreichen lassen würde, wäre es ein für allemal zu spät.
„Ich schäme mich so …“, nuschelte ich, und mir schien, als hätten seine Ohren gezuckt, als wollten sie noch aufmerksamer zuhören, als sie es ohnehin schon taten. „Ich habe Medikamente geschluckt, Missbrauch, schätze ich … nein, weiß ich“, korrigierte ich mich stotternd.
Dubia sah zu mir herüber, nickte mir aufmunternd zu. Ich sah ihr an, wie froh sie war, dass ich endlich den Mut gefunden hatte zu reden. Doch hätte ich geahnt, was auf mich zukommen würde, hätte ich wahrscheinlich gleich die Klinke in die Hand genommen und gesagt: „Danke für Ihre Mühe, aber ein Schachspiel spielt man nur zu zweit und bis zum bitteren Ende! Nur dumm für mich, dass ich zugleich Weiß und Schwarz bin!“
„Im Deutschunterricht haben wir mal einen Artikel gelesen, der dieses Arzneimittel Ritalin als Hirn-Doping-Wunder bezeichnete“, erzählte ich weiter, das Gesicht wieder zum Arzt gewandt, der inzwischen leicht erschüttert wirkte.
„Du hast Ritalin genommen? Wie lange denn?“
Sein kariertes Hemd verlor sich in einem schwarzen Richterumhang; mir war, als stünde ich vor der Anklagebank. Meine Hände schwitzten fürchterlich und ich nahm mir vor, ihm beim Abschied nicht die Hand zu schütteln, damit er meine Nervosität nicht bemerkte.
„Ein paar Monate, manchmal nur eine Pille, manchmal mehrere täglich“, gestand ich leise. „Sie gaben mir dieses unglaubliche Gefühl, alle anstehenden Aufgaben meistern zu können und den anderen überlegen zu sein. Dieses Gefühl brauchte ich, wollte ich nicht aufgeben.“
„Wo hast du die Pillen her? Sie sind schließlich rezeptpflichtig.“ Er ließ den Bick nicht von mir.
Ich musste tief schlucken, bevor ich überhaupt einen Ton herausbekam.
„Von Dennis. Er ist ADHS-Patient. Ich mag ihn zwar nicht, aber die Pillen hab ich schon von ihm genommen!“
Für Dubia wurde es zu viel; sie weinte leise vor sich hin. Ich hatte immer geglaubt, ich sei sensibel, aber sie schien die Empfindsamkeit in Person zu sein.
„Darf ich Ihnen etwas zeigen?“
„Ja natürlich.“
Ich überreichte ihm den braunen Umschlag, den ich die ganze Zeit über fest umklammert gehalten hatte.
„Es sind Zeichnungen. Ich wollte damit nicht Situationen festhalten, sondern loslassen, weil ich doch mit niemandem über diese Dinge zu reden wagte!“, erklärte ich ihm. „Papier urteilt nicht, wissen Sie!“
Er betrachtete still die Bilder; sollten sie ihn erschreckt haben, so zeigte er es zumindest nicht.
„Dieses Bild entstand, nachdem ich Ritalin genommen hatte“, wandte ich beschämt ein, als er bei einem Bild länger zu verweilen schien.
„Wenn ich es richtig deute – und sag mir, wenn ich mich irre –, dann hast du, um Ritalin zu bekommen, mit diesem Dennis geschlafen?“
Ich wich seinem Blick aus, blickte zu Boden. Hass breitete sich in mir aus. Hass gegenüber Dennis, aber vor allem gegenüber mir selbst!
„Ja, das habe ich.“
„Freiwillig? Oder wie kann ich mir das vorstellen?“
Am besten gar nicht vorstellen, dachte ich bei mir. Unter seinem forschenden Blick kam ich mir plötzlich so billig vor.
„Ich habe ihn gefragt, was er haben wollte, da ich gelernt habe, dass es nichts umsonst gibt … Doch alles, was ich vorschlug, lehnte er ab“, stammelte ich und mit jedem Atemzug schien das Wort „Schlampe“ in meinem Kopf heller aufzuleuchten. „Also hab ich ihm angeboten, mit ihm zu schlafen! Ich wusste, dass er schon länger in mich verliebt war. Na ja, und was meinen Körper betrifft, der ist mir immer schon egal gewesen, denn ich hasse ihn. Doch scheinbar fand er Gefallen daran.“
„Wie reagierte er auf dein, nun, Angebot?“
„Er meinte, er erwarte keine Gegenleistung.“
„Was sich im Nachhinein doch als Humbug herausstellte, nicht wahr?“, half Dr. Reimar.
Ich war dankbar, dass er mir einige Peinlichkeiten ersparte. Er erwartete keine Antwort, die Zeichnung sprach für sich. Dennoch erzählte ich, wie Dennis die Pillen auf meinem schwarzen Klavier abgestellt hatte, dann meinte, dass er mir sie nicht gäbe, weil er sonst ein schlechtes Gewissen bekäme, wie er immer näher gerückt sei und sagte, er habe seine Meinung geändert, und auf dem Weg zu mir habe er sich schon in Gedanken alles ausgemalt. Dr. Reimar hörte kopfschüttelnd zu und in seinen Gesichtszügen spiegelten sich meine – ein Ausdruck, als ob man unvorbereitet in eine saure Zitrone gebissen hätte.
Während Dr. Reimars Finger über die Tastatur des Computers glitten, zogen an mir die unauslöschlichen Bilder von jenem Tag vorüber. War ich mir so wenig wert? Ich hatte nie so sein wollen und war dennoch so geworden. Dabei hatte ich Dennis nicht einmal ein klein wenig gemocht. Sein arrogantes Auftreten, sein buschiges schwarzes Haar, seine monotone Stimme und sein Gang, der mich an den eines Pinguins erinnerte, sein ekelerregender Duft, der an diesem Tag an mir zu kleben schien. Selbst eine Dusche hatte mich nicht davon befreien können. All das für eine Packung Ritalin, damit ich noch mehr leisten konnte, als ich ohnehin schon tat, aber es reichte mir nicht. Es war wie ein Zwang, ich musste immer noch eins drauflegen, denn nur diejenigen, die nicht stehen bleiben, erlangen in unserer Leistungsgesellschaft Aufmerksamkeit.
„Sabrina? Bist du noch hier?“, hörte ich Dr. Reimars Stimme aus der Ferne. Langsam kroch ich aus meiner Gedankenhöhle.
„Ich möchte gerne wissen, was die Tabletten bewirkt haben?“
„Alles schien leichter!“, erinnerte ich mich. „Ich war wie besessen und suchte förmlich nach neuen Herausforderungen. Zuerst war ich nicht nur geistig hellwach, sondern auch der Körper reagierte wie von einem Motor angetrieben, aber im Nachhinein wurde ich physisch, nicht psychisch, immer schlapper. Doch ich nahm Kopfschmerzen, schlaflose Nächte und Stimmungsschwankungen gerne in Kauf, denn das Gefühl, alles schaffen zu können, überwog alles andere; die Nebenwirkungen waren mir egal. Wenn ich die Pillen mal nicht einnahm, wurde ich nervös und dachte unentwegt daran, dass ich an diesen Tagen wohl in allem versagen würde!“
Reimar löste seine Finger von der Tastatur und wandte sich wieder dem Stapel Zeichnungen zu.
„Diese Zeichnung …“, er legte sie in die Mitte des Tisches zwischen uns, „würdest du mir bitte mehr darüber erzählen, denn ich bin womöglich nicht in der Lage, das alles deuten zu können! Man sieht dich hier in der Mitte, ein Schatten geht von dir aus, der jedoch eine eigene Persönlichkeit zu haben scheint! Ist das eine Peitsche, die er hält?“
Während ich das Bild fixierte, versuchte ich das Dargestellte so gut wie möglich in Worte zu fassen. Es fiel mir nicht leicht, denn ich hatte plötzlich Angst, dass er mich allmählich für total gestört halten könnte.
„Das bin ich in der Tat …“, fing ich vorsichtig an. „Die Augen habe ich mit einem Kreuz gezeichnet, um zu verdeutlichen, dass ich Geist und Körper trenne. Mein Körper ist wie eine leere, tote Hülle, die von Fäden bewegt wird, wie eine Marionette!“
„Von wem bewegt?“
„Von meinen Ichs, oder anders ausgedrückt, von meinen Trieben …“
Ich deutete mit dem Finger auf das Bild, auf dem man erkennen konnte, wie aus dem Kopf des gezeichneten Ichs ein paar geistergleiche Gestalten in verschiedene Richtungen flogen.
„Jeder hat seine ganz eigene Aufgabe und da es so viele gibt, entsteht ein enormes Chaos!“
„Wie sieht bei dir denn in der Woche so aus?“
„Ich gehe zur Schule, habe auch einige Kurse im Konservatorium belegt. Dann kommen die Hausaufgaben und ich muss mich auf Tests vorbereiten. Meist gehe ich nicht vor zwölf ins Bett und stehe gegen fünf Uhr morgens auf, um Lernstoff zu wiederholen oder das zu erledigen, was ich am Vortag nicht geschafft habe. Ich schätze, deshalb habe ich begonnen, mir die verschiedenen Ichs einzubilden, um mir die ganze Situation zu erleichtern, irgendwie, weil ich mich sonst wahrscheinlich zu alleine gefühlt hätte, um mit allem klarzukommen.“
„Recht interessant, dass du dich selbst so analysieren kannst!“, lächelte Dr. Reimar. Er meinte es nicht sarkastisch, eher anerkennend, schien mir, was mir ein Lächeln entlockte, wenn auch ein gequältes.
„Jedenfalls steigt mir das alles über den Kopf, denn ich fühle mich wie zerrissen. Es geht nicht nur darum, die Aufgaben zu erledigen, ich muss das perfekt hinkriegen, ich muss in der Schule oder in der Musik die Beste sein. Darum mag ich auch keine Gruppenarbeiten, weil man da …“ Ich stockte.
„Weil man da die Kontrolle verlieren könnte?“, vervollständigte Dr. Reimar meinen Satz.
Als ich nickte und ihn ansah, schien mir, als hätte er meine Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung gesehen.
„Wissen Sie, ich zeichne, lese, schreibe, dichte und komponiere nebenbei; das gab mir immer ein Gefühl der Freiheit. Doch mittlerweile fühle ich mich, als müsse ich mich immer bei allem beweisen, nichts ist gut genug, es ist, also ob ich mich selbst immer weiter antreibe! Das Schlimmste ist, wenn ich etwas beginne, egal ob Schularbeiten oder sonst was, kommt eine andere Ich-Gestalt daher und fordert, dass ich mich um ihre Aufgabe kümmere … so gerät alles durcheinander. Ein fürchterliches Hin und Her.“
„Und was bedeutet dieser Schatten mit Peitsche?“
„Ich habe mir immer jemanden gewünscht, der mich unterstützt, in allem was ich tue, jemand, der nur für mich da ist, der mir hilft Entscheidungen zu treffen, ja, vielleicht einfach jemanden, der mir den Weg weist … einen Vormund vielleicht!“, erwiderte ich und überlegte, ob ich nicht doch etwas vergessen hatte.
„Aber was bedeutet die Peitsche, denn er scheint dich ja zu unterdrücken?“ Dr. Reimar betrachtete die Zeichnung erneut für eine Weile, dann sah er mich besorgt an. „Es scheint mir, als bewahre er die Kontrolle? Liege ich also richtig in der Annahme, dass du nicht mehr Herr über dich selbst bist, sondern dein …“, er räusperte sich, und ich nahm an, er suche die passenden Worten, um mich nicht zu verletzen, „dein Schatten, oder wie es im Volksmund heißt, Teufelchen oder Schweinehund?“
Mein Gesichtsausdruck schien ihm die geforderte Antwort zu geben, denn ohne Umschweife fuhr er fort: „Wie lange geht das denn schon?“
„Einige Jahre. Zuerst war es nicht so stark, doch im Laufe der Zeit wurde es halt immer extremer, diese quälende Zerrissenheit.“
Diesmal war ich es, die seinen Ausdruck interpretierte und die unausgesprochene Frage: Und warum kommst du erst jetzt?
„Er, der Schatten oder wie auch immer, ließ es nicht zu, dass man mir hilft, denn wir brauchen keine Hilfe, eigentlich! Und er ist jetzt auch unzufrieden und wird mir wehtun …“, fuhr ich fort und mit einem Nicken bestätigte er mir, dass ich ihn richtig gedeutet hatte.
„Dubia meinte, du hättest binnen ein paar Wochen rasant an Gewicht verloren, stimmt das?“
„Ach, so schlimm ist’s doch nicht!“
„Wie viel?“
„Jeder macht doch mal ’ne Diät!“
Während ich darüber nachgrübelte, ob ich freiwillig gehungert hatte, da ich mich schon immer als zu dick empfunden hatte, oder ob ich beabsichtigt hatte, mich langsam, aber sicher umzubringen, blieb sein Blick auf mir haften, die Frage noch stets im Raum. Plötzlich beschloss ich zu schweigen. Doch ich hatte Dubia vergessen, die es nun für nötig hielt, an meiner Stelle eine Antwort aus ihrem Ärmel hervorzuzaubern.
„Neun Kilo in drei Wochen, ungefähr!“
„Stimmt das?“ Mein Kopf nickte heftig, doch in meinem Inneren schrie eine Stimme, ich solle endlich die Klappe halten. Wieso kümmerten die sich um meine Angelegenheiten?
Dr. Reimar stand auf, bat mich, ihm in den Nebenraum zu folgen. Sonnenlicht durchflutete den kleinen Raum, durch die weißen Wände wurde man fast geblendet.
Als sich meine Augen an die Helligkeit gewöhnt hatten, sah ich, was er vorhatte: Eine große Waage griente mir entgegen. Ich wurde gewogen und gemessen.
Zurück im Büro flogen seine Finger wieder über die Tastatur und er meinte, auch wenn ich noch normalgewichtig sei, so sähe es aus, als würde ich eine Essstörung entwickeln. Dubia seufzte.
„Sabrina, was hältst du von der Idee, dich in einer Psychiatrie unterzubringen?“
Mir wurde abwechselnd warm und kalt und ich presste meine Lippen mit aller Kraft zusammen, damit mein Unterkiefer nicht auf den Tisch klatschte. War das überhaupt noch eine Frage oder stand mir eine Einweisung schon bevor und ich sollte nur den Eindruck gewinnen, dass ich eine Wahl hätte?
„Heißt das, ich bin verrückt?“, platzte es aus mir heraus. Grausige Bilder schossen mir durch den Kopf. „Und was wird aus der Schule? Ich habe doch soeben die 13. Klasse, nun Sie wissen schon, die zweite, begonnen!“
Er lächelte und versuchte, mich zu beruhigen. Ich sei keineswegs verrückt, sondern brauche Ruhe und Zeit, und die würde ich seiner Meinung nach nur dort und mit psychologischer Unterstützung finden.
„Dort kannst du lernen, deine Zwänge zumindest zu mindern. Dein unersättliches Streben nach Perfektion, dein Kontrollzwang …“, er hielt inne, als er bemerkte, wie meine rechte Augenbraue langsam höher wanderte. „Hör zu, für jeden, ja, auch für mich, kann es mal angebracht sein, eine Weile dort zu verbringen. Das macht uns weder zu Verrückten, noch heißt das, dass wir dumm sind! Sabrina, dieser Schritt hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern fordert Mut!“
„Es ist nur zu deinem Besten“, meldete sich Dubia zu Wort, doch ich hörte nicht hin.
In die Psychiatrie? Was würden meine Freunde denken? Und was zum Geier würden erst die Rafflints dazu sagen? Nun, Petunia würde sich sicherlich in ihrer Ansicht bestätigt fühlen, dass ich schon längst dort hingehörte.
Mir wurde übel und ohne recht zu wissen, wieso und weshalb, gab ich mein Einverständnis, mich in ein Irrenhaus einliefern zu lassen.
„Unter einer Bedingung!“
Dubia und Dr. Reimar, die sich mittlerweile emsig unterhielten, verstummten und vier Augen richteten sich auf mich.
„Ich gehe nicht ins Krankenhaus meiner, nennen wir sie ‚Heimatstadt’ im Süden! Wenn, dann will ich weit weg von allem dort sein!“
„Das wird wohl wegen des Papierkrams nicht leicht werden, aber wenn das dein Wunsch ist, tue ich, was ich kann, und versuche dich hier im Norden unterzubringen“, erwiderte Dr. Reimar und schenkte mir ein kurzes Lächeln.
Am selben Abend noch wurde ich aufgenommen. Meine Erwartungen waren nicht sehr hoch, doch der erste Eindruck war erschreckend. Mein zukünftiger Arzt, Dr. Callidus, baute sich sofort vor mir auf und fragte mürrisch, wieso wir erst jetzt einträfen, wo wir doch am Morgen schon bei Dr. Reimar gewesen seien. Ich könne froh sein, dass er so geduldig gewartet habe. Ich war so ausgelaugt von den Geschehnissen des Tages, dass ich nur noch wie benommen auf der Kante des Stuhles saß und ihn mehrmals um Entschuldigung bat.
Und dann ging die Fragerei von vorne los. Mir schwirrte der Kopf, während mein Mund noch einmal zu erzählen begann, was er bereits in der Früh Dr. Reimar offenbart hatte, doch ich war weniger verkrampft und angespannt. Auch Dr. Callidus schien nun weniger streng. Sein wirres weißes Haar und sein Bart verliehen seinem Gesicht eine gewisse Sanftheit und Ruhe. Die tiefliegenden Augen ließen auf einen nachdenklichen Menschen schließen, der das Leben mit großer Ernsthaftigkeit betrachtete.
Dr. Callidus hörte meiner Schilderung, wie es zum Tablettenmissbrauch kam und was ich getan hatte, um an die Medikamente zu kommen, aufmerksam zu. Wir sprachen über meine turbulente Vergangenheit, über jene Jahre, an die ich mich erinnern konnte, und natürlich auch über den Grund für meine Selbstmordgedanken. Da ich mich bereits in der Klinik befand und es für ausgeschlossen hielt, dass man mich sofort wieder gehen ließ, fiel es mir wesentlich leichter, meine kleinen Geheimnisse, wenn auch nur flüsternd, offen zu gestehen. Weil ich Herrn Callidus hoch und heilig versprach, mir nichts anzutun – denn dann wäre ich in die geschlossene Psychiatrie gesteckt worden –, wurde mir ein Zimmer in der offenen Psychiatrie-Abteilung im vierten Stock zugeteilt.
Einige sehr lange Wochen verbrachte ich erfolglos damit, mich dagegen aufzulehnen, wie ein Kind behandelt zu werden. Ich hatte das Gefühl, mit der Zeit würden alle meine Gehirnzellen wegen Unterforderung platzen. Fieberhaft suchte ich in den Gemäuern nach Herausforderungen, an die ich mich festklammern konnte, um das quälende Gefühl, eine Müßiggängerin, ein Faulpelz und eine Versagerin zu sein, abzuschütteln. Doch vergebens. Nicht einmal Dr. Callidus und Herr Tiponi, mein Psychologe, der mich fortan betreute, konnten mich davon überzeugen, dass ich das Recht auf Ruhe hatte, besonders angesichts der Tatsache, dass mich gerade das Gegenteil hierhin gebracht hatte.
Abgesehen von den beiden Herren schenkte ich niemandem sonst mein Vertrauen, denn das Pflegepersonal empfand ich als schroff und ihre skurrile Umgangsweise mit den Patienten war erniedrigend, als seien wir kleine, unwissende Kinder, denen man erst zeigen musste, wie man bastelt und malt. Mehr als ein irritiertes Lächeln hatte ich für diese Art von Therapie nicht übrig; sie brachte mir auch nichts, denn mein Schatten gestattete mir nicht im Geringsten, mich von ihm zu lösen.
nDann, Ende Dezember, wurde mir mitgeteilt, dass ich das Krankenhaus verlassen und fortan die Tagesklinik besuchen könnte. Dort verbrachte man, wie der Name es schon verriet, den Tag. Nach den absolvierten Therapiestunden, die man fast eigenständig auswählen durfte – hätte das Personal, den Stift zum Ankreuzen fest in der Hand, nicht bei der einen oder anderen Möglichkeit mit entschlossener Stimme verlautbart: „Das könnte Ihnen doch weiterhelfen …“ –, konnte man die Rückfahrt Richtung Zuhause, insofern man eins hatte, antreten.
Im Laufe des Hospitalaufenthaltes pendelte sich mein Körpergewicht auf beharrliche und bedrückende 65 Kilo ein, sodass ich die letzten Wochen meine Herausforderung darin fand, abzunehmen – wenn möglich ohne große sportliche Betätigung. Die Tatsache, dass ich schließlich nur die Tagesklinik besuchte, ließ meinem Hang zum Extremen unbegrenzten Freiraum, denn ich musste mich in meinen eigenen vier Wänden vor niemandem rechtfertigen.
April 2013
„Ich will gestehen …“, fuhr Dr. Callidus fort, als er keine Antwort erhielt, warum ich ihm damals nichts von meiner anorektischen Phase erzählt hatte, „ich bin über mich selbst ziemlich empört, dass ich so lange zugesehen habe und nicht eingeschritten bin!“
Er tat mir leid, doch als sich meine zusammengepressten Lippen lösten, um eine Entschuldigung hervorzubringen, kam er mir zuvor.
„Jetzt, wo ich dich so sehe, bist du dürrer, als ich dachte. In meiner Praxis habe ich dich ja nur in deinem dicken Mantel zu Gesicht bekommen.“ Er musterte mich streng. Ich kam mir vor, als sei ich in eine Parallelwelt eingetaucht, denn jeder schien mich für zu mager zu halten, wo ich doch genau wusste, dass ich nicht einmal dünn war! „Ich bin fett! Er lügt! Alle lügen!“, hallte es im Innern meines Schädels.
„Hör zu, Sabrina. Wärst du nicht hier, hätte es spätestens in zwei Tagen den totalen Zusammenbruch gegeben! Damals in meiner Praxis hattest du mich gebeten, das Thema Essen zu vermeiden, ich ging darauf ein, weil ich wusste, dass man, wenn man dich zu etwas zwingt, genau das Gegenteil von dem erreicht, was man eigentlich bezweckt. Aber versteh doch, jetzt können wir nicht mehr darauf verzichten!“ Sein eben noch ernstes Gesicht nahm besorgte Züge an: „Es steht wirklich ernst um dich! Kooperiere, sonst – nicht, dass ich es unbedingt will –, sehen wir uns gezwungen, dich an die Sonde zu hängen, was ich auch ohne mit der Wimper zu zucken tun würde.“ Die Stimme in meinem Kopf, die mir unentwegt einredete, ich sei immer noch zu dick und sollte es den Leuten hier auch klarmachen, verstummte schlagartig, sodass das Wort Sonde in meinem Kopf nachhallte. Ich schluckte.
An die Sonde? Warum? Ich stehe, ich gehe, ich rede und ich denke! So schlimm kann es um mich also gar nicht stehen! Ich will nicht fetter werden! Was wollt ihr von mir?
•
Mein Kopf drohte zu platzen. Nicht nur, dass die Mitpatienten ihr Leiden durch den Korridor plärrten, auch mein innerer Schatten drosch weiterhin verbal auf mich ein, mit immer der gleichen Phrase, dass ich hier nichts zu suchen hätte. Das weiß gekleidete Personal hingegen vertrat eine völlig andere Meinung und bemühte sich, mit mir ins Gespräch zu kommen, mit mir über eine Krankheit zu reden, unter der ich angeblich litt. Doch mir fehlte nichts, was sollte ich auf ihre Fragen antworten? Mir blieb nichts als Schweigen.
Ich verkroch mich in mein Zimmer, versteckte mich stundenlang hinter der Zimmertür. Als es klopfte, musste ich mir nicht einmal die Mühe machen, zu öffnen oder ein „Herein!“ zu rufen, denn unverzüglich nach dem Anklopfen wurde die Tür abrupt aufgerissen.
„Guten Tag. Sabrina? Das musst du wohl sein.“ Eine junge Frau mit hellbraunem, hochgestecktem Haar, in Weiß gekleidet wie alle hier, eine Mappe in der Hand, stolzierte herein und lächelte mich an. „Ich bin Tabera. Ich werde mit dir zusammen deinen Essensplan aufstellen!“
„Ach Gottchen, wieso denn das?“
Sie sah mich mit hochgezogenen Augenbrauen an, als hätte sie soeben eine Kuh aus dem Fenster fliegen sehen, doch dann lächelte sie unbeirrt weiter und erklärte mit ruhiger Stimme, dass sie als Ernährungsberaterin die Aufgabe hätte, mich wieder auf ein Normalgewicht zu bringen.
„Warum füttert ihr nicht die Menschen, die es nötig haben! Die in Afrika oder sonst wo, aber doch nicht mich!“, rebellierte ich.
„Schau dich doch an. Du bist doch genauso dürr! Du hast es nötig.“
Ich wollte lachen, doch als ich den ernsten Ausdruck in ihrem Gesicht sah, hielt ich mich zurück. Trotzdem wollte ich das Ganze nicht einfach so hinnehmen.
„Nun, wenn man Sie als Ernährungsberaterin schickt, sollen Sie mir wohl Nahrung empfehlen; und dafür brauch ich nun scheinbar auch noch einen Essensplan! Gut, machen wir das“, motzte ich.
Doch sie lächelte nur und öffnete die Mappe, die sie die ganze Zeit in der Hand gehalten hatte, und las mir die Auswahl der Gerichte für die nächste Woche vor. Wenn mir nichts zusage, könne ich sogar Extra-Wünsche äußern, meinte sie. „Hauptsache ist, du isst was!“ Womöglich war sie überzeugt davon, mir einen Gefallen damit zu tun, dass mir Extra-Bestellungen zugestanden wurden.
„Moment mal … das habe ich nicht gesagt“, protestierte ich laut gegen diesen Gedanken. „Ich habe nicht gesagt, dass ich essen werde. Ich meinte lediglich, dass ich damit einverstanden bin zu wählen, weil man mich sonst wohl nicht in Ruhe lässt!“
„Wie du meinst, dann kann ich dir aber jetzt schon verraten, dass wir dich nicht in Ruhe lassen werden, bis du kooperierst und dir eingestehst, dass du essen musst!“
Ich konnte es nicht mehr hören. Du musst dies, du musst das! Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich gar nicht erst hier! Dieses dämliche Gelaber über Nahrungszufuhr, als drehe sich die ganze Welt nur darum!
„Du, wir können dir auch gleich eine Sonde verpassen, aber an deiner Stelle würde ich mich für eine normale Kalorienaufnahme entscheiden und nicht für eine, die du nicht kontrollieren kannst, weil dir die Nahrung über einen Schlauch zugeführt wird.“
Ich war völlig perplex und verfiel wieder in mein geliebtes Schweigen. Sie wusste dies wohl zu deuten, denn sie hielt mir den Essensplan vor die Nase, fragte, ob ich einverstanden sei, und ohne Gegenwehr bejahte ich, machte meine Kreuzchen und beantwortete die restlichen Fragen. Sie lächelte zufrieden.
„Prima. Ich werde auch“, versprach sie, „jedes Mal nur eine halbe Portion aus der Küche hochkommen lassen. Ich denke nicht, dass du anfangs viel essen kannst, selbst wenn du wolltest.“
Sie schloss ihre Mappe und reichte mir die Hand, die ich misstrauisch nahm. „Wenn du, was das Essen angeht, etwas auf dem Herzen hast, dann kannst du jederzeit zu mir kommen.“ Ich nickte.
Sie ging zur Tür.
„Warten Sie bitte!“
Mit einem fast sachten „Mmh“ drehte sie sich noch einmal zu mir um.
„Wie viel muss ich zunehmen, um hier raus zu können?“, fragte ich und hätte mir gegen die Stirn klatschen können, dass ich diese wichtigste aller Frage nicht schon eher gestellt hatte.
„Du solltest, um im gesunden Bereich zu liegen, einen Body-Mass-Index von 18 oder 19 haben“, meinte sie, ohne dass die Wärme in ihrer Stimme nachließ. „Mit einem Gewicht von gerade mal 36 Kilo liegt deiner zurzeit bei ca. 14.“
„Wie glorreich“, dachte ich. „Eine Gewichtszunahme als Rückfahrschein in die Freiheit.“
Kaum war sie gegangen, steckte eine andere, allerdings weit weniger freundliche Weißbekittelte kurz den Kopf ins Zimmer und quäkte, dass das Mittagessen für uns bereitstünde. Mit einem durchdringenden Blick sah sie mich an, als wolle sie sagen: „Und wehe, wenn nicht.“ In diesem Augenblick wusste ich nicht, was mich mehr anwiderte, die schrille Stimme dieser Frau, die mich warnte, dass mit ihr nicht gut Kirschen essen sei, oder der Ton, der zum Essen befahl. Vermutlich beides. Im Korridor beobachtete ich, wie die Mitpatienten – Alkoholsüchtige, Drogenabhängige, Menschen mit Depressionen oder Persönlichkeitsstörungen – apathisch links und rechts aus ihren Klausen schlappten und zu dem langen Tisch, der am Ende des Ganges vor einem riesigen Fenster stand, hinübertrotteten. Missmutig schloss ich mich an.
Bevor wir uns setzten, reichten die Pfleger jedem von uns ein Tablett, das meist seufzend entgegengenommen wurde, und wünschten einen „Guten Appetit“. Während ich widerwillig meine Ration in Empfang nahm, schien bei den anderen ein Schalter umgelegt worden zu sein: Sie stürzten sich wie die Aasgeier auf ihr Essen. Und als wäre der Geruch, der mir von den Schälchen in die Nase stieg, nicht schon schlimm genug, so musste ich ertragen, wie rechts und links gesabbert, mit dem Geschirr geklappert und geschmatzt wurde. Mir wurde fast schlecht.
Die Blicke der drei Pfleger, die uns beaufsichtigten, schienen insbesondere mir zu gelten. Ablehnend und trotzig vergrub ich mein Gesicht in den Händen und blieb regungslos sitzen, wie ein gefrorener Sturzbach, der im normalen Zustand kein Halten kennt.
„Warum isst du denn nicht?“ Die rundliche Frau mir gegenüber sah mich mit großen, fragenden Augen an. Da ich mich eh von allen unverstanden fühlte, ging ich davon aus, dass auch diese Frau keineswegs Verständnis für meine Sorgen haben würde. Ich beobachtete eine Weile stumm und verblüfft, wie sie ihr Essen in sich hineinschaufelte, und vergrub mein Gesicht wieder in der schützenden Dunkelheit meiner Hände.
„Du wirst diesen Tisch nicht verlassen, bis du gegessen hast“, ertönte eine barsche Frauenstimme. Eine Gestalt im unverkennbaren Weiß der Pfleger nahm auf dem frei gewordenen Stuhl neben mir Platz.
„Und selbst dann werden wir noch aufpassen, dass auch alles in deinem Magen bleibt! Nun, wir haben Zeit! Selbst wenn es bis morgen dauern sollte“, fuhr die Stimme fort, die einer gewissen Ayana gehörte.
So wenig Geduld? Es könnte vielleicht noch morgiger als morgen werden, bis ich zu essen gedenke! Meine Kehle war wie zugeschnürt, Tränen kullerten heiß zwischen meinen Fingern hindurch auf das Tablett, das ich nicht angerührt hatte. Wem sollte ich gehorchen? Esse ich, wird das schlechte Gewissen mich bestrafen, esse ich nicht, habe ich diese Menschen ständig an der Backe kleben, was jedoch eine harmlosere Bestrafung wäre als die, die mir mein böses Ich zufügen würde.
„Ich kann nicht!“, schluchzte ich laut auf.
•
„Weißt du, du erinnerst mich ein wenig an den Steppenwolf!“ Dr. Callidus schneite am nächsten Morgen wieder in mein Zimmer, doch diesmal mit sanfterer Miene.
„Bitte was? An wen?“, erkundigte ich mich und hätte gerne gewusst, ob es sich dabei um eine Beleidigung oder um ein Kompliment handelte. Ich war weder ein Wolf, noch kam ich aus der Steppe! Dr. Callidus setzte sich hin, schlug die Beine übereinander und schaute mich ungläubig an.
„Kennst du echt nicht?“
Ich schüttelte heftig den Kopf und war froh, dass wir über etwas anderes redeten als mein Gewicht. Ich lehnte mich gegen das hölzerne Fensterbrett und augenblicklich begann die Stelle, wo sich Rücken und Bord berührten, zu schmerzen. Doch ich ließ mir nichts anmerken und hörte dem Arzt aufmerksam zu, der kurz den Inhalt von Herrmann Hesses „Steppenwolf“ erläuterte.
„Du erinnerst mich an die Zentralfigur, weil die innerlich so hin- und hergerissen ist wie du, gewissermaßen zumindest! Weißt du, man kann sich entscheiden zwischen Leben oder Tod, aber man sollte sich Zeit lassen, denn sterben kann man immer noch, im Nachhinein, wenn einem das Leben immer noch nicht zusagt … So ist es bei dir mit deinem Essverhalten!“ Ich warf ihm einen fragenden Blick zu.
„Fang an zu essen, starte zumindest den Versuch, nachher kannst du immer noch auf Abmagern zurückschalten! Es ist ein Machtkampf, aber du wirst ihn gewinnen!“
Ich hatte immer noch keine Ahnung, ob der Vergleich zwischen dem Steppenwolf und mir nun eine Beleidigung oder ein Kompliment sein sollte, aber ich schüttelte den Gedanken daran ab und erkundigte mich mit einem treuen Hundeblick, wie es mit Ausgang aussehe.
„Ich schlage vor, dass dir für jedes Kilo, das du zulegst, eine Stunde Ausgang gewährt wird!“
Mir blieb vor Schreck der Mund offen stehen. Das könnte ja ewig dauern. Den ganzen Tag ließ mich der Gedanke nicht mehr los, dass nur eine Gewichtszunahme mir meine Freiheit wiedergeben würde. Ich beschloss, mich nicht mehr gegen eine Nahrungsaufnahme zu wehren, damit ich diesen Ort so schnell wie möglich wieder verlassen und wieder nach Belieben abnehmen konnte.
Bereits kleine Mengen bereiteten mir unheimliche Schmerzen. Für meinen Bauch gab es eine Wärmeflasche, aber gegen die Qualen, die mein tobendes Gewissen mir zufügte, gab es kein Mittel. Dennoch wollte ich an meinem Entschluss festhalten und so bat ich meine beste Freundin Cordia und deren Freund Arty, mir bei ihrem Besuch am Nachmittag heimlich Schokolade mitzubringen, damit ich rascher zunehmen würde. Denn was führt schneller zu speckigen Leibesringen als dieses süße, fettige Zeug?
„Ich habe deinen Arzt angerufen“, eröffnete mir Ayana, der ich gestern noch Feindseligkeit nachgesagt hatte, als Cordia und Arty da waren. „Er gestattet dir eine Stunde Ausgang in Begleitung deiner Freunde.“
Und zu Arty und Cordia gewandt: „Ihr bringt sie uns nachher auch sicher wieder?“ Beide setzten sofort eine ernste Miene auf.
„Aber sicher doch! Wir würden doch nicht …“
Aber Ayana zwinkerte uns dreien zu, was Cordia zu verstehen gab, dass sie ihren Satz gar nicht zu Ende führen musste.
Ein Lächeln huschte über mein Gesicht, als sie mir die Tür zur Freiheit aufschloss, mir dabei zulächelte und mich freundlich ansah. Ich ertappte mich dabei, dass ich sie näher betrachtete und sogar daran dachte, mich mit ihr zu unterhalten, womit ich ihr den ersten Schritt in Richtung meiner Welt gestattet hätte. Statt Strenge zeichnete Sanftmut ihr Gesicht und ihre Augen glichen nun weniger einem endlosen Tunnel als einer leuchtenden Laterne in schwarzer Nacht.
Am Abend lag ich noch lange wach, denn die Kaloriensoldaten schienen unaufhörlich gegen meine innere Magenwand zu treten. Ich hatte furchtbare Angst, schon morgen mindestens fünf Kilo schwerer zu sein, furchtbare Angst davor, dass ich bald mehr wiegen würde als jemals zuvor. Ob es nicht doch vernünftiger wäre, sich an diese Mahlzeiten zu gewöhnen, statt sich nebenbei auch noch vollzustopfen, um schneller die Flucht ergreifen zu können?
„Ach, halt doch die Klappe! Du wirst noch rascher dicker, als dir lieb sein wird, auch ohne dieses Zeug,“ zischte mir die Stimme meines Gewissens grienend und schadenfroh ins Ohr.
Ich hätte am liebsten geheult, doch ich war nicht mehr alleine im Zimmer und so blieb mir nichts anderes übrig, als meinen Tränen den Rückzug zu befehlen.
Meine unangenehme Zimmergenossin war immer total aufgedreht. Sie hörte laute Musik auf ihrem MP3-Player, hampelte herum, tanzte und summte dazu. Ich fragte mich, ob sie nicht schon einen Hörschaden hatte, da die Musik aus ihren Kopfhörern bis zu mir hinüber dröhnte. Offensichtlich war Rücksicht ein Fremdwort für diese junge, ausgeflippte Frau, deren Kleidung so bunt war wie das Gefieder eines Bienenfressers. Sie knipste das Licht über ihrem Bett an, zog sich aus, dann wieder an, ging zum Bad, betrachtete sich im Spiegel und wiederholte das Ganze von vorne. Und da sie auch noch Raucherin war, schlurfte sie regelmäßig in ihren Pantoffeln zum Raucherraum und kehrte noch aufgekratzter zurück. Rastlos wie ein Kolibri, aber wohl nicht so harmlos und nett. Wobei ich lieber den Vogel beobachtet hätte, mit seinen schnellen Flügelschlägen, wie er fast bewegungslos in der Luft verharrt, um den Nektar aus den Blütenkelchen zu saugen, statt dieses Wesen, mit dem ich eingepfercht war. Selbst wenn ich mich zum Fenster drehte, ließen die Geräusche und Töne die dazugehörenden Bilder vor meinen Augen entstehen, sodass ich immer wusste, was sie gerade trieb.
Doch noch unruhiger als ihr hektisches Gefuchtel bewegten sich meine Gedanken rund ums Zunehmen. Ich konnte mich einfach nicht damit anfreunden, die Zahl auf der Waage steigen zu lassen. Seit Monaten war es mein einziges Glück gewesen, sie sinken zu sehen. Außerdem würde mein Gewissen mich daran hindern, eine Veränderung zu akzeptieren. Hatte ich nicht schon lange genug gegen mich gekämpft? „Ich hasse meinen widerlichen fetten Körper, der nun von Tag zu Tag noch fetter werden wird“, dachte ich und schloss die Augen. „Ich will nicht, dass meine Oberweite wieder voll wird, ich will keinen runden Po und keine kräftigen Beine! Ich will dünn sein! Ich will ein Haufen Nichts sein, und selbst das ist noch ein Haufen zu viel!“
•
„Guten Morgen! Habt ihr gut geschlafen?“
Ein Pfleger und eine Pflegerin stürmten ins Zimmer, rissen die Vorhänge beiseite und schalteten das Licht an. Ich spähte zu meiner Bettnachbarin hinüber, die schon längst auf den Beinen war, und hätte am liebsten gefragt, wie man mir so eine dämliche Frage stellen konnte, bei einer solchen Zimmergenossin.
Ich rappelte mich schweigend hoch, streckte auf Befehl brav den Arm zum Blutdruck- und Pulsmessen aus.
„Zu tief, zu tief!“
„Ja, vermutlich so tief wie Ihr IQ“, murmelte mein genervtes Ich in meinem Kopf. Ich kämpfe dagegen an, laut loszuprusten, denn das hätte mir nur endlose Fragen beschert und darauf konnte ich verzichten.
„Aber ist ja nicht anders zu erwarten, wenn man sich in einem Zustand befindet wie deinem!“ Sie musterte mich streng. „Schau dir doch nur diese Ärmchen an!“
Ich ließ meinen Arm unverzüglich wieder unter der Bettdecke verschwinden und schaute grimmig.
„Hast du Schmerzen?“, fragte mich die zweite Person in weißer Tracht. „Nein, aber Sie in Kürze“, meinte ich im Stillen, doch aus meinem Mund kam nur ein muffiges: „Po und Nacken! Vom Liegen vermutlich!“
Einige Minuten später wurde eine Waage herbeigerollt, der ich misstrauisch mit den Augen folgte. Schließlich türmte sie sich vor meinem Bett auf, als wolle sie mir mitteilen, dass der Tag erst beginne, wenn ich ihr meinen Tribut gezollt hätte. Mir wurde übel und ein Zittern durchfuhr meinen Körper. Ich schwitzte, obgleich mir eigentlich ständig kalt war.
„Darf ich bitten?“
„Na, die sind ja klasse drauf“, dachte ich mir, „was soll das heißen – bitten? Bitten darf man, aber sich nichts erwarten!“ Aber ich wusste, dass ich keine Wahl hatte, also schob ich vorsichtig die Bettdecke beiseite und stieg zornig auf die Waage.
„43 Kilo! Da tut sich ja was“, meinte Paco, der die Waage herangerollt hatte. Diese Worte waren wie ein Schlag ins Gesicht, nur dass ich keinen Nasenbruch erlitt, sondern einen unmerklichen, ganzheitlichen Zusammenbruch. Rasch hüpfte ich zurück ins Bett und während die Anzeige der Waage längst erloschen war, hatten sich die Zahlen bedrohlich in meinem Gedächtnis festgebrannt.





























