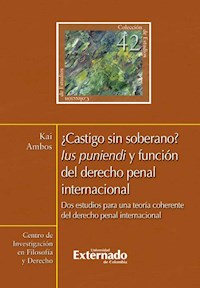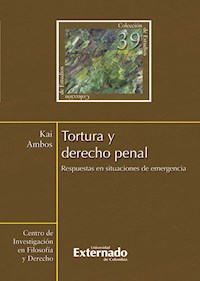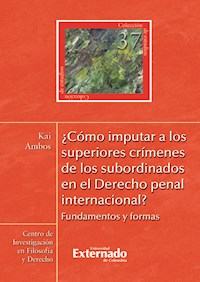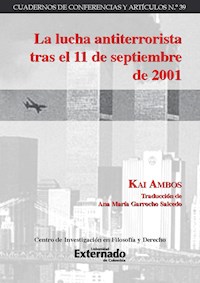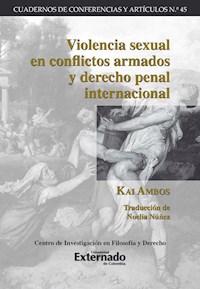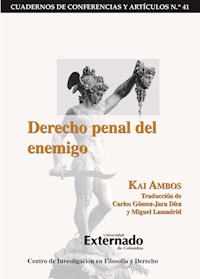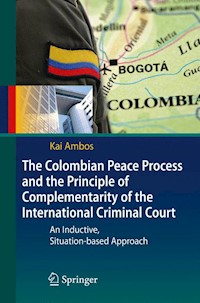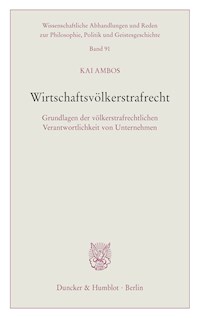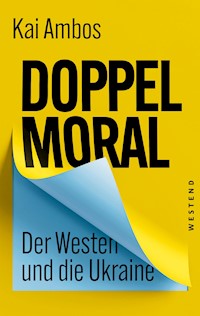
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der deutschen Diskussion um den Ukraine-Krieg liegt die Annahme zugrunde, dass unsere Verurteilung des russischen Angriffskriegs von der ganzen Welt geteilt wird. Diese Annahme ist jedoch unzutreffend und es ist Zeit, selbstkritisch nach den Gründen dafür zu fragen. Der russische Bruch des Gewaltverbots, der Fundamentalnorm des modernen Völkerrechts, verdient unzweifelhaft eine konsequente und nachhaltige Antwort, doch kann diese Antwort glaubwürdig vom Westen, geführt von den USA, gegeben werden? Ist möglicherweise die Doppelmoral des Westens der Grund dafür, dass der Großteil der Staaten dieser Welt, vor allem des Globalen Südens, allenfalls verbal die russische Aggression verurteilt? Wie kann dem Glaubwürdigkeitsverlust des Westens in weiten Teilen der Welt begegnet werden? Was muss der Westen tun, um weltweite Glaubwürdigkeit zu erlangen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 97
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ebook Edition
Kai Ambos
Doppelmoral
Der Westen und die Ukraine
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN: 978-3-98791-007-4
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2022
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz: Publikations Atelier, Dreieich
Inhalt
Titel
Vorwort
Einführung
Kapitel I Die begrenzte Unterstützung der westlichen Ukraine-Politik
1.Die Resolution der UN-Generalversammlung vom 1. März 2022
2.Taten statt Worte: tatsächliche Unterstützung der westlichen Ukraine-Politik?
2.1.Sanktionen und militärische Unterstützung
2.2.Völkerstrafrechtliche Strafverfolgung
2.3.Vorläufiges Fazit
Kapitel II Der widersprüchliche Umgang des Westens mit dem Völker(straf)recht
1.Historische Schuld …
2.… und heutige Brüche des Völkerrechts
3.Völkerstrafrechtliche Widersprüche
4.Jüngste völkerrechtliche Inkonsistenzen
4.1.Memorandum of Understanding (MoU) zwischen Finnland, Schweden und Türkei
4.2.Draft Bill of Rights des Vereinigten Königreichs
Kapitel III Schlussfolgerungen: Größere westliche Konsistenz im Völker(straf)recht
Abkürzungsverzeichnis
Anmerkungen
Einführung
Kapitel I Die begrenzte Unterstützung der westlichen Ukraine-Politik
Kapitel II Der widersprüchliche Umgang des Westens mit dem Völker(straf)recht
Kapitel III Schlussfolgerungen: Größere westliche Konsistenz im Völker(straf)recht
Orientierungspunkte
Titel
Inhaltsverzeichnis
Für Vânia
Ganze Wahrheit statt Doppelmoral
Vorwort
Dieser Essay geht auf meine Beschäftigung mit dem von der Russischen Föderation begonnenen Angriffskrieg gegen die Ukraine zurück – eine Aggression, die bekanntlich schon lange vor der sogenannten »militärischen Sonderoperation« des 24. Februar 2022 begonnen und mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Oblaste Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson am 30. September 2022 ihren – nur vorläufigen – Abschluss gefunden hat.. Ich habe mich an verschiedenen Stellen zu völker(straf)rechtlichen Aspekten der Ukraine-Situation geäußert, zuletzt auch zunehmend kritisch, weil ich mehr und mehr eine Diskrepanz zwischen dem hierzulande und in anderen westlichen Staaten propagierten Anspruch der Verteidigung einer regelbasierten Völkerrechtsordnung qua militärischer Unterstützung der Ukraine und der (sonstigen) westlichen Völkerrechtspraxis zu erkennen glaube. Zudem müssen wir uns die Frage stellen, warum die westliche Ukraine-Politik im weltweiten Maßstab keineswegs von der viel beschworenen »internationalen Gemeinschaft« – ein im hiesigen Mainstream unreflektiert und fast postkolonial gebrauchtes Konzept – unterstützt wird, sondern vielmehr vor allem im Globalen Süden auf viel Kritik stößt.
In den Anmerkungen finden sich zahlreiche Hinweise auf öffentlich und frei zugängliche Internetquellen; sie wurden alle zuletzt am 20. September 2022 abgerufen. Etwaige Übersetzungen stammen, sofern nicht anders vermerkt, von mir.
Ich danke zahlreichen Kollegen für wichtige Diskussionen zum Ukraine-Thema, insbesondere Gleb Bogush, Alexander Heinze, Julian Roberts und Alec Walen. Marlene Nebel schulde ich Dank für Unterstützung bei der Recherche. Schließlich danke ich dem Westend Verlag, dass er sich dem Projekt spontan angenommen und daraus zügig ein Buch produziert hat. Dank auch an Marvin Baudisch für ein sehr engagiertes Lektorat.
Ich habe diesen Essay in meiner akademischen Funktion geschrieben; er kann insbesondere nicht dem Den Haager Kosovo Sondertribunal (Kosovo Specialist Chambers) zugerechnet werden.
Kai Ambos
Göttingen, 30. September 2022
Einführung
Der beispiellose russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sollte uns nicht blind machen gegenüber den komplexen rechtsstaatlichen Problemen, denen sich dieses Land gegenübersieht. Zu diesen Problemen zählen etwa strukturelle Defizite der Justiz, insbesondere deren mangelnde Unabhängigkeit, und die immer noch grassierende Korruption.1 In diesem Sinne habe ich schon an anderer Stelle argumentiert.2
In unserem Zusammenhang werden diese Probleme sowohl durch die Strafverfolgung russischer Soldaten wegen Kriegsverbrechen3 als auch die (unzureichende) Untersuchung angeblicher Kriegsverbrechen der ukrainischen Streitkräfte deutlich. Die reflexhafte und überaus emotionale Ablehnung des jüngsten Berichts von Amnesty International4 (AI) durch die ukrainische Führung5 war insoweit wenig hilfreich, als dass sie schon vorhandene Zweifel an der Unparteilichkeit der ukrainischen Ermittlungsbehörden verstärkt. Es wäre klüger gewesen, wenn sich die ukrainische Regierung inhaltlich mit den AI-Vorwürfen im Einzelnen auseinandergesetzt und mit einer detaillierten – durchaus möglichen – Antikritik repliziert hätte.6
Um keinerlei Missverständnisse aufkommen zu lassen, sei jedoch klargestellt, dass diese Probleme in keiner Weise das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der UN-Charta7 in Frage stellen. Auch geht es dabei nicht um einen Vertausch der Rollen und Verantwortlichkeiten in diesem Krieg (im Sinne eines sogenannten »victim-blaming«), nämlich der Rolle Russlands als Aggressor und der Ukraine als Opfer dieser Aggression. Richtig ist aber auch, dass man zwischen der kollektiven Ebene – Täter-/Opferstaat – und der individuellen – Einzeltäter/-opfer – unterscheiden muss. Obwohl beide Opfer – ob kollektiv (Ukraine) oder individuell (Einzelperson) – ein Recht auf Selbstverteidigung haben und ihre Vorgeschichte dieses Recht nicht berührt, hängt die Beendigung der Aggression in beiden Situationen von verschiedenen Faktoren und Umständen ab.
Während nämlich das Opfer eines individuellen Angriffs diesen durch eine oder mehrere Abwehrmaßnahmen abwenden kann, ist die kollektive Verteidigung eine viel komplexere und langwierigere Angelegenheit. Sie kann einen Punkt erreichen, an dem die Kosten (in Form von Verlusten an Menschenleben, Zerstörung von Land und Eigentum usw.) es für den Verteidiger vernünftiger erscheinen lassen, auf sein Verteidigungsrecht zu verzichten und eine Verhandlungslösung zu suchen.8 Natürlich kann diese Entscheidung nur von dem Verteidiger selbst getroffen werden.9 Ratschläge dritter Akteure sollten sich deshalb darauf beschränken, ihre eigene Politik kritisch zu hinterfragen. Konkret bedeutet das: Der Westen kann der Ukraine nicht vorschreiben, wann der Moment für einen Verhandlungsfrieden gekommen ist; westliche Gesellschaften dürfen und sollten aber sehr wohl diskutieren, ob, in welcher Form und bis wann die Unterstützung der Ukraine (noch) politisch sinnvoll ist.
Auch in diesem Essay liegt der Schwerpunkt der Betrachtung nicht so sehr auf der Ukraine als vielmehr auf uns, d. h. dem Westen, der, unter der Führung der USA, der EU und der NATO (North Atlantic Treaty Organisation), den Anspruch erhebt, mittels seiner – fast bedingungslosen – Unterstützung der Ukraine eine regelbasierte Völkerrechtsordnung zu verteidigen.10 Gemeint ist damit – jenseits der mitunter ungenauen Begrifflichkeiten (»regelbasierte internationale Ordnung«)11 – eine Ordnung, die sich an die geltenden Normen des Völkerrechts, also insbesondere internationale Übereinkünfte, internationales Gewohnheitsrecht und allgemeine Rechtsgrundsätze,12 hält. Eine besondere Bedeutung kommt dabei der schon erwähnten UN-Charta13 zu, denn sie ist die Rechtsgrundlage der Vereinten Nationen (United Nations) als der wichtigsten und einzigen globalen multilateralen Institution zur Friedenssicherung und Streitbeilegung und enthält die grundlegenden materiellen und verfahrensrechtlichen Normen zur Verwirklichung dieser Zwecke.
Eine grundlegende – vielleicht die grundlegendste – Norm des Völkerrechts stellt das Gewaltverbot gemäß Artikel 2 Abs. 4 der UN-Charta14 dar. In den Worten des Internationalen Gerichtshofs (IGH) handelt es sich um einen »Eckstein der Satzung der Vereinten Nationen«;15 für den großen Staats- und Völkerrechtler Hans Kelsen ist das Gewaltverbot schlechthin konstitutiv für die Existenz einer Völkerrechtsordnung, denn andernfalls stünden die von dieser Ordnung gewährten Rechte und geschützten Interessen in der freien Disposition eines auf Gewalt rekurrierenden feindlichen Staates.16 Es unterliegt insofern keinem Zweifel, dass das Gewaltverbot und seine raison d’être, nämlich die Unverletzlichkeit der territorialen Integrität souveräner Staaten, durch die russische Invasion vom 24. Februar 2022 flagrant verletzt wurde, gleichsam in radikaler und eskalierender Fortsetzung der Verletzungen seit Frühjahr 2014.17 Die territoriale Integrität kann eben nur auf dem Verhandlungswege, nicht aber mit Gewalt geändert werden. Die uns hier interessierende Frage ist nun aber, ob ausgerechnet der Westen den Anspruch erheben kann, mittels seiner Ukraine-Politik diese Norm und die regelbasierte Völkerrechtsordnung insgesamt zu verteidigen bzw. wiederherzustellen.
Ich werde hier darlegen – durchaus in Widerspruch zum gesellschaftlichen Mainstream –, dass ein solcher westlicher Anspruch angesichts der Widersprüchlichkeiten des eigenen Umgangs mit dem Völkerrecht nur bedingt eingelöst werden kann. Ich werde dies in drei Schritten begründen: Zunächst werde ich zeigen, dass die westliche Reaktion auf den russischen Angriffskrieg keineswegs globale Unterstützung erfährt, insbesondere nicht im sogenannten »Globalen Süden« (Kapitel I). Sodann werde ich versuchen, den Grund dieser begrenzten globalen Unterstützung – zumindest teilweise – zu erklären, indem ich auf historische und jüngere westliche Widersprüchlichkeiten im Umgang mit dem Völkerrecht eingehe (Kapitel II). Auf dieser Grundlage werde ich dann einige Schlussfolgerungen ziehen, im Kern einen konsequenteren westlichen Umgang mit dem Völkerrecht fordern, gleichzeitig aber auch meine vorherige Analyse mit einigen differenzierenden Vorbehaltenversehen(Kapitel III).
Kapitel I Die begrenzte Unterstützung der westlichen Ukraine-Politik
1.Die Resolution der UN-Generalversammlung vom 1. März 2022
Um die universelle Verurteilung des russischen Angriffskriegs zu belegen, verweisen westliche Politiker regelmäßig auf die Resolution »Uniting for Peace«18 der UN-Generalversammlung (GV) vom 2. März 2022.19 Diese Resolution, in der die russische Invasion als »Aggression« bezeichnet, »auf das Schärfste« verurteilt wird und die Einstellung der Feindseligkeiten sowie ein sofortiger, vollständiger und bedingungsloser Abzug der russischen Streitkräfte gefordert werden,20 fand in der Tat eine überwältigende Mehrheit von 141 (von insgesamt 193 grundsätzlich stimmberechtigen) UN-Mitgliedstaaten,21 bei nur fünf Gegenstimmen und 35 Enthaltungen.22 Damit sendete sie ein viel deutlicheres Signal als die GV-Resolution von 2014 zur Verurteilung der Krim-Annexion, die nur von 100 Staaten bei 11 Gegenstimmen und 58 Enthaltungen unterstützt wurde;23 diesem Abstimmungsergebnis wiederum entsprach die GV-Resolution vom 7. April 2022 zum Ausschluss Russlands aus dem UN-Menschenrechtsrat.24
Bei näherer Betrachtung der Abstimmung zur Uniting for Peace-Resolution ergibt sich jedoch, insbesondere im Hinblick auf die regionale Verteilung und die Position einiger wichtiger Staaten, ein aus westlicher Sicht eher ernüchterndes Bild.25 Während die Ablehnung Russlands und seiner treuen Verbündeten (Weißrussland, Nordkorea, Syrien) zu erwarten war (mit Ausnahme von Eritrea26 vielleicht), haben sich viele wichtige Staaten der Stimme enthalten (unter anderem Algerien, Bangladesch, China, Indien, Südafrika), wobei der Schwerpunkt auf Afrika (17)27 und Asien (14)28 liegt und die restlichen vier Enthaltungen auf Lateinamerika entfallen.29 Auch die zwölf Staaten, die sich nicht an der Abstimmung beteiligt haben, kommen von diesen Kontinenten30 und hätten sich wohl auch enthalten, wenn nicht sogar gegen die Resolution gestimmt.31 Bereits diese regionale Verteilung des Abstimmungsverhaltens zeigt, dass die Resolution nur in Europa eine eindeutige und in Amerika noch eine starke Unterstützung fand, diese aber in Afrika (28 Ja-Stimmen von 54 Staaten) und Asien (29 von 47) weitaus geringer ausfiel. Während die europäische Position von traditionellen westlichen Verbündeten (Australien, Kanada, Neuseeland, USA) sowie auch in Lateinamerika (z. B. Kolumbien, Costa Rica, Chile) und Asien (Japan, Südkorea) unterstützt wurde, distanzierte sich der Globale Süden, vertreten durch Afrika und in geringerem Maße Asien, angeführt von China und Indien, deutlich von der westlichen Position.
Dieses Bild könnte noch durch eine Analyse der individuellen Motivationen der sich enthaltenden Staaten verfeinert werden,32 doch bedarf es dieser Einzelanalyse für unser Argument – die schon verbale Distanzierung des Globalen Südens von der westlichen Position durch sein Abstimmungsverhalten – nicht. Es soll hier der Hinweis genügen, dass sich die Stimmenthaltungen einerseits nicht einfach mit dem Verweis auf spezifische aktuelle Loyalitätsmusterzur Russischen Föderationerklären lassen – auch wenn dies für diejenigen Staaten zutreffen mag, die ehemalige Republiken der Sowjetunion (z. B. Kasachstan) sind, sich immer noch als »sozialistisch« betrachten (z. B. Kuba, Vietnam) oder/und Regierungen haben, die russische Unterstützung benötigen, um an der Macht zu bleiben (z. B. Nicaragua).33 Andererseits gibt es ein historisches Erbe, das bis zum Antikolonial-/Anti-Apartheid-Kampf zurückreicht, wo einige dieser Staaten (z. B. Angola, Südafrika) nur von der ehemaligen Sowjetunion und ihren Verbündeten unterstützt wurden34 – und Moskau spielt diesen Trumpf geschickt aus.35 Die Enthaltung globaler bzw. regionaler Großmächte wie China,36 Indien,37 Brasilien38 und Südafrika39 wiederum folgt einer ganz eigenen und länderspezifischen Logik, die sich jedenfalls auch als Antwort auf die westliche bzw. US-amerikanische Hegemonie in der – nun überwundenen – unipolaren Weltordnung verstehen lässt. Wir werden darauf zurückkommen.
Dieses vielschichtige und komplexe Bild ändert freilich nichts daran, dass die GV-Resolution, wie wir schon zu Beginn dieses Abschnitts gesehen haben,40