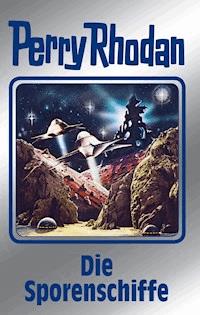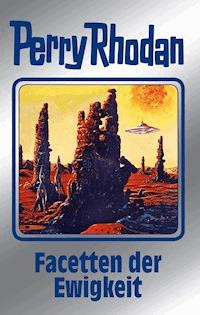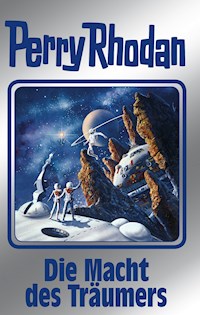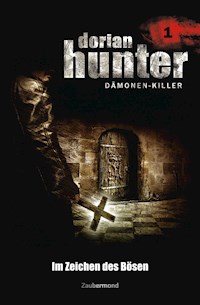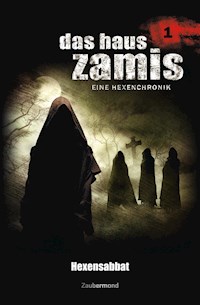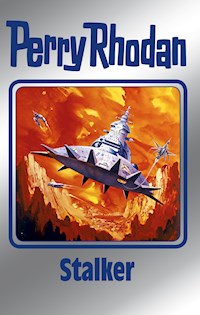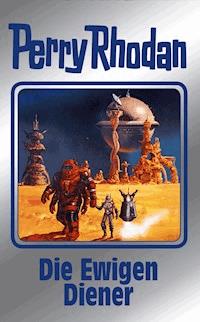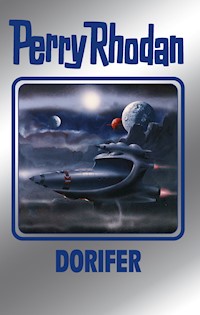1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Dorian Hunter - Horror-Serie
- Sprache: Deutsch
Das Zimmermädchen brach zusammen. Das Tablett entfiel ihren kraftlos gewordenen Händen. Sie musste längst schon von den Ratten zu Tode gebissen worden sein und konnte nur noch magisch belebt gewesen sein.
Dorian sah zwei graue Schatten auf sich zuspringen. Der einen Ratte konnte er ausweichen, die andere spießte er mit dem Kommandostab auf. Hinter ihm schrie Alfredo vor Entsetzen auf.
»Wir müssen fliehen«, rief Dorian. »Es sieht fast so aus, als wären die Ratten auf uns gehetzt worden.«
Sie eilten auf den Korridor hinaus. Die Ratten drängten sich dort so dicht, dass es kaum eine freie Lücke gab. Sie schritten über einen Teppich von Rattenkörpern ...
Dorian und Coco setzen die Suche nach ihrem Sohn Martin in Vigo in Galicien fort. Doch eine gegnerische Partei stellt sich ihnen in den Weg und hinterlässt eine erschreckende Fährte: die Spur der Ratten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
DIE SPUR DER RATTEN
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Der ehemalige Reporter Dorian Hunter hat sein Leben dem Kampf gegen die Schwarze Familie der Dämonen gewidmet, seit seine Frau Lilian durch eine Begegnung mit ihnen den Verstand verlor. Seine Gegner leben als ehrbare Bürger über den Erdball verteilt. Nur vereinzelt gelingt es dem »Dämonenkiller«, ihnen die Maske herunterzureißen.
Bald kommt Dorian seiner eigentlichen Bestimmung auf die Spur: In einem früheren Leben schloss er als Baron Nicolas de Conde einen Pakt mit dem Teufel, der ihm die Unsterblichkeit sicherte. Um für seine Sünden zu büßen, verfasste de Conde den »Hexenhammer« – jenes Buch, das im 16. Jahrhundert zur Grundlage für die Hexenverfolgung wurde. Doch der Inquisition fielen meist Unschuldige zum Opfer; die Dämonen blieben ungeschoren. Als de Conde selbst der Ketzerei angeklagt und verbrannt wurde, ging seine Seele in den nächsten Körper über. So ging es fort bis in die Gegenwart. Dorian Hunter begreift, dass es seine Aufgabe ist, de Condes Verfehlungen zu sühnen und die Dämonen zu vernichten.
Als Rückzugsort in seinem Kampf bleibt Dorian neben der Jugendstilvilla in der Baring Road in London noch das Castillo Basajaun in Andorra, in dem er seine Mitstreiter um sich sammelt – darunter die ehemalige Hexe Coco Zamis, die aus Liebe zu Dorian die Seiten gewechselt hat. Nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Martin hat Coco diesen zum Schutz vor den Dämonen an einem Ort versteckt, den sie selbst vor Dorian geheimhält.
Auf der Suche nach der Mumie des Hermes Trismegistos findet Dorian den Steinzeitmenschen Unga, der Hermon gedient hat und der sich nach seinem Erwachen schnell den Gegebenheiten der Gegenwart anpasst. Auf Island gewinnt Dorian den Kampf um das Erbe des Hermes Trismegistos.
Die Invasion der Janusköpfe von der Parallelwelt Malkuth wird von den Padmas abgewehrt – mit Dorians Hilfe. Dem Padmasambhawa, der niemand anderes als Hermes Trismegistos ist, wird klar, dass er für das Entstehen der fürchterlichen Psychos auf Malkuth verantwortlich ist. Um zu büßen, geht Hermon durch eins der letzten Tore nach Malkuth. Auf der Erde sind zehn Janusköpfe gestrandet. Olivaro, das ehemalige Oberhaupt der Schwarzen Familie und selbst ein Januskopf, beschließt, seine Artgenossen zu jagen. Wenig später verursacht der Erzdämon Luguri die Zerstörung des Tempels des Hermes Trismegistos in Island. Unmittelbar vor der Vernichtung zeigt der magische Tisch sieben düstere Prophezeiungen. Vier davon haben sich bereits bewahrheitet, darunter auch jene über Martin Zamis: Der Sohn des Dämonenkillers wird von Luguri und dem Kinddämon Baphomet, der Reinkarnation des Dämonenanwalts Skarabäus Toth, entführt. Auf Sizilien kommt es zu einem magielosen Zustand. Auf der Suche nach Martin begeben sich Dorian und Coco nach Vigo. Dort erfahren sie von einer verfluchten Zitadelle und einem Geisterschiff. Coco bewahrt Dorian davor, von den Geistern rekrutiert zu werden, ehe die Galeere in See sticht.
DIE SPUR DER RATTEN
von Ernst Vlcek
Er war ein Virtuose besonderer Art. Er spielte mit den Gefühlen von Menschen und mit Menschenschicksalen. Es bereitete ihm höchste Lust, Menschen so anzuheizen, dass sie in euphorische Stimmung gerieten, dass sie vor Glück überschäumten, nur um ihnen dann Schicksalsschläge zu bereiten, an denen sie zerbrachen. Es bedurfte nicht viel, um dies zu erreichen. Er brauchte sich nicht groß anzustrengen, denn es waren meistens die kleinen Dinge des Lebens, die Schicksale bestimmten. Ganz banale Dinge, wie etwa einem eifersüchtigen Ehemann beizubringen, dass seine Frau ihn betrog, konnten ergötzliche Komplikationen bewirken. Intrigen brauchten nicht kompliziert angelegt zu werden, um wirksam zu sein. Die Menschen waren in ihren Gefühlen so verletzlich, dass es nicht nötig war, ihnen körperlichen Schaden zuzufügen.
Die Menschen kennenzulernen, hieß für ihn, ihre Schwächen schätzen zu lernen. Er hatte sich in Galicien niedergelassen; eigentlich aus keinem besonderen Grund, und wenn doch, weil die Menschen hier einfacher und direkter als anderswo waren. Und sie waren tief gläubig. Ihren Glauben zu zerstören, war eine schöne Aufgabe für ihn.
1. Kapitel
Er hatte sich schon ziemlich gut eingewöhnt und führte seine Dolchstöße gegen die Seelen der Menschen aus dem Hinterhalt heraus. Er wollte nicht im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Die Fäden zu ziehen, zu sehen, wie die Saat seiner Intrigen aufging, das machte für ihn den besonderen Reiz aus.
Er hatte schon einige Macht erlangt. Und er hatte ein Lieblingsprojekt. Im Augenblick feilte er an einem Schicksal herum, das mit diesem Projekt in engem Zusammenhang stand.
Da war Mutter Arosa. In den Augen der Menschen eine herzensgute, hilfreiche und selbstlose Person, voller Güte und Mildtätigkeit für die Hilfsbedürftigsten unter den Hilfsbedürftigen dieser Welt: die Kinder. Sie war wohlhabend und besaß ein großes Anwesen, in dem sie elternlose und verstoßene Kinder aus der ganzen Welt um sich geschart hatte. Eine Samariterin, würden die Menschen sagen.
Für ihn aber war Mutter Arosa ein williges Opfer, in ihrer Hilfsbereitschaft viel verletzlicher als andere Menschen. Aber ihr Leben wollte er – und das musste symbolisch gesehen werden – erst in einem großen Finale mit einem Paukenschlag zerstören. Zuerst wollte er ihr durch kleinere Schicksalsschläge nur kleine Nadelstiche versetzen, sozusagen, um ein ausgefülltes Leben langsam zu unterhöhlen.
Und dann war da Helene Courbert neben vielen anderen.
Helene Courbert war früher einmal das genaue Gegenteil von Mutter Arosa gewesen: gefühlsroh, egozentrisch, leichtlebig. Ein richtiges Flittchen. Was er nüchtern feststellte, ohne sie beschimpfen zu wollen. Inzwischen war sie geläutert. O ja, das gab es unter den Menschen. Sie waren so unglaublich wandlungsfähig, dass er nur staunen konnte. Selbst Mörder wurden später nicht selten fromm. So bereute auch Helene Courbert ihre früheren Verfehlungen. Und eine davon, die unter den Menschen als besonders verwerflich galt, reute sie besonders.
Vor vierzehn Jahren war sie von einem Sohn entbunden worden. Es war das Produkt eines unbedeutenden Abenteuers, das Helene Courbert längst schon vergessen hätte, wäre es ohne Folgen geblieben. Aber sie zeigte auch so recht deutlich, was sie von dem Seitensprung hielt: Ohne die Taufe ihres Kindes abzuwarten, gab sie es zur Adoption frei.
Jetzt, nach vierzehn Jahren, hatte sie deshalb ein schlechtes Gewissen. Inzwischen war sie durch Heirat zu Geld gekommen, zu viel Geld. Jetzt konnte sie es sich leisten, ihren Fehler von damals wiedergutzumachen.
Er war ihr dabei behilflich. Er half ihr, die verschlungenen Pfade zu ihrem verstoßenen Kind zu finden. Und jetzt wartete er in lustvoller Vorfreude darauf, was bei der schicksalhaften Gegenüberstellung passieren würde.
Es war eigentlich nur eine kleine Episode am Rande, aber er war sicher, dass er auf seine Rechnung kommen würde. Seine Erregung steigerte sich fast ins Unerträgliche.
Mutter, bitte!
Nein, mein Junge, du darfst dich mir nicht verschließen.
Aber wenn Theo merkt, dass ich mich hinter seinem Rücken mit dir unterhalte, wird er sehr böse werden.
Wenn du dich vor ihm fürchtest, dann verrate es ihm einfach nicht!
Ich habe keine Angst vor ihm. Er ist mein Freund.
Dann kann er dir die Unterhaltung mit mir nicht verbieten.
Theo ist sehr eifersüchtig.
Magst du ihn mehr als deine Eltern?
Ich mag dich am liebsten, Mutter.
Es ist schön, das zu hören. Ich will dich auch nicht lange ablenken, sondern dir nur sagen, dass ich ganz in deiner Nähe bin.
Wo bist du?
In Vigo. In einem Hotel in der Nähe des Hafens. Es heißt »Puerto Romano«. Und wo bist du?
Auf einer Finca. Ich weiß schon, dass Finca »Gut« heißt, und diese Finca ist ein großes Gut. Aber ich habe ehrlich keine Ahnung, wie der Ort heißt. Es gefällt mir hier von Tag zu Tag besser. Ich habe einen neuen Freund, der ein wenig Deutsch kann. Aber Theo ist auf ihn eifersüchtig und will nicht, dass ich mit ihm spiele.
Wie heißt dein neuer Freund?
Alfredo, aber ich sage Alfie zu ihm.
Bitte Alfie, dass er auf dich achtgibt! Versprichst du mir das, mein Junge?
Wenn du meinst, Mutter. Lass mich jetzt, bitte! Theo kommt.
Sei vorsichtig.
Ja, ja.
Fürchte dich nicht vor Theo! Wir sind bald bei dir.
Theo ist mein Freund. Und er ist gut zu mir.
Leb wohl, mein Junge!
Leb wohl, Mutter!
Trotz seiner vierzehn Jahre hatte Alfredo schon eine große Verantwortung zu tragen. Er hatte die Aufsicht über fünf Jungen von fünf bis zehn Jahren. Alfredo kümmerte sich um ihre Erziehung, machte mit ihnen die Aufgaben, sofern sie schon zur Schule gingen, und sorgte für ihr leibliches Wohl. Mutter Arosa sprach nur in den höchsten Tönen des Lobes von ihm, und das machte Alfredo stolz.
Irgendwie war ihm vor dem Tag bang, an dem er alt genug war, um auf eigenen Beinen zu stehen, und Mutter Arosa ihn fortschicken würde. Das tat sie mit allen ihren Schützlingen, wenn sie volljährig waren; von diesem Prinzip ging sie nicht ab.
Alfredo hatte aber auch aktuellere Sorgen. Diese bereiteten ihm die beiden Kinder, die vor vierzehn Tagen in seine Obhut gegeben worden waren. Sie hießen Theo und Martin und waren deutscher Abstammung. Es hieß, dass sie fünf Jahre alt seien, und so sahen sie eigentlich auch aus. Ja, sie waren vielleicht sogar intelligenter als andere Fünfjährige. Aber Martin hatte ihm im Vertrauen gesagt, dass er erst dreieinhalb war.
Mit Martin verstand sich Alfredo eigentlich blendend. Aber ihr Verhältnis hätte noch besser sein können, wenn Theo nicht gewesen wäre.
Theo tyrannisierte Martin geradezu, ohne dass dieser es zu merken schien. Oder er ließ es sich gefallen, weil er vor Theo Angst hatte. So genau war das nicht festzustellen, weil Martin sich glattweg weigerte, dazu Stellung zu nehmen. Er war seinem Freund hörig. Alfredo konnte nichts dagegen tun.
Als er sich einmal Theo vorgenommen hatte, da hatte dieser eine Drohung ausgestoßen, die Alfredo eine Gänsehaut über den Rücken jagte.
»Wenn du versuchst, mir Martin abspenstig zu machen, dann reiße ich dir die Eingeweide bei lebendigem Leib heraus!«
Theo wurde Alfredo immer unheimlicher. Er hatte Mutter Arosa nichts davon gesagt, weil er auch bisher mit allen seinen Problemen allein fertig geworden war; er würde es auch diesmal schaffen.
Einmal hatte ihm Martin, der nur deutsch sprach, anvertraut: »Ich bleibe nicht lange. Meine Mutter wird mich bald holen.«
»Wieso bist du dann überhaupt hier?«, wollte Alfredo in seinem schlechten Deutsch wissen. Französisch und Englisch beherrschte er besser.
»Ich weiß es nicht genau«, hatte Martin geantwortet. »Mutter tut so geheimnisvoll. Ich bin sicher, dass sie mir etwas verschweigt. Außerdem mag sie Theo nicht. Das sagt sie mir immer, wenn ich mit ihr spreche. Darum führe ich nicht viele Gespräche mit ihr.«
»Wann sprichst du denn mit ihr?«
Martin presste die Hand auf den Mund. »O je, jetzt habe ich zu viel ausgeplaudert.«
Alfredo ließ nicht locker, bis Martin ihm gestand, dass er manchmal – eigentlich wann immer er wollte – die Gedanken seiner Mutter hören konnte und umgekehrt. Bevor Alfredo mehr darüber in Erfahrung zu bringen vermochte, erschien Theo, und Martin zog sich zurück. »Lass endlich die Finger von Martin!«, zischte Theo im Vorübergehen Alfredo zu. »Sonst breche ich dir alle Knochen im Leib.«
Alfredo hätte viel darum gegeben, Theo loszuwerden. Er ertappte sich sogar einmal dabei, wie er sich wünschte, dass er sich das Genick brach. Er bat daraufhin den Heiligen Jakob inständig um Vergebung.
Aber in seinem Innersten begann er Theo mehr und mehr zu hassen.
Und sein Hass bekam immer neue Nahrung. So wie eben.
Martin saß im Gemeinschaftsraum über einem Puzzle, das er schneller zusammensetzte, als es selbst Alfredo gekonnt hätte. Plötzlich erstarrte er und war für einige Minuten wie abwesend. Dabei bewegte er die Lippen, als führte er ein Selbstgespräch.
»Martin, was ist?«, erkundigte sich Alfredo besorgt.
Martin schreckte hoch und lächelte, als er Alfredo sah. »Ich habe mich gerade mit Mutter unterhalten«, sagte er. »Ich habe ihr von dir erzählt, Alfie.«
Alfredo schluckte. »Was hat deine Mutter gesagt?«, fragte er, nur um etwas zu sagen.
»Sie sagte, dass sie ganz in der Nähe sei. In Vigo, in einem Hotel, das ›Puerto Romano‹ heißt. Was bedeutet dieser Name?«
»Römischer Hafen«, übersetzte Alfredo. »Weiß deine Mutter endlich, wo du bist?«
»Nein!«, rief Martin erschrocken aus. »Ich habe doch Theo versprochen, es ihr nicht zu verraten. Und ein Versprechen muss man halten.«
»Aber willst du denn nicht zu ihr zurück?«
Martin versteifte sich. »Hör bitte damit auf, Alfie! Sonst spreche ich nicht mehr mit dir.«
»Schon gut.«
Alfredo merkte, wie Martins Augen sich auf einmal erschrocken weiteten und er leicht zu zittern begann. Alfredo blickte zur Tür. Dort war Theo aufgetaucht.
»Kommst du einmal mit, Alfie?«, sagte er mit falscher Freundlichkeit. »Ich muss dir etwas zeigen.«
Alfredo folgte dem kaum einen Meter großen Jungen auf den Gang hinaus. Als sie den Blicken der anderen Kinder entschwunden waren, drehte sich Theo blitzschnell um und hieb Alfredo die Faust mit solcher Wucht in den Unterleib, dass dieser sich vor Schmerz krümmte.
Alfredo meinte zu träumen. Ein Knirps von dreieinhalb Jahren versetzte ihm einen Schlag, dass ihm davon sterbenselend wurde.
Während sich Alfredo immer noch röchelnd krümmte, hörte er Theo zynisch sagen: »Das war längst schon fällig. Aber zum Glück erledigt sich dieses Problem von selbst. Du weißt noch nichts davon, aber ich kann dir schon jetzt verraten, dass du heute noch von hier verschwindest. Mutter Arosa wird es dir sicher so schonend wie nur möglich beibringen.«
Theo verschwand im Gemeinschaftsraum.
»Alfie!«, rief vom Eingang des Gebäudes her eine Mädchenstimme. »Alfie, bist du da?«
Er erkannte an der Stimme Isabelle sofort. Sie traute sich nicht herein, weil den Mädchen der Zutritt in die Knabenunterkünfte untersagt war. Alfredo fand aber trotzdem immer wieder Gelegenheit, Isabelle zu treffen.
Er taumelte zum Ausgang.
»Alfie!«, rief Isabelle erschrocken aus, als sie sein aschfahles Gesicht sah. »Brauchst du ...«
»Es ist nichts weiter«, sagte er ungehalten. »Was willst du?«
»Mutter Arosa möchte dich sprechen«, sagte Isabelle und biss sich auf die Lippen. »Es scheint ernst zu sein.«
Alfredo fuhr erschrocken hoch. »Weiß sie ...«
Isabelle schüttelte den Kopf. »Von mir bestimmt nicht.«
Alfredo dachte sofort an Theo. Er traute dieser kleinen Ratte jede Gemeinheit zu, auch dass er ihn bei Mutter Arosa angeschwärzt hatte. Aber wenn schon. Er würde das durchstehen. Schließlich war zwischen ihm und Isabelle nichts Ernstes gewesen.
Alfredo erreichte das Hauptgebäude, in dem Mutter Arosa mit ihrem Diener Domenico wohnte. Vor dem Portal stand ein silbergrauer Luxuswagen. Alfredo hatte ihn vor zwei Stunden vorfahren sehen. Es war ein Rolls-Royce, wie er fachkundig feststellte. Daneben stand ein piekfein herausgemachter Chauffeur. Der Wagen hatte ein französisches Kennzeichen.
Alfredo betrat das Gebäude mit klopfendem Herzen.
Er hätte Mutter Arosa stundenlang zuhören können, ohne selbst auch nur ein einziges Wort zu sagen. Sie hatte eine angenehme sanfte Stimme, die nie den Ton veränderte, egal, ob sie jemanden ausschalt oder lobte. Und wenn sie schwieg, hätte Alfredo einfach dasitzen können, um sie zu betrachten.
Mutter Arosa war schön. Sie hatte ein blasses Engelsgesicht mit feinen Zügen, dessen Sanftheit auch nicht durch das strenge schwarze Kleid verloren ging. Das graue, locker aus dem Gesicht gekämmte Haar unterstrich den Eindruck, sie sei ein überirdisches Wesen.
Während ihr Alfredo zuhörte und versuchte, ihren Ausführungen zu folgen, betrachtete er das anmutige Spiel ihrer schmalen, weißen Hände auf dem Schreibtisch. Von diesen grazilen Händen ging etwas Beruhigendes aus.
»Sieh mich bitte an, Alfredo, wenn ich mit dir spreche!«, sagte sie mit sanftem Tadel.
Er hob den Blick.
Für ihn war Mutter Arosa immer ein zeitloses Wesen gewesen. Er war nie auf die Idee gekommen, sich über ihr Alter Gedanken zu machen. Jetzt stellte er erschrocken fest, dass sie uralt wirkte. Er bemerkte Falten in ihrem Gesicht, die er vorher nie gesehen hatte. Die Haut wirkte grau und eingefallen, und ihr sonst stets lächelnder Mund hatte plötzlich etwas Verhärmtes. Verbitterung zog die Mundwinkel nach unten.
»Hast du mir überhaupt zugehört, Alfredo?«, fragte sie.
Er spürte, wie er rot wurde. »Jawohl, Mutter Arosa«, sagte er. »Aber ich habe nicht alles verstanden. Es hört sich so verwirrend an.«
»Vielleicht sollte ich ...«, begann die andere Frau, die noch im Zimmer war und Alfredo mit nervösen Blicken bedachte.
Sie war vornehm gekleidet, mit Schmuck behangen und vermutlich nur halb so alt wie Mutter Arosa. Aber neben ihr wirkte sie wie eine aufgedonnerte Schaufensterpuppe und ebenso seelenlos und unpersönlich.
Alfredo hatte keine Ahnung, was sie hier sollte und warum Mutter Arosa in ihrer Anwesenheit mit ihm sprach.
»Bitte!«, sagte Mutter Arosa sanft, und die fremde Frau verstummte. »Unsere Aufgabe ist auch so schon schwer genug. Es würde für Alfredo alles nur schlimmer machen, wenn wir einfach mit der Tür ins Haus fielen.«