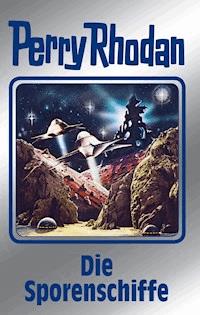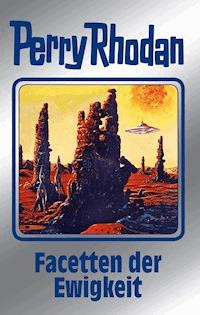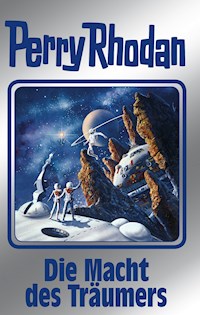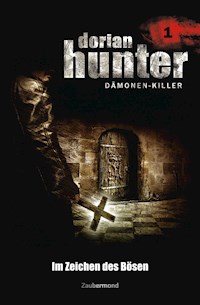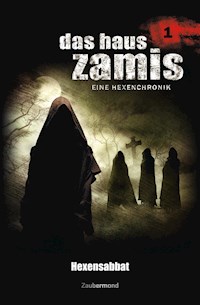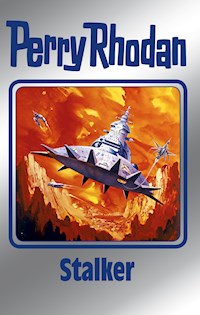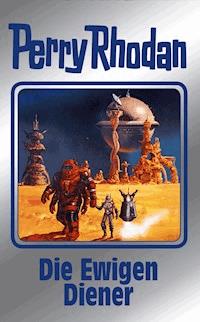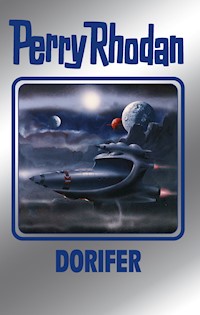1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Dorian Hunter - Horror-Serie
- Sprache: Deutsch
Coco erwachte schweißgebadet. Sie musste befürchten, dass Olivaro ihren Geist überwachte, und deshalb durfte sie nicht einmal an Dorian denken - und noch viel weniger an sein Kind, das in ihr heranwuchs.
Die Hütte, in der sie sich befand, klebte wie ein Adlerhorst am Fels. Es führte nur ein schmaler Pfad von ihr zu zwei anderen Häusern. Als Coco ihn betrat, stieß ein mächtiger Schatten auf sie herab. Über sich erkannte sie den Schädel des Raubvogels, aus dem ein langer, stark nach unten gebogener Schnabel ragte - ein grässliches Mordinstrument. Der Adler schloss seine riesigen Krallen um ihren Unterleib. Er brauchte jetzt nur noch zuzudrücken ...
Coco hat sich offenbart. Sie trägt nicht Olivaros Kind unter dem Herzen, sondern das des Dämonenkillers! Doch so einfach mag das Oberhaupt der Schwarzen Familie seine vermeintliche Gefährtin nicht freigeben. Aus Olivaros Sicht gibt es nur eine Lösung: Hunters Kind muss sterben, bevor es überhaupt geboren wird!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Was bisher geschah
MÖRDER DER LÜFTE
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
mystery-press
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabeder beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Mark Freier
eBook-Produktion:3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 9-783-7325-9798-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Der ehemalige Reporter Dorian Hunter hat sein Leben dem Kampf gegen die Schwarze Familie der Dämonen gewidmet, seit seine Frau Lilian durch eine Begegnung mit ihnen den Verstand verlor. Seine Gegner leben als ehrbare Bürger über den gesamten Erdball verteilt. Nur vereinzelt gelingt es dem »Dämonenkiller«, ihnen die Maske herunterzureißen. Unterstützung in seinem Kampf erhält er zunächst durch den englischen Secret Service, der auf Hunters Wirken hin die Inquisitionsabteilung gründete.
Bald kommt Dorian jedoch seiner eigentlichen Bestimmung auf die Spur: In einem früheren Leben schloss er als französischer Baron Nicolas de Conde einen Pakt mit dem Teufel, der ihm die Unsterblichkeit sicherte. Um für seine Sünden zu büßen, verfasste de Conde den »Hexenhammer« – jenes Buch, das im 16. Jahrhundert zur Grundlage für die Hexenverfolgung wurde. Doch der Inquisition fielen meist Unschuldige zum Opfer; die Dämonen blieben ungeschoren.
Als de Conde selbst der Ketzerei angeklagt und verbrannt wurde, ging seine Seele in den nächsten Körper über. So ging es fort bis in die Gegenwart. Dorian Hunter begreift, dass es seine Aufgabe ist, de Condes Verfehlungen zu sühnen und die Dämonen zu vernichten. Er jagt die Dämonen auf eigene Faust, und als die Erfolge ausbleiben, gerät Trevor Sullivan, der Leiter der Inquisitionsabteilung, unter Druck. Die Abteilung wird aufgelöst.
Hunter bleibt nur sein engstes Umfeld: die junge Hexe Coco Zamis, die früher selbst ein Mitglied der Schwarzen Familie war, bis sie wegen ihrer Liebe zu Dorian den Großteil ihrer magischen Fähigkeiten verlor; weiterhin der Hermaphrodit Phillip, der weder Mann noch Frau ist und dessen hellseherische Fähigkeiten ihn zu einem lebenden Orakel machen – sowie die Ex-Mitarbeiter des Secret Service Marvin Cohen und Donald Chapman. Letzterer wurde bei einer dämonischen Attacke auf Zwergengröße geschrumpft.
Trotz der Rückschläge gelingt es Dorian, Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie, zu vernichten. Doch mit Olivaro steht schon ein Nachfolger bereit, der in der Vergangenheit keinerlei Skrupel hatte, sogar mit Dorian zusammenzuarbeiten, wenn es seinen eigenen Interessen diente.
So hat Olivaro auch Coco Zamis auf seine Seite gezwungen und präsentiert sie während einer Schwarzen Messe auf der griechischen Insel Athos als neue Gefährtin, die sein Kind unter dem Herzen trage. Umso schlimmer trifft ihn Cocos Geständnis: Das Kind stammt von Dorian Hunter! – Dorian, der sich unter die Dämonen geschmuggelt hat, wird Zeuge, wie Olivaro mit Coco entschwindet. Sie hat ihn also nie verraten, sondern nur versucht, ihr gemeinsames Kind vor dem Zugriff der Dämonen zu schützen! Um Coco aufzuspüren, bleibt Dorian nur noch eine Möglichkeit: die Zusammenarbeit mit den Oppositionsdämonen um Demur Alkahest ...
MÖRDER DER LÜFTE
von Ernst Vlcek
Der Dämon schwebte für einen kurzen Augenblick körperlos im Nichts. Er war nur Geist, bestand aus reinen metaphysischen Schwingungen. Ein Gefühl der Leere befiel ihn, Angst, hier für immer von der Unendlichkeit gefangen gehalten zu werden, stieg in ihm auf.
Doch nur für den Bruchteil eines Gedankens, nicht lange genug, um die Angst in Panik zu verwandeln, denn die Körperlosigkeit war nur ein Übergangsstadium. Es war jene Phase, die immer eintrat, wenn er seinen Körper verließ und in den anderen überwechselte, seine schwache menschliche Hülle abstreifte und sie hinter sich ließ wie ein nutzlos gewordenes Gewand.
Die Dunkelheit um ihn wich, dann war das Tageslicht um ihn, und er konnte sehen. Er sah die Welt mit den Augen des Adlers.
Er lebte im Körper des weißen Adlers und spürte die geballte Kraft dieses majestätischen Körpers, die tödliche Macht des gekrümmten Schnabels und der messerscharfen Krallen.
1. Kapitel
Er genoss das Gefühl, Herr der Lüfte zu sein, Beherrscher der mittleren Sierra Madre, König der Berge und des Himmels.
Mit dem Gefühl seiner eigenen Macht und Stärke kam das Bedauern, das er für seine Brüder und Schwestern aus der Schwarzen Familie empfand, die in den Körpern von Menschen dahinvegetieren mussten.
Ja, es war nicht viel mehr als ein Dahinvegetieren. Selbst wenn sie die Fähigkeit besaßen, sich in Wölfe oder andere Tiere zu verwandeln, konnte keiner sich mit ihm vergleichen, der den Körper des weißen Adlers beherrschte.
Wenn er sich in diesem majestätischen gefiederten Wesen manifestierte, hätte er nicht einmal mit dem Fürsten der Finsternis tauschen wollen. Denn sein Reich konnte ihm nicht einmal vom Oberhaupt der Schwarzen Familie streitig gemacht werden.
Er reckte den Adlerkopf und stellte die Nackenfedern leicht auf. Sein Kopf ruckte hin und her, als er den scharfen Blick seiner Augen über den Canyon gleiten ließ.
Den Adleraugen entging nichts, was sich in den schroffen Felsen tat, die sich Hunderte von Metern senkrecht rund um das Tal erhoben. Die unzähligen Raubvögel, die dort nisteten, schienen den stechenden Blick ihres Herrn und Meisters zu spüren. Sie erstarrten in ihren Bewegungen, duckten sich, verstummten.
Die Zeit schien stehen zu bleiben, als der weiße Adler seine mächtigen Schwingen ausbreitete. Sein Hakenschnabel öffnete sich, die Zunge stand steif heraus.
Er gab kein Geräusch von sich. Seinen Körper durchlief ein schwaches Zittern, bevor er sich von der Klippe abstieß und durch die Luft segelte.
Er ließ sich nicht lange treiben, sondern teilte bald die Luft mit trägen, spielerisch anmutenden Bewegungen. Immer rascher stieg er höher, ohne sich jedoch zu vorausgaben. Er besaß noch immer große Kraftreserven, die er kaum je einzusetzen brauchte.
Der weiße Adler hatte keinen ebenbürtigen Gegner.
Er glitt über die höchsten Felserhebungen hinweg und kreiste einige Male über dem Canyon. Die Raubvögel in den Steilwänden waren seine Geschöpfe, aber keines konnte sich mit ihm vergleichen.
Von hier oben wirkten selbst die Viertausender der Sierra Madre klein. Die tiefstehende Sonne des frühen Morgens warf scharfe Schatten in die schroffen, von den urweltlichen Gewalten vergangener Jahrmillionen in den Fels gegrabenen Schluchten.
Diese Berge muteten wie eine tote Landschaft an, wie eine Welt, die noch nicht den Lebensfunken empfangen hatte. Doch das scharfe Auge des Adlers konnte nicht getäuscht werden.
Hier gab es überall Leben, das sich in Löchern und Ritzen verbarg. Der Adler erspähte das ängstlich verborgene Kleintier, aber er stürzte sich nicht darauf.
Das war eine zu leichte Beute für den Herrn der Lüfte. Er suchte sich seine Opfer anderswo.
Mit schneller werdenden Flügelschlägen ließ er das Tal hinter sich, schoss wie ein Pfeil gen Westen, wo die Berge flacher und zugänglicher wurden.
Dorthin verirrten sich nicht selten Menschen. Manche waren Jäger, manche Schatzsucher oder andere Abenteurer.
Früher hatte es hier auch größere Städte gegeben, als Reichtümer geschürft worden waren. Aber viele waren längst verlassen, und nur noch die in den Fels gesprengten Trassen mit Eisenbahnschienen zeugten davon, dass einst sogar bis hierher die Wege der Zivilisation geführt hatten.
Dichte Nebelberge sammelten sich darin wie die Wasser eines Staudammes, stiegen in Schwaden höher und wurden wie Schnee von der Sonne fortgeschmolzen.
Eine dieser Grubenstädte war Real de Contrabandista. Dort lebten noch etwa fünfzig Männer und Frauen, die litten, liebten und hofften ... und von Zeit zu Zeit neues Leben in die Welt setzten.
Diese Siedlung war das Ziel des weißen Adlers.
Real de Contrabandista hätte nach Jimenenz Ortuga benannt sein können, denn er war ein Schmuggler.
Zumindest war er es bis vor drei Jahren gewesen. Doch dann war ihm der Boden an der Küste zu heiß geworden. Da es ihm nicht mehr möglich gewesen war, sich in die Staaten abzusetzen, hatte er sich in die Berge zurückgezogen. Auf der Flucht vor der Polizei und seinen früheren Kumpanen, die sich von ihm geprellt fühlten, war er in Real de Contrabandista gelandet.
Er hatte sofort gemerkt, dass dies der richtige Ort für ihn war, um unterzutauchen. Niemand fragte ihn, woher er kam und was er früher getan hatte, denn die Bewohner dieser aufgelassenen Grubenstadt waren froh, selbst nicht Auskunft über ihre dunkle Vergangenheit geben zu müssen.
Sie hatten, wie Jimenez, zwangsläufig einen Schlussstrich unter ihr früheres Leben gezogen und sich hier eine neue Existenz geschaffen. Doch von einer ›Existenz‹ zu sprechen, war eine maßlose Übertreibung. Aber irgendwie waren alle mit ihrem Leben zufrieden, das zwar primitiv war, aber ruhig verlief.
Es war das Ende der Welt, bis hierher reichte der Arm des Gesetzes nicht. Man brauchte nicht zu befürchten, sein Konterfei auf einem Steckbrief zu erblicken und zuckte auch nicht zusammen, wenn sich einem eine schwere Hand auf die Schulter legte. Denn sie gehörte bestimmt keinem Gesetzeshüter, sondern einem Gleichgesinnten.
Jimenez Ortuga war mit seinem Los zufrieden. Wenn er darüber nachdachte, gelangte er sogar zu der Ansicht, dass er es nicht besser hätte treffen können. Er hatte in Contrabandista ein bescheidenes Glück gefunden, das er nicht gegen sein luxuriöses Schmugglerleben tauschen würde.
Er besaß ein Haus und die schönste unter den verwelkenden Blumen der Siedlung – Rosita. Er wusste so wenig über ihr Vorleben wie sie über das seine, und als sie ihm einmal in einer schwachen Stunde davon erzählen wollte, hatte er ihren Mund mit einem Kuss geschlossen. Das war nicht ohne Folgen geblieben.
Rosita erwartete das Kind, das beide sich wünschten. Dieses Kind war alles, was ihnen zu ihrem Glück gefehlt hatte.
Aber Jimenez fühlte auch, dass das Kind ihr bisheriges Leben ändern würde. Schon an dem Tag, als feststand, dass Rosita schwanger war, hatten sie begonnen, Pläne zu schmieden.
Das Kind musste in einer anderen Umgebung aufwachsen. Es sollte alles vom Leben erwarten dürfen, worauf seine Eltern verzichten mussten. Vielleicht war über die Schmuggelaffäre längst schon Gras gewachsen, und kein Hahn krähte mehr nach Jimenez Ortuga. Der Kleine – Jimenez war sicher, dass es ein Junge sein würde – sollte eine gute Ausbildung bekommen, Geld scheffeln, sich die Welt kaufen und seine Frau unter den schönsten Mädchen der Welt aussuchen können.
Jimenez schreckte aus seinen Gedanken hoch, als er durch die Wände das Stöhnen seiner Frau hörte.
Er krümmte sich auf dem Bett zusammen, verbiss sich in die Decke, als verspüre er selbst den Schmerz der aufkommenden Wehen. Wie lange dauerte es noch? Schon die halbe Nacht lag er hier wach und litt mit seiner Frau. Wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, die Schmerzen der Geburt ganz auf sich zu übertragen, er hätte es getan. Aber so konnte er Rosita nur beistehen, indem er mit ihr litt, sich vorstellte, wie es war, wenn das neue Leben mit elementarer Kraft auszubrechen versuchte, den Schutz des umhüllenden Körpers verlassen und die Bande zum Mutterleib durchtrennen wollte.
Er spürte, wie das Kind sich aus Rositas Körper drängte. Er schrie mit ihr, wenn sie in den Knebel biss, den helfende Hände ihr hinhielten, und er war am Rande einer Ohnmacht, wenn die Kräfte sie zu verlassen drohten.
Rosita wusste das, und es würde beide für immer verbinden. Jimenez glaubte fest daran, dass sein Kind stets die Kraft fühlen würde, die sie in diesen schweren Stunden miteinander verband.
Jimenez starrte mit fiebrigen Blicken zu dem verdunkelten Fenster. Draußen schien die Sonne. Hier drinnen war es Nacht, heiß und schwül. Schweiß und Tränen sättigten die Luft.
Wässrige Schleier zogen über seine Augen. Er versuchte, sich den Augenblick der Geburt vorzustellen. Es musste jeden Augenblick so weit sein. Es gab so etwas wie Telepathie – daran glaubte er voller Überzeugung, und er hörte die Gedanken seiner Frau und die Gedanken des Kindes.
Jetzt?
Eine Wolke schien schnell über den Himmel zu ziehen, denn das verhangene Fensterviereck verdunkelte sich für einen Augenblick noch mehr. Schon war der Schatten vorbei.
Ein Geräusch. Etwas barst. Was? Das Rauschen in seinen Ohren übertönte es. Er hörte alles wie aus weiter Ferne. Einen Schrei, langgezogen und in tiefsten Tönen. Er stimmte darin ein. Jetzt gebar Rosita, und er teilte ihren Schmerz.
Etwas schlug von der anderen Seite gegen die Trennwand. Es hörte sich an, als ob ein Kampf stattfinden würde. Warum war es Rosita nicht gegönnt, eine leichte Geburt zu haben? Warum konnte er ihr die Schmerzen nicht abnehmen?
Viele Stimmen schrien durcheinander. Die Verbindungstür wurde aufgestoßen. Eine der Frauen, die als Geburtshelferinnen bei Rosita geblieben waren, tauchte im Türstock auf. Über ihre Stirn floss Blut. Sie brach wimmernd zusammen.
Durch die offene Tür war ein Gepolter zu hören, ein Flattern wie von kräftigen Flügelschlägen. Und wieder der Schrei, der Schrei einer Mutter. Und der Schrei eines Kindes. Stimmen, die nicht Erlösung von den Schmerzen ausdrückten, sondern von grenzenlosem Leid erfüllt waren. Sie verkündeten nicht die Erschaffung neuen Lebens. Nein, sie kündigten den Tod an. Und das Schlagen der Schwingen klang für Jimenez wie eine mit scharfer Klinge die Luft durchschneidende Sense.
Er brauchte nicht lange zu warten, um zu merken, dass hier etwas nicht stimmte. Benommen kletterte er von seinem Lager, taumelte zur Tür und stolperte über die am Boden kauernde Geburtshelferin.
Als er ins andere Zimmer blickte, sah er zuerst nur seltsam tanzende Schatten. Sie schienen zu wimmern wie Klageweiber. Aber dann blendete ihn die Helligkeit, die durch das offene Fenster fiel. Der Vorhang hing in Fetzen vor den zerbrochenen Fensterscheiben. Und etwas entfleuchte durch dieses Fenster, wie es gekommen sein musste.
Ein Adler. Ein schneeweißer Adler, dessen Gefieder von Blut getränkt war. Vom Blut getränkt war auch das Wochenbett. Rosita lag auf dem Boden, die zuckenden Beine noch halb auf der Lagerstatt, die Hände in Richtung Fenster gestreckt, so als wolle sie zurückholen, was ihr der Raubvogel soeben geraubt hatte.
Jimenez stieg über sie hinweg. Alles um ihn erstarrte zu einer unwirklichen Kulisse. Er sah nur den majestätischen Adler, der steil in den Himmel Mexikos hinaufstieg und in seinen Krallen Jimenez’ Lebensinhalt davontrug.
Jimenez starrte dem Raubvogel nach, bis er hinter den Bergen als winziger Punkt verschwunden war. Noch nie in seinem Leben hatte er sich so hilflos und so verzweifelt gefühlt. Eine ganze Welt stürzte für ihn zusammen.
Aber er resignierte nicht. Er war schon immer ein Kämpfer gewesen. Und er schwor in diesem Augenblick dem weißen Adler Rache. Er wollte nur noch dafür leben.
Die Hütte stand zwischen Schutthalden vor dem Stahlbetonskelett eines im Bau befindlichen Hochhauses. Von außen sah sie aus wie jede andere Bauhütte. Die Wände aus Holzplanken waren etwas aus dem Winkel geraten, das mit Teerpappe bedeckte Dach hing auf der einen Seite etwas tiefer herunter, wie der lahme Flügel eines Vogels. Aus dem einzigen Fenster ragte ein Ofenrohr.
Aus dem Ofenrohr kräuselten sich schwache Rauchschwaden.
Das machte Dorian Hunter etwas misstrauisch, und die Warnungen seines Freundes, nicht zu dem Treffen mit den Dämonen zu gehen, kamen ihm wieder in den Sinn.
Eine geheizte Bauhütte mitten im Juni?
Und eine so primitive Hütte auf dem Bauplatz eines Hochhauses!
Dorian hatte sich erkundigt. Das Hochhaus würde wohl nicht so schnell fertiggestellt werden. Der Bauherr hatte vor Jahren Pleite gemacht, und seit damals stand das Skelett aus Stahlbeton unberührt.
Wollten die Dämonen nicht, dass der Bau voranging? Eigentlich eine müßige Frage, denn sie hatte mit seinem Problem nichts zu tun.
Entschlossen öffnete er die Tür der Hütte und trat ein.
Plötzlich wusste er sofort, dass ihn sein Gefühl nicht getrogen hatte. Mit dieser Bauhütte stimmte irgendetwas nicht. Von außen hatte sie nur eine Länge von fünf Metern. Als er jetzt in ihrem Innern war – die Tür fiel hinter ihm wie von Geisterhand bewegt zu, und Finsternis umgab ihn –, hatte er das Gefühl, sich in einem grenzenlosen Raum zu befinden.
Die Falle war hinter ihm zugeschnappt. Er stand im Banne eines magischen Zaubers.
Er versuchte, die Dunkelheit mit den Augen zu durchdringen. Tatsächlich war ihm nach einer Weile, als könne er umherhuschende Schatten erkennen, die finsterer waren als die ihn umgebende Dunkelheit. Als sich sein Gehör an die tiefe Stille gewöhnt hatte, war ihm, als vernehme er raunende Stimmen, geheimnisvolles Wispern, unverständlich, von nirgendwo und doch von überall her.
»Ist hier jemand?«, rief er, wobei er sich bemühte, seiner Stimme einen festen Klang zu geben. Die Dämonen sollten nicht glauben, dass sie ihm Angst einjagen konnten.
»Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt«, fuhr er fort. Seine Stimme klang in der Dunkelheit verloren, obwohl er laut sprach. »Ich bin allein und unbewaffnet gekommen. Also gebt euch zu erkennen.«
War da nicht ein Lachen? Ein diabolisches, hämisches Lachen? Oder bildete er es sich nur ein?
Als er die Nachricht bekommen hatte, sich hier einzufinden, da vertraute er sich Trevor Sullivan an. Er wollte allein zu dem Treffen gehen, aber er wollte auch, dass zumindest einer seiner Freunde wusste, wohin er sich begeben hatte.
Und Sullivan hatte ihn beschworen, von diesem Treffen abzusehen, weil es sonst leicht geschehen konnte, dass er sich in die Abhängigkeit der Dämonen begab und ihnen seine Seele verschrieb.
Dorian hatte diese Warnung in den Wind geschlagen. Er wollte jedes Risiko eingehen, um an sein Ziel zu kommen. Ihm war kein Preis dafür zu hoch, Olivaro zur Strecke zu bringen und Coco vor ihm zu retten.
Coco, die ein Kind von ihm, den man den Dämonenkiller nannte, erwartete.
Der Dämonenkiller auf dem Wege, einen Part mit den Dämonen zu schließen?
Er sah keinen Grund, den Oppositions-Dämonen zu misstrauen. Er musste nur vermeiden, in ihre Abhängigkeit zu geraten, ihr willenloses Werkzeug zu werden. Er musste sehr auf der Hut sein, wollte er nicht seine Seele verlieren.
»Komm, komm, komm ...«, raunte es geheimnisvoll.