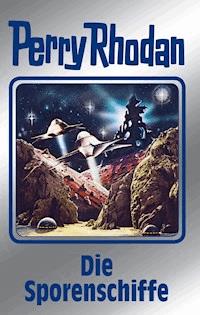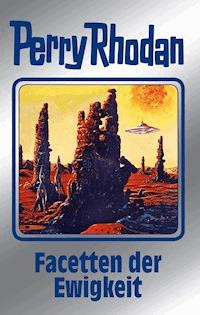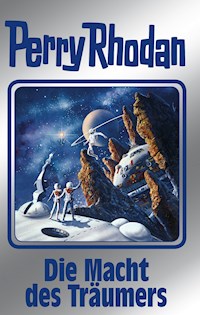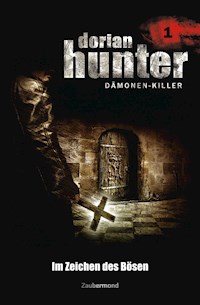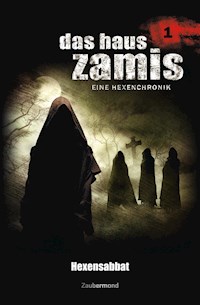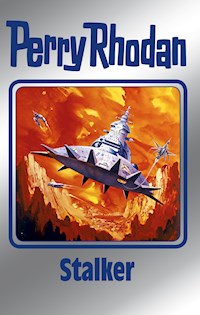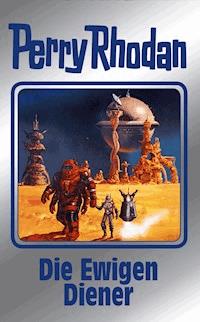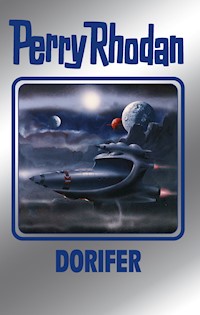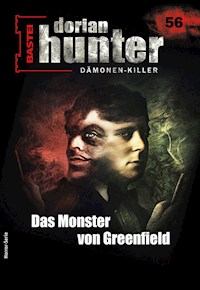
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Dorian Hunter - Horror-Serie
- Sprache: Deutsch
Dorian Hunter macht die Bekanntschaft von Mike »Cleanhead« Hyde, als er ihn am Straßenrand vor einigen Rowdys rettet. Aber der tollpatschige Mann bedankt sich nur widerwillig und behauptet, die Jugendlichen hätten ihn zurecht angegriffen. Was zunächst wie eine merkwürdige Episode wirkt, entwickelt sich schon bald zu einem Fall, in dem Dorian Hunter tatsächlich das Gefühl beschleicht, es mit einem Monster zu tun zu haben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Was bisher geschah
DAS MONSTER VON GREENFIELD
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
mystery-press
Vorschau
BASTEI LÜBBE AG
Vollständige eBook-Ausgabeder beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
© 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Mark Freier
eBook-Produktion:3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 9-783-7517-0457-1
www.bastei.de
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Der ehemalige Reporter Dorian Hunter hat sein Leben dem Kampf gegen die Schwarze Familie der Dämonen gewidmet, seit seine Frau Lilian durch eine Begegnung mit ihnen den Verstand verlor. Seine Gegner leben als ehrbare Bürger über den gesamten Erdball verteilt. Nur vereinzelt gelingt es dem »Dämonenkiller«, ihnen die Maske herunterzureißen. Unterstützung in seinem Kampf erhält er zunächst durch den englischen Secret Service, der auf Hunters Wirken hin die Inquisitionsabteilung gründete.
Bald kommt Dorian seiner eigent¬lichen Bestimmung auf die Spur: In einem früheren Leben schloss er als Baron Nicolas de Conde einen Pakt mit dem Teufel, der ihm die Unsterb¬lichkeit sicherte. Um für seine Sünden zu büßen, verfasste de Conde den »Hexen¬hammer« – jenes Buch, das im 16. Jahrhundert zur Grundlage für die Hexen¬verfolgung wurde. Doch der Inquisition fielen meist Unschuldige zum Opfer; die Dämonen blieben ungeschoren. Als de Conde selbst der Ketzerei angeklagt und verbrannt wurde, ging seine Seele in den nächsten Körper über. So ging es fort bis in die Gegenwart. Dorian Hunter begreift, dass es seine Aufgabe ist, de Condes Verfehlungen zu sühnen und die Dämonen zu vernichten.
In der Folge beginnt Dorian die Dämonen auf eigene Faust zu jagen. Als die Erfolge ausbleiben, gerät Trevor Sullivan, der Leiter der Inquisitionsabteilung, unter Druck. Die Abteilung wird aufgelöst, und Sullivan gründet im Keller der Jugendstilvilla die Agentur Mystery Press, die Nachrichten über dämonische Aktivitäten aus aller Welt sammelt. Hunter bleibt nur sein engstes Umfeld: die junge Hexe Coco Zamis, die selbst ein Mitglied der Schwarzen Familie war, bis sie ¬wegen ihrer Liebe zu Dorian den Großteil ¬ihrer magischen Fähigkeiten verlor; weiterhin der Hermaphrodit Phillip, dessen hellseherische Fähigkeiten ihn zu einem lebenden Orakel machen, sowie ein Ex-Mitarbeiter des Secret Service namens Donald Chapman, der bei einer dämonischen Attacke auf Zwergengröße geschrumpft wurde.
Trotz der Rückschläge gelingt es Dorian, Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen ¬Familie, zu vernichten. Doch mit Olivaro steht schon ein Nachfolger bereit, der die schwangere Coco Zamis zur Rückkehr in die Schwarze Familie zwingt, wo er sie als Trophäe und neue Gefährtin präsentiert. Doch Cocos Kind stammt von Dorian Hunter! Es gelingt Dorian, Coco zu retten, und nach einer Flucht um den halben Erdball bringt sie ihr Kind in London zur Welt. Die Schmach für Olivaro ist zu groß, er muss den Thron räumen. Coco hingegen versteckt das Neugeborene aus Angst vor einem dämonischen Angriff an ¬einem Ort, den sie selbst vor Dorian geheimhält.
In dieser neuen »Normalität« angekommen, macht Dorian die Bekanntschaft von Mike »Cleanhead« Hyde, als er ihn am Straßenrand vor einigen Rowdys rettet. Was zunächst wie eine merkwürdige Episode wirkt, entwickelt sich kurz darauf zu einem Fall für den Dämonenkiller ...
DAS MONSTER VON GREENFIELD
von Ernst Vlcek
Es ist nett, und ich freue mich riesig, dass Sie mich im Gefängnis besuchen kommen, Mr. Hunter, aber verdienen tue ich’s nicht. Ich bin ein Mörder und Sittenstrolch. Die Polizisten haben schon recht, dass sie mich so nennen. Aber glauben tun sie mir wahrscheinlich auch nicht. Warum glaubt mir denn keiner, dass ich ein Mörder bin? Warum hängt man mich nicht? Ich hab’s verdient. Wirklich, Mr. Hunter. Wenn einer an den Galgen gehört, dann ich.
Was ich da am Hals und auf den Armen habe? Blaue Flecke. Ja, ich habe Prügel gekriegt. Aber ich beschwere mich nicht. Sie dürfen das den Polizisten nicht übel nehmen. Es ist ja ganz natürlich, dass sie vor Wut kochen, wenn sie ein Scheusal wie mich vor sich haben und es nicht aufknüpfen dürfen.
Man kann mir nichts beweisen, obwohl ich gestanden habe. Die Ärzte sind misstrauisch. Sie sagen, dass ich die Geständnisse aus Geltungssucht abgelegt habe. Aber das stimmt nicht. Ich will nicht protzen. Ich gestehe doch nur, weil ich das alles nicht mehr ertrage. Solange ich zurückdenken kann, habe ich diese Albträume. Meine Opfer erscheinen mir jede Nacht im Traum.
1. Kapitel
Es ist immer der gleiche Traum. Zuerst ist es finster. Nur die Gesichter von Vater und Mutter sind zu sehen. Sie bieten einen schrecklichen Anblick, obwohl sie zuerst noch leben. Aus ihren Gesichtern spricht Angst.
Anfangs bin ich nur ein unbeteiligter Zuschauer. Ich bin ja noch ein kleines Kind und verstehe das alles nicht so recht, nur die Angst fällt mir bei meinen Eltern auf. Und ich erkenne, dass ich ihren Tod beschlossen habe.
Sie schreien, als Hände aus der Dunkelheit auftauchen, Hände mit langen, blitzenden Dolchen. Der Schein der schwarzen Kerzen spiegelt sich in den Klingen. Und dann stoßen die Hände mit den Dolchen zu. Ich bin noch Zuschauer, obwohl ich weiß, dass ich die Dolche führe. Ma und Pa schreien immer lauter. Die Sehnen der Hände spannen sich, die Adern schwellen an. Und dann wird alles in Blut getaucht, und die Schreie werden so schrill, dass ich sie nicht mehr ertragen kann. Die Münder von Ma und Pa sind weit aufgerissen, die großen erstarrten Augen auf mich gerichtet.
Ich bin froh, als Feuer das ganze Bild auslöscht. So werde ich von dem Anblick meiner toten Eltern, die ich umgebracht habe, erlöst. Aber im Traum bin ich gar nicht erschüttert, sondern will noch mehr Blut sehen. Das Böse ist in mir. Das weiß ich während des Traumes. Ich bin durch und durch böse, wenn ich manchmal auch Zeiten habe, wo ich nicht mal einer Fliege was zuleide tun könnte. Einmal habe ich mich an einem Dorn gestochen, und als das Blut aus meinem Finger quoll, wurde mir ganz schlecht. Ich habe solche Zeiten. Dann wieder kann ich vom Blut nicht genug kriegen – wie in diesem Traum.
Nach meinen Eltern kommt Lord Marbuel dran. Ich kann mich an ihn erinnern. Aber in diesem Traum war er mein Lehrmeister und Gönner. Er hat mir alles Böse dieser Welt beigebracht. Nun glaube ich, dass ich ihn übertreffen kann. Ich bin noch grausamer und bösartiger als er. Deshalb bringe ich ihn um. Nachdem ich über meinen Lehrmeister des Bösen gesiegt habe, bin ich Herr über Leben und Tod.
Dann ist der Traum aus. Ich erwache schweißgebadet in meinem Bett in Tante Annas Haus. Mir ist ganz übel. Durch das offene Fenster weht kalte Luft herein, denn es ist November. Ich bekomme eine Gänsehaut. Die Sonne scheint durchs Oberlicht.
Ihre Strahlen blenden mich.
Ich stehe auf, und da kommt es mir auch schon hoch. Ich zittere und heule und kotze. Dabei torkle ich durchs Zimmer und besudle alles.
Tante Anna kommt händeringend angerannt. Sie muss die Schweinerei aufwischen. Als ich ihr helfen will, sagt sie, dass ich dazu zu tollpatschig sei. Also ziehe ich mich zitternd in eine Ecke zurück.
Tante Anna ist wütend. Ich mache ihr auch wirklich viel Scherereien. Als sie von unten zu mir aufblickt, verändert sich ihr Gesichtsausdruck. Sie seufzt.
»Was ist denn nur los mit dir, Mike? Hattest du schon wieder einen deiner Albträume?«
»Es ist immer der gleiche Albtraum«, sage ich.
Sie wringt das Tuch aus, mit dem sie den Boden aufwischt. »Du solltest dir das alles nicht so zu Herzen nehmen, Mike. Es ist doch nur ein Traum. Vergiss ihn!«
»Wie kann ich denn vergessen, dass ich Ma und Pa umgebracht habe – und all die anderen?«
Da wird sie wieder wütend. Sie knallt den nassen Lappen auf den Boden, stemmt die Hände in die Hüften und kommt auf mich zu. Ich werde in meiner Ecke kleiner und kleiner. Aber als sie bei mir ist, hat sie keine Wut mehr.
»Hör doch endlich damit auf, Mike!«, bittet sie. »Deine Träume haben mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun. Deine Eltern kamen bei einem Autounfall ums Leben. Wie oft soll ich dir das noch sagen?«
»Aber...«
»Es war nur ein Traum.«
»Ja, Tante.«
Sie seufzt wieder. »Wenn sich dein Zustand nicht bald bessert, dann ...«
Sie spricht nicht weiter, aber ich weiß, was sie sagen wollte. Mir wird sofort wieder schlecht.
»Muss ich in eine Anstalt?«, frage ich ängstlich.
»Nein, nein, Mike«, sagt sie schnell. »Solange ich für dich sorgen kann, bleibst du in diesem Haus.«
»Ich muss aufs Klo«, sage ich.
Durch das Klofenster sehe ich in den Garten hinter dem Haus. Im Frühling und Sommer blühen hier viele Blumen. Manche habe ich selbst gesetzt. Die liebe ich besonders. Ich helfe meiner Tante auch oft beim Jäten. Ich darf das Unkraut auf einem Haufen zusammenschichten und anzünden. Das macht Spaß! Aber manchmal habe ich in dem Feuer auch die Gesichter von Ma und Pa gesehen. Das war furchtbar.
Als ich jetzt durchs Klofenster hinausblicke, ist der Garten öd und leer. Na ja, im November. Aber gerade als ich an der Spülung ziehen will, tauchen beim Gartenzaun Angie und Tommy auf. Das sind zwei Nachbarskinder. Geschwister. Ich weiß, dass ihre Mutter, Mrs. Sutherland, ihnen verboten hat, sich mit mir abzugeben. Aber was können die Kinder dafür? Also winke ich ihnen zu.
Sie stecken die Köpfe zusammen und kichern. Dann sehen sie hoch und rufen: »Cleanhead, Cleanhead, fang uns doch!«
Alle nennen mich Cleanhead, weil ich keine Haare habe. Dagegen habe ich nichts. Glatzkopf wäre geschimpft, oder? Cleanhead ist netter, wenn Tante Anna es auch nicht gerne hört. Aber ich weiß, dass es die Kinder nicht böse meinen. Sie sind meine einzigen Freunde. Ich mag Kinder.
»Na wartet!«, rufe ich lachend durchs Fenster. »Ich erwische euch schon.«
Ich renne raus aus dem Klo, ziehe Hose und Jacke über den Pyjama an und flitze aus dem Haus. Die Kinder schreien bei meinem Anblick vor Vergnügen, nehmen aber Reißaus, als ich ihnen nachlaufe.
Nach einigen Metern trennen sie sich. Angie rennt nach links, Tommy nach rechts. Es dauert etwas, bis ich mich für eine der beiden Richtungen entschlossen habe. Ich beschließe, Angie auf den Fersen zu bleiben. Also nichts wie hinter Angie her. Das macht Spaß. Aber als ich sie fast erreicht habe – ich kann zwar nicht besonders schnell laufen, aber schneller als so ein kleines Gör bin ich ja immer noch –, als ich sie einhole und nach ihr greifen will, beginnt sie auf einmal laut zu schreien. Es hört sich so an wie das Schreien meiner Opfer.
Angie hat Angst vor mir, erkenne ich. Ich rufe ihr zu, dass sie sich vor mir doch nicht zu fürchten braucht, weil ja alles nur Spaß ist, aber sie hört mich nicht, schreit nur noch lauter. Mir ist zum Heulen.
Da taucht Mrs. Sutherland auf.
Angie rennt in die Arme ihrer Mutter, schluchzt haltlos.
»Was wolltest du meiner Angie antun?«, schreit Mrs. Sutherland mich an.
Und die Worte sprudeln nur so aus ihrem Mund, ohne dass sie Luft holt.
Ich will ihr erklären, dass alles ganz harmlos war, nur Spaß. Mrs. Sutherland, will ich sagen, ich wollte Angie ganz bestimmt keine Angst einjagen. Und ich weiß selbst nicht, warum sie sich auf einmal zu fürchten begann, Mrs. Sutherland. Aber ich bringe keinen Ton hervor. Mir ist ganz schwindelig, und in meinem Kopf dröhnt und pocht es. Ich höre nicht, was mir Mrs. Sutherland zubrüllt, höre nur den einen Satz: »... werden schon noch dafür sorgen, dass du in eine Irrenanstalt kommst. Denn dort gehörst du hin.«
Auf einmal tauchen weitere Frauen auf, schreien auf mich ein, drohen mir mit den Fäusten. Mrs. Quimbley ist auch darunter, und obwohl sie keine Kinder hat, die sie vor mir beschützen muss, ist sie die Schlimmste von allen.
Mrs. Quimbley verspricht, dass ihr Mann nach diesem Vorfall nun alles tun werde, damit ich endlich dorthin komme, wo ich hingehöre – ins Irrenhaus. Mr. Quimbley hat in Greenfield sehr viel zu sagen, denn er hat viel Geld. Und Mrs. Donaldson ist auch da. Das ist die Mutter von Lisa. Ich habe Angst, dass sie mir die Augen auskratzen will, und hebe die Hände. Das kommt ihr so vor, als wollte ich sie schlagen. Sie schreit noch lauter und droht, dass mich ihr Mann noch windelweich prügeln wird.
Zum Glück taucht dann Tante Anna auf und bringt mich ins Haus. Dort weine ich mich an ihrer Brust aus, und sie redet mir gut zu. Wenn es nach ihr ginge, dann bräuchte ich nicht in eine Anstalt. Aber der mächtige Mr. Quimbley hat mehr zu sagen als sie.
»Dazu lasse ich es nicht kommen«, verspricht sie trotzdem. »Bevor ich dich mir wegnehmen lasse, ziehe ich lieber in einen anderen Ort.«
»Ich schäme mich so, dass ich dir solche Schande mache«, sage ich, als ich wieder reden kann. »Ich bin ein Ungeheuer, ich weiß ...«
Aber das will sie nicht hören und schickt mich auf mein Zimmer. Ich verspreche ihr, dass ich das Haus heute nicht mehr verlassen werde, gehe auf mein Zimmer und versuche zu zeichnen.
Ich kann ganz gut zeichnen. Das sagen auch die Ärzte, die mich behandelt haben. Und ich kann auch ganz gut basteln. Früher, als wir noch woanders wohnten, habe ich meine Weihnachtssterne aus Stroh im Ort verkauft. Aber in Greenfield will sie niemand haben.
Ich versuche also zu zeichnen, aber es macht mir heute keinen Spaß. So setze ich mich ans Fenster und blicke in den Garten hinaus. Wenn Sommer wäre, gäbe es wenigstens mehr zu beobachten, aber so tauchen nur einige Spatzen auf, die von meinen Brotkrumen angelockt werden.
Da steht auf einmal Lisa am Zaun. Lisa ist das schönste Mädchen von der Welt. Eigentlich ist sie ja schon fast eine Frau. Zumindest ist sie bestimmt so alt wie ich.
»Hallo, Cleanhead!«, ruft sie herauf.
»Hallo, Lisa!«, rufe ich zurück.
»Wieso sperrst du dich denn an einem so schönen Tag in deinem Zimmer ein? Wer weiß, wie lange das warme Wetter noch anhält. Viele Sonnentage werden wir nicht mehr haben.«
Mir fällt erst jetzt auf, dass kaum eine Wolke am Himmel ist.
»Ich habe meiner Tante versprochen, nicht aus dem Haus zu gehen«, sage ich.
»Schade!« Lisa macht ein ganz trauriges Gesicht. »Ich habe gedacht, dass du vielleicht Lust hättest, mit mir spazieren zu gehen.«
Lisa ist – sie war ein nettes Mädchen. Ich mochte sie. Sie war nicht so gemein zu mir wie ihre Freundinnen. Aber seit sie mit den Burschen aus Greenfield zum Tanzen ging, hatte sie sich kaum noch mit mir abgegeben. Dann wurde sie die Freundin von Bobby Mason, und der hat mir ganz deutlich gesagt, dass ich Lisa von nun an nicht einmal mehr anschauen dürfte.
»Wenn du ihr zu nahe kommst«, hat er gesagt, »dann schlage ich dich zusammen.«
Daran muss ich denken.
»Mit dir spazieren gehen?«, wiederhole ich. »Aber Bobby will das sicher nicht.«
»Bobby«, sagt sie so abfällig, als würde ihr überhaupt nichts an seiner Meinung liegen. »Ich kann tun, was ich will. Was ist, Cleanhead – willst du mich begleiten oder nicht?«
»Ich will schon, aber ...«
»Hast du etwa vor deiner Tante Angst?«
»Ach wo«, behaupte ich, obwohl ich tatsächlich an Tante Anna denke – und auch an Bobby. Aber vor Lisa möchte ich nicht als Feigling dastehen. Deshalb behaupte ich: »Ich fürchte mich vor niemandem.«
»Na, dann komm schon! Ich warte beim Bach auf dich, damit uns niemand zusammen sieht.«
Sie rennt davon, bevor ich noch etwas sagen kann.
Ich mache die Tür auf, horche, ob ich irgendwo Tante Anna höre. Aus der Küche kommen Geräusche. Sie wird es nicht merken, dass ich fort bin, wenn ich einfach aus dem Fenster springe. Ich schlüpfe nur in meinen Pullover, den schönen, neuen Norwegerpullover, den ich von meiner Tante zum Geburtstag habe. Mehr brauche ich nicht anziehen. Es ist ja ein warmer Tag. Ich springe aus dem Fenster, renne durch den Garten, klettere über den niedrigen Zaun und brauche nur noch den Hang zum Bach hinunterzusteigen.
Lisa erwartet mich und sagt, dass ich nicht besonders sportlich sei, weil ich keuche. Wir gehen in den Wald, in Richtung A 11, der Straße, die nach London führt. Dabei redet Lisa die ganze Zeit über so seltsam. Ob ich denn nie Lust verspürte, mit Mädchen meines Alters allein zu sein? Ich weiß gar nicht, warum ich rot werde und mir so ist, als müsste ich aufs Klo. Sie lacht mich aus und redet in dieser seltsamen Art weiter, so dass ich immer unsicherer werde, weil ich überhaupt nicht weiß, was sie meint. Ich denke, dass es besser wäre, so schnell wie möglich nach Greenfield zurückzukehren, aber als ich Lisa das sage, nimmt sie mich an der Hand und zieht mich mit.
Wir kommen auf eine Lichtung nahe der Straße – und dort steht auf einmal Bobby mit drei Freunden.
»Habe ich es mir doch gedacht, dass ich dich eines Tages mit Lisa erwischen würde, Cleanhead«, sagt er und klopft sich mit einem Gummiknüppel auf die Oberschenkel. Dabei grinst er mich an.
Seine Freunde umringen mich. Lisa rennt zu Bobby und schmiegt sich an ihn. Er legt einen Arm besitzergreifend um ihre Hüfte.
»Aber – Bobby ...«, versuche ich ihm zu erklären.
Da erhalte ich von hinten einen Tritt, dass ich hinfalle. Lisa lacht. Als ich das sehe, denke ich, alles sei nur ein Scherz, und lache mit. Aber da tritt mir Bobby mit dem Schuh ins Gesicht.
»Wie war das denn nun, Baby?«, höre ich ihn dann Lisa fragen. »Wie hat er dich denn in den Wald gelockt?«
Und Lisa sagt: »Er hat was von einem Versteck erzählt, das er mir zeigen wollte. Ich dachte mir nichts dabei, weil ich ihn für harmlos hielt – bis er dann nach mir fasste ...«
»Aber Lisa!«, rufe ich ihr zu. »Das ist doch nicht wahr!«
Irgendjemand gibt mir einen Tritt in die Seite.