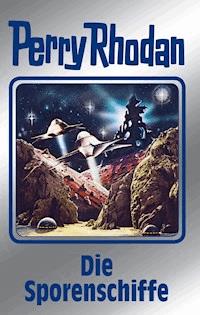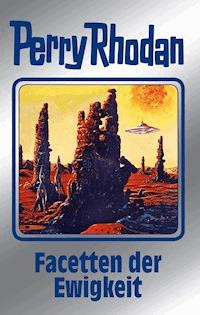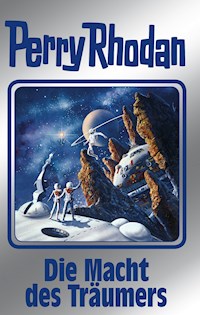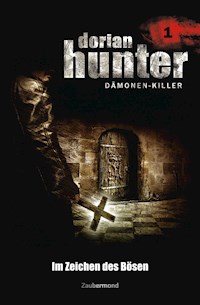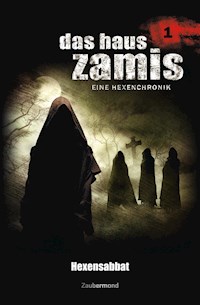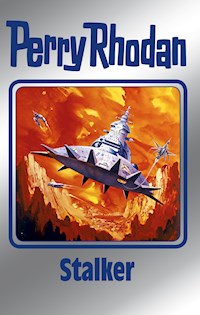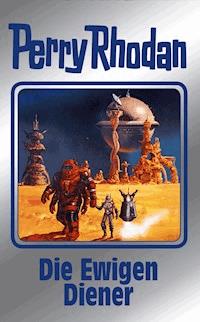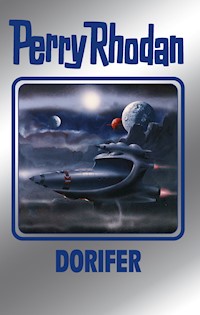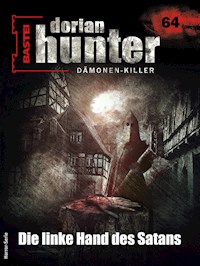
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Dorian Hunter - Horror-Serie
- Sprache: Deutsch
»Ihr edlen Herren, erbarmt Euch meiner! Wenn Euer Herz noch nicht so hart ist wie der Stein unter Euren Füßen, dann habt Mitleid mit mir! Straft mich nicht mit Euerm Hochmut! Hört mir wenigstens zu! Vielleicht findet sich einer, der Gnade für eine Sünderin vor dem Herrn erwirkt. Denn nur vor dem himmlischen Richter fühle ich mich schuldig. Dagegen kann kein weltliches Gericht Recht sprechen, wenn es mich verurteilt. Denn ich bin unbescholten in dieser Welt.«
Ich hörte die flehende Stimme schon von Weitem, noch bevor der Wagen des Händlers, bei dem ich mitfuhr, die Stadtgrenze von Konstanz erreichte. Andere Wagen verstellten die Sicht. Dann trieb ein Hirte ein halbes Dutzend Ziegen über die Straße, so dass wir anhalten mussten.
Warum nur hasst Hekate Dorian so sehr, wo sie ihn doch in seinem Leben als Georg Rudolf Speyer geradezu abgöttisch geliebt hat? Bald erinnert sich Dorian - an jenen Tag, an dem Speyer einst, fünfzig Jahre nach dem Tod des Barons Nicolas de Conde, nach Konstanz zurückgekehrt ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
DIE LINKE HAND DES SATANS
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Der ehemalige Reporter Dorian Hunter hat sein Leben dem Kampf gegen die Schwarze Familie der Dämonen gewidmet, seit seine Frau Lilian durch eine Begegnung mit ihnen den Verstand verlor. Seine Gegner leben als ehrbare Bürger über den gesamten Erdball verteilt. Nur vereinzelt gelingt es dem »Dämonenkiller«, ihnen die Maske herunterzureißen. Unterstützung in seinem Kampf erhält er zunächst durch den englischen Secret Service, der auf Hunters Wirken hin die Inquisitionsabteilung gründete.
Bald kommt Dorian seiner eigentlichen Bestimmung auf die Spur: In einem früheren Leben schloss er als Baron Nicolas de Conde einen Pakt mit dem Teufel, der ihm die Unsterblichkeit sicherte. Um für seine Sünden zu büßen, verfasste de Conde den »Hexenhammer« – jenes Buch, das im 16. Jahrhundert zur Grundlage für die Hexenverfolgung wurde. Doch der Inquisition fielen meist Unschuldige zum Opfer; die Dämonen blieben ungeschoren. Als de Conde selbst der Ketzerei angeklagt und verbrannt wurde, ging seine Seele in den nächsten Körper über. So ging es fort bis in die Gegenwart. Dorian Hunter begreift, dass es seine Aufgabe ist, de Condes Verfehlungen zu sühnen und die Dämonen zu vernichten.
In der Folge beginnt Dorian die Dämonen auf eigene Faust zu jagen. Als die Erfolge ausbleiben, gerät Trevor Sullivan, der Leiter der Inquisitionsabteilung, unter Druck. Die Abteilung wird aufgelöst, und Sullivan gründet im Keller der Jugendstilvilla die Agentur Mystery Press, die Nachrichten über dämonische Aktivitäten aus aller Welt sammelt. Hunter bleibt nur sein engstes Umfeld: die junge Hexe Coco Zamis, die selbst ein Mitglied der Schwarzen Familie war, bis sie wegen ihrer Liebe zu Dorian den Großteil ihrer magischen Fähigkeiten verlor; weiterhin der Hermaphrodit Phillip, dessen hellseherische Fähigkeiten ihn zu einem lebenden Orakel machen, sowie ein Ex-Mitarbeiter des Secret Service namens Donald Chapman, der bei einer dämonischen Attacke auf Zwergengröße geschrumpft wurde.
Trotz der Rückschläge gelingt es Dorian, Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie, zu vernichten. Doch mit Olivaro steht schon ein Nachfolger bereit, der die schwangere Coco Zamis zur Rückkehr in die Schwarze Familie zwingt. Es gelingt Dorian, Coco zu retten. Nach einer Flucht um den halben Erdball bringt sie ihr Kind in London zur Welt, und Olivaro muss den Thron räumen.
Coco versteckt das Neugeborene an einem Ort, den sie selbst vor Dorian geheim hält. Um gedanklich eine Verbindung zu seinem Sohn herstellen zu können, schluckt Dorian die magische Droge Theriak – und versäumt es, rechtzeitig das Gegenmittel Taxin-Theriak einzunehmen. Auf der Suche nach der Droge erhält Dorian den Hinweis auf eine neue Gegnerin namens Hekate, die ihn im Himalaya in eine Falle lockt und offenbart, dass sie sich schon einmal begegnet seien – vor einem halben Jahrtausend, als Dorians Seele noch im Körper des Georg Rudolf Speyer gesteckt habe. Bald darauf gelingt es Dorian, die Gedächtnisbarriere zu überwinden ...
DIE LINKE HAND DES SATANS
von Ernst Vlcek
Vergangenheit
»Ihr edlen Herren, erbarmt Euch meiner! Wenn Euer Herz noch nicht so hart ist wie der Stein unter Euren Füßen, dann habt Mitleid mit mir! Straft mich nicht mit Euerm Hochmut! Hört mir wenigstens zu! Vielleicht findet sich einer, der Gnade für eine Sünderin vor dem Herrn erwirkt. Denn nur vor dem himmlischen Richter fühle ich mich schuldig. Dagegen kann kein weltliches Gericht Recht sprechen, wenn es mich verurteilt. Denn ich bin unbescholten in dieser Welt.«
Ich hörte die flehende Stimme schon von Weitem, noch bevor der Wagen des Händlers, bei dem ich mitfuhr, die Stadtgrenze von Konstanz erreichte. Andere Wagen verstellten die Sicht. Dann trieb ein Hirte ein halbes Dutzend Ziegen über die Straße, so dass wir anhalten mussten.
Der fahrende Händler, ein dicker Schwabe namens Rötter, der mit angeblich echter venezianischer Spitze handelte, fluchte nicht schlecht.
1. Kapitel
Als es endlich wieder weiterging, rückte der Pranger am Stadttor in mein Blickfeld, und ich sah die junge Frau, die die Vorüberkommenden in so verzweifelter Weise anflehte. Niemand schenkte ihr wirklich Beachtung; selbst der Ziegenhirte spie vor ihr aus.
Ich war gewiss der Einzige, der sie genauer anschaute. Zuerst sah ich nur ihren Oberkörper und das Gesicht. Mir fiel gleich auf, dass ihre Augenhöhlen leer waren. Die Brauen fehlten, die Haut ringsum war durch Brandnarben entstellt. Sie musste geblendet worden sein.
Vermutlich war sie nie eine Schönheit gewesen, aber sie wirkte noch sehr jung. Achtzehn Lenze war sie vielleicht. Ihre Grobschlächtigkeit verriet, dass sie seit frühester Kindheit hatte hart zupacken müssen.
Auf einmal sah ich sie in voller Gestalt und zuckte unwillkürlich zusammen. Es waren ihre Beine, die mich entsetzten und mein Mitleid steigerten. Diese Beine wollten nicht zu ihrem übrigen Körper passen. Sie waren dick wie Säulen, so plump und unförmig wie die eines Elefanten, jedes Bein war bestimmt doppelt so schwer wie der übrige Körper. Was für eine erbärmliche, bedauernswerte Missgestalt!
Ich hatte keine Ahnung, wessen man sie beschuldigte. Aber war sie nicht vom Schicksal genug bestraft, so dass man ihr wenigstens den Pranger hätte ersparen können? Neben ihr stand ein Stadtknecht als Wache, der stumpf vor sich hin starrte.
Als Rötters Wagen mit dem Pranger auf gleicher Höhe war, rief ich dem Stadtknecht zu: »Was hat dieses Weib angestellt?«
»Eine Diebin ist sie«, antwortete er knapp. »Ihren eigenen Herrn hat sie bestohlen.«
»O nein!«, rief die Frau am Pranger beteuernd aus und wand sich in den Fesseln. »Ich habe es nicht getan, Herr! Bei allem, was mir heilig ist – beim Leben meiner Mutter –, will ich schwören, dass ich nichts Unrechtes getan habe.«
»Oho!«, sagte der Stadtknecht mit spöttischem Lachen. »Dann nennst du deinen Herrn also einen Lügner?«
»Nicht nur ein Lügner – ein wahrer Teufel ist er!«
Das brachte den sächsischen Händler derart gegen die Frau auf, dass er mit der Pferdepeitsche nach ihr schlug. Ich konnte nicht verhindern, dass er sie traf. Als er jedoch zu einem zweiten Schlag ausholte, konnte ich die Hand mit der Peitsche packen. Der Stadtknecht lachte über diesen Zwischenfall und meinte: »Grollt Euerm Begleiter nicht, Händler! Er hat recht getan. Denn was bliebe für den Henker, wenn jeder an dieser Diebin sein Mütchen kühlen wollte?«
Aus der Stadt näherte sich ein Wagen mit einem Ochsengespann, der von zwei Männern in den Uniformen von Stadtknechten gelenkt wurde.
»Diesmal seid Ihr zu weit gegangen, Speyer«, sagte der dicke Rötter in seinem für mich kaum verständlichen Dialekt. »Statt mir dankbar zu sein, dass ich Euch mitnehme, gefallt Ihr Euch darin, mich ständig zu maßregeln. Ich will es Euch freiheraus sagen: Ihr ward mir ein unangenehmer Weggenosse.«
»Ihr habt mich nicht umsonst mitgenommen«, erwiderte ich wütend, »sondern habt mich um mein letztes Geld erleichtert.«
»Die paar lumpigen Taler!« Er zog am Zügel und machte: »Brrr!«
Die Pferde hielten an. »Wie dem auch sei, ich habe Euch versprochen, Euch bis nach Konstanz mitzunehmen. Jetzt sind wir in Konstanz.«
Mir hätte noch eine entsprechende Entgegnung auf der Zunge gelegen, doch es stand nicht dafür, sie ihm an den Kopf zu werfen. So nahm ich mein Bündel, in dem sich alle meine wenigen Habseligkeiten nebst einer eisernen Geldreserve befanden, und sprang vom Kutschbock. Sollte dieser fette Halsabschneider zum Teufel gehen. Ich blieb am Wegesrand stehen und ließ den Wagen an mir vorbeirollen. Hinter mir hörte ich Geschrei. Der Ochsenkarren mit den Stadtknechten hatte den Pranger erreicht. Sie banden die bedauernswerte Frau los, um sie zum Richtplatz zu bringen. Ich machte, dass ich schnell in die Stadt kam und von all dem nichts mehr sehen musste.
»Zum heiligen khindlein«, las ich auf dem Schild eines Gasthofes. Und sofort erinnerte ich mich daran, dass ich vor über fünfzig Jahren – als Baron de Conde – in einem Gasthof gleichen Namens abgestiegen war. War es derselbe Gasthof? Er kam mir völlig verändert vor. Aber vielleicht spielte mir mein Gedächtnis einen Streich. Fünfzig Jahre waren eine lange Zeit – insbesondere, wenn die Seele unruhig von Körper zu Körper gewandert war. Als Georg Rudolf Speyer sah ich die Dinge mit ganz anderen Augen. Heute wusste ich, dass man mit den Mitteln der Inquisition keine Dämonen bekämpfen konnte, denn die Inquisition war ein Werkzeug der Dämonen. In den Kerkern und Folterkammern schmachteten Unschuldige, und auf den Scheiterhaufen brannten nicht die Schwarzblütigen, sondern deren Opfer. Das alles hatte ich schon gewusst, bevor es mich in die Neue Welt verschlug. Konnte ich so naiv sein und glauben, dass sich in den sieben Jahren meiner Abwesenheit an diesen Zuständen etwas geändert hatte?
Ich dachte, das Leben in der Neuen Welt hätte mich abgehärtet, nachdem ich miterlebte, wie grausam die spanischen Konquistadoren gegen die Indianer vorgegangen waren. Sie hatten sie so lange gejagt und ihrer Schätze beraubt, bis sie praktisch ausgerottet und die wenigen Überlebenden völlig verarmt gewesen waren. Ich war Augenzeuge unbeschreiblicher Gräueltaten geworden. Kein Wunder, dass ich mich nach Europa zurückgesehnt hatte. Doch kaum hatte ich meinen Fuß auf den alten Kontinent gesetzt, da war mir klar geworden, dass die Menschen des Abendlandes zu sich selbst nicht weniger grausam und barbarisch waren als gegen die Indianer.
Europa fieberte im Hexenwahn.
Die vergangenen sieben Jahre hatten keine Besserung gebracht; es war eher nur noch schlimmer geworden. Was trieb mich nun gerade nach Konstanz, dem Ort meiner größten Niederlage im Kampf gegen die Dämonen – wo ich als Baron de Conde vor fünfzig Jahren durch das Urteil der Inquisition den Tod gefunden hatte? Mein Besuch hier hatte nichts mit der Vergangenheit zu tun, sondern hing nur mit der Sorge um die Gegenwart und die Zukunft zusammen. Ich verfolgte die Spur von Alraune, jenem geheimnisvollen Geschöpf, das durch das Wirken des Magisters Arrabell aus einer Mandragora entstanden war. Alraune, das Mädchen, das nicht geboren worden war, sondern durch magische Kräfte aus einer Pflanze zu einem Wesen aus Fleisch und Blut gewachsen war. War sie denn nun schon ein vollwertiges Lebewesen?
Körperlich wohl, das ganz sicher; sie hatte einen geradezu vollkommenen Körper, doch geistig war sie noch unfertig – ihre Persönlichkeit war noch nicht ausgereift. Aber in Alraune schlummerten Fähigkeiten, die nur geweckt zu werden brauchten, so dass sie innerhalb kürzester Zeit auch geistig erblühen konnte. Was alles in ihr steckte, konnte ich nur erahnen. Ich wusste nur, dass es sich um geballte übernatürliche Kräfte handelte.
Ich hatte miterlebt, wie Alraune Männern der Schiffsbesatzung der Torquemada das Leben aus den Leibern saugte, um sich selbst zu stärken. Und dann wieder – als wir in einem Rettungsboot auf dem offenen Meer trieben – hatte sie mir ihre Lebenssäfte eingeflößt, um mich am Leben zu erhalten. War sie nun eine Dämonin oder ein Engel? In meinen Augen war sie keines von beidem. Sie stand in der Mitte – war eben noch unausgegoren. Ihre weitere Entwicklung würde von den äußeren Einflüssen abhängen. Deshalb suchte ich sie. Ich wollte, dass sie keinen schlechten Umgang bekam und nicht in die falschen Hände geriet. Denn je nachdem, wer sie beeinflusste, konnte sie eine Dämonin oder ein Engel werden. Noch war es nicht zu spät.
Dennoch erschauerte ich bei dem Gedanken, was Alraune inzwischen alles angestellt haben könnte. Als unser Rettungsboot von einer spanischen Karavelle aufgefischt wurde, war ich selbst nicht mehr bei Sinnen gewesen. Ich konnte erst wieder klar denken, als ich an Land war – und da fehlte von Alraune bereits jede Spur. Sie war fort, und ich begann mit der mühsamen Suche nach ihr, die mich schließlich nach Konstanz brachte. In ein Konstanz, das sich äußerlich stark verändert hatte, seit vor fünfzig Jahren Baron de Conde auf dem Scheiterhaufen verbrannte. In ein Konstanz, wo man aber heute noch wie damals als Unschuldiger ein Opfer der Inquisition werden konnte.
Ich war so in meine Gedanken versunken gewesen, dass ich gar nicht bemerkte, wohin mein Schritt mich lenkte.
»Platz da! Macht Platz! Nur nicht drängen! Es bekommt jeder was zu sehen.«
Ich schreckte hoch, als hinter mir Räder ratterten, drehte mich um und sah den Wagen mit dem Ochsengespann. Auf dem Kutschbock saß einer der Stadtknechte. Die beiden anderen gingen zu Fuß, flankierten ihn links und rechts. Auf dem strohbedeckten Boden des Leiterwagens kauerte die Frau mit den Elefantenbeinen: Sie hielt die Sprossen umkrampft, um nicht umzufallen. Ihre leeren, schwarzen Augenhöhlen erschienen mir auf einmal riesig groß. Die Leute warfen mit faulem Obst und Steinen nach ihr. Es war abstoßend, entwürdigend. Plötzlich vernahm ich unter all dem Geschrei und Gejohle eine leise und ängstliche Stimme ganz nahe hinter mir.
»Man darf das doch nicht zulassen! Tut denn niemand etwas dagegen?«
Ich drehte mich um. Da stand Alraune.
Ich starrte sie an. Sie erwiderte meinen Blick mit verschleierten Augen. Um ihren Mund spielte kurz ein unsicheres Lächeln. Dann weiteten sich ihre Augen vor Entsetzen und Staunen, als könnte sie nicht begreifen, und ihr Blick wanderte wieder an mir vorbei, zu der Szene in meinem Rücken. Ihre eine Hand hob sich, legte sich auf meinen Umhang, und langsam schlossen sich ihre grazilen Finger um meinen Kragen, verkrallten sich in dem Stoff, so als müsste sie Halt suchen.
»Alraune«, flüsterte ich.
»Ist es nicht schrecklich?«, fragte sie.
Ich wusste, dass sie auf den Wagen starrte, der die Geblendete zum Richtplatz brachte.
»Was wird mit dem armen Ding geschehen?«, fragte sie ahnungsvoll. »Kann man ihr nicht helfen?«
»Alraune!«
Ihr Blick richtete sich wieder auf mich, und wieder zeigte sie das unsichere, schüchterne Lächeln. »Nenne mich Gretchen! Diesen Namen hat man mir gegeben.«
»Warum Gretchen?«
»Warum nicht?«
»Wo – wo warst du die ganze Zeit über?«
»Ich habe nach dir gesucht, Georg. Und nun habe ich dich gefunden. Ich – ich bin froh.«
Ich fasste nach ihrer Hand und drückte sie. Die Hand war kalt. Ich dachte kurz daran, dass dies für manchen die Kälte des Todes sein konnte, und erschrak über mich selbst, als ich mich fragte, wie vielen Männern sie in der Zwischenzeit den Tod gebracht haben mochte, um sich selbst am Leben zu erhalten. Ich forschte in ihrem Gesicht. Es war ausgeprägter, als ich es in Erinnerung hatte. Nicht mehr so masken-, so puppenhaft. Anzeichen einer sich entwickelnden Persönlichkeit waren darin zu sehen. Um ihre Mundwinkel hatten sich leichte Furchen eingeprägt. Spuren der ersten Enttäuschungen?
»Wie ist es dir ergangen ... seit unserer Trennung, Alraune?«
»Sage Gretchen zu mir!«, bat sie wieder, ohne mich anzusehen. »Ich musste erfahren, dass der Name Alraune für die Menschen dieses Landes eine oft gar furchtbare Bedeutung hat. Ach, Georg, ich bin's zufrieden. Aber was wird aus dem armen Ding auf dem Wagen? Wenn meine Ahnungen stimmen ... Es wäre schrecklich, Georg.«
Obwohl wir leise gesprochen hatten, mussten wir die Aufmerksamkeit eines der Umstehenden erweckt haben. Es war ein kleiner, grobschlächtiger betagter Mann, der einen runden Rücken hatte und lange, fast bis zum Boden reichende Arme. Er öffnete seinen fast zahnlosen Mund und lachte, wobei er den Speichel schlürfend einsog.
»Es ist keine große Kunst, zu ahnen, was mit der Diebin geschieht«, meinte er. »Sie hat mit der linken Hand gestohlen. Also ...«
»Haltet den Mund!«, fuhr ich ihn an, als ich sah, wie Alraune blass wurde und zu zittern begann. »Seht ihr nicht, wie sehr sich diese Dame entsetzt?«
»Na, dann soll sie zu Hause am warmen Kamin bleiben«, meinte der Fremde spöttisch, der mir einen sehr heruntergekommenen Eindruck machte und mir als Gesprächspartner äußerst unlieb war. Doch Alraune fand nichts dabei, sich mit ihm zu unterhalten.
»Was hat dieses Weib angestellt?«, verlangte sie zu wissen. »Was hat sie gestohlen? Wen hat sie bestohlen?«
Der Mann kicherte. »Der Henker wird nicht viel Federlesen machen, denn er bekommt diesmal bloß einen Taler. Aber ihr wollt ja hören, was diese Diebin verbrochen hat. Seht ihr den Edelmann in Schwarz? Er sitzt zur Rechten des Richters in der Ehrenloge.«
Alraune reckte den Hals. Ich brauchte mich nicht groß anzustrengen, um den bezeichneten Edelmann zu erblicken. Der machte mir in seiner protzigen und düsteren Pracht allerdings mehr den Eindruck eines Räuberhauptmanns. Er war ganz in schwarzes Leder gekleidet, und auf seinem fettigen, schmutzigen Gewand spiegelten sich ornamentartige geschmiedete Eisenbeschläge. Er trug einen Helm – ebenfalls aus Leder und Eisen – mit einem roten Federbusch darauf. Sein Gesicht war knochig. Er hatte stark hervortretende Backenknochen und eine gebogene, hervorspringende Nase, die einen schmalen, fast klingenscharfen Rücken hatte und unten breit in flatternden Nasenflügeln endete. Dazu trug er einen Spitzbart nach der Art spanischer Edelleute. Seine Brauen waren dicht und außen nach oben geschwungen, so dass sie, weil sie sich an der Nasenwurzel trafen, ein V bildeten. Seine Augen, deren Blick starr und bannend war wie der eines Raubvogels, glühten vor Bösartigkeit.
»Das ist der Burgherr Ambrosius von Graucht«, erklärte der Fremde. »Die Beschuldigte ist seine Magd, die die Güte ihres Herrn damit belohnte, dass sie seinen Siegelring stahl. Wie gesagt – mit der linken Hand.«
»Wie könnt Ihr im Zusammenhang mit diesem Mann von Güte sprechen?«, erregte ich mich. »Er dünkt mir eher wie ein Scheusal, wenn er seine eigene Magd auf den Richtblock schickt.«