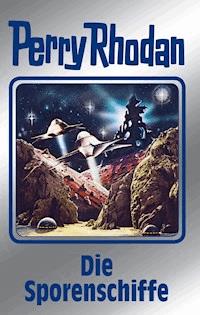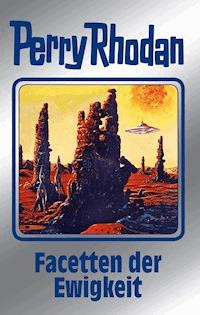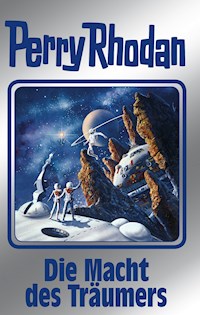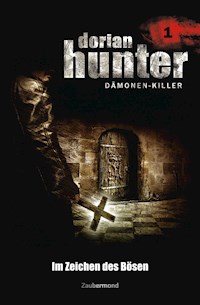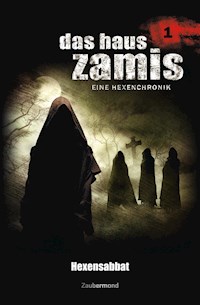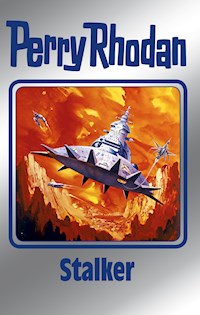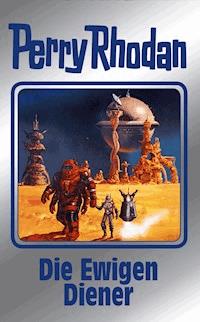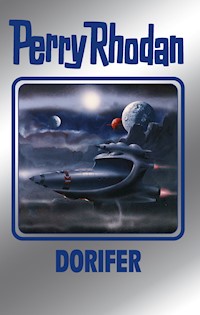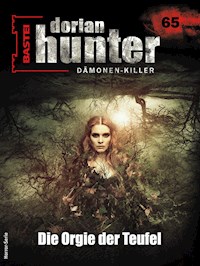
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Dorian Hunter - Horror-Serie
- Sprache: Deutsch
Der Großmeister Thomas Becker blies fünf der sechs Lichter aus. »Schließe dich, Auge ... höre nichts, Ohr ... sprich nicht, Mund ... entziehe dich den Gerüchen und fühle nicht.« Er ließ nur eine einzige Flamme brennen und sagte dazu: »Öffne dich, Sinn aller Sinne. - Wir rufen dich, Geist, der du auf unseren Anruf wartest, in der Ewigkeit ...«
Da fühlte sich Dorian auf einmal so leicht, als schwebe er ... Er entfernte sich von dem gläsernen Tisch und den sechs Männern, die an ihm saßen.
Aber wieso sechs? Ohne ihn waren es doch nur fünf!
Dorians Herz setzte für einen Moment aus, als er in einem der Männer sich selbst erkannte. Er hatte seinen eigenen Körper verlassen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
DIE ORGIE DER TEUFEL
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Der ehemalige Reporter Dorian Hunter hat sein Leben dem Kampf gegen die Schwarze Familie der Dämonen gewidmet, seit seine Frau Lilian durch eine Begegnung mit ihnen den Verstand verlor. Seine Gegner leben als ehrbare Bürger über den gesamten Erdball verteilt. Nur vereinzelt gelingt es dem »Dämonenkiller«, ihnen die Maske herunterzureißen. Unterstützung in seinem Kampf erhält er zunächst durch den englischen Secret Service, der auf Hunters Wirken hin die Inquisitionsabteilung gründete.
Bald kommt Dorian seiner eigentlichen Bestimmung auf die Spur: In einem früheren Leben schloss er als Baron Nicolas de Conde einen Pakt mit dem Teufel, der ihm die Unsterblichkeit sicherte. Um für seine Sünden zu büßen, verfasste de Conde den »Hexenhammer« – jenes Buch, das im 16. Jahrhundert zur Grundlage für die Hexenverfolgung wurde. Doch der Inquisition fielen meist Unschuldige zum Opfer; die Dämonen blieben ungeschoren. Als de Conde selbst der Ketzerei angeklagt und verbrannt wurde, ging seine Seele in den nächsten Körper über. So ging es fort bis in die Gegenwart. Dorian Hunter begreift, dass es seine Aufgabe ist, de Condes Verfehlungen zu sühnen und die Dämonen zu vernichten.
In der Folge beginnt Dorian die Dämonen auf eigene Faust zu jagen. Als die Erfolge ausbleiben, gerät Trevor Sullivan, der Leiter der Inquisitionsabteilung, unter Druck. Die Abteilung wird aufgelöst, und Sullivan gründet im Keller der Jugendstilvilla die Agentur Mystery Press, die Nachrichten über dämonische Aktivitäten aus aller Welt sammelt. Hunter bleibt nur sein engstes Umfeld: die junge Hexe Coco Zamis, die selbst ein Mitglied der Schwarzen Familie war, bis sie wegen ihrer Liebe zu Dorian den Großteil ihrer magischen Fähigkeiten verlor; weiterhin der Hermaphrodit Phillip, dessen hellseherische Fähigkeiten ihn zu einem lebenden Orakel machen, sowie ein Ex-Mitarbeiter des Secret Service namens Donald Chapman, der bei einer dämonischen Attacke auf Zwergengröße geschrumpft wurde.
Trotz der Rückschläge gelingt es Dorian, Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie, zu vernichten. Doch mit Olivaro steht schon ein Nachfolger bereit, der die schwangere Coco Zamis zur Rückkehr in die Schwarze Familie zwingt. Es gelingt Dorian, Coco zu retten. Nach einer Flucht um den halben Erdball bringt sie ihr Kind in London zur Welt, und Olivaro muss den Thron räumen.
Coco versteckt das Neugeborene an einem Ort, den sie selbst vor Dorian geheimhält – und ihre Vorsicht ist berechtigt, da bald eine neue, »alte« Gegnerin auf sich aufmerksam macht: Hekate, die Dorian einst in seinem Leben als Georg Rudolf Speyer liebte, die nun aber zu seiner Todfeindin geworden ist. Hekates Hass erscheint Dorian nach wie vor rätselhaft. Einst hatten sie sich ewige Liebe geschworen, bevor Georg sich sogar von Hekate töten ließ, um Mephisto zu entkommen. In der Gegenwart allerdings lockt Hekate Dorian in eine Falle – in ein unheimliches Reich außerhalb der Wirklichkeit, um ihr teuflisches Werk zu vollenden ...
DIE ORGIE DER TEUFEL
von Ernst Vlcek
Der Dämon saß immer noch im Affenbrotbaum.
Er ließ sich weder durch das Stakkato der Trommeln noch durch die herausfordernden Gebärden der Tänzer und die Beschwörungen des Medizinmanns verjagen. Der junge Ewe Bhawa hatte den Baum zufällig entdeckt. Sein Anblick hatte ihn dermaßen erschreckt, dass er sofort den Medizinmann verständigt hatte. Und dieser hatte an der ungewöhnlichen Form des Baumes sofort erkannt, dass in ihm ein furchtbarer Dämon nistete: ein tro!
Jetzt, im Licht der untergehenden Sonne, wirkte der Affenbrotbaum noch bedrohlicher. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Dämon nicht daran dachte, ihn zu verlassen. Aber er musste vertrieben werden, wollte man vermeiden, dass er furchtbares Unheil über den ganzen Stamm brachte. Die Bewegungen der Tänzer wurden immer schneller, ihre Gebärden und Schreie herausfordernder. Einige brachen vor Erschöpfung zusammen und blieben mit verschwitzten zuckenden Körpern liegen. Sie wurden von ausgeruhten Stammesangehörigen abgelöst. Der Tanz durfte nicht einen Augenblick unterbrochen werden, denn das hätte der tro als Schwäche angesehen.
1. Kapitel
Der Medizinmann hatte seinen größten Zauber angewandt – doch der tro ließ sich auch davon nicht verjagen. Da gab der Medizinmann Bhawa das Zeichen, und der junge Ewe betrat in vollem Kriegsschmuck den Kreis der Tänzer. Die Stammesnarben an seinem kraftvollen Körper waren noch frisch, denn der Initiationsritus hatte erst vor wenigen Tagen stattgefunden. Dennoch ruhten nun die Hoffnungen des ganzen Stammes auf ihm. Er hatte den Dämonenbaum entdeckt, und deshalb stand er mit dem tro in besonderer Beziehung.
Schon als sich Bhawa mit den ersten Tanzschritten dem Affenbrotbaum näherte, spürte er, dass er es hier mit einem überaus mächtigen und bösartigen tro zu tun hatte. Er würde sich mit keinem geringen Opfer zufriedengeben. Vielleicht wollte er sogar Bhawas Leben. Der junge Ewe nahm die Herausforderung des Baumes an. Er ging zum Angriff über, stieß schrille Schreie aus, die den tro reizen sollten, und richtete drohend seinen Speer gegen ihn. Da begann der Dämon im Baum zu heulen und rascheln. Ein Windstoß fuhr in die Reihen der Tänzer, wirbelte sie durcheinander und riss den Medizinmann von den Beinen. Nur Bhawa blieb hoch aufgerichtet stehen. Doch als er schon triumphieren wollte, schlug etwas wie ein Blitz in seinem Körper ein. Es war der tro! Bhawa erstarrte. Schwärze senkte sich über ihn. Die Sonne erstarb, und der Affenbrotbaum wurde von der Dunkelheit verschluckt. Der junge Ewe hielt sich noch immer tapfer auf den Beinen.
Aber er war allein.
Im Nichts.
Langsam lichtete sich das Dunkel und zeigte ihm eine fremde Umgebung.
Zur selben Zeit setzte sich in London der Vertreter Laurence Wytton in den Sessel eines Augenarztes. Es war nach Greenwich mean time – ebenso wie in Togo – Punkt neunzehn Uhr, als der Augenarzt die Bemerkung machte, dass Wytton sein letzter Patient sei. Laurence Wytton hatte plötzlich ein unerklärliches Gefühl der Beklemmung, als es in der Praxis dunkel wurde und die kleine Taschenlampe des Arztes die einzige Lichtquelle war. Panik ergriff ihn. Er konnte nicht sagen, was der Anlass war, aber es schien ihm, als stürze er in einen bodenlosen Abgrund.
»Na, na, na«, tadelte der Augenarzt. »Wer wird denn gleich ... Öffnen Sie die Augen weit, Mr. Wytton. Noch weiter ... Ich träufle Ihnen jetzt eine Flüssigkeit in die Augen, die Ihre Pupille weitet. Das spüren Sie nicht einmal.«
Laurence Wyttons Augen öffneten sich tatsächlich weit, als er die Pipette mit dem Tropfen glasklarer Flüssigkeit auf sich zukommen sah.
»So ist es recht, Mr. Wytton.«
Aber seine Augen weiteten sich vor Angst. Er dachte mit Schrecken daran, was geschehen würde, wenn der Augenarzt die harmlose Flüssigkeit gegen eine Säure ausgetauscht hätte.
Wie kindisch von ihm. Narr!, schalt er sich. Aber das verringerte seine Angst nicht. Im Gegenteil – er bäumte sich auf, als sich ein Tropfen von der Pipette löste. Er sah ihn langsam, wie in Zeitlupe, auf sein Auge niedersinken, ihn größer und immer größer werden ... Und dann kam der Aufprall, und es brannte wie Feuer, und er glaubte von einer Flut hinweggespült zu werden, und er wurde in einem wirbelnden Strudel hinabgerissen, und er schrie vor Schmerz und schloss die brennenden Augen und machte mit Armen und Beinen rudernde Bewegungen, um irgendwo einen Halt zu finden.
Ich bin blind!, dachte er entsetzt.
Endlich stießen seine Hände auf Widerstand. Er hatte Boden unter den Füßen. Wo war er? Gerade hatte er sich noch in der Praxis des Augenarztes befunden – und jetzt tasteten seine Hände über nasskalten rissigen Fels.
Neunzehn Uhr in London – Punkt 14 Uhr in New York.
Claire Douglas registrierte es geistesabwesend, als sie auf die Uhr über dem Lift blickte, die die Uhrzeit aller größeren Weltstädte angab. Ungeduldig wartete sie, bis sich die Lifttür öffnete.
Die Kabine war leer. Wo war der Fahrstuhlführer?
Sie zuckte die Schultern. Auch Liftboys waren nur Menschen, die gelegentlich ihren Bedürfnissen nachgeben mussten. Sie drückte die Taste für das dreiunddreißigste Stockwerk. Die Schiebetüren schlossen sich, und der Aufzug setzte sich ohne jeden Ruck nach oben in Bewegung. Wie seltsam, ganz allein in einer so großen Liftkabine zu fahren. Soweit sie sich erinnern konnte, hatte sie das bisher noch nie erlebt. Sonst herrschte in den Liften des American West Building immer dichtes Gedränge. Claire hatte es trotz ihrer dreiundzwanzig Jahre bereits zur Chefsekretärin gebracht. Und das keineswegs wegen ihres guten Aussehens. Sie war einfach tüchtig. Sie hatte einen nüchternen Verstand, der logisch arbeitete, und sie war alles andere als abergläubisch.
Aber jetzt, während sie ganz allein in der Liftkabine zum 33. Stock hinauffuhr, beschlich sie ein eigenartiges Gefühl. Sie wusste, dass etwas Derartiges während der Bürostunden noch nie vorgefallen war. Das Ausbleiben des Fahrstuhlführers und anderer Menschen war ein eigenartiges Zusammentreffen. Und auf einmal wusste sie, dass das kein Zufall sein konnte. Irgendetwas stimmte nicht. Und der Lift fuhr so langsam. Sie hätte längst schon am Ziel sein müssen. Sie fühlte sich in der großen Kabine auf einmal eingeengt. Gefangen wie ein Tier im Käfig. Sie wollte hinaus! Ein Krachen und Knirschen erschütterte die Kabine. Claire wurde gegen eine Wand geschleudert. Aus der Steuerungskonsole zuckte ein Blitz.
Die Tasten flogen wie Geschosse durch die Kabine. Die Wände beulten sich aus und bekamen lange Risse, und ein lang gezogenes schrilles Geräusch betäubte sie fast. Metall und Kunststoff verkeilten sich ineinander. Dichte Rauchschwaden drangen von allen Seiten in den Lift und legten sich schwer auf Claires Atemwege. Sie schaffte es gerade noch, aus ihrer Tasche ein Tuch zu reißen und es sich vor Mund und Nase zu halten, bevor der Qualm sie endgültig einhüllte.
Das Denken fiel ihr immer schwerer. Alles begann sich um sie zu drehen. Sie glaubte noch zu spüren, dass der Lift mit einem letzten Ruck anhielt, bevor sie das Bewusstsein verlor und in einem Schlund aus Glut und Schwärze versank.
Das ist der Tod!, dachte sie.
»Einen ungünstigeren Zeitpunkt haben Sie sich wohl nicht aussuchen können«, knurrte Jakob Ehrlich missmutig. Er warf dem Mann einen giftigen Blick zu, der ihn vor einer Viertelstunde aus dem Bett geläutet hatte. Jetzt war es gleich fünf Uhr morgens. Den Besucher rührte das nicht. Er wirkte gelassen und keineswegs so unausgeschlafen wie Jakob Ehrlich.
»Hätte das nicht Zeit gehabt, bis ich den Laden aufmache?«, fragte Jakob, als er den Besucher in sein Antiquitätengeschäft führte.
»Nein«, sagte der Fremde.
Jakob ließ eine Jalousie hoch, so dass die ersten Strahlen des neuen Tages durchs Fenster fielen. Der Antiquitätenhändler war vor zehn Jahren von Deutschland nach Australien ausgewandert, und sein kleines Geschäft in Sydney hatte ihm zu einem bescheidenen Wohlstand verholfen. Nicht zuletzt deshalb, weil er für seine Kunden und Geschäftspartner jederzeit zu sprechen war.
Seine besten Geschäfte hatte er zu den ungewöhnlichsten Zeiten und unter seltsamsten Bedingungen gemacht. Er war auch diesmal seinem Grundsatz treu geblieben, dass Geschäft allem anderen vorging. Und deshalb hatte er den Fremden nicht abgewiesen, der ein seltenes Stück anzubieten hatte und von einem Notverkauf sprach.
»Also zeigen Sie her!«, verlangte Jakob.
Er blickte dem Fremden zum ersten Mal ins Gesicht – es war nichts sagend, alltäglich. Ein Dutzendgesicht.
Jakob blickte auf die Hand des Fremden, als diese in einer ledernen Handtasche verschwand. Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis die Hand wieder zum Vorschein kam.
Der Antiquitätenhändler wollte schon ungeduldig werden. Da tauchte die Hand auf. Sie kam blitzschnell auf ihn zugeschossen – so schnell, dass er nicht einmal Zeit fand, zurückzuweichen – und erstarrte dicht vor seinen Augen. Die Finger der Faust öffneten sich, und Jakob blickte auf einen seltsamen Gegenstand, eine Art Amulett oder Talisman aus Stein oder Metall. Er war sich da nicht sicher.
Was ist das?, wollte er fragen. Aber er kam nicht mehr dazu, die Worte auszusprechen. Als er die Hand nach dem seltsamen Gegenstand ausstreckte, begann dieser auf einmal zu glühen und explodierte.
Die Explosion fand völlig lautlos statt – oder aber der Knall zerriss Jakob das Trommelfell, so dass er sofort taub wurde. Der Explosionsblitz war so grell, dass er überdies geblendet war. Er stützte sich an einer Vitrine ab, verlor den Halt und taumelte blind durch sein Geschäft, ohne gegen etwas zu stoßen. Endlich berührten seine Hände ein Hindernis, doch es fühlte sich wie nasskalter Fels an. Und als schließlich auch die Blendung wich und seine Augen ihre Sehkraft wiedererhielten, da war ihm, als befände er sich in einer Höhle.
Wo aber war er wirklich?
Nach mitteleuropäischer Zeit war es zwanzig Uhr.
Zu diesem Zeitpunkt sollte die Aktion in der Düsseldorfer Avantgarde-Galerie Plus Ultra beginnen. Die engen Räume der Galerie waren bereits zum Bersten gefüllt, als endlich der Mann eintraf, dem das Interesse an diesem Abend galt: der Aktionskünstler Herbert Ohm. Der mittelgroße bärtige Beuys-Schüler galt bei den Insidern als Geheimtipp, und niemand zweifelte daran, dass internationale Erfolge nur noch eine Frage der Zeit waren.
Herbert Ohm hörte sich solche Prognosen eher gelassen an, ebenso wie ihn die Ovationen kaltließen, die man ihm bei seinem Eintreffen darbot. Mit unverbindlichem, etwas scheuem Lächeln bahnte er sich den Weg durch die Menge und steuerte zielstrebig auf das würfelförmige Gebilde auf dem Podium zu. Die Kanten des Würfels bestanden aus starken Holzleisten, über die sich weiß grundiertes Segeltuch spannte. Die Seitenlänge der leinenbespannten Holzkonstruktion betrug zwei Meter. Die eine Segeltuchwand war noch aufgerollt und sollte erst über den Holzrahmen gespannt werden, wenn sich der Aktionskünstler ins Innere des Würfels begeben hatte. Und das tat er sogleich – schweigend. Die Besucher wussten ohnehin aus den Ankündigungen, was sie nun zu erwarten hatten: Herbert Ohm wollte auf die Innenseite der Leinwände Zeichen und Symbole setzen, die sich durch den Stoff auf der Außenseite durchdrückten, so dass sie auch die Zuschauer zu sehen bekamen – nur eben seitenverkehrt.
Als Herbert Ohm in dem Würfel eingeschlossen war, verließ ihn plötzlich seine Ruhe. Seine Hände, die den Filzstift hielten, begannen zu zittern. Schweiß brach ihm aus allen Poren. Er wusste, dass außerhalb des Würfels Dutzende Neugieriger darauf warteten, dass er den ersten Strich machte. Und davor hatte er Angst. Wo – und wie – sollte er beginnen?
Diese Frage hatte ihn schon den ganzen Tag gequält. Aber dieses Problem war nicht der einzige Grund für seine Nervosität. Als er in dem Würfel zwischen Leinenwände eingeschlossen war, fühlte er sich auf einmal in eine andere Dimension versetzt. Und befand er sich nicht auch innerhalb einer eigenen Welt, die nicht mehr den kosmischen Gesetzen unterworfen war? Für ihn hatten andere Gesetze Gültigkeit. Jede Botschaft, die er an die Wand seines weißen Mikrokosmos schrieb, würde für die Menschheit eine andere Bedeutung haben.
Wie sollte er beginnen, um sich dennoch verständlich zu machen?
Seine Hand begann noch heftiger zu zittern, als er den Stift an der Leinwand ansetzte. Er wollte einfach eine Waagerechte ziehen – doch er kam nicht mehr dazu. Der Punkt, den er gesetzt hatte, weitete sich auf einmal aus, wurde größer und größer, bis er Ohms gesamten Mikrokosmos ausfüllte.
Er befand sich plötzlich inmitten grenzenloser, absoluter Schwärze. Eine Schlussfolgerung drängte sich ihm auf, die ihn mit Entsetzen erfüllte. Er war sich sicher, dass der Punkt sich nicht ausgeweitet hatte, sondern dass er in diesen gestürzt war. Der Punkt hatte ihn einfach verschlungen, ihm, Herbert Ohm, die Gesetze der ersten Dimension aufgezwungen.
Herbert Ohm war im Punkt.
Die Panik wich aber schnell von ihm, als er erkannte, dass seine Umgebung alles andere als eindimensional war. Die Schwärze hatte Tiefe und Breite und Höhe. Sie besaß Plastizität. Er war in einem Raum.
Wo?
Davon hatte er keine Ahnung. Er wusste nur, dass er sich nicht mehr in seinem Aktionswürfel befand. Und dann vernahm er Stimmen ...
Alain Gabin fühlte, dass das Ende kam.
Das Ende unter einer Seinebrücke, wie schon für so viele Clochards vor ihm. Er hatte eigentlich nichts anderes erwartet. Und doch, als es nun so weit war, bedauerte er doch die Trostlosigkeit seines Todes. Er lag wie ein Stück Vieh auf dem warmen Pflaster. Er hörte sich röcheln und schreien und sah – wie ein unbeteiligter Zuschauer – seinen Körper zucken und seine Arme und Beine um sich schlagen. Am entwürdigendsten war jedoch, dass von überall her die Schaulustigen herbeigerannt kamen. Keiner rührte einen Finger, obwohl Alains Freund Pierre sie anflehte, einen Arzt zu verständigen.
Reg dich nicht auf, Pierre, wollte Alain sagen. Es tut gar nicht weh. Aber er konnte nicht sprechen. Er konnte auch nicht hören, was die Leute sagten. Aber er las es von ihren Lippen ab.
»Wieder einer, der sich ins Grab gesoffen hat.«
Alain lachte. Er lachte sie alle aus. Diese Idioten wussten ja gar nicht, was für ein Erlebnis das für ihn war. Er fühlte sich auf einmal ganz leicht, als schwebte er. Und das Zucken seiner Glieder hatte aufgehört. Noch immer lachend trat er aus dem Kreis der Schaulustigen hinaus und strebte leichtfüßig auf das nahe Ziel zu.
Was für ein Ziel? Auf welchem Weg befand er sich eigentlich?
In den Tod?
Alain zuckte zusammen, als plötzlich vor ihm ein dunkelhäutiger Buschmann auftauchte und ihn mit einem primitiven Speer bedrohte. Er trug nichts weiter als einen Lendenschurz am Leib, aber sein Körper war furchterregend bemalt und wies unzählige Tätowierungsnarben auf.
Er schrie Alain an: »Jetzt werde ich dich vernichten, tro!«
Alain fragte sich, wieso er die Sprache des Buschmanns verstehen konnte. Und woher kam auf einmal diese junge Frau, die den Dunkelhäutigen von seiner Wahnsinnstat abhielt? Und wo war der Mann, der immer wieder rief: »Ich bin blind. Dieser hinterhältige Hund hat mir Säure in die Augen getropft!«
Es war zum Verrücktwerden ... Wahnsinn!