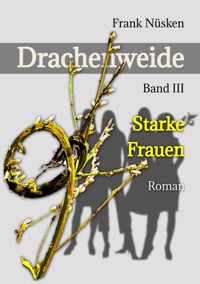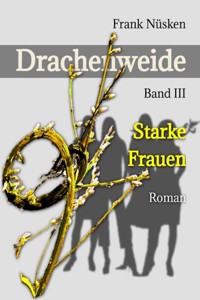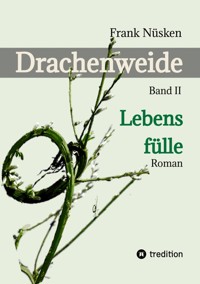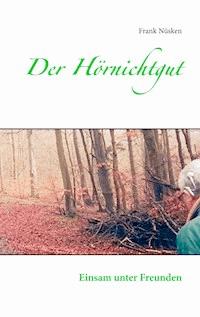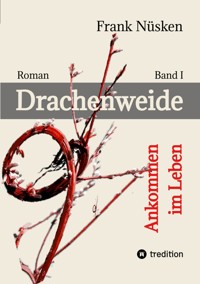
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Drachenweide
- Sprache: Deutsch
Der Roman Drachenweide schildert in drei Bänden das Leben von Christian, Jan und Wolff ab 1942 bis ins Jahr 2019. Er beschreibt, wie Prägungen langfristig wirken. Band I Ankommen im Leben, begleitet die Freunde bis ins Jahr 1975. Im Band I trägt Christian bis zum Tod seines Adoptivvaters den Namen Horst. Ankommen im Leben Horst, Jan und Wolff werden mitten im Krieg geboren. Horsts Mutter verschwindet kurz nach seiner Geburt, Jan überlebt eine Bombennacht und Wolff flieht mit seinen Eltern vor der Roten Armee. Obwohl die drei unterschiedliche Charaktere sind, werden sie Freunde. Prägende Erlebnisse im Jugendalter beeinflussen ihre weiteren Leben: Internat, Begegnungen im Moor und Arbeit im Wald. Mit der Zeit verlieren sich die Freunde aus den Augen. Wolff trifft eine Entscheidung. Jans Berufswahl hat nicht absehbare Folgen. Horst erfährt erschütternde Einzelheiten zum Verlust seiner leiblichen Eltern. Ihre Leben verlaufen wie bunte Fäden auseinander, kreuzen und berühren sich fast. Hauptorte der Handlung: Hunsrück, Saarland, Oberschwaben. Ulm und weitere Orte. Weitsicht und Humor, Liebe und Sexualität erweisen sich stärker als Ohnmacht, Trauer und Engstirnigkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Frank Nüsken wurde in Wuppertal geboren, prägende Jahre seiner Kindheit verbrachte er im Bayerischen Wald. Während seiner Jugend in Oberschwaben übernahm er die Malfreude für Aquarelle von seinem Vater. In der mit Freunden gegründeten Musikband Sondos, trat er als Gitarrist und Sänger auf. Seit vielen Jahren lebt er am südlichen Ausläufer des Hunsrücks.
Als Betriebswirt schulte er Auszubildende und Außendienstmitarbeiter eines Großunternehmens. Anschließend arbeitete er als selbstständiger Seminarleiter für Kommunikation. Als Coach begleitete er Veränderungsprozesse in Unternehmen. Arbeitseinsätze in Kolumbien und in Äthiopien veränderten seine Sichtweise auf unsere Welt. Gewonnene Erkenntnisse zu Ursachen und Wirkungen beeinflussen seine Arbeit als Romanautor.
Ankommen im Leben widme ich meiner Familie,
die mich während der Arbeit an Drachenweide
unterstützt und ertragen hat.
Mein Dank gilt allen, die Drachenweide während der Entwicklung gelesen haben. Ihre Rückmeldungen, Anregungen und konstruktiven Beiträge waren für mich wertvoll.
Frank Nüsken
Drachenweide
Band I
Ankommen im Leben
Roman
© 2023 Frank Nüsken
Umschlag, Illustration: Frank Nüsken
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
ISBN
Paperback
978-3-384-05678-8
e-Book
978-3-384-05679-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Inhalt
Cover
Widmung
Titelblatt
Urheberrechte
Kindheit
Jugend
Jans Reifeprüfung
Wolffs Moorkontakte
Horsts Erkenntnisse
Lucs Greidach
Ingenieurstudium
Agrarwissenschaftler
Finanzbeamter
Ankommen
Reise der Veränderungen
Ankunft
Drachenweide
Cover
Widmung
Titelblatt
Urheberrechte
Kindheit
Ankunft
Drachenweide
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
Kindheit
Hinzert im Hunsrück
Frühling 1942
Luc Dechamps blickte über die weiten Höhenzüge des Hunsrücks. Die tief stehende Frühlingssonne setzte die Berge in helles Licht und zauberte ein magisches Leuchten auf das junge Grün der Laubbäume. Nur wenige Nordhänge trugen noch den winterlichen Grauschleier. Schlehenbüsche hoben sich weiß von den Wäldern ab.
Obwohl Luc jedes Mal hier anhielt, sog er diesen Blick auf, als fürchte er, dieses Panorama zu vergessen. Tief atmete er die frische Frühlingsluft ein. Wohltuende Entspannung floss durch seinen Körper.
Sein Blick fiel auf die tieferliegenden Wiesen und Felder. Siedlungen wirken wie zufällig in die Landschaft gestreut. Dechamps hielt sich an einer dürren Birke fest und beugte sich weit vor. Jetzt konnte er einzelne Dächer des Dorfs Pölert erkennen. „Harmonisch und friedlich“, brummte er in sich hinein.
Der Weinhändler Dechamps riss sich von diesem Bild los, schüttelte sich und setzte sich in seinen Lieferwagen, um seinen nächsten Kunden anzusteuern. Seine Kunden kannten ihn als Lucien Dechamps. Privat aber liebte er die Abkürzung seines Vornamens.
Weiter unten, zwischen den Hunsrückdörfern Pölert und Hinzert, lag das SS-Sonderlager Hinzert, ein kleines Konzentrationslager. Die Kommandanten des Lagers gehörten zu Dechamps Weinkunden. Seit Ende 1941 stand das KZ unter der Führung des Kommandanten Egon Zill. Er galt als rücksichtslos, unberechenbar und brutal. Zill umgaben grausame Gerüchte. Angeblich griff er willkürlich einen Häftling, den er gerade sah und führte ihn persönlich zum Hinrichtungsplatz. Als Anlass genügte Zill eine Haarsträhne, eine Bartflechte oder ein Gesichtsausdruck.
Bei Dechamps letztem Besuch flüsterte ein SS-Mann diskret zu Zills Weingeschmack: Nicht so sauer. Aus einem Nebensatz entnahm er, dass sich Zill als Sohn eines Brauereiarbeiters dem Wein zugewandt hatte. Sein Gesicht verbarg der Lagerleiter weitgehend unter dem großen Schirm seiner Dienstmütze. Auf Lucien Dechamps wirkte Zill fanatisch und machtbesessen.
Sei wachsam, ermahnte er sich.
„Kommen Sie Dechamps, trinken Sie mit uns. Wir wollen sofort Ihren Wein probieren.“ Der Lagerleiter reichte Luc Dechamps ein gefülltes Glas. Zill wollte mit ihm und einem SS-Mann, der sich als Siegfried Saht vorstellte, anstoßen. „Auf das Leben“, prostete Zill den beiden zu.
„Auf unsere Gesundheit“, meinte Saht.
„Auf weiterhin guten Wein“, prostete der Weinhändler Dechamps.
Lautes Geschrei und Rattern außerhalb des Gebäudes lenkten seinen Blick zum Fenster. Gefangene, begleitet von SS-Männern mit Maschinengewehren, zogen einen beladenen Wagen an der Deichsel. Weitere Häftlinge schoben von hinten die schwere Last.
„Eine unserer kleinen Erziehungsmaßnahmen.“ Zill lachte, als er erkannte, was Dechamps beobachtete. „Der Wein ist gut“, beendete er sein Lachen und trank noch einmal, „Auf das Leben.“
Dechamps hatte zuvor genau darauf geachtet, dass der Wein in seinem Glas, aus der von ihm gelieferten Flasche stammte.
„Ihr Wein schmeckt mir, wie viele Kisten haben Sie geladen?“
„Von dieser Sorte noch sieben Kisten.“
„Laden Sie alles aus und kommen Sie in vier Wochen mit Nachschub wieder.“ Luc Dechamps war überrascht, wie viel er hier verkaufen konnte.
Erleichtert verließ er das Lagergebäude, setzte sich in seinen weinroten Opel P4 Lieferwagen und schloss sorgsam die Tür.
„Gut, wieder draußen zu sein“, flüsterte er. Selbst im geschlossenen Wagen wagte er nur zu flüstern.
Außerhalb auf der Hunsrückstraße fiel die Anspannung der Atmosphäre des Straflagers von ihm. Auf der abschüssigen Strecke nach Reinsfeld begegnete ihm ein weiterer schwer beladener Wagen. Häftlinge zogen und schoben ihn bergauf. Wachpersonal trieb sie an, indem es auf diese Männer einprügelte. Der Weinhändler sah geradeaus. Er hatte genug von diesen Eindrücken.
Luc Dechamps dachte an sein kurzes Gespräch mit dem SS-Mann Siegfried Saht. Er kam aus dem KZ Dachau und war bei Zill zu Besuch.
„Saht? Ich kenne eine Familie Saht an der Saar“, platzte der Weinhändler voreilig heraus. Saht ging nicht darauf ein.
„Ja, den Namen gibt es wohl öfter in der Gegend.“
Offenbar war ihm ein Gespräch zu seiner Herkunft unangenehm. Dechamps beließ es dabei. Er entnahm aber Sahts Mimik, dass ihm die Freundschaft von Lucs Schwägerin Maria mit Anna Saht bekannt war. Der Weinhändler war sich sicher, mit Anna Sahts Sohn zu sprechen.
Dechamps grübelte über seine Arbeit. Es gelang ihm nicht, die Eindrücke des SS-Lagers zu verdrängen. Bei anderen Institutionen erlebte er nicht, was die Leute taten. Es handelte sich um Schreibtischtäter. Doch in Hinzert sah er mit eigenen Augen, wie mit Inhaftierten umgegangen wurde. Ja, aber, rechtfertigte er sich, ich liefere nur Wein. Würde ich diesen Menschen keinen Wein verkaufen, bezögen sie ihn aus anderen Quellen. In den Lagern würde sich nichts ändern, nur stünde ich ohne ausreichendes Einkommen da.
Überführung nach Oberschwaben
Februar 1943
Seit gut einer Stunde saß Luc Dechamps am Steuer seines Lieferwagens. Er konzentrierte sich auf die winterlichen Straßen. Seine Schwester Paula saß auf dem Beifahrersitz und hielt sich an einem Griff fest. Sie hatte ihren Bruder seit 1936 nicht mehr gesehen. Interessiert betrachtete sie Luc. Schon als Kind gefiel er ihr. Sie mochte seinen dunklen Teint und seinen tiefbraunen, fast schwarzen Haarschopf. Paula schrieb seine körperlichen Merkmale der französischen Linie der Dechamps zu. Ihr gemeinsamer Bruder Heinz war dagegen hellhäutig und blond. Gedanken an Heinz wollte sie jetzt aber nicht zulassen.
„Gut siehst du aus, Luc, wie alt bist du jetzt?“
„Noch bin ich achtunddreißig.“
„Und immer noch keine Frau?“
Paulas Bruder lächelte. „Dafür habe ich keine Zeit. Außerdem scheue ich die Verantwortung – jetzt im Krieg.“
Paula hatte das Bedürfnis, sich mit ihrem Bruder über die Hintergründe ihrer Fahrt zu unterhalten. Bei diesem Wetter wollte sie Luc aber nicht vom Fahren ablenken. Sie verschob ihr Anliegen, plapperte aber Belangloses.
„Da vorne liegt ein Dorf“, informierte sie ihren Bruder, der das gleiche Bild vor Augen hatte. „Da hinten kommt eine Kurve.“
Luc ließ diese Kommentare über sich ergehen.
„Dieser Wald wirkt richtig dunkel“, setzte Paula ihre Beobachtung fort.
„Deshalb heißt er auch Schwarzwald.“ Luc machte sich über seine Schwester lustig.
Paula unterbrach die inhaltslosen Beobachtungen. Bilder ihrer gemeinsamen Kindheit in Völklingen tauchten in ihrer Erinnerung auf. Als kleine Schwester hielt sie sich früher gerne in Lucs Nähe auf. Häufig lief sie hinter ihm her, wenn er mit Freunden unterwegs war. Oft versuchte er, sie abzuschütteln, blieb aber freundlich zu ihr. Besonders ihr gemeinsames Lachen liebte sie.
Erneut verglich sie sich mit Luc. Sie hatte vorwiegend Erbgut ihrer Mutter erhalten. Gerne wäre sie schlanker gewesen, aber es gelang ihr nie. Fad fand sie ihre Haare, so zwischen dunkelblond und nichtssagend, auf jeden Fall waren sie ihr zu dünn.
Paula dachte erneut an ihren Bruder Heinz. Ihre traurigen Gedanken ließ sie jetzt zu. Vor einem Jahr fiel er im Russlandfeldzug. Sein Leichnam wurde bisher nicht überführt. Es gab nur ungenaue Nachrichten. Ihre Gedanken passten zum trüben Winterwetter.
Im Saarland regnete es, im Pfälzer Wald behinderte Nebel die Sicht. In der Rheinebene schien den beiden überraschend Sonne ins Gesicht. Paula erkannte das bei Sonnenlicht typische kastanienbraune Leuchten in Lucs Haaren. Das war früher schon so, erinnerte sie sich. Kurz darauf setzte Schneeregen ein. Auf den Höhen des Schwarzwaldes kämpfte Luc gegen Schneetreiben an. Zu jedem Wetter kamen Paula Erinnerungen an ihre Kindheit mit ihren älteren Geschwistern.
Früh am Morgen waren sie bei Familie Saht in Ballern aufgebrochen. Sie übernahmen Lenas wenige Wochen alten Säugling, um ihn nach Buchau zu bringen. Dort lebte Paula seit einigen Jahren mit Ihrem Mann Alfred. Der Vater des Kindes war laut Geburtsurkunde der SS-Sturmführer Siegfried Saht, Annas Sohn.
Luc sorgte sich, seine Mission könnte seinen Kunden bekannt werden. Diese Fahrt war legal. Er wollte aber vermeiden, mit einem Kind in Zusammenhang gebracht zu werden.
Bisher sprachen sie nur Belangloses.
Paula Dechamps lernte bei ihrem früheren Arbeitgeber, der Familie Kelch in Völklingen, den schwäbischen Finanzbeamten Alfred Hard kennen. Nach der Volksabstimmung im Januar 1935 wurde das Saargebiet ins Deutsche Reich eingegliedert. Hard war von seiner Finanzbehörde vorübergehend ins Saargebiet abgestellt worden. Er sollte die dortigen Finanzämter bei der Umstellung auf die Regelungen und Systeme des Deutschen Reichs unterstützen. Von einem ortsansässigen Kollegen wurde er eines Donnerstags zum monatlichen Kochabend im Hause Kelch mitgenommen. Es galt als guter Einstieg, wenn ein neuer Gast ein neues Rezept samt Zutaten mit einbrachte. Selbstverständlich wurde auch erwartet, dass er sich aktiv an Küchenarbeit und Gesprächen beteiligt. Alfred Hard brachte schwäbische Buabespitzle mit Specksoße und seine ganz besondere oberschwäbische Sprache mit.
Paula Dechamps versorgte an Kochabenden die Gäste mit Getränken und Messern, um Kartoffeln zu schälen oder Gemüse zu schneiden. Dabei sprang der Funke über, der Alfred Hard veranlasste, öfter zu Besuch zu kommen. Das gefiel nicht allen, Hard galt als förmlich, starr im Denken und langweilig.
Alfred Hard vertrat die deutsche Obrigkeit im Saarland, zumindest was die Besteuerung betraf. Der Würde dieser Funktion entsprechend trug er Anzug mit Weste und Krawatte. Grautöne schien er zu bevorzugen. Bei Küchenarbeiten legten die Männer ihre Sakkos ab, knöpften die Westen auf und lockerten die Hemdkragen. Manch einer bat um eine Schürze. Alfred Hard jedoch erschien das der Bedeutung seines Amtes nicht angemessen. Er beteiligte sich zwar beim Gemüseschneiden, legte aber niemals ein Kleidungsstück ab oder lockerte es auch nur. Entsprechend vorsichtig hantierte er bei der Küchenarbeit mit dem Messer. Seine Kleidung durfte keinen Schaden nehmen.
„Was unterscheidet das deutsche Steuersystem von dem der Saar?“, interessierte sich Dr. Kelch.
„Als Staatsdiener mache ich mir solche Gedanken nicht, ich übertrage das deutsche System auf die hiesigen Bearbeitungsvorgänge. Vielleicht ist das Saarsystem französischer geprägt.“
„Aha“, meinte Dr. Kelch, „Sie machen hier halt Ihre Arbeit. Sie legen fest, welche Steuersätze für welche Vorgänge angewendet werden müssen?“
„Genau, das ist hier meine Aufgabe“, bestätigte Alfred Hard stolz. Paula gefiel diese Schlichtheit. Alfred entsprach ihrer eigenen Prägung. Sie verliebten sich und heirateten noch in Völklingen. Der Einsatz von Alfred Hard im Saarland endete, als ihn sein Heimatfinanzamt Saulgau zurückforderte. Paula zog mit ihrem Mann in dessen Heimatort Buchau in Oberschwaben.
Obwohl sich Alfred Hard penibel auf Ereignisse im gemeinsamen Bett vorbereitete, blieb die Ehe kinderlos. Dieser Zustand fand innerhalb der Ehe kaum Beachtung – bis der Postbote Paula das Telegramm ihres Bruders Luc überreichte.
Anrufe Mittwoch, 11:00 Postamt Buchau. Frühzeitig fand sie sich im Postamt ein und wartete aufgeregt auf das Ferngespräch. Was mag da wohl geschehen sein, fragte sie sich, dass Luc bei mir anruft?
„Frau Hard, Ferngespräch für Sie.“ Der Postbeamte beendete ihr Grübeln. „Zelle zwei bitte.“
Paula war aufgeregt, Telefonieren war neu für sie. Das Telefon in Zelle zwei klingelte und Paula nahm zögerlich den schweren Hörer ab. Unbeholfen hielt sie ihn ans Ohr.
„Hallo“, sagte sie mit unsicherer Stimme, „Hallo.“
„Ja, ich bin’s, Luc. Hör zu, du weißt vom Tod unseres Bruders Heinz im Russlandfeldzug und dem seiner Frau Maria in der Lungenklinik. Ihre Tochter Lena lebte bei Bauer Saht in Ballern. Sie hat dort ein Kind bekommen. Lena kann sich aber nicht darum kümmern. Familie Saht und auch ich denken, dass ihr den kleinen Jungen, er heißt Christian, aufnehmen könntet, vielleicht sogar adoptieren.“
Insgeheim wünschte sich Paula schon lange ein Kind. Lucs Ansinnen kam für sie jetzt unerwartet, sie atmete tief durch.
„Ja wie? Wie soll das denn gehen? Darüber muss ich zuerst mit Alfred reden. Wie soll das Kind denn hierherkommen?“
„Ja, klar, das müsst ihr gemeinsam entscheiden. Es würde allen Beteiligten helfen. Am Telefon kann ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Du könntest mit dem Zug hierherkommen und ich würde dich und den Jungen mit dem Auto nach Buchau bringen“.
Sie vereinbarten ein erneutes Telefonat in einer Woche. Bis dahin sollte sich Paula gemeinsam mit Alfred darüber klar werden, ob sie darauf eingehen könnten.
Paula hatte die Dringlichkeit in ihres Bruders Stimme erkannt. In dieser Zeit war allen bewusst, am Telefon nur wenig zu sagen.
Ein Antrag seines Finanzamtes beendete vorzeitig Alfred Hards Karriere als Soldat. Gerade während des Krieges mussten Steuereinnahmen geordnet erfolgten. Somit konnte Paula dieses Thema innerhalb weniger Tage mit ihrem Mann besprechen.
Jetzt fuhr sie mit Luc und dem Säugling im Lieferwagen nach Buchau. Luc bestand darauf, unbelebte Straßen zu nutzen und durch weniger dicht besiedelte Gebiete zu fahren.
„Schließlich befinden wir uns im Krieg und man muss mit allem rechnen.“ Luc glaubte, so weniger aufzufallen.
„Was ist denn nun mit Lena?“, brach Paula endlich das Schweigen. „Wo ist sie und warum kümmert sie sich nicht um das Kind?“
„Na gut“, brummte Luc. „Ich berichte dir, was ich selbst weiß. Das Kind, also Christian, hat nicht den Vater, der in der Geburtsurkunde steht. Anna ließ ihren Sohn eintragen, nachdem der SS-Offizier Siegfried Saht den Heldentod starb und sich nicht mehr wehren konnte. Der leibliche Vater ist oder war ein Fremdarbeiter, keiner weiß, ob er noch lebt. Nach dem Namen habe ich nicht gefragt. Dieser Mann hat bei Bauer Saht auf dem Hof gearbeitet.“
Paulas Bruder überlegte, was er noch wusste. „Vielleicht kennst du die Anordnung Hitlers von 1939. Danach wird ein Kriegsgefangener, der sich mit einer deutschen Frau oder einem deutschen Mädel einlässt, erschossen. Fremdarbeiter zählen auch als Kriegsgefangene. Frauen, die sich auf eine Beziehung mit einem Kriegsgefangenen einlassen, sollen durch Abschneiden der Haare öffentlich angeprangert und anschließend in einem Konzentrationslager untergebracht werden.“
Es vergingen einige sprachlose Minuten, in denen jeder seinen Gedanken nachhing. Das Baby hinter den Sitzen meldete sich deutlich mit einem durchdringenden Geruch und einem kräftigen Stimmchen. Das Kinderkörbchen hatten sie auf eine schmale Ablage hinter den Sitzen eingeklemmt. Zum Frischmachen und Wickeln mussten sie anhalten. Sie fanden eine überdachte Bushaltestelle mit einer Holzbank. Paula übernahm die Arbeit, die sie nun in Zukunft regelmäßig zu tun hatte. Noch fühlte sie sich unbeholfen dabei.
„Du hast mir jetzt einiges erzählt, aber …“, sie machte eine Pause, „was ist mit Lena, wo ist sie, warum kann sie sich nicht um ihr Kind kümmern?“
„Erst gehen wir wieder ins Auto, für den Kleinen ist es zu kalt hier draußen.“
Sie fuhren weiter. „Ich kann dir nur wiedergeben, was mir Anna Saht berichtet hat.“ Luc zögerte. „Lena wollte unbedingt herausfinden, was mit dem Fremdarbeiter geschehen ist, seit die Gestapo ihn nachts abgeholt hatte. Sie hatte wohl eine Spur. Lena bat Anna, für zwei Wochen das Baby zu versorgen. Sie sagte aber auch, wenn ich bis dahin nicht zurück bin und du nichts von mir hörst, versuche Christian in meiner Verwandtschaft unterzubringen. Laut Geburtsurkunde bist du Anna, die Großmutter.“
„Ja und?“ Paula wurde ungeduldig.
„Lena ist nicht wieder aufgetaucht. Wenn Lena bei ihrer Suche nach dem Fremdarbeiter enttarnt wurde, musste Anna davon ausgehen, dass das Kind von den Behörden abgeholt würde. Anna hätte das Baby auch gerne behalten. Sie hatte aber Angst, dass die Nazis es in ein Lebensborn Heim stecken oder gleich umbringen.“
Paula dachte nach. Sie wunderte sich, wie offen ihr Bruder über seine Kundschaft sprach.
Worin liegt der Unterschied, wenn ich nun das Kind aufnehme?“
Luc ließ mit der rechten Hand das Lenkrad los, griff in die Innentasche seiner Jacke und fingerte ein verknittertes Kuvert heraus.
„Lies das.“ Er reichte das Kuvert seiner Schwester.
„Nimm die Hände ans Lenkrad, das macht mir Angst.“
Paula kämpfte damit, im holpernden Fahrzeug dem Umschlag zwei Bogen Papier zu entnehmen und zu entfalteten. Das erste Blatt enthielt die Geburtsurkunde.
Christian Dechamps, geb. am 24.12.1942 in Ballern/Saar.
Vater: Siegfried Saht, geb. 02.03.1920, gest. 21.08.1942;
Mutter: Lena Dechamps, geb. 05.10.1921.
Das zweite Blatt war handgeschrieben:
Ich, Lena Dechamps, geb. am 5, Oktober 1921, gebe hiermit meinen leiblichen Sohn, Christian Dechamps, geb. am 24. Dezember 1942 zur Adoption frei. Die Großmutter des Kindes, Frau Anna Saht, berechtige ich zur Abwicklung der Adoption.
Bevorzugen würde ich die Adoption durch meine Tante, Frau Paula Hard, geb. Dechamps, und ihren Mann Alfred Hard, beide wohnhaft in Buchau am Federsee in Oberschwaben. Schon als Kind habe ich Paula im Haus meiner Großeltern kennen und schätzen gelernt. Ich halte sie für liebevoll und verantwortlich.
Ballern, 15. Januar 1943 - Lena Dechamps
„Sie wollte mich als Adoptivmutter haben?“ Paula war gerührt. „Jetzt ist schon Anfang Februar.“
„So ist es. Und es sprechen weitere Fakten dafür, dass das Kind aus der Region verschwindet.“ Luc schnaubte.
„Wir wissen bisher alle nicht, wo Lena tatsächlich ist und was mit ihr geschehen ist. Das bedeutet, wir wissen demnach auch nicht, ob sie in die Mühlen der Bürokratie geraten ist. Die Familie Kelch wurde von der Gestapo kritisch beobachtet, man mochte sie nicht. Seit sie das Land verlassen haben, ist ihre Enkelin Lena einzige Nachkommin dieser Familie in Deutschland. Die Verbindung mit Siegfried Saht, die nur auf dem Papier steht, könnte dem einen oder anderen zweifelhaft vorkommen.“
Paula nutzte die Atempause ihres Bruders. „Das ändert sich doch auch nicht, wenn der Kleine bei uns ist.“
„Vordergründig betrachtet, hast du recht. Jedoch spielt die Entfernung hier eine gewisse Rolle. In Ballern ist das Kind noch nicht aufgefallen, es ist Winter. Lena und Anna haben sich draußen nicht mit dem Kind gezeigt. Außer dem Meldeamt weiß es keiner. Es gibt aber Menschen im Umfeld, die, sobald sie das Kind wahrnehmen, Anschuldigungen machen könnten“.
„Was meinst du damit?“ Paula reagierte ungeduldig.
„Anna Saht war die beste Freundin von Lenas Mutter, unserer Schwägerin Maria. Es gab im Umfeld fanatische Nationalsozialisten, die, je nach Blickrichtung, Fantasien entwickeln. Einerseits die Verbindung Maria Kelch und Anna Saht. Andererseits der gemeinsame Aufenthalt von Lena und dem Fremdarbeiter im Hause Saht. Es ist also wichtig, dass dieses Kind in Ballern und Merzig erst gar nicht wahrgenommen wird.“
„Bin ich jetzt nur deshalb von euch ausgewählt worden?“
„Nein.“ Luc war genervt. „Du hast doch die Erklärung von Lena gelesen. Uns ging es jetzt darum, dass das Baby so schnell wie möglich von Ballern verschwindet – aus den eben benannten Gründen. Wenn ihr ein Kind einer Nichte aus dem Saargebiet adoptiert, wird in Buchau keiner genau nachhaken. Es ist formal ganz legal. Dein Mann ist ein langjähriger Beamter, der allgemein akzeptiert wird“.
Lucs Stimme wurde drängender und schriller. Auch im eigenen Interesse wollte er, dass der kleine Christian aus der Saar Region verschwindet. Er fürchtete um seine Geschäfte, und die gehen nur gut, solange da keine familiären Störungen hineinspielen.
„Da ist noch was“, druckste Paula. „Alfred hat der Adoption nur zugestimmt, wenn das Kind einen anderen Vornamen bekommt“.
„Einen anderen Vornamen? Was hat er denn gegen Christian?“
„Ja, er will, dass er Horst heißt. Das war seine einzige Bedingung, der habe ich zugestimmt.“
„Na, das schadet keinem und ist sogar hilfreich dabei, das unschuldige Kind zu verstecken.“ Luc war erleichtert. „Wenn euer Standesamt ohne Probleme dabei mitmacht, kann das nur gut sein.“
Bis Buchau mussten sie noch eine Stunde fahren, wenn nichts dazwischenkommt, wie die Menschen damals gerne und oft sagten. Der Säugling Christian Dechamps verließ das Saargebiet und kam als Horst Hard in Buchau an.
Buchau am Federsee liegt in Oberschwaben, einer Region zwischen Schwäbischer Alb und Bodensee. Buchau ist freie deutsche Reichsstadt, was in Schriften aus dem vierzehnten Jahrhundert zum ersten Mal erwähnt wurde. Seither blieb dem Ort der Status einer Stadt erhalten. Mit nur etwa dreitausend Einwohnern, erschien das, Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts ungewöhnlich.
Der Federsee entstand vor fünfzehntausend Jahren als Schmelzwassersee. Buchau bildete darin eine Insel. Durch Absenkungen des Seespiegels wollten frühere Generationen landwirtschaftliche Flächen gewinnen. Es entstand Moor, das für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht taugte, aber die Basis für das spätere Moorheilbad bildete. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich eine eigenartige und einzigartige Landschaft, die einen besonderen Reiz auf Besucher ausübt. Durch den Verlandungsprozess schrumpfte der Federsee auf einen Bruchteil der ursprünglichen Fläche. Buchau ist längst keine Insel mehr.
In der Nachkriegszeit war Buchau eine Kleinstadt mit überwiegend katholischer Bevölkerung. Die Stiftskirche stand angemessen im Bereich des Schlosses, am höchsten Punkt des Ortes, der früher einmal Insel war. Das Schloss war ursprünglich ein Kloster und später ein Stift für adelige Damen.
Jahrhunderte bestand hier auch eine jüdische Gemeinde. Sie war seit der Reichspogromnacht weitestgehend erloschen. Durch den Zuzug von Neubürgern wuchs eine kleine evangelische Gemeinde im Ort.
Horst Hard
Die Fünfzigerjahre
Horst Hard trug nur wenige Wochen seines Lebens den Namen Christian Dechamps. Alfred und Paula Hard wurden seine Eltern. Horst kannte nichts anderes als Buchau, er fühlte sich als Einheimischer und wurde auch so gesehen. Von seinem Geburtsort kannte er nur den Namen. In Buchau erlebte er das normale Kinderleben, Taufe, Kindergarten, Schule und Kommunion.
Seit Frühjahr 1949 besuchten Horst und seine Mitschüler die Volksschule in Buchau, die in einem uralten und lang gestreckten Gebäude untergebracht war.
Im Schulfach Heimatkunde vermittelte Fräulein Merzer den Kindern eine Vorstellung von Oberschwaben, Württemberg und Deutschland. Die Lehrerin fragte die Kinder nach ihren Geburtsorten. Die meisten Mädchen und Jungen stammten aus der Region, nur wenige kamen von weiter her. Was Fräulein Merzer zur Geschichte Buchaus erwähnte, interessierte die Kinder nicht mehr. Sie drängelten zur Pause auf den Schulhof.
„Wir kommen aus Stargard in Pommern. Das ist nicht in Deutschland.“ Wolff erklärte seinen Mitschülern Horst, Inge und OPA seinen Geburtsort. „Wir wohnen aber schon immer in Kanzach.“
„Das geht doch gar nicht“, platzte OPA heraus. „Wenn ihr nicht in Deutschland wart, könnt ihr nicht schon immer in Kanzach wohnen.“ OPA war die Abkürzung für Ottmar-Peter Abel, alle nannten ihn OPA.
„Wohl“, reagierte Wolff, „Ich bin da geboren. Aber ich weiß da nichts mehr von.“
„Wenn er`s doch sagt“, unterstützte Inge, Wolffs Behauptung. „Ich bin auch nicht aus Buchau, ich bin aus Ravensburg.“
„Ich komme auch von weit her“, gab Horst bekannt. „Ich bin in einem Bauernhaus zur Welt gekommen. Das ist weit weg.“
„In einem Bauernhaus wohne ich auch, aber das ist in Kanzach“, reagierte Wolff.
„Ja, aber wo ich zur Welt kam, ist Frankreich“, stellte Horst klar.
„Frankreich?“, meldete sich OPA erneut zu Wort. „Schon wieder nicht in Deutschland. Wieso seid Ihr nicht aus Deutschland?“
„Wegen dem Krieg damals“, antwortete Horst.
„Ihr sprecht aber ganz normal, spricht man in Pommern und in Frankreich deutsch?“, forschte OPA nach.
„Früher halt, ich wohn` ja hier.“ Damit glaubte Horst, alles geklärt zu haben.
„Ich bin in Riedlingen geboren“, gab OPA als Letzter bekannt. Damit war die Pause beendet und die Kinder gingen zurück in den Klassenraum.
Alfred Hard ging nach wie vor seiner Arbeit beim Finanzamt Saulgau nach. Er leitete inzwischen eine kleine Abteilung. Im Dienst trug Alfred graue Anzüge, mal mit und mal ohne Weste. Dazu zierte eine dezent schräg grau gestreifte Krawatte seine Brust. Die schrägen Streifen fand er besonders keck. Alfred wechselte seine Anzüge täglich. Einmal den Hellgrauen und am Folgetag den Dunkelgrauen. Diese Abwechslung gönnte er sich. Auch die Krawatte wechselte er täglich. Zum dunkelgrauen Anzug trug er die Streifen in einem blaugrauen Ton. Paula war angehalten, den gerade nicht getragenen Anzug, täglich auszubürsten und zu lüften. Da Alfred den langen Tag auf bereits Verdautem aber noch nicht Ausgeschiedenem saß, tat frische Luft dem Anzug gut. Außerdem rauchte Alfred Zigaretten. Der erkaltete Rauch sollte ebenfalls bis zum nächsten Gebrauch wieder verflogen sein.
Um seinen Arbeitsplatz zu erreichen, stieg der Finanzbeamte Hard in seinen Volkswagen Standard, eine preiswerte Ausführung, die generell in der Farbe grau hergestellt wurde. Täglich vor dem Start ins Amt musste Paula Scheinwerfer und Rücklichter des Volkswagens säubern.
„Es ist für die Sicherheit“, referierte Alfred.
Da der VW-Standard über kein synchronisiertes Getriebe verfügte, musste Alfred beim Gangwechsel Zwischengas geben und doppelt kuppeln. Nachbarn, hörten an den Schaltgeräuschen, wenn Alfred morgens zum Dienst aufbrach. Otto Strahl kam regelmäßig zu dieser Zeit mit seinem Hund durch den Wiesenweg. Wenn er Alfred losfahren sah, duckte er sich Schutz suchend. Alfred Hard ärgerte sich darüber.
Der Wiesenweg trennte das Grundstück der Familie Hard vom Nachbargrundstück. Horst und weitere Gleichaltrige nutzten den Fußweg als Spielplatz. Eines Tages fanden sie am Wegesrand einen Ball. Sie kickten damit bis sie die Lust verloren. Den Ball ließen sie liegen.
Das ging solange gut, bis Alfred Hard sah, wie die Kinder ihr Ballspiel beendeten.
Alfred streckte seinen Arm und zeigte auf den Ball. „Weshalb räumst du den Ball nicht auf? Der kann dort nicht liegen bleiben.“
„Der liegt immer dort.“ Horst zuckte mit den Schultern.
„Spielzeug muss aufgeräumt werden, wenn es nicht mehr benutzt wird. Das weißt du doch. Hole jetzt diesen Ball und bring ihn in dein Zimmer.“
„Ich weiß nicht, wem er gehört.“
„Keine Widerworte, mach was ich gesagt habe. Ordnung muss sein. Wie würde es hier aussehen, wenn jeder seine Sachen liegen ließe.“
Horst wusste, dass Diskussionen mit seinem Vater zu seinem Nachteil ausgingen. Er holte den Ball und brachte ihn in sein Zimmer. Beim nächsten Treffen der Kinder im Wiesenweg, fehlte der Ball.
„Wo ist der Ball hin?“
„Der liegt in meinem Zimmer. Mein Vater wollte, dass ich ihn ins Haus hole.“
„Wieso das denn? Wem gehört der Ball überhaupt?“
Horst hob seine Schultern und lief los, den Ball zu holen. Als er zurückkam, spielten die anderen Fangen. Er legte den Ball ab und schloss sich ihnen an.
Alfred Hard stieg zu genau dem Zeitpunkt aus seinem mausgrauen Volkswagen, als Otto Strahl mit seinem Hirtenhund Zeus durch den Wiesenweg kam. Horst befiel ein ungutes Gefühl.
„Ah, da liegt ja unser Ball“, freute sich Otto, bückte sich und nahm den Ball auf.
„Halt!“, rief Alfred. Was willst du mit unserem Ball?“
Während die Alten um die Eigentümerschaft des Balls diskutierten, beäugten die Kinder das Geschehen.
„Horst, komm her.“ Alfred befahl seinen Sohn zu sich. „Wem gehört dieser Ball?“
„Ich weiß es nicht, der liegt da schon länger.“
Alfred wollte das nicht verstehen. Während sich das Gezeter um den Ball fortsetzte, erleichterte sich der Hund Zeus direkt hinter Alfred Hard. Als dieser im Eifer der Diskussion einen Schritt zurücktrat, trat er mit seinem linken Schuh in den frischen Hundehaufen.
„Muss jetzt dein blöder Köter auch noch hier in den Weg kacken?“, schrie Alfred verärgert Otto an.
„Zeus ist kein Köter, sondern ein intelligenter Hirtenhund. Hättest du uns mit deinem albernen Gezeter nicht aufgehalten, wären wir hier längst weg. Der Hund muss einfach.“
Damit verschwand Otto Strahl samt Zeus und Ball. Alfred Hard drehte sich weg und humpelte mit dem Hundekotschuh auf sein Haus zu.
Wieder im Haus wurde Horst einem Verhör unterzogen.
„Wenn das nicht dein Ball war, weshalb hast du ihn dann mit ins Haus genommen?“
„Ich wollte ihn liegen lassen, du wolltest, dass ich ihn mit ins Haus nehme und aufräume.“
„Wie konnte ich wissen, dass du mit fremden Bällen spielst. Nimm doch deine eigenen Spielsachen.“
„Ich habe dir gesagt, dass ich nicht weiß, wem der Ball gehört.“ Horst versuchte, sich zu rechtfertigen.
„Schluss damit, ich will nicht mehr über diesen Ball diskutieren.“ Damit beendete Alfred das Gespräch.
Später sprach er mit seiner Frau. „Ich habe mich ziemlich blamiert, weil der Junge mich nicht richtig informierte. Außerdem bin ich in einen Hundehaufen getreten. Mein Schuh steht vor der Tür.“
Immer dann, wenn sich Alfred Hard über Horst ärgerte, nannte er ihn nicht beim Namen. Er benutzte dann die Redewendung, der Junge. Seine Frau bewertete das so: Er distanziert sich von Horst und deutet an, dass er nicht sein Fleisch und Blut ist.
Paula fasste den Hinweis zum verschmierten Schuh als Aufforderung auf, ihn zu reinigen. Wollte aber noch wissen, was passiert ist.
„Die Kinder spielten mit Ottos Ball. Ich dachte, es sei unserer.“ Alfred machte sich Luft. „Sein Köter macht einfach auf den Weg.“
Paula versuchte, sich aus Alfreds Äußerungen einen Reim zu machen.
Dann setzte Alfred noch einmal nach: „Der Junge muss in der Spur gehen. Ich ärgere mich.“
Was Alfred nicht bemerkte, Horst verfolgte vom Flur aus, das Gespräch seiner Eltern. Leise schlich er in sein Zimmer und dachte darüber nach, was Vater Alfred mit Spur meinte. Horst kannte die Schmalspureisenbahn, die damals Buchau mit Nachbarorten verband. Somit hatte er eine Vorstellung von einer Spur. Was das mit seinem Verhalten zu tun hatte, verstand er als Achtjähriger noch nicht. Horst hatte längst gelernt, sich an Anweisungen seines Vaters zu halten, um Ärger zu vermeiden. Was den Ball betraf, hatte er sich an Alfreds Anweisungen gehalten, was sich aber auch als verkehrt herausstellte.
Alfred Hard wiederholte im Laufe der Jahre häufig seinen Satz: Der Junge muss in der Spur gehen. Er richtete ihn ausschließlich an seine Frau. Horst hörte diesen Satz dennoch selbst oft genug, um ihn nicht mehr zu vergessen.
Um seinen Volkswagen zu wenden, bog Alfred täglich in den Wiesenweg ein. In den letzten Tagen fuhr Alfred beim Wenden mehrere Male mit den Vorderreifen in einen Hundehaufen – Zeushaufen nannte er sie. Das macht der Otto bestimmt absichtlich, um mich zu ärgern, dachte Alfred. Er überlegte, wie er darauf reagieren könnte. Die Hundehaufen ließen Alfred nicht ruhen.
„Wegen dieser blöden Ballgeschichte lässt Otto seinen Köter jetzt ständig in den Wiesenweg kacken. Ich fahre dauernd mit den Vorderreifen da rein.“
Damit warf er Horst einen leicht vorwurfsvollen Blick zu. Paula sah er so an, dass sie verstand, für die Säuberung der Vorderreifen zuständig zu sein.
Horst hörte sich Vater Alfreds Reden äußerlich ungerührt an. Doch innerlich duckte er sich, wenn Alfred sprach. Alleine mit Mutter Paula verhielt er sich unbekümmerter.
Wenige Tage später brachte ein Handwerker an die zum Wiesenweg grenzende Hausseite ein Schild an.
Der Weg ist keine Hundetoilette.
Der Finanzbeamte war stolz darauf, auf seine Weise für mehr Ordnung zu sorgen.
Beim nächsten Zusammentreffen mit Otto und seinem Hund, setzte der Finanzbeamte ein überlegenes Lächeln auf.
„Alfred, gut dass ich dich treffe“, freute sich Otto. „Ich sagte dir bereits, dass Zeus ein intelligenter Hund ist. Ich bringe Zeus derzeit das Lesen bei. Das Wort, keine‘ hat er noch nicht begriffen.“
Horst hörte diesen Dialog. Er erkannte, dass sich Otto über seinen Vater lustig machte.
Horst wurde nach Alfreds Vorstellung von Gradlinigkeit erzogen. Es war das, was er als Spur bezeichnete. Besonders Fremden gegenüber wirkte Horst zurückhaltend und schüchtern.
„Da kommt sicher das polnische Blut durch“, kommentierte Alfred dieses Verhalten seines Sohnes.
Horst war ein mittelmäßiger Schüler. Im Freundeskreis wirkte er anhänglich, auch zuverlässig, wenn es erforderlich war. Hier fand er Anerkennung. Impulse für Aktivitäten gingen selten von ihm aus.
Schon früh klärte Paula Horst darüber auf, dass seine leiblichen Eltern wahrscheinlich gestorben seien und er deshalb zu ihnen, zur Familie Hard in Buchau, gehöre. Diese Information genügte ihm für einige Jahre. Seinen Freunden erzählte er nichts davon, es war für ihn zu dieser Zeit kein wichtiges Thema. Er hatte Eltern und Freunde. Alles stimmte mit dem überein, was auch seine Freunde hatten. Doch mit der Zeit, so ab seinem achten Lebensjahr begann Horst, seine Mama nach Details zu fragen.
„Deine Mutter Lena ist im Krieg, kurz nach deiner Geburt, verschollen. Keiner weiß bis heute, was mit ihr geschehen ist.“
„Was ist verschollen?“
„Verschollen bedeutet, wenn jemand einfach verschwindet und keiner mehr von ihr oder ihm gehört hat. Deine Mutter wollte nach deinem Vater suchen und kam nie wieder. Keiner weiß bis heute, was aus ihr geworden ist. Es wird vermutet, dass sie gestorben ist.“
Horst blickte traurig. „Wie hat sie ausgesehen?“
„Sie war wunderschön. Ich hatte sie zuletzt gesehen, als sie siebzehn Jahre alt war.“
„Und mein Vater? Was weißt du über meinen Vater?“
„Deinen Vater kannte ich leider nicht, ich habe ihn nie gesehen. Ich weiß nicht einmal seinen Namen. Als deine Großeltern starben, also die Eltern deiner Mutter, lebte Lena bei den Bauersleuten Saht im Saarland. Dort arbeitete auch dein Vater. Er war ein sogenannter Fremdarbeiter.“
„Ja und? Was ist mit ihm geschehen?“
„Er kam in ein Gefängnis. Keiner weiß, was aus ihm geworden ist.“
„War mein Vater ein Verbrecher?“ Der kleine Horst war verunsichert.
„Nein, das war er sicher nicht. Es war den Fremdarbeitern verboten, mit den Bewohnern des Hauses normale Kontakte zu haben. Lena, deine Mutter, wollte aber diesen Kontakt. Wir nehmen an, dass das verraten wurde. Dein Vater soll ein besonders lieber und guter Mensch gewesen sein.“
Paula suchte in alten Alben und Schachteln nach Bildern von Lena und deren Eltern. Sie fand lediglich ein Foto von Lena, da war sie etwa sechzehn Jahre alt. Außerdem fand sie noch ein Hochzeitsfoto von Lenas Eltern, Heinz und Maria. Es waren kleine schwarz-weiß Aufnahmen. Beide Bilder schenkte sie Horst. Der sah die Fotos lange an. Anschließend holte er seine Schachtel mit wichtigen Gegenständen aus seinem Versteck und legte sie vorsichtig hinein.
Mama Paula, hatte ihm schon früher erklärt, dass sie die Tante seiner leiblichen Mutter Lena sei, also seine Großtante.
„Ich heiße mit Mädchennamen Dechamps, Paula Dechamps. Mein ältester Bruder Heinz war dein Opa. Wir wohnten alle im Saargebiet, so hieß das Saarland früher. Dechamps ist ein französischer Name, die Dechamps kommen ursprünglich aus Frankreich. Dein Opa war ein kluger und vielseitig interessierter Mensch. Leider ist er im Krieg in Russland gefallen. Wir wissen bis heute nicht, wo er beerdigt wurde. Deine Großmutter Maria, seine Frau, starb leider kurz zuvor an einer Lungenkrankheit. Sie war eine Tochter der Familie Kelch. Das war damals eine bekannte Familie, die aus der Schweiz stammte.“
Paula Hard bemühte sich, dem Jungen altersgerecht seine Verwandtschaft zu erklären.
„Ich habe noch einen weiteren Bruder, er heißt Lucien oder kurz Luc, alle sagen Luc zu ihm. Er lebt in der Nähe von Köln, das ist weit weg von hier.“
„Weshalb sind alle meine Verwandten so kurz nacheinander gestorben.“
„Hm, es war Krieg, das war für alle eine schwere Zeit. Deutschland begann diesen Krieg gegen unsere Nachbarländer. Menschen, die das alles nicht wollten und falsch fanden, wurden von der damaligen Regierung verfolgt, eingesperrt und manchmal umgebracht.“
Horst empfand diese Informationen bedrohlich. Er fürchtete, noch schlimmere Nachrichten zu erhalten. Deshalb wechselte er das Thema.
„Kann ich den Onkel Luc mal besuchen?“
„Es ist dein Großonkel, der Bruder deines Großvaters und auch mein Bruder. Ich denke, wenn du älter bist, geht das sicher.“ Paula dachte nach. „Aber ich habe eine andere Idee, du kannst einen Brief an die Familie Saht schreiben. Anna Saht könnte ungefähr mein Alter haben. Schreibe ihr und stelle alle deine Fragen an sie. Sie kennt sicher auch den Namen deines Vaters.“
Horst war plötzlich interessiert und so setzte er sich hin und schrieb einen Brief.
Liebe Tante Anna und Onkel Viktor. (Mama sagt, ich darf euch so anreden)
Ich heiße Horst Hard, Mama erzählte, dass ich ursprünglich auch Christian heiß und bei euch geboren wurde. Christian finde ich auch schön. Ich weiß nur wenig über meine Mutter Lena und gar nichts über meinen Vater, auch nicht seinen Namen. Mama sagt, Ihr seid ganz liebe und freundliche Menschen. Wenn ich älter bin, will ich euch einmal besuchen.
Liebe Grüße von Horst
Im Jahr 1951 gehörte das Saarland noch nicht wieder zu Deutschland. Es bildete eine teilweise selbstverwaltete Region von Frankreich. Der Postweg ins Ausland dauerte entsprechend lange. Das Ehepaar Saht führte noch seinen Bauernhof. Karl ihr früherer Mitarbeiter, damals als Knecht bezeichnet, kehrte leicht verwundet aus dem Zweiten Weltkrieg zurück und arbeitete wieder bei ihnen. Mit seinem rechten Bein hinkte er stark, was ihn bei seiner Arbeit einschränkte. Die Sahts brauchten Hilfe auf dem Hof und nahmen ihn gerne wieder auf. Karl war ihnen vertraut.
Anna Saht weinte, als sie Christians Brief las. Sobald sie sein kurzes Schreiben zur Hand nahm, rannen Tränen über ihr Gesicht. Durch die Tränen erkannte sie die kindliche Schrift nur verschwommen und begann wieder von vorn. Für sie war Horst Christian geblieben. Sie dachte daran, wie sie gemeinsam mit ihrem Mann Viktor bei seiner Geburt half. Es war somit auch ihr Kind. Die Bilder dieses Ereignisses sah sie wieder vor sich. Sie bewegten sie stark.
Die letzten acht Jahre waren von Veränderungen geprägt, immerhin herrschte Frieden. Mit den Aufgaben der Landwirtschaft, die die Tage vollständig ausfüllten, hatte Anna vieles verdrängt. Jetzt sah sie alles wieder vor sich, Lena und Lev, die brutale nächtliche Festnahme von Lev, die Geburt und die Ungewissheit über Lenas Verbleib. Am Abend las sie ihrem Mann, Viktor den Brief vor. Bei der Erinnerung an Christians Geburt rang auch er mit den Tränen. Lena hatte er gerngehabt, auch den Fremdarbeiter Lev. Beide waren weg, verschwunden oder umgebracht. Es war ihm nicht gelungen, das zu verhindern. Auch ihren Sohn hatten sie verloren. Die Nazis hatten ihm den Sohn gleich zweimal genommen, erst durch ihre Gehirnwäsche und dann durch den Tod. Erneut machte er sich Vorwürfe. Ich war unfähig, meinem Sohn meine Werte zu vermitteln, habe diese Nazis unterschätzt, grübelte er in Gedanken. Ich habe mich zu wenig um Siegfried gekümmert. Habe ich die Arbeit nur vorgeschoben? Ich habe versagt. Seit dieser Zeit war Viktor noch stiller geworden. Stoisch verrichtete er seine gewohnten Tätigkeiten. Mit dem hinkenden Karl sprach er das Notwendigste. Karl wusste, was zu tun war und das tat er.
Anna benötigte vier Wochen, bis sie sich in der Lage fühlte, Christians Brief zu beantworten. Horst, weshalb gab Alfred dem Jungen diesen Namen? Lena wählte den Namen Christian. Anna wurde sich aber schnell darüber klar, dass ihre Gedanken unfair waren.
„Wir sollten Alfred und Paula dankbar sein, den Jungen aufgenommen zu haben“, erklärte Viktor seiner Frau. „Das war in dieser Zeit nicht selbstverständlich.“
Anna hätte Christian damals gerne behalten. Das Risiko war ihr zu groß.
Endlich begann sie ihren Antwortbrief.
Lieber Horst, vielen Dank für deinen Brief. Viktor und ich haben uns riesig darüber gefreut. Wie geht es dir? Wir dachten in den vergangenen Jahren oft an dich.
Ja, ich kann es gut verstehen, dass du mehr über deine Eltern wissen möchtest. Wir haben deine Eltern gerne gehabt. Beide lebten längere Zeit bei uns im Haus und halfen uns bei der Arbeit.
Gerne würde ich dir