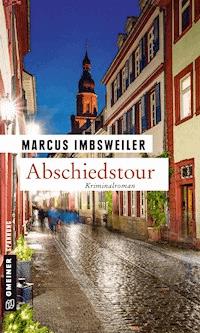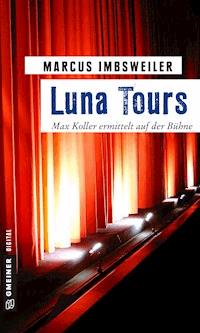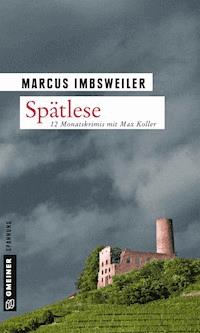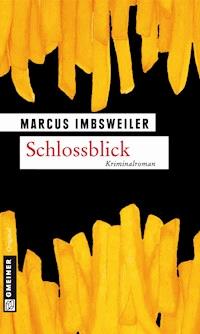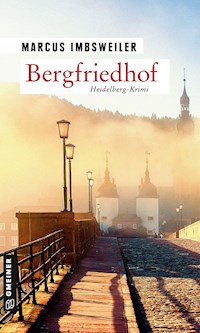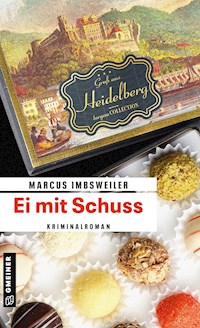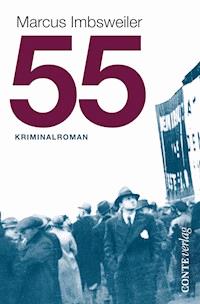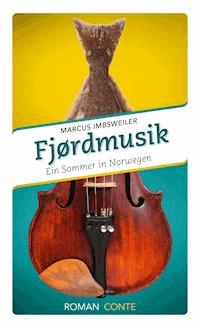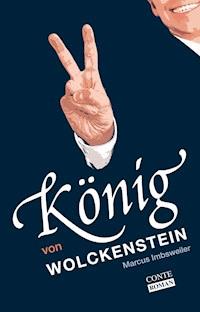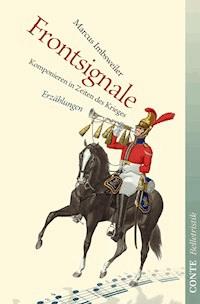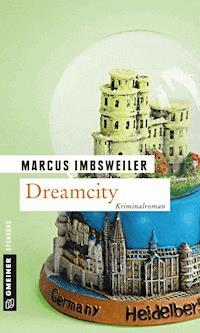
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Privatdetektiv Max Koller
- Sprache: Deutsch
Heidelberg im Baufieber. Ein neuer Stadtteil entsteht: die Bahnstadt. Zu den Investoren zählt der Mäzen Lorenz Driehm, der seine Konzernzentrale nach Heidelberg verlegen möchte. Da werden Max Koller Dokumente zugespielt, die auf kriminelle Machenschaften bei Driehm hindeuten. Kurz danach findet Koller seinen Informanten tot auf dem Bahnstadtgelände. Steckt Driehm dahinter? Und welche Rolle spielt dessen Tochter Therese, die ebenfalls Kontakt zu Koller aufgenommen hat?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcus Imbsweiler
Dreamcity
Kollers siebter Fall
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung / E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © city-souvenir-shop.de
ISBN 978-3-8392-4342-8
Prolog
Ein Windstoß aus Osten wirbelte feinen Sand auf. Im Hintergrund tanzten die Baukräne Ballett. Das Gerippe eines fünfstöckigen Gebäudes warf einen langen Schatten. Etwas abseits wartete ein Schaufelbagger auf seinen Einsatz, man sah die orange gekleideten Beine des Fahrers aus der Tür baumeln.
Und dann war da noch das große Plakat. »Willkommen in Dreamcity!«, schrie es in die Welt hinaus.
Ich fühlte, wie mein Mund trocken wurde.
Jetzt kam Bewegung in die Gruppe gutgekleideter Herren. Ein Mitarbeiter der Stadt verteilte sechs Spaten. Hemdsärmel wurden aufgerollt, sechs Gebisse entblößt. Die üblichen Scherze flogen durch die Luft. Entschlossenheit demonstrierend, schritt man zur Tat. Der dicke Ministerialdirektor aus Stuttgart schwitzte bereits aus allen Poren. Und da, eine Kamera, eine Journalistin mit Mikro: Der SWR war hier!
Dass der Spatenstich gefilmt würde, hatte mir Therese verheimlicht.
Mit einem gewissen Presseaufkommen war natürlich zu rechnen gewesen. Eine Handvoll Fotografen, aus Heidelberg, aus Mannheim, von der Stadt, von den beteiligten Firmen, ein junger Kerl von den Neckar-Nachrichten, der noch immer Bleistift und Notizblock benutzte, eine Vertreterin der Interessengemeinschaft Bahnstadt – aber der SWR! An den hatte ich nicht gedacht.
Dann würde ich also ins Fernsehen kommen.
»Bisschen nach links, die Herren«, rief einer der Fotografen. »In die Sonne bitte!«
Gehorsam trippelte das halbe Dutzend Krawattenträger weiter. Der Abgesandte des Rhein-Neckar-Kreises klopfte dem Oberbürgermeister im Gehen auf die Schulter. Hinter ihnen betrachtete ein hochgewachsener Mensch, dessen Funktion mir unbekannt war, skeptisch seinen Spaten. Kein Grund zur Sorge, mein Junge! Das Gerät hat unter Garantie noch keinen Krümel Freilanderde berührt. An dem kann man sich nicht dreckig machen!
»So ist es gut, danke! Der Chef des Ganzen in die Mitte, bitteschön.«
Einmal abgesehen von der Tatsache, dass es bei sechs Personen keine exakte Mitte gab, war das ein sinnvoller Vorschlag, denn Lorenz Driehm trug als Einziger der Herren noch seinen schiefergrauen Anzug. Die anderen standen längst im weißen oder blass karierten Hemd da, die Ärmel hochgekrempelt, Schweißflecken unter eng an den Leib gepressten Armen verbergend. Der dunkel gekleidete Driehm stellte sich zwischen seine hellen Mitstreiter, packte den Spaten mit beiden Händen und ein Haifischgrinsen aus. Neben ihm sein Haus- und Hof-Architekt, bloß ein Strich in der Landschaft, Hautfarbe grau. Das war Shaun Dircksen.
Mein Mann.
Reflexartig suchte meine Hand in der Hosentasche nach dem Zettel. Nach dem zerknitterten, abgegriffenen Stück Papier, das einmal ein leserlicher Zettel gewesen war. Überflüssig. Ich kannte den Text seit Tagen auswendig.
»Und jetzt alle zu mir schauen!«
Die blitzblanken Spatenblätter reflektierten das Sonnenlicht. Ringsum klackerten die Kameras. Driehm fletschte sein Gebiss, der Oberbürgermeister grinste, der dicke Ministerialdirektor lachte über das ganze runde Gesicht. Sogar Dircksen schaffte es, sein schmales Lippenpaar ein wenig in die Breite zu ziehen. Der Kameramann vom SWR stand breitbeinig da, ein Fels in der aufgewühlten Landschaft.
»Einmal Erde werfen, bitte!«
Sechs Häufchen Kurpfälzer Grund flogen durch die Luft. Klack-klack-klack. Der Fahrer des Schaufelbaggers fiel vor Lachen fast aus seiner Kabine. Bei seinen Enkeln im Sandkasten ging es wohl ähnlich zu. Noch immer spielten meine Finger mit der Zettelruine in meiner Hosentasche. Dircksen schien nichts zu ahnen.
Ob ich es bis in den Aktuellen Bericht schaffen würde?
»Danke, die Herren!«
Die Fotografenschar ließ ihre Gerätschaften sinken. Hinter den Spaten entspannte man sich. Applaus der Umstehenden.
Mein Auftritt.
Der Oberbürgermeister rammte gerade sein Spatenblatt tief in die Erde, als ich einen kleinen Erdhügel erkletterte, den ich mir im Vorfeld ausgeguckt hatte. Ein paar schnelle Schritte nur, doch sie genügten, um die Aufmerksamkeit aller Beteiligten auf mich zu ziehen. Da stand ich nun. Formte beide Hände zu einem Trichter und rief: »Einen Moment, meine Damen und Herren! Einen Moment!«
Mein Puls raste, aber nicht von dem Minibergsprint. Alles blickte zu mir hoch. Für den Dicken aus Stuttgart war ich wahrscheinlich bloß einer dieser verrückten Studenten, die Leute aus dem Rathaus hielten mich für einen Krawallmacher der Opposition, während Dircksen sich vielleicht fragte, woher er mein Gesicht kannte. Hoffnung und Vorfreude dagegen bei den Pressevertretern: endlich mal eine Abweichung vom langweiligen Protokoll!
Wenn ihr wüsstet, dachte ich noch. Dann legte ich los.
Ich schrie: »SHAUN DIRCKSEN! WOLLEN SIE SICH AN DIESEM ORT, VOR DIESEN LEUTEN NICHT ENDLICH ZU IHREM KIND BEKENNEN?«
Dann ließ ich die Hände sinken.
Die Stille nach meinen Worten war beeindruckend. Selbst der Baggerfahrer in Orange hörte auf, mit den Füßen zu wippen. Der Kerl von den Neckar-Nachrichten zupfte sich am Ohr. Die Fotografen sahen sich ratlos an. Bis der erste seine Kamera hob und zu knipsen begann. Sofort machten es alle ihm nach.
Aber das nahm ich nur nebenbei wahr. Was mich interessierte, war die Reaktion Dircksens und seiner Mitschaufler. Den vom Kreis und den unbekannten sechsten Mann können wir übergehen. Auch der Ministerialdirektor schaute vernachlässigenswert unministrabel. Die anderen drei dagegen …
Beide Fäuste in die Seiten gestützt, blitzte mich der Oberbürgermeister empört an. Der Zeus von Heidelberg schleuderte Blicke. Es war sein Stadtteil, der hier entstand, sein Projekt, seine Zukunft, die ließ er sich von niemandem durch unqualifizierte Zwischenrufe entweihen. Dreamcity: Traum der perfekten Stadt. Vermutlich kannte er mich, schließlich hatte ich innerhalb seines Gemeinwesens schon mehrfach für Ärger gesorgt. Geschenkt.
Dircksen wiederum reagierte irgendwie seltsam. Eher gar nicht nämlich. Glotzte mich bloß aus seinen tiefliegenden Riesenaugen an, wie man glotzt, wenn man glotzt und sonst nichts tut. Er schien nicht einmal zu denken. Hatte er den Satz nicht verstanden? Hatte er nicht kapiert, dass er ihm galt?
Am interessanten war die Reaktion Driehms. Innerhalb von Sekundenbruchteilen lief sein Gesicht rot an. Die Wut eines Mannes, der alles erreicht, der keine Majestätsbeleidigung zu gewärtigen hat, brach aus seinen Zügen. Ich fühlte Driehms Hitzewallungen bis hoch auf den Erdhügel. Er packte seinen Spaten, dass das Weiß auf seinen Fingerknöcheln zu leuchten begann.
Wäre ich in Reichweite seiner Zähne gewesen, hätte er mir den Kopf abgerissen.
»Schönen Tag noch«, sagte ich und stieg von meiner Kanzel. Das Kameraauge des SWR folgte jeder meiner Bewegungen.
Kapitel 1
Löwe.
Der im Sternzeichen Löwe Geborene zeichnet sich durch Kaltblütigkeit und Tatkraft aus. Er scheut weder Gefahren noch Widerstand. Wohl dem Manne, der einen Löwen zum Freund hat – wehe dem, der ihn Feind nennt! Die Geschichte der Menschheit wird durch Löwen geschrieben.
*
Alles begann eine knappe Woche zuvor mit einem Klopfen an meiner Bürotür. Und so wenig mein Büro das ist, was man sich unter einem Büro vorstellt, sondern bloß eine umfunktionierte Voliere im Hinterhof, so wenig war das Klopfen ein echtes Klopfen. Die Knöchel trafen ja kaum das Holz! Ein Hauch von Einlassbegehren – nein, noch weniger: die zaghafte Bekanntgabe von Anwesenheit nur, so ein richtig mädchenhaftes Klopfen war das.
Brauchte man darauf zu reagieren? Brauchte man nicht. Lieber gab ich meinem Computer einen Fußtritt. Rück die Datei raus, binärer Lümmel! Wo hast du sie versteckt? Ohne Abschlussbericht stand ich blöd da. Mein Auftraggeber, ein schwerreicher Immobilienmakler, wollte schwarz auf weiß lesen, mit wem seine Gattin fremdging, vorher zahlte er nicht. Und ich war so dankbar über die diversen Liebhaber der Dame gewesen, denn mit jedem neuen Namen verdoppelte sich mein Honorar.
Aber wo war der Bericht?
Wieder klopfte es. Eine Frau, ganz klar. Christine konnte es nicht sein, denn erstens pflegte meine Ex nicht an meine Bürotür zu klopfen, warum sollte sie, und zweitens klopfte sie männlich. Also richtig. Draußen im Hof trippelte irgendein Mäuschen auf der Stelle, knabberte an lackierten Fingernägeln und hoffte, dass sich die Tür zum Paradies von selbst öffnete.
Ich durchkämmte sämtliche Verzeichnisse. Meine Fälle. Alles säuberlich dokumentiert, so säuberlich wie mein Büro. Nichts. Der Maklergattinnenbericht war weg. Verschollen im Datenall.
»Ich könnte kotzen!«, brüllte ich.
Das dritte Klopfen. Mit so viel Penetranz hatte ich nicht gerechnet. Zur Tür stiefeln, aufreißen. Draußen stand ein Typ im Konfirmandenalter, die Faust noch erhoben, Mund offen. Ich schob ihn beiseite und ließ meine Blicke durch den Hof wandern, konnte aber nirgendwo ein Mädchen entdecken.
»Wo ist sie?«, fragte ich.
Der Mund des Knaben klappte zu und wieder auf. »Wer?«
»Die Kleine, die geklopft hat.«
»Aber… Ich habe geklopft.«
»Du?« Ich betrachtete ihn von oben bis unten. Zarte Hände, zarte Finger, ein braver Seitenscheitel und nicht ein einziges Härchen rund ums Kinn. Er trug ein Poloshirt, das er praktisch faltenlos in die Hose gesteckt hatte. Irgendetwas Süßliches kitzelte meine Nase.
»Sind Sie Herr Koller?«, fragte er.
Ich nickte.
»Freut mich.« Lächelnd streckte er mir seine Hand hin. »Leonard Untersteller. Ich bin Ihr neuer Praktikant.«
Hoppla.
Jemand hatte Gießharz über die Szene ausgekippt. Regungslos stak die Hand des Besuchers in der morgendlichen Luft, sein Blick ruhte hoffnungsfroh auf mir, im gesamten Hof regte sich kein Blatt.
Und ich?
Hatte auf Stand-by geschaltet. Energiesparmodus bis zum letzten Atom. Selbst wenn ich gewollt hätte, ich hätte mich nicht rühren können.
Was sollte denn das? Max Koller und ein Praktikant? Warum nicht gleich ein Fahrer für die Stretchlimousine? Und wieso neuer Praktikant? Das klang ja, als hätte es jemals einen alten gegeben – an den ich mich jedoch ums Verrecken nicht erinnern konnte. Auch der Name Untersteller produzierte mehr Frage- als Ausrufezeichen. Ganz zu schweigen vom Vornamen dieses Wichts.
Ein Martinshorn draußen auf der Bergheimer Straße brach die Erstarrung. Das Lächeln meines Besuchers erstarb, die Hand wurde zurückgezogen.
»Oder komme ich unpassend?«, fragte er verunsichert.
Ich sah ihn an. Sein Poloshirt hatte so ein unschön neutrales Grün, nichts Freches, nichts Fröhliches, nichts, was auch nur entfernt an Natur erinnerte. Ein echtes Industriegrün. Was man bestimmt nur in den exklusivsten Designerläden bekam.
»Leonard«, sagte ich langsam. »Das letzte Mal, dass dieser Name verwendet wurde, muss in einem Ufa-Film aus den Fünfzigern gewesen sein.«
Wenn ich erwartet hatte, dass er sich auf dem Absatz umdrehen und heulend auf die Straße rennen würde, hatte ich mich getäuscht. Er schüttelte bloß den Kopf und sagte: »In meiner Parallelklasse gibt es auch einen Leonhard. Aber mit h.«
»Eben.«
Fragend zog er eine Augenbraue hoch.
»Was soll dieser Mist?«, rief ich ärgerlich. »Kannst du das mit dem Praktikanten noch mal wiederholen?«
»Gern. Ich trete mein Praktikum bei Ihnen an.«
»Quatsch!«
»Aber Sie haben …«
»Willst du mich verarschen? Versteckte Kamera oder so was? Eher macht man ein Praktikum bei der Queen als bei mir!«
»Sie haben es mir versprochen!«
Ich konnte nicht verhindern, dass mein Kopf nach vorn schnellte. »Hä?«, raunzte ich ihm aus geringer Entfernung ins Gesicht.
»Ja, haben Sie.«
»Völliger Blödsinn.«
»Doch!«
»Wann?«
»Vor zwei Wochen. Am Telefon. Sie haben gesagt, dass ich heute anfangen könnte.«
Mir verschlug es die Sprache. Von wegen Mädchen! Von wegen schüchtern! Bei diesem Kerl handelte es sich um den unverschämtesten Rotzbengel, der mir je untergekommen war. Der log doch, dass sich die Balken bogen!
»Hör mal, Kleiner«, zischte ich und tippte ihm mit dem Finger auf die Brust. Was dem Poloshirt definitiv nicht guttat. »Ich bin kurz davor, meinen Computer in Kleinstteile zu zerlegen, weil er mir blöd kommt. Wenn du so was Ähnliches vorhast, kann ich bei dir ja schon mal üben.«
»Aber, Herr Koller! Erinnern Sie sich nicht?«
»Ich erinnere mich sehr gut daran, dass das Letzte auf dieser Welt, was ich brauche, ein Praktikant ist.«
Herrgott, jetzt kämpfte er mit den Tränen! »Sie haben es versprochen, wirklich. Ich sollte eine Wasserpistole mitbringen, sagten Sie.«
»Eine was?«
Moment. Gehirn einschalten, Max Koller. Was sollte das jetzt? Wie kam der Junge auf eine Wasserpistole? Mir dämmerte da was. Ein Abend im ›Englischen Jäger‹ … ein Anruf auf meinem Handy, als wir die fünfte Runde bestellten … eine aufgeregte Schülerstimme … Dass der Anrufer nach einer Praktikumsmöglichkeit gefragt hatte, hatte ich schon zwei Bier später wieder verdrängt. Erst recht, dass ich ihm zugesagt hatte. Aus Spaß natürlich, schließlich hörte die halbe Kneipe mit.
»Eine Wasserpistole soll er mitbringen!« Tischfußball-Kurt wollte sich gar nicht mehr beruhigen. »Du wirst sehen, Max, der macht das!«
Sogar der schöne Herbert hatte geschmunzelt.
»Nicht wahr, Sie erinnern sich?«, frohlockte mein Besucher. Es war ganz still im Hof. Die Sonne stanzte scharfe Schatten.
Ich räusperte mich. »Und? Hast du sie dabei?«
»Was?«
»Die Wasserpistole.«
Grinsend zog Leonard ein Plastikspielzeug aus der Tasche. Die Pistole war gelb und biss sich farblich mit seinem Poloshirt.
»Super«, sagte ich.
Er strahlte.
»Super, Kleiner. Kannst du mir verklickern, was ein Privatermittler mit einer Plastikwaffe anfängt?«
»Keine Ahnung. Sie sagten doch …«
»Das war ein Test«, blaffte ich. »Ein Test, verstehst du? Wer auf so was reinfällt, ist zu naiv für diesen Job. Quod erat demonstrandum. Also geh nach Hause und setz dich mit dem Ding in die Badewanne!«
An dieser Stelle hätte der Junge, der so jungfernhaft an Türen klopfte, drehbuchgerecht in Tränen ausbrechen müssen. Stattdessen wurde sein Mund ganz klein und spitz, auch die Augen verengten sich. »Sie haben es mir aber versprochen, Herr Koller! Was soll ich denn jetzt tun? Ich habe mich auf Sie verlassen.«
»Eine Wasserpistole!« Ich tippte mir an die Stirn und wollte zurück in meine Voliere.
»Alle aus meiner Klasse haben einen Praktikumsplatz«, hielt er mich auf. »Es ist Pflicht in unserer Stufe. Hat Ihnen mein Klassenlehrer nichts geschrieben? Er fand es gut, dass ich nichts mit Computern machen wollte wie alle anderen. Sondern etwas Besonderes. Sie müssten einen Brief von ihm erhalten haben. Haben Sie? Wie soll ich denn jetzt auf die Schnelle eine Alternative finden?«
»Brief? Was für ein Brief?« Es kam schon mal vor, dass ich Anschreiben, die nichts Gutes verhießen, ungeöffnet liegen ließ. Bis sie abgehangen waren sozusagen. Wenn der Absender nach Stadt, Polizei oder Gericht klang beispielsweise. Oder nach Schule. Von daher war es durchaus denkbar …
»Bitte, Herr Koller, das können Sie nicht mit mir machen!«
»Jetzt pass mal auf, mein Junge. Ich hatte noch nie einen Praktikanten, und ich werde auch nie einen haben. Weiß ja gar nicht, was man mit so einem anstellt!«
Er lächelte schwach. »Das erkläre ich Ihnen.«
»Nein, verdammt! Nichts erklärst du mir. Ich kann nicht mit Fremden zusammenarbeiten. Mit überhaupt niemandem, nicht mal mit meiner Ex-Frau. Es geht einfach nicht. Du würdest nur stören. So wie jetzt. Es tut mir leid, aber du störst. Ich sitze gerade an einer wichtigen …« Ich brach ab. Woran saß ich noch mal?
»Alles Ausreden«, sagte Leonard finster. »Sie stehen nicht zu Ihrem Wort, und das ist … das ist …«
Er schwieg, ich ebenfalls. Auf der Bergheimer Straße trugen zwei Autofahrer ein Hupduell aus. Über uns flatterte eine Taube von Dach zu Dach.
»Schändlich ist das«, stieß er hervor.
Ich kratzte mich am Kinn. Noch nicht mal Abi, aber vokabelmäßig bis an die Zähne bewaffnet!
»Schändlich«, wiederholte er. Trotz umwölkte seine jugendliche Stirn.
»Sag mal, Leonard …«
»Ja?«
»Mir fällt da etwas ein. Du hast vorhin über Computer gesprochen. Dass du der Einzige bist, der kein Praktikum in dieser Richtung macht.«
»Stimmt.«
»Heißt das, dass du dich mit Computerkram nicht auskennst?«
»Doch, besser als die anderen. Deshalb wäre es ja naheliegend gewesen, dass ich zu SAP gehe oder so was. Aber ich wollte etwas wirklich Spannendes erleben.«
»So spannend ist das Ermittlerdasein gar nicht. Und Computer«, ich grinste schief, denn jetzt kam ein ganz bescheuerter Satz, »Computer gehören zu unserem Alltag mittlerweile dazu. Wenn du dich wirklich auskennst, hätte ich eine Aufgabe für dich. Danach könnten wir über dein Praktikum sprechen. Eventuell.«
»Klingt gut!«
»Meinst du, du könntest eine verlorene Datei wiederfinden? Oder wiederherstellen?«
»Das ist doch keine Aufgabe«, winkte er ab. »Haben Sie nicht was Schwereres für mich?«
»Dann komm rein.«
Kapitel 2
Leonard Untersteller benötigte keine fünf Minuten, um meinen Abschlussbericht aus dem Datenozean zu fischen. Noch einmal fünf Minuten später hatte er ein halbes Tausend Viren auf meinem PC dingfest gemacht, und um sie in die Flucht zu schlagen, brauchte er auch kaum länger.
»So richtig schnell läuft der aber immer noch nicht«, merkte er an. »Ein Privatdetektiv wie Sie sollte über die modernste Technik verfügen.«
»Wenn ich in Computer investiere, muss ich an meinem Praktikanten sparen. Also verkneif dir deine Kommentare.«
Leonard schwieg, aber los wurde ich ihn so nicht. Okay, sagte ich, das sei sehr nett von ihm gewesen, das mit der Datei und den Viren und all dem Kram, ich könne mir durchaus vorstellen, mit ihm auszukommen, einen halben Tag vielleicht, im Notfall sogar einen ganzen.
Er schaute mich groß an. »Wieso nur einen Tag?«
»Meinetwegen auch zwei.«
»Zwei Wochen, Herr Koller! Unser Praktikum geht über zwei Wochen. Wir haben keinen Unterricht in dieser Zeit. Soll ich vielleicht zu Hause sitzen und Däumchen drehen?«
»Verdammt, ich kann mich doch nicht 24 Stunden am Stück um dich kümmern! Ich habe Aufträge, verstehst du, ich bin dauernd unterwegs, aber dauernd.«
»Super! Ich begleite Sie.« Dieser Glanz in seinen Augen!
»Mit Wasserpistole?«, knurrte ich. Der Glanz verschwand.
Aber egal, was ich ihm an den Kopf warf, er blieb sitzen. In meinem Büro, an meinem Schreibtisch. Das muss man sich mal vorstellen: Ich hatte einen Praktikanten! Einen Hiwi, einen Sklaven der modernen Arbeitswelt. Einen, den ich ausbeuten konnte, drangsalieren, auspressen, schikanieren – bis er kapiert hatte, dass er für den rauen Kapitalismus von heute nicht geschaffen war. Ja, das würde mein Ziel sein: dass Leonard Untersteller nach diesen zwei Wochen freiwillig auf Hartz IV machte.
»Mann oh Mann, Herr Koller«, seufzte er. »Sie dürfen Ihren Computer nicht so zumüllen, hören Sie?«
»Sag mal …«
»Was?«
»Kriegst du eigentlich Geld für das Praktikum? Muss ich dir was zahlen?«
Er sah mich an. Ohne mit der Wimper zu zucken, geradewegs würdevoll. »Sie dürfen«, sagte er feierlich. »Sie müssen nicht.«
»Ach.«
»Ja.«
»Und was heißt das?«
»Wir haben keinen Anspruch auf ein Gehalt, sagt unser Klassenlehrer. Aber wenn wir unsere Sache gut gemacht haben, spricht nichts gegen einen Taschengeldzuschuss.«
»Also eine Art Erfolgsbeteiligung. Sehr gut. Damit kann ich leben.« Ich lehnte mich auf dem Besucherstuhl zurück und starrte gegen die Decke des Schuppens. Erfolg wollte definiert sein. Und die Definitionshoheit hatte immer noch ich, der Arbeitgeber.
»Leonard?«
»Ja?«
»Wie alt bist du eigentlich?«
»16.«
16, soso. Schwieriges Alter. Ganz schwieriges Alter. So seufzten sie doch immer, die Eltern Halbwüchsiger. Als er klein war, da war er noch süß, aber jetzt! Hört die nie auf, die Pubertät …? Außerdem wusste ich es selbst. Spritztouren auf frisierten Mofas, dämliche Mutproben, Alkohol, Gekiffe. Nur mit Mädchen war nix. War nie was. Säße jetzt der 16-jährige Max Koller vor mir, würde ich ihn hochkant auf die Straße befördern.
Der 16-jährige Max Koller hätte sich allerdings lieber die Kugel gegeben, als sich irgendwo für ein Praktikum einzuschleimen.
»Leonard?« Noch immer klebte mein Blick an der Schuppendecke.
»Ja?«
»Was machst du eigentlich sonst so? Hobbymäßig, meine ich. Hast du eine Freundin?«
»Nö.«
»Klar, mit 16.«
»Also nicht mehr. War zu zeitaufwendig.«
Schwupp, saß ich wieder normal da. »Zu was?«
»Ich bin im Ruderklub. Da hat es nicht gepasst mit Lena. Und ich muss ziemlich viel Klavier üben.«
»Klavier?«
»Jugend musiziert. Das ist mein Ziel.«
»Verstehe. Da bleibt keine Zeit für ’ne Frau.«
»War bei Lena genauso. Sie macht Ballett. Außerdem sehe ich sie regelmäßig im Afrikaprojekt meiner Mutter. Ich interessiere mich nämlich für Politik.«
»Politik?« Skeptisch ließ ich meinen Blick über Leonards Poloshirt wandern. »Demos und so?«
»Mir geht es eher um Inhalte. Ich war schon ein paar Mal bei den Jungen Liberalen.«
»Wie bitte?«
»Steinbrück finde ich auch gut.«
»Steinbrück ist bei der SPD, Kleiner, wusstest du das nicht? Bei den Roten! Das sind die Feinde der Julis, klar? Die bekriegen sich, bis aufs Messer!«
»Bekriegen?« Leonard schüttelte den Kopf. »Es geht um unterschiedliche Konzepte, nicht um Feindbilder.«
»Nein? Und deshalb kann man politisch die Seiten wechseln, wie man will?«
»Wie gesagt, es kommt auf die Inhalte an. Bei der letzten Landtagswahl haben meine Eltern Grün gewählt. Das haben wir im Familienrat so beschlossen.«
Stöhnend nahm ich wieder Relaxhaltung ein. Diese jungen Leute! Keine Demos mehr, keine Feindbilder und vor lauter politischen Inhalten nicht genug Zeit für ihre Tussi. Das begreife, wer konnte! War das die Generation Praktikum? Die mit Seitenscheitel und Klavierunterricht?
Mitten in mein Stöhnen platzte das Handysignal. Gott sei Dank, eine Ablenkung konnte ich gut vertragen. Aber nicht nur ich: Auch Leonards Brauen hoben sich erwartungsvoll.
»Ja?«, knurrte ich wenig dienstleistergerecht in das Telefon.
Zögern auf der anderen Seite. »Kann ich mit Herrn Koller sprechen?«, meldete sich schließlich eine männliche Stimme.
»Moment, ich verbinde Sie mit seinem Praktikanten.« Allein zu sehen, wie Leonards Kinnlade nach unten klappte, war die Sache wert. »Tut mir leid, der junge Mann ist gerade extrem beschäftigt. Fängt Fliegen oder so was. Würden Sie mit mir vorliebnehmen? Ich bin Max Koller.«
Nach diesem Geplänkel war der Rest des Gesprächs reine Formsache. Der Anrufer nannte mir sogar seinen Namen. Liebherr, wie die Firma. Was genau er von mir wollte, behielt er für sich, nur, dass ihm an einem Treffen gelegen war. Dringend. Möglichst heute.
»Können wir heute?«, fragte ich meinen Praktikanten.
Der glotzte mich an. »Klar«, sagte er dann hastig. »Immer doch!«
»In einer Stunde«, gab ich dem Anrufer Bescheid. »Ich werde kommen.« Gespräch beendet.
»Sie allein?«, fragte Leonard enttäuscht. »Eben sprachen Sie noch vonwir. Also von uns beiden.«
»Das war der berühmte Pluralis Majestatis. Wir Chef, du Prakti.«
»Und was soll ich in der Zwischenzeit tun?«
»Deine Waffe föhnen?«
»Ha ha.«
»Kennst du den Kiosk im DLRG-Haus an der Neckarwiese?«
»Ja sicher.«
»Dort treffe ich mich mit diesem Liebherr. Fahr schon mal hin, such dir einen Platz, aber schön unauffällig, und halt die Augen offen.«
»Wie, die Augen offen?«
»Wenn dir etwas auffällt, notier’s dir. Sollte dir jemand komisch vorkommen, merk dir sein Aussehen.«
»Ich könnte ihn auch fotografieren.«
»Hast du eine Kamera?«
Er sah mich irritiert an. »Wieso Kamera? Smartphone!«
Richtig. Generation Smartphone. »Mach, was du willst, aber bitte so, dass keiner was merkt. Okay? Und noch eins, Leonard Untersteller.«
»Ja?« Du meine Güte, wie gespannt er aussah!
»Vergiss deine Wasserpistole nicht.«
Kapitel 3
Skorpion.
Wer als Skorpion die Welt betritt, lebt ewig im Zwielicht. Niedertracht und Tücke sind seine Charaktereigenschaften, selbst für seine Wohltäter hat er nur einen Stich übrig. Und doch kann auch der Skorpion-Mensch erlöst werden: durch ein Weib, das reine Liebe für ihn empfindet.
*
So ganz daneben lag ich mit meinem Hinweis auf das Plastikspielzeug übrigens nicht. Der Neckarwiesenkiosk grenzte an einen Wasserspielplatz, der an heißen Sommertagen von Kindern geradezu überflutet war. Von Wasser und Kindern, genau. Aus einer kreisrunden Öffnung sprudelte das eiskalte Nass über eine künstliche Felslandschaft mit beweglichen Schwellen und Schleusen. Was da plantschte, spritzte und schrie, war kaum jünger als mein Praktikant, altersmäßig jedenfalls näher an ihm als er an mir. Meine Generation saß oben auf der Kioskterrasse und schaute sonnenbeschirmt dem feucht-fröhlichen Treiben zu. Gelangweilt, besorgt, übernächtigt, genervt.
»Amelie, gib Paul das Schäufelchen zurück!«
»Bleib vom Neckar weg, Marlon, hörst du? Weg vom bösen Neckar!«
»Nicht ins Wasser pinkeln, Lucaschatz!«
Marlon konnte nicht ins Wasser pinkeln, auch nicht in den bösen Neckar, denn er trug eine Pampers XXL. Prall gefüllt. Paul regelte das mit dem Schäufelchen schon selbst, woraufhin Amelie heulend gegen den nackten Popo von Lucaschatz purzelte. Oben öffnete ein größerer Junge das Schleusentor, woraufhin ein gewaltiger Schwall Wasser alles – Marlon, das Schäufelchen, die heulende Amelie und Lucas Pipi – aus dem Weg spülte. Auf der Terrasse sprangen entsetzte Eltern auf, um ihr Wertvollstes in Sicherheit zu bringen, bevor es im Fluss landete. Auch der Vater des Schleusenwärters schnappte sich seinen Jungen und zog ihn aus der Reichweite Neuenheimer Lynchjustiz.
Ich fand das gut, denn nun war sein Platz frei.
»Der kommt nicht wieder«, sagte ich zu den beiden, die sich mit dem Papa einen Tisch geteilt hatten, und setzte mich.
Keine Reaktion.
In meinem Rücken verkrümelte sich Leonard Untersteller hinter einer Speisekarte und vermied jeglichen Blickkontakt. Liebherr schien noch nicht da zu sein. Niemand zwinkerte mir zu, niemand sprach mich an. Abgesehen von der Bedienung. Erst wollte ich einen Kaffee bestellen, schließlich war der Tag noch jung, aber dann spürte ich Leonards verstohlene Blicke zwischen meinen Schulterblättern.
»Ein Hefeweizen«, sagte ich, lauter als notwendig. »Muss sein.«
Nicht nur die Bedienung nickte verständnisvoll, auch die Familienväter ringsum, die mit ihren Gattinnen an Bionade nippten, zwinkerten neidisch. Was machten die eigentlich an einem Werktag um halb elf am Neckar? Lauter Müßiggänger! Die Sonne brannte, Eiswürfel trieben in Kaltgetränken, halb Heidelberg blickte lethargisch auf den Neckar.
Als es hinter mir klapperte, blinzelte ich kurz über die Schulter. Mein Praktikant hatte sein Smartphone fallen gelassen. Mit hochrotem Kopf fischte er es wieder auf.
Dann kam Liebherr. Gemächlich schlurfte er die Treppen zur Terrasse hoch. Er fiel sofort auf, weil er als Einziger auf der gesamten Neckarwiese eine Jacke trug. Ein dünnes Blouson zwar nur, aber trotzdem. Bei 28 Grad im Schatten! Dazu eine blaue Schirmmütze mit Scorpions-Aufdruck, unter der nackenlanges Haar hervorquoll. Rötlich-blonde Koteletten, Hühnerbrust und Wohlstandsbäuchlein. In der Hand eine Plastiktüte. Auf der obersten Treppenstufe blieb er stehen und fixierte mich. Achselzuckend sah ich mich um: kein Platz mehr frei. Liebherr machte eine Kopfbewegung Richtung Spielplatz. Ich stand auf, nahm der Bedienung, die eben angerauscht kam, das Bier vom Tablett, zahlte und folgte dem Typen nach unten. Den ersten Schluck nahm ich im Gehen. Bei 28 Grad schmeckt ein Hefeweizen auch vormittags.
Liebherr schlenderte an den spielenden Kindern vorbei bis zum Neckar. An der Anlegestelle für DLRG-Boote lehnte er sich gegen ein Geländer, von dem die Farbe abblätterte. Ich stellte mich neben ihn, das Glas in der Hand. Sanft plätscherte der Fluss gegen den Steg, über uns spielte der Wind in den Blättern einer riesenhaften Linde.
»Keinen Durst?«, fragte ich.
»Das Labberzeug?« Sein Blick war mehr als geringschätzig. »Bloß nicht.«
»Sie haben recht. Kippe ich es lieber in den Neckar. Aber dann gibt es wieder Ärger mit dem Ordnungsamt wegen der Fische. Also doch trinken.«
»Ich habe einen Auftrag für Sie.«
»Das dachte ich mir.«
»Einen besonderen Auftrag. Nicht das, was Sie sonst machen. Keine Ermittlung, meine ich. Sie sollen etwas an die Öffentlichkeit bringen.«
Jetzt war es an der Zeit, seinen Blick von eben zu imitieren. An die Öffentlichkeit? Ich? Beruf Pressesprecher oder was?
Liebherr kratzte sich im Nacken. Dort, wo seine Haarspitzen auf schwitzende Haut trafen. Was trug er auch im Hochsommer ein Blouson? Labberjacke, genau! »Ich kenne Sie schon lange, Herr Koller«, sagte er. »Verfolge, was Sie so tun. Hab auch gelesen, wie Sie damals den Mord im Theater … Aber egal. Jedenfalls weiß ich, dass Sie ein anderer Typ Ermittler sind als diese Juristen und Versicherungsexperten.«
»Bin ich das?«
»Sie trauen sich, dort hinzugehen, wo es wehtut. Darauf kommt es an.«
Ich drehte mich um und ließ meine Blicke über die Kioskterrasse schweifen. Wer wollte Liebherr da widersprechen? Klang doch prima, was er sagte. Schade, dass mein Prakti das nicht hören konnte! Dort hinten saß er und machte Stielaugen.
»Es geht um Folgendes«, fuhr der Mann neben mir fort. »Nehmen wir den Spielplatz hier. Ist Ihnen das neue Klettergerüst aufgefallen? Gut. Dann drehen Sie sich jetzt mal wieder um und schauen Richtung Südwesten. Die Kräne hinter dem Bahnhof. Haben Sie?«
Ich nickte.
»Jetzt der Yachthafen gegenüber. Da fläzt sich so ein 30-Meter-Luxusschiffchen zwischen all den Minibooten. Und wenn Sie das Klinikgelände dahinter ins Visier nehmen, wird Ihnen ein Altbau mit rotem Dach auffallen. Komplett renoviert, das Ding. Vollmodern ausgestattet. Was ist das Verbindende zwischen all diesen Sachen? Dem Klettergerüst, den Kränen, der Yacht und dem Klinikbau?«
Schweigend nippte ich an meinem Bier. Ein Rätsel kurz nach dem Frühstück. Leonard Untersteller hätte es gefallen. Bestimmt stellte er sich so das Leben eines Privatermittlers vor. Vormittags Rätsel lösen, nachmittags Banditen stellen. »Keine Ahnung«, seufzte ich schließlich.
»Ein Name. Der Name eines Mannes. Er hat all dieses Zeug bezahlt. Es gehört ihm oder er hat es gestiftet. Das und noch viel mehr, was man von hier aus nicht sieht.«
»Schön von ihm.«
»Ja, sehr schön. Deswegen wird dieser Mann auch von allen hofiert. Weil er mächtig ist. Gewissermaßen unangreifbar. Eine Ikone. Über die Jahre hat er ein Netzwerk von Unternehmen aufgebaut, ein Imperium. Aber in seinem Stammhaus, der Firma, die ihn groß gemacht hat, wird gerade ein Betrug aufgedeckt. Oder auch nicht aufgedeckt. Da wurden Gelder unterschlagen, und ich habe die Beweise.«
»Sie?«
Er nickte.
Ich unterdrückte einen Rülpser. »Gratuliere. Aber warum kommen Sie damit zu mir? Gewöhnlich läuft es anders herum, da werden Leute wie ich beauftragt, derartige Beweise erst zu finden.«
»Sie sollen den Skandal öffentlich machen. Wie ich schon sagte.«
Ich schwieg. Meine Augen waren auf den träge fließenden Neckar gerichtet, meine ganze Aufmerksamkeit auf Liebherr. Was war das für ein Typ? Mitte 40, nachlässig gekleidet, noch nachlässiger rasiert. Er roch nach Zigaretten. Zähe Artikulation. In seiner Jugend vielleicht ein cooler Typ, jetzt vor einer ungewissen Zukunft. Sein rechter Daumen strich ohne Unterlass über die rostige Stange. Zwischen seinen Füßen stand die Einkaufstüte.
»Okay«, sagte ich schließlich. »Ich soll also an die Öffentlichkeit gehen. Warum tun Sie es nicht selbst?«
Energisches Kopfschütteln. »Ohne mich, Herr Koller. Ich will nichts mit der Sache zu tun haben. Die Unterlagen bekommen Sie nur, wenn Sie meinen Namen raushalten.«
»Sie könnten mit Ihrem Wissen zur Polizei gehen.«
»Polizei!« Er winkte ab, gab einen verächtlichen Laut von sich. »Die ist doch längst eingeschaltet. Und mit welchem Ergebnis? Am Ende rollen ein paar Köpfe, aber der Hauptverantwortliche kommt ungeschoren davon. Es wäre nicht das erste Mal. Nein, schauen Sie nicht so skeptisch, ich weiß, wovon ich rede. Der ermittelnde Staatsanwalt ist ein Duzfreund unseres Mannes. Die gehen zusammen Golf spielen und solche Sachen. Wir brauchen öffentlichen Druck, nur dann tut sich etwas.«
»Und diesen Druck könnte man mit Ihrem Material aufbauen?«
»Ja, absolut. Es sind interne Mails dabei, die zeigen, dass der Firmenchef von dem Betrug wusste. Ihn wahrscheinlich sogar initiiert hat. Sie können sich ausmalen, dass ich mir dieses Zeug nicht gerade auf legalem Weg besorgt habe.«
»Verstehe.« Ein roter Ball kam vom Spielplatz auf uns zugeschossen. Ich brachte es fertig, ihn zurückzukicken, ohne mir einen Bänderriss zu holen. Der Knirps, der ihn in Empfang nahm, schaute fast beeindruckt.
»Polizei ist nicht«, bekräftigte Liebherr.
»Und die Zeitung? Das wäre doch ein gefundenes Fressen für die Journalisten, und Ihr Name würde …«
Lachend fiel er mir ins Wort. »Super Idee! Wirklich super, Herr Koller. Wissen Sie, was? Ich habe mein Material der Zeitung angeboten.«
»Welcher Zeitung?«
»Den Neckar-Nachrichten. Es geht schließlich um einen Heidelberger Skandal. Und genau das ist der Punkt. Die wollten nicht. Verstehen Sie, die Chefredaktion hat Muffe, es sich mit einem ehrenwerten Bürger der Stadt zu verscherzen.«
»Dann sind Sie an die Falschen geraten. Ich kenne da jemanden, der …«
»Gut! Sehr gut. Deshalb habe ich Sie angesprochen. Ich hoffe, Sie sind erfolgreicher als ich. Wie Sie den Skandal publik machen, ist mir egal. Hauptsache, er schlägt Wellen. In der Zeitung, im Fernsehen, im Radio – egal. Sie können auch Handzettel verteilen. Nur erwähnen Sie meinen Namen nicht.«
»Klingt nach Rachegelüsten Ihrerseits.«
Er grinste schwach. »Nennen Sie es, wie Sie wollen. Ich habe in der betreffenden Firma gearbeitet. Seit einem halben Jahr bin ich arbeitslos. Aber nicht wegen mangelnder Qualifikation.«
»Sondern?«
»Spielt keine Rolle. Wie sieht’s aus? Sind Sie dabei? Dann erkläre ich Ihnen die Details.«
Ich nahm einen Schluck. Verdammt, schmeckte das Hefeweizen lecker! Labberzeug hin oder her. Hoffentlich verging mein Praktikant auf der Terrasse vor Neid. »Klingt interessant«, meinte ich, nachdem ich mir den Schaum von den Lippen gewischt hatte. »Nur: Warum sollte ich es tun? Warum sollte ausgerechnet ich einen Betrug aufdecken?«
»Werbung in eigener Sache.« Liebherr lüpfte seine Scorpions-Mütze, um sich ein paar Haare aus der Stirn zu streichen. »PR-mäßig ist das doch ein Sechser im Lotto. Wenn Sie nicht wollen, versuche ich es woanders. Irgendeiner wird schon anbeißen. Aber Sie wären vom Typ her der geeignete Mann.«
So, wäre ich das? Vergifteter konnte ein Lob kaum sein. He, Leute, wir wühlen da in der Scheiße rum – ruft schon mal den Koller! Andererseits hatte er recht: So ein nettes, hausgemachtes Heidelberger Skandälchen aufzudecken, würde mir Spaß machen.
»Sagen Sie mir erst, um wen es geht. Welchem ehrenwerten Herrn ich da ans Bein pinkeln soll.«
»Also sind Sie interessiert?«
»Fest zusagen kann ich erst nach Sichtung des Materials. Zumindest haben Sie mich neugierig gemacht.«
»Immerhin.«
»Und? Wie heißt der Mensch nun? Kenne ich ihn überhaupt?«
»Ganz bestimmt.« Ein grimmiges Lächeln huschte über Liebherrs Gesicht, bevor er sagte: »Es geht um Lorenz Driehm.«
»Boah«, platzte es aus mir heraus. Dann sagte ich eine ganze Weile nichts mehr.
Kapitel 4
Lorenz Driehm war nicht irgendwer. Er war der gute Mensch der Metropolregion. Der Mäzen, der Stifter, der Krösus, mit einem Wort: ein Samariter der Neuzeit. Über seinen Reichtum kursierten die wildesten Gerüchte. Mit Generika war er groß geworden, aber längst auf allen möglichen Gebieten tätig. Er investierte in Start-up-Unternehmen, kaufte Traditionsbetriebe auf, gründete Firmen in Asien und Südamerika. Medizin, Versicherungen, die IT-Branche, Energieversorger – überall mischte Driehm mit. Seit einigen Jahren setzte er verstärkt auf Baugeschäfte. Natürlich leistete er sich Sportvereine in Brandenburg und Österreich, natürlich betrieb er eine Riesenfinca auf Mallorca und natürlich bewohnte er eine Villa oben am Philosophenweg.
Vor allem aber: Lorenz Driehm war der Retter von Heidelberg.
»Im Zuge der Finanzkrise«, dozierte mein Freund Marc Covet, wobei er meinem Lateinlehrer beängstigend ähnlich sah, »geriet die Erschließungsgesellschaft der Bahnstadt in akute Geldnot. In der Gesellschaft sitzen hauptsächlich Banken. Die haben getan, was alle taten, nämlich in großem Stil Immobilienfonds finanziert, die komplett auf Grund liefen. Und während der Gemeinderat noch stritt, ob und wie geholfen werden sollte, schob Driehm mal eben 100 Millionen über den Tisch. Als günstiges Darlehen, einfach so. Problem gelöst.«
»Einfach so? Ohne Gegenleistung?«
»Offiziell ohne. Driehm sagte, er wolle seine Konzernzentrale in die Bahnstadt verlegen, aus Nostalgie und Heimatverbundenheit, da könne er nicht mit ansehen, wie der neue Stadtteil den Bach hinunterginge. Deshalb die Finanzspritze.«
»Und seine Zentrale?«
»Wird gebaut. Ob er Nachlass beim Erwerb der Grundstücke erhielt, eine Vorzugsbehandlung oder sonst eine Vergünstigung – wer weiß das schon? Aber selbst wenn.« Covets Stimme nahm einen präsidialen Ton an. »Sollte nicht jedem Heidelberger daran gelegen sein, einem solchen Mann den roten Teppich auszurollen? Auch dir, Max Koller!«
Ich kratzte mich am Kinn. »Mir? Was geht mich dieser Typ an?«
»Viel.« Covet ging zum offenen Fenster und wies hinaus wie Napoleon am Tag der Schlacht. »Dort am Horizont blüht und gedeiht sie: die Bahnstadt. Die Zukunft Heidelbergs! Nur sie kann das Gespenst der Raumnot vertreiben, von dem die Perle am Neckar seit Jahr und Tag heimgesucht wird. Ich sehe Wohnungen. Gebäude. Stadthäuser, Penthäuser, Mehrfamilienhäuser. Ein Traum in 3D. Und«, er wandte sich wieder mir zu, »ökologisch korrekt. Alles Passivhäuser.«
»Passiv bin ich selbst«, brummte ich. »Da bleibe ich lieber in meiner zugigen Bergheim-Klitsche.«
»So kann nur ein erzkonservativer Sack sprechen. Ein Fossil. Abgesehen von seiner Konzernzentrale lässt Driehm in der Bahnstadt jede Menge Privatbauten errichten. Dafür hat er ganz kurzfristig den Zuschlag gekriegt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es gibt ja auch keinen Grund für böse Gedanken. Driehm hat nämlich schon angekündigt, seine Wohnungen billiger anbieten zu wollen als die Konkurrenz. Ob Miete oder Kauf: Bei Lorenz Driehm wohnst du zum Schnäppchenpreis.«
»Und warum ist er günstiger? Etwa, weil er günstiger bauen konnte? Etwa, weil die Stadt hier und da ein Auge zugedrückt hat?«
»Das kann dir doch egal sein.« Covet zog einen Stuhl heran und setzte sich neben mich. »Hauptsache, alle sind neidisch auf dich. Weil du in einer Traumstadt wohnen wirst. In Dreamcity. Und das auch noch für kleines Geld.«
»Dreamcity!« Ich rollte mit den Augen.
»Da staunst du, was? Das Segment der Bahnstadt, das Lorenz Driehm bebaut, wird so heißen. In ein paar Tagen ist offizielle Einweihung. Spatenstich mit Minister und allem Pipapo.«
»Du verarschst mich.«
Marc verschränkte die Arme vor der Brust und schaute beleidigt.
»Driehm City«, rief ich. »Wer denkt sich so was …«
»Nicht Driehm. English speaking, Sir: Dream! Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Lorenz Driehm in seiner grenzenlosen Bescheidenheit würde es niemals zulassen, dass ein Stadtteil nach ihm benannt würde.«
»Das glaube ich erst, wenn es in der Zeitung steht. Aber nicht in deiner.«
Verstimmt sah mich Covet an. Dann schnellte er aus seinem Stuhl, riss die Tür auf und brüllte »Knuppe!« durch den Redaktionsflur. Ein junger Kerl erschien, nickte mir zu und wartete auf Anweisung. Die auch prompt kam.
»Wie soll der neue Teil der Bahnstadt heißen, Knuppe?«, blökte Covet ihn an.
»Dreamcity. Wieso?«
»Wann dürfen wir die Katze aus dem Sack lassen?«
»Erst am Wochenende.«
»Und warum, Knuppe?«
»Befehl von oben.«
»Abtreten, Knuppe.«
Folgsam trollte sich der junge Mann. Covet schloss die Tür und nahm wieder Platz.
»Ein Praktikant?«, fragte ich.
»Freier Mitarbeiter. Glaubst du es jetzt?«
»Dreamcity. Das kapiert sogar der amerikanische Tourist.« Mir kam Christine in den Sinn. Immer, wenn in unserer Altbauwohnung mal wieder der Putz von den feuchten Wänden bröselte, träumte sie sich ein Penthouse in der Bahnstadt herbei. Mit neuer Küche und Kinderzimmer. »Dann such dir schon mal einen Mann für das Kind«, pflegte ich solche Spinnereien vom Tisch zu fegen.
»Was ist nun?«, fragte Marc. »Zeigst du mir die Unterlagen oder nicht?«
Ich drückte ihm Liebherrs Plastiktüte in die Hand. Für mich hatte das Ding jetzt schon Kultstatus. Es färbte ab, wenn man Schweißhände hatte! Und die hatte man in dieser Jahreszeit immer.
Der Inhalt der Tüte war allerdings auch nicht ohne. Marc begann, ihn auf seinem Schreibtisch auszubreiten.
»Da sind ja alle Namen geschwärzt«, moserte er.
»Alle bis auf einen.« Ich tippte auf den Absender einer E-Mail. »Hier: Driehm, Lorenz.«
»Warum gibt man dir überhaupt Ausdrucke? Papier statt USB-Stick, das ist doch vorsintflutlich!«
»Weil sich mein Informant das alles nach und nach zusammensuchen und dabei unterschiedlich vorgehen musste. Hier eine Kopie, da ein Ausdruck. Was er als Datei hat, mailt er mir zu, sobald ich anbeiße. Dann natürlich ungeschwärzt.«
»Und worum geht es jetzt? Du kannst doch von mir nicht verlangen, dass ich auf einen Blick …«
»Marc.« Ich nahm ihm die Blätter aus der Hand und schob sie wieder ordentlich zusammen. »Jammer nicht rum, sondern hör mir zu. Auch wenn ich von diesen Dingen null Ahnung habe, versuche ich es dir so zu erklären, wie ich es verstanden habe. So, wie es Liebherr mir auf der Neckarwiese erzählt hat. Also: Driehm hat vor einigen Jahren beschlossen, Teile seiner Firma auszulagern. Aus Kostengründen.«
»Welcher Firma?«, knurrte Covet.
»Driehm Pharma, sein Stammunternehmen. Steht doch hier überall. In Heidelberg waren nur ein paar Stellen davon betroffen, anderswo, in Sachsen zum Beispiel, wurde eine ganze Abteilung dichtgemacht. Forschung und Testreihen, so was in der Art. Diese personalintensiven Aufgaben wurden an Externe vergeben, und zwar an Unternehmen, mit denen man schon vorher zusammenarbeitete. Macht Sinn, oder?«
Marc schwieg.
»Außerdem«, fuhr ich fort, »hat man nicht beliebig viele Unternehmen damit betraut, sondern möglichst wenige: um die Übersicht zu behalten, die Konstanz zu wahren, den Informationsfluss kontrollieren zu können und so weiter. Ebenfalls sinnvoll, stimmt’s?«
Covet grunzte. Jetzt war ich der Lateinlehrer. Was ihm überhaupt nicht passte. Personalintensiv! Informationsfluss! Ja, auch ein Studienabbrecher schwingt zuweilen die ganz große Vokabelkeule.
»Im Endeffekt blieb ein einziges Unternehmen übrig, von dem Driehm Pharma ab sofort Forschungsknowhow, Testergebnisse und all das bezog. Ein Betrieb in China. Und auf deutscher Seite gab es einen Typen, der für den Kontakt mit den Chinesen zuständig war. Ein ziemlich hohes Tier offenbar, eine Ebene unter der Firmenspitze. Der hier.« Ich tippte auf einen der geschwärzten Namen.
»Senior Vice President!« Marckringelte sich.»Ein Kinderspiel, rauszukriegen, um wen es sich da handelt. Gib mir fünf Minuten, Max, ich renne rüber zu den Wirtschaftskollegen, die werden mir …«
»Weiß ich doch. Liebherr sagte mir, dass der Name kein großes Geheimnis ist. Um diesen Mann geht es ihm auch nicht. Sondern um Driehms Anteil an der Sache. Hör lieber weiter zu. Der Typ hier, der Kontaktmann zu den Chinesen, fädelte folgenden Deal ein: Er sorgte dafür, dass aus einem kleinen Labor vor Ort ein richtig großes Unternehmen wurde – es musste ja groß sein, um exklusiv für Driehm Pharma arbeiten zu können. Statt zehn oder 20 Angestellten waren es plötzlich mehrere 100. Dazu brauchte er natürlich einen Vertrauten in Peking. Der wiederum bugsierte einen Strohmann an die Spitze der neuen Firma, und schon hatte man eine Lizenz zum Gelddrucken. Denn was die chinesischen Angestellten verdienten, war die eine Sache, was man Driehm Pharma in Rechnung stellte, eine völlig andere. Die Differenz strichen der Deutsche und sein chinesischer Partner ein.«
»Und die war erheblich?«
»Sogar sehr. Es ging wohl um den Faktor 4 bis 5. Hinzu kam, dass die meisten Angestellten junge KP-Mitglieder waren, die keine Fragen stellten, um ihre Karriere nicht zu gefährden. Auch bei Driehm Pharma gab es keinen Anlass für Nachfragen. Dort war man zufrieden, dass die Umstellung so reibungslos funktioniert hatte.«
»Aber was hat Driehm mit der Sache zu tun?«
»Genau das ist das Problem. Liebherr meinte, der Betrüger, unser Senior Vice President hier, würde über kurz oder lang hinter Gitter wandern. Da seien bereits Ermittlungen im Gange. Aber für ihn, Liebherr, sei es undenkbar, dass der Deal nicht vom Vorstand abgesegnet worden sei. Also von Driehm persönlich.«
»Und das beweisen diese Unterlagen hier?«
»Wäre zu prüfen. Liebherr behauptete es, klang aber nicht sehr überzeugend.« Ich zog ein Blatt aus dem Konvolut. »Hier, nur als Beispiel. Da schreibt Driehm, unser Unbekannter solle die Sache mit Peking schnellstmöglich in Ordnung bringen. Er könne sonst für nichts garantieren und so weiter. Was heißt das nun? Wusste Driehm von Anfang an Bescheid oder versucht er nur, den Schaden für die Firma zu begrenzen? Solche Mails gibt es viele. Dann ein Reiseprotokoll Driehms in China und jede Menge Abrechnungen, die ich nicht kapiere.«
»Hm.« Covet griff nach dem Stoß Blätter und wog sie abschätzend in der Hand. »Dann mache ich mir mal eine Kopie von dem Zeug und berate mich mit einem Kollegen. Aber ich sage dir gleich, Max: Solange wir keine hieb- und stichfesten Beweise gegen einen Lorenz Driehm haben, wird sich hier keiner aus dem Loch trauen. Keiner!«
»Du auch nicht?«
Er zuckte mit den Achseln. »Ich bin Journalist, kein Träumer. Selbst wenn ich demnächst in Dreamcity leben sollte.«
Kapitel 5
Natürlich war Marcs letzte Bemerkung nur ein Scherz gewesen. Trotzdem ging sie mir noch eine ganze Weile durch den Kopf. Mit seiner Kulturbeflissenheit und snobistischen Anwandlungen passte mein Journalistenfreund viel besser in Heidelbergs schöne neue Immobilienwelt als die Exfrau eines windigen Ermittlers, keine Frage. Und auf wen würde er dort treffen? In der Bahnstadt sollten schon ganze Straßenzüge fertiggestellt sein, aber ich kannte niemanden, der dort lebte. Niemanden, der einen Umzug erwog. Wer also? Leute von außerhalb vermutlich, Familien aus dem Speckgürtel der Stadt, die endlich eine Chance sahen, zu echten Heidelbergern zu werden. Auch wenn man das Schloss von der Bahnstadt aus nur mit dem Fernglas sah.
Dreamcity … Da hielt einen ja schon der Name ab!
»Wo wohnt ihr eigentlich?«, fragte ich Leonard.
»In der Weststadt.«
»Und was machen deine Eltern beruflich?«
»Meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater Mathe-Prof. So, jetzt hab ich’s.« Er drehte den Monitor meines PCs in meine Richtung. Ich erkannte die Terrasse des Neckarwiesenkiosks, mich mittendrin.
»Bisschen überbelichtet. So ein Smartphone hat seine Grenzen, findest du nicht?«
»Ich hab alle Gäste drauf, wirklich alle. Hier die linke Hälfte«, er rief das nächste Foto auf, »dann die rechte«, nächstes Foto, »und jetzt auch noch den Typen ganz außen.«
»Entsetzlich«, murmelte ich. So sah ich also von hinten aus! Die haarlose Stelle auf meinem Hinterkopf war mir neu.
»Wie bitte?«
»Mach weiter.«
»Hier bestellen Sie gerade Ihr Bier. Die Bedienung hat übrigens vorletztes Jahr bei uns Abi gemacht.« Bekümmert klickte er weiter. »Erkannt hat sie mich aber nicht.«
»Wie schade«, hauchte ich mitleidig.
Er sah mich groß an.
»Mensch, Junge! Sei froh, dass sie dich nicht erkannt hat. Du solltest verdeckt ermitteln, klar? Bist du nun mein Praktikant oder nicht?«
»Naja, schon. Aber was spielt es für eine Rolle, ob sie mich kennt oder nicht?«
»Eine erhebliche. Du willst doch ein gutes Zeugnis, ja? Also Obacht!«
Leonard nickte eingeschüchtert. Das mit dem Zeugnis war eine prima Idee. Immer noch das schlagkräftigste Argument in unserer gymnasialen Leistungsgesellschaft. Was ich da für Sachen reinbuttern würde! Gebrauch der Wasserpistole: zackig. Arbeitskleidung: ungenügend (Poloshirt!). Demut und Gehorsam: verbesserungswürdig.
»Warum grinsen Sie so?«, fragte der Knabe.
»Nix. Weiter.«
»Da kommt Liebherr. Sie haben Blickkontakt«, klick, »stehen auf«, klick, »bezahlen«, klick, »gehen mit ihm zum Neckar runter.«
»Dass du keine Fingerlähmung bekommen hast, bei der Dauerknipserei!«
»Sie sollten kein Bier vor dem Mittagessen trinken«, entgegnete er finster. So allerliebst finster, wie nur Mädchen schauen konnten.
Ich lachte.
»Gucken Sie mal hier. Der Mann am Rand der Terrasse. Der benahm sich richtig auffällig, sah immer zu Ihnen beiden rüber.«
»Der wollte auch so ein kühles Weizenbier, aber seine Frau saß daneben.«
»Das ist nicht seine Frau. Die haben kein Wort miteinander gewechselt. Schauen Sie, auf jedem Bild glotzt er rüber zum Neckar.«
»Du meine Güte, wie viele hast du denn noch geschossen?«
»Da auch. Und hier wieder!«
»Okay. Superverdächtig, der Typ. Den merke ich mir. Sei froh, dass er dein hübsches Smartphone nicht in seinen Pranken zerquetscht hat.«
»Sie nehmen mich nicht ernst.«
»Dir fehlt die Erfahrung, das ist alles. Wo du schon mal am PC sitzt: Leg einen neuen Ordner mit der Driehm-Geschichte an. Da kannst du deine Fotos unterbringen und den Bericht über heute.«
»Wo ist der Bericht?«
»Den schreibst du. Arial, 12 Punkte. Denk an dein Zeugnis, Leonie!«
»Leonard!« Er fuhr regelrecht auf.
Ich grinste. Der Mädchenname war mir einfach rausgerutscht. Aber er passte perfekt. Leonie, die Löwin aus der Weststadt! Eine Seele von Raubkatze. Aber wehe, etwas geht ihr gegen die Praktikantenehre! Dann fährt sie die Krällchen aus!
»Leonard, natürlich«, nickte ich. »Wie konnte ich das vergessen? Jedenfalls freue ich mich auf den Bericht. Der erste, den ich nicht selbst schreiben muss. Und dann habe ich noch einen Spezialauftrag für dich. Mein Freund Covet gibt seit einiger Zeit meine spektakulärsten Fälle als Buch heraus. So eine Mischung aus Fakten und Fiktion, darauf stürzen sich die Leute. Du könntest die Satzfahnen meines dritten Falles Korrektur lesen.«
»Korrektur lesen?« Ein Mundwinkel zeigte nach unten.
»Du kannst doch lesen?«
»Nach fehlenden Kommas suchen ist nicht gerade das, was ich mir unter einem Praktikum bei Ihnen vorgestellt habe.«
»Was hast du dir denn vorgestellt? Stopp, ist vielleicht besser, wenn ich es nie erfahre. Du kennst doch die Steigerung von Praktikum? Praktikummer, genau. Also mecker nicht rum, sondern leide still.«
»Und wann gibt es mal was zu essen?«
»Essen?« Er hatte recht. Ein neuralgischer Punkt. Ohne Essen geht der härteste Praktikant zugrunde. Von seinem Chef ganz zu schweigen. Am Neckarwiesenkiosk hätte man sich verpflegen können, aber da gab es anderes zu tun. Also lud ich meinen Mitarbeiter zum Einstand feierlich ein. Vielleicht nicht in das edelste, dafür ins nächstgelegene Etablissement von Bergheim.
»Döner«, stellte er fest, als wir die Bude betraten.
»Sag bloß, du magst keinen?«
»Weiß nicht. Man stinkt so aus dem Mund danach.« Gönnerhaft fügte er an: »Aber solange es Pommes gibt …«
»Gibt es. Für mich einmal das Mundgestinke bitte!«
Der Typ am Drehspieß nickte und schliff schon mal sein Messer. Ich war Dauergast, da konnte ich mir solche Bemerkungen leisten. Leonard entschied sich für eine doppelte Portion Pommes mit Ketchup extra. Und ich muss sagen, was er sich an roter Schmiere über seine Fritten kippte, war drei Mal ekliger als sämtliche Stinkbomben in meinem Klappbrötchen.
»Warum bestellst du dir keine Ketchupflasche und trinkst sie aus?«, sagte ich. »Das ist ja pervers!«
Er wischte sich einen Klecks aus dem Mundwinkel. »Pervers? Nee, notwendig. Pommes ohne Ketchup geht gar nicht. Das wäre ja wie …« Er überlegte.
»Wie Schule ohne Praktikum? Wie ein Detektiv ohne Waffe?«
»Wie ein Handy ohne gescheiten Klingelton. Ihres braucht dringend eine Nachrüstung.«
Ich stoppte mitten im Kauen. Keine Ahnung, was ich für einen Klingelton hatte. Es klingelte halt. Elektronisch irgendwie. Hatte ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
»Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht«, sagte ich.
»Sollten Sie aber. Ist ja auch eine Art Markenzeichen. Was Persönliches.«
»Dudel dudel ist nichts Persönliches.«
»Ich stelle Ihnen etwas ein, darf ich?« Schon wieder landete ein Striemen Ketchup neben seinem Mund. »Was würde Ihnen denn gefallen? Vielleicht was von Ihrer Frau? Ich hatte mal Lenas Schnarchen drauf, das war verboten cool.«
»Lenas Schnarchen? Kein Wunder, dass ihr nicht mehr zusammen seid. Außerdem kennst du Christines Gesäge nicht. Das hält kein Handy aus.«
»Tiergeräusche sind auch klasse.«
»Elefant?«
»Ja, zum Beispiel. Oder Frösche.«
»Okay.« Ich leckte mir etwas Knoblauchsoße vom Daumen. »Die Ferkel vom Grumbachhof. Dort essen wir manchmal, Christine und ich. Wenn du die auf mein Handy kriegst, gut. Ansonsten: Finger weg. Und jetzt ein anderes Thema, bitte.«
»Der Nutzen von Ketchup im Detektivalltag?«, grinste er.
Okay, ich sah schon, den Jungen musste man hart rannehmen, sonst kam er auf dumme Gedanken. Die restlichen Nachmittagsstunden vergingen wie angekündigt: Erst arbeitete sich Leonard am Neckarwiesenbericht ab, dann an Covets Manuskript. Von den Toten auf dem Uniplatz damals habe er gehört, sagte er – aber: »Da war ich noch jung.«
»Jetzt dagegen …«, nickte ich.
Still las er weiter.
Später kam es noch zu einer drolligen Begegnung mit meiner Ex. Ich wollte Leonard eben nach Hause schicken, da stand Christine in der Tür. Sie zog beide Brauen nach oben, als sie hörte, in welcher Funktion der Junge hier war.
»Liebe Güte«, sagte sie. »Du hast einen Praktikanten? Ja, kannst du das denn?«
»Chef kann ich.«
»Aber der Rest? Menschenführung, Ausbildung, psychologische Betreuung?«
»Für einen Schuljungen, der Ketchup am Kinn hat, reicht’s.«
Hastig wischte sich Leonard über das Gesicht. Christine lachte.
»Sei ein bisschen netter, Max, sonst hast du bald nicht nur eine Exfrau, sondern auch einen Expraktikanten.«
Leonard ließ den Arm sinken. »Sie sind seine Exfrau? Aber warum leben Sie dann zusammen?«
»Tun wir das?« Sie warf mir einen spöttischen Blick zu.
Ich schüttelte den Kopf. »Im besten Fall nebeneinander her. Friedliche Koexistenz nennt man es im Politikerjargon.«
»Privilegierte Partnerschaft«, korrigierte Christine.
»Träum weiter. Es hat sich halt so ergeben. Soll auch steuerlich günstiger sein. Wenn ich endlich einmal schwarze Zahlen schreibe, werde ich es wissen.«
»Jetzt träumst du.« Christine klimperte mit den Lidern.
»Wir leben ja auch im Dunstkreis von Dreamcity. Bis morgen, Leonard!«
»Bis morgen, Chef.«
Kapitel 6
Ja, bis morgen. Wer hätte gedacht, dass sich die Generation Praktikum einmal vor meinem Büro drängeln würde! Okay, ›drängeln‹ klang in diesem Zusammenhang etwas sehr perspektivisch, aber Leonard mit seinem mädchenhaften Klopfen war ein Anfang. Wenn sich das erst rumsprach!
Die Pommes jedenfalls hatten ihm geschmeckt.
Auch beim Abendessen war Leonard Untersteller noch Thema. Mit Christine erwog ich das Für und Wider heutiger Arbeitswelten, wie es um den Nachwuchs unseres Landes bestellt war, ob die 16-Jährigen bald alle unter smartphonedegenerierten Fingerkuppen litten und so weiter. Was Leute in unserem Alter halt so erörtern. Aber komisch, irgendwie war meine Ex nicht recht bei der Sache. Unaufmerksam. Abgelenkt. Bloß wovon? Von mir bestimmt nicht, ich war ungehobelt wie immer. Ständig wanderte ihr Blick zum Kalender an der Pinnwand. Hatte sie noch etwas vor?
Aber wenn, war ich der Letzte, der sie deswegen löchern würde.
»Ich pack’s dann mal«, gähnte sie schließlich.
»Ich pack mit.«
Kurze Zeit später lagen wir beide, Exmann und Exfrau, friedlich schlafend in unserem Exehebett – als das Telefon schrillte. In Wahrheit schrillte es natürlich nicht, kein modernes Telefon tut das, sondern es dudelte elektronisch, und das war schlimmer als jedes Schrillen. Ganz klar, da musste ein neuer Klingelton her. Das hier war akustischer Sondermüll. Der sich in deine Träume einnistete. Mein Traum ging so: Ich fuhr mit Fatty den Tourmalet hoch. So, wie wir es vor Dekaden getan hatten: Bier auf dem Gepäckträger, die Zunge knapp über dem Asphalt. Zu unseren Füßen die Schlachtrufe der Tour: Allez, Virenque! Go, Armstrong, go! Armdick in Weiß auf die rissige Straße gepinselt. Wenn nun ein Telefon geschrillt hätte, wären wir beide den Berg hinunter gepurzelt. Stattdessen suchte ich nach einem Murmeltier im Delirium.
Dudel dudel.
Oder war das Fatty, der aus dem letzten Loch pfiff? Seine Miene sprach dafür. Ignorieren. Dudel. Nächste Serpentine. Dudel. Verdammt, das Geräusch nervte! So würden wir die Passhöhe niemals …
»Wer ruft denn um diese Zeit an?«, moserte meine Ex neben mir.
Nun war ich wach. Christine hatte es geschafft. Ich sprang aus dem Bett, stürzte ins Wohnzimmer und riss das Telefon aus der Basisstation.
»Ja?«, blaffte ich den Anrufer an.
Es war kein Anrufer. Sondern eine Anruferin: die nette Frau Boskop aus dem ersten Stock. Sie entschuldigte sich auch sofort wegen der Störung, sie wisse ja selbst, die Uhrzeit, herrje, ach Gottchen, aber: bei mir werde gerade eingebrochen.
»Bitte?« Ich sah mich um. Das Wohnzimmer: still. Unser Schlafzimmer: still. Die ganze Wohnung: dunkel und still. Nirgendwo das Zipfelchen eines Einbrechers.
»Unten in Ihrem Büro«, rief Frau Boskop bebend. »Da ist jemand!«
Mit dem Telefon am Ohr lief ich in die Küche zum offenen Fenster, obwohl ich genau wusste, dass ich von dort keinen direkten Blick auf den Schuppen hatte. Nur einen Teil des Dachs konnte ich erkennen. Alles ruhig im Hof.
»Sind Sie sicher, Frau Boskop?« Die alte Dame war jenseits der 70, vielleicht schon 80, und auch wenn sie bislang keinerlei Anzeichen von Verwirrtheit gezeigt hatte – so etwas konnte schnell gehen. Über Nacht sozusagen. Ich schaute auf meine Uhr: halb zwei.
»Ich habe Licht gesehen«, erklärte sie. »Von Taschenlampen.«
»Okay. Ich komme runter.«
Christine ein paar Worte der Beruhigung zuwerfend, zog ich mir T-Shirt und kurze Hose über und verließ die Wohnung. Barfuß tappte ich hinunter bis in den ersten Stock, wo die alte Frau Boskop angstschlotternd in der Tür stand.
»Jetzt ist alles still«, flüsterte sie. »Vielleicht haben die mich am Fenster gesehen und sind abgehauen.«
Ich unterdrückte die Frage, ob ich von ihrer Wohnung aus einen Blick auf den Schuppen werfen dürfte. Bestimmt hatte sie am Schlafzimmerfenster gestanden, neben dem Bett ihres Mannes, der nicht annähernd so fit war wie sie.
»Und Sie haben sich auch nicht getäuscht, Frau Boskop?«
Sie schüttelte den Kopf. »Bei dieser Hitze kann ich nicht schlafen. Liege oft wach und hole mir ein Glas Wasser aus der Küche. Da sah ich plötzlich Licht in Ihrem Büro. Hin und her«, sie führte es mit einer Hand vor, »hin und her, immer wieder.«
»Dann werde ich mal nachschauen.«
»Sind Sie bewaffnet?«
Ich unterdrückte ein Lachen. Diese Frage hätte ich eher meinem Praktikanten zugetraut! Solange ich als Ermittler arbeite, habe ich noch keine Waffe besessen.
»Nehmen Sie das hier, Herr Koller.«
Jetzt konnte ich das Lachen nicht mehr verhindern. Da drückte mir die alte Dame tatsächlich eine Teigrolle in die Hand! Dunkles Holz, kaum jünger als sie selbst.
»Frau Boskop, bitte …«
»Nehmen Sie schon!«
»Wie soll ich mit so einem …?«
»Besser als nichts.«
»Sie wollen doch morgen noch Kuchen backen.«
»Ohne lasse ich Sie nicht gehen!«
Ich verzichtete auf die Frage, wie sie mich zurückhalten wolle, und schlappte los. Mit einem Grinsen im Gesicht und ihrer Teigrolle in der Hand. Hoffentlich schaute Leonard Untersteller jetzt nicht vorbei. Der würde mir meine Vollholzwaffe mit seiner Wasserpistole glatt aus der Hand schießen!
Okay, Schluss mit lustig. Ich hatte das Erdgeschoss erreicht. Haustür oder Hintertür? Da ich keinen Schlüssel eingesteckt hatte, entschied ich mich für Letztere. Schob die beiden Riegel vorsichtig beiseite und drückte die Tür auf. Ganz ohne Geräusch ging es nicht. Egal, raus in den Hof. Eine laue Sommernacht. Unter meinen nackten Sohlen das angenehm kühle Kopfsteinpflaster. Am diesigen Himmel kein Mond. Der Schuppen war ein dunkler Klotz.
Ich wartete. Nichts. Da war niemand. Das Licht von Taschenlampen wollte Frau Boskop gesehen haben. Vielleicht hatte sich der Mond in den Scheiben gespiegelt. Nein, stand ja kein Mond am Himmel. Und das mit dem Einfallswinkel passte auch nicht. Trotzdem, alles war ruhig. Völlig ruhig.
»Na, dann woll’n wir mal«, sagte ich zu der Teigrolle, während ich sie abschätzend in den Händen wog. Hoffentlich beobachtete mich keiner.
Ein paar Schritte über den Hof, und ich stand vor der Tür des Schuppens. Warten. Lauschen. Immer noch nichts. Ich linste zum ersten Stock hoch, ob vielleicht Frau Boskop vom Schlafzimmerfenster aus meinen Bewegungen folgte … Auch dort keine Regung.
Also weiter im Text. Jetzt war die Türklinke dran. Heute Nachmittag, beim Verlassen des Büros, hatte ich abgeschlossen. Hatte ich? Ich schloss doch immer ab. Fast immer jedenfalls. Sofern ich es nicht vergaß oder Abschließen spießig fand oder einen in der Krone hatte.
Klar hatte ich abgeschlossen. Ich drückte die Klinke in Zeitlupentempo nach unten … gab der Tür einen leichten Schubs … sie schwang auf.
Auf!
Ein Schwall abgestandener Volierenluft schwappte mir entgegen. Abgestanden, weil die Fenster geschlossen waren. Und zwar alle. Aber die Tür war auf, verdammt!
Max Kollers Vergesslichkeit?
Oder doch Einbrecher?
Halb zwei, und ich war hellwach. Von den nackten Zehen bis zum Resthaar auf meinem Ermittlerschädel. In der Hand Frau Boskops Teigrolle. Vor mir die spaltoffene Schuppentür. Der dünne Mief uralter Sittichkacke. War die Tür aufgebrochen worden? Um das herauszufinden, hätte ich eine Taschenlampe gebraucht.
Und jetzt?
Stocksteif stand ich da. Trotz Teigrolle unbewaffnet. Kein Geräusch, nirgends. Ich mochte wetten, dass das Büro menschenleer war. Die Einbrecher: längst getürmt. Als sie merkten, dass die alte Boskop ihnen auf der Spur war: Abflug. Und jetzt erst der Koller! Der Privatflic, dem die Praktikanten die Bude einrannten! Heute mit Spezialwaffe!