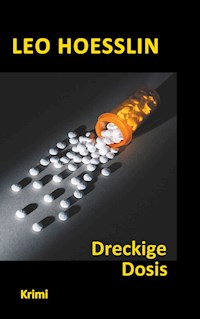
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Fitness-Studio bekommt Felix Moosburger, wissenschaftlicher Assistent an der Fachhochschule Vorarlberg, eine Auseinandersetzung zwischen Bodybuildern mit. Tage später verunglücktein Beteiligter schwer mit seinem Motorrad. Felix besucht den Verletzten in der Reha-Klinik; am darauffolgenden Tag ist der Bodybuilder tot. Felix bezweifelt, dass der querschnittsgelähmte Sportkamerad mit seinem Rollstuhl versehentlich die Kellertreppe hinabgestürzt war. Da die Polizei den Treppensturz als Unfall ansieht, wird Felix aktiv. Auf den Spuren eines kryptischen Tattoos tritt er nicht nur rechtsradikalen Kreisen und dubiosen Importeuren auf die Zehen. Zu allem Überfluss bekommt ihn außerdem ein süddeutscher Unterweltboss in die Fänge. Nun reitet Felix den Tiger.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Hedwig
Inhaltsverzeichnis
Duschgel
Dropse
Detektive
Domains
Durchbruch
Drecksäcke
Dresche
Ducki
Dobříš
Durchschlagen
Desaster
Dauerfeuer
Deutschrock
Devot
Degradiert
Duell
Doppelspiel
Dokumente
Durchsuchung
Dank
Durchhalten
Doping
Doppelmoral
Detektor
Demaskiert
Diabolus
Dagobert
Dankbarkeit
Drogentote
Dumm gelaufen
Dumas
Demaskiert
Delikt
Da-damm-da-da
Doctor Doctor
1. Duschgel
Verschwitzte Männerkörper schälten sich aus hautengen Shirts und Transtex-Hosen und schlurften aufreizend langsam im Adamskostüm, mit Handtüchern und Hygieneartikeln bewaffnet, Richtung Gemeinschaftsdusche. Die Männerumkleide des Fitness-Studios war testosterongeschwängert wie ein Angus-Stier auf Brautschau. Es roch darin auch so ähnlich, obwohl ich zugeben muss, nie einem Angus-Stier nahegekommen zu sein. Auch optisch ähnelte manch Zeitgenosse dem Prachtrind, was bei den meisten gewollt war, da beabsichtigte Folge intensiven Krafttrainings. Mich ließ diese Form der Körperkultur kalt, weil ich nicht zu den Muskelakrobaten gehörte, obwohl ich zweimal wöchentlich unter ihnen weilte und im selben Raum Gewichte lupfte.
Wie so oft, verausgabte ich mich im Training, als ginge es um die Weltmeisterschaft. Zunächst schlauchte die Einheit im Selbstverteidigungskurs. Unser Ausbilder, ehemaliges Mitglied der österreichischen Spezialeinheit ‚Cobra‘, brachte den Kursteilnehmern erlaubte und unerlaubte Tricks gegen diverse Angriffe bei. Heute hatte er anscheinend miese Laune gehabt und sie an uns Eleven ausgelassen, was Muskeln und Sehnen schwer verübelten. Nicht genug damit, anschließend gab ich mir im angrenzenden Fitness-Studio die Kante. Stemmte dort zusätzlich Eisen, wie ich es seit knapp drei Jahren annähernd regelmäßig tat, als ich mit dem Kurs in klassischen und modernen Techniken des Straßenkampfs begonnen hatte.
Die anschließenden Schnellkraftübungen im Fitness-Club waren grundsätzlich in Ordnung, nur die Klientel des Etablissements sagte nicht zu hundert Prozent zu, weil ich nicht auf deren Gehabe und Figur aus war. Fast alle Eisenstemmer waren männlich, Pi mal Daumen in meinem Alter plus minus zirka zehn Jahre. Hier liefen nur wenige schöngeistige Vertreter unseres Geschlechts herum, eher war der Typ Türsteher oder Rammbock vertreten, und mit dem wollte ich wahrlich nichts zu tun haben. Doch was soll’s? Die Möglichkeit, für einen geringen Aufpreis zusätzlich trainieren zu können, machte die Gegenwart der Protze einigermaßen erträglich.
Hinter der Umkleide quoll der Duschraum zu Babel gegen Ende der Öffnungszeit förmlich über. Heute zögerte ich die Dusche nicht etwa wegen des darin herrschenden europäischen und vorderasiatischen Sprachgewirrs hinaus, denn die kulturelle Vielfalt der Sportkameraden war durchaus interessant. Vielmehr hielten mich praktische Gründe vom Waschen ab. Alle Brausen waren belegt, und ich wollte nicht wie Klein-Doofie hinter nackten Männerrücken anstehen. So enterte ich das letzte Refugium kollektiver männlicher Eitelkeit – nach Minze riechende Shampoos hier, puffähnliche Deos und Cremes dort – erst, als sich die meisten gesäuberten Muskelmänner vor ihren Spinden in körperbetonende Freizeitkluft zwängten.
Nach dem Duschen ging sich noch eine Runde in der angrenzenden Sauna und ein wenig Relaxen im Ruhebereich aus. Wie so oft diente zur Entspannung eine abgeschiedene Plastikliege hinter dem Saunablock. Die überdurchschnittliche Anstrengung des heutigen Trainings musste mich ermüdet haben, denn plötzlich schreckte mich eine heftige Auseinandersetzung aus wirren Träumen auf.
Kein Wort zu verstehen. In einer mir unbekannten Sprache – slawisch, südwestindisch oder lustenauerisch – stritten drei Kerle miteinander. Nicht ein bekannter Ausdruck war herauszuhören. Dafür hatte es der Tonfall in sich, in dem sich die Leute auf der anderen Seite der Sauna gegenseitig anmachten. Eine Diskussion über die aktuelle Matisse-Ausstellung in Lindau dürfte sich anders angehört haben. Ohne Zweifel standen die Streithähne unter Hochspannung.
Möglichst geräuschlos hob ich den Kopf, um durch die Seitenfenster der Sauna einen Blick auf die Szene zu erhaschen. Unter mir knarrte die Plastikliege. Ich erstarrte in halber Hocke.
Was sich abspielte, war nicht genau zu erkennen. Es schien nur eine verbale Auseinandersetzung zu sein, allerdings wurde sie heftig geführt. Zwei große Brecher hatten einen mittelgroßen in die Zange genommen, wobei der rechte Hüne, ein Angeber mit blondiertem Bürstenschnitt, das Wort führte und sein Kompagnon den Mittelgroßen mit einer Boxgeste bedrohte. Die aggressiven Muskelmänner wedelten mit Händen groß wie Torwarthandschuhe. Am Bizeps des Linken zuckte bei jeder Bewegung ein skurriles Tattoo. Die beiden Großen hatte ich hier noch nie gesehen. Der von ihnen hitzig angegangene Typ gehörte dagegen zum lebenden Inventar des Fitness-Studios.
Mich hatten sie nicht entdeckt, also sank ich vorsichtig zurück. Nichts hören, nichts sehen, und sich auf keinen Fall einmischen schien hier angesagt. Ich war nicht besonders stolz auf mich, spürte aber auch kein Verlangen, von den Kerlen als Blitzableiter benutzt zu werden. So ist es mit der grundsätzlich vorhandenen menschenfreundlichen Moral: Auch die ehrenhafteste Haltung findet ihre Grenzen, wenn das eigene Gut höher eingeschätzt wird als das fremde. Um nicht wegen innerer Widersprüche Magengeschwüre zu bekommen, redete ich mir ein, auf jeden Fall einzuschreiten und dem mittleren Sportkameraden beiseite zu stehen, sollten die beiden anderen handgreiflich werden. Gleichzeitig hoffte ich, dieser Fall möge nie eintreten.
Kurze Zeit später verdiente der Ruheraum wieder seinen Namen; die Streithähne hatten sich verzogen. Ich wartete, bis die klappende Eingangstür zur Umkleide signalisierte, dass ich der Letzte war, huschte zum Spind und zog mich in Nullkommanichts an. Zwei Minuten bevor das Studio schloss trat ich den Heimweg an. Langsam wurde es Zeit, denn es war schon gegen zweiundzwanzig Uhr. Die Heimfahrt würde eine Dreiviertelstunde dauern, und bevor es ans Schlafen ging, wollte ich zu Hause noch essen und wenigstens ein paar Worte mit meiner Verlobten wechseln.
Auf dem schummrigen Parkplatz hinter dem Studio trafen wir uns wieder. Wie es aussah, waren die zerstrittenen Parteien inzwischen auf Tuchfühlung gegangen. Ich sah mir das Spektakel aus sicherer Entfernung an und wägte ab, ob ich endlich dem mittelgroßen Sportkameraden beistehen sollte oder nicht. Er rang mit dem zweiten Hünen um etwas, das beide in der Hand hielten, als der Wortführer mit einem gezielten Handkantenschlag die Verbindung radikal kappte. Ein Behältnis fiel zu Boden und verteilte seinen Inhalt im näheren Umkreis. Inzwischen hatten mich die drei Muskelmänner bemerkt.
„Alles in Ordnung“, rief mir der blondierte Wortführer entgegen, „nix passiert.“
„Klar, Mann“, antwortete ich wider besserer Einschätzung.
Dass alles in Ordnung war, konnte ich kaum glauben, doch ich spielte die Scharade zum Selbstschutz mit. Nachdem der Typ mit dem Bürstenschnitt den beiden anderen in der fremden Sprache etwas zugerufen hatte, ließen sie von ihrem Streit ab. Der Mittelgroße, ein bronzefarbener Mitbürger mit buschigen schwarzen Augenbrauen, etwas zu eng beieinander stehenden Augen und wulstigen Nackenmuskeln, bückte sich und sammelte das heruntergefallene Zeug auf: fingernagelgroße rosafarbene Pastillen, die aussahen, als wären sie einer Tüte Gummibärchen entflohen. Doch das konnte kaum sein, denn das Zeug war aus der Plastikflasche eines billigen Duschgels gekullert, die der zweite Hüne gerade aufhob. Wer füllt schon Kaubonbons in Duschgel-Flaschen ab?
Ohne mich weiter darüber zu wundern ignorierte ich die Aktion und strebte langsam meinem Polo entgegen. Dummerweise befand er sich hinter der Troika, weswegen ich jetzt auf keinen Fall Angst zeigen durfte. Mit dem Mut des Mimikry-Begabten umrundete ich die drei zerstrittenen Gestalten, öffnete den Wagen und verstaute die Sporttasche im Kofferraum.
Es war einer dieser unscheinbaren Momente, in denen sich durch kleine Eingriffe Unvorhersehbares entwickelt – typische Variante der Chaos-Theorie. Just, als ich einsteigen wollte, lagen zwei dieser Pastillen und ein zusammengeknüllter Zettel direkt vor dem Schweller der Fahrertür. Obwohl kaum zu erkennen, übten die Gegenstände eine faszinierende Wirkung aus. Im Nachhinein betrachtet war unklar, warum ich nicht widerstehen konnte. Um ehrlich zu sein, lag es nicht daran, dass mich der Polo gegenüber den Streithähnen abdeckte. Eher hatte mich mal wieder mein altes Leiden gepackt, eine nur schwer zu befriedigende Neugier.
Wie der Blitz hob ich die Pastillen und den Zettel auf und warf alles in den Innenraum. Jetzt rasch einsteigen, den Schlüssel ins Schloss fummeln. Polo anlassen. Vorsichtig ausparken. Die Gestalten weiträumig umfahren und langsam vom Parkplatz in den fließenden Verkehr einfädeln. Der Wortführer beäugte jede Sequenz wie ein hungriger Habicht.
Der restliche Abend gestaltete sich kurz aber erbaulich. Alex, meine Freundin und Verlobte, berichtete von ihren heutigen Erlebnissen, ich von meinen, allerdings unter Auslassung der beiden Sequenzen mit den zerstrittenen Muskelmännern. Wir überlegten, was wir am Wochenende unternehmen würden und stiegen kurz vor Mitternacht ins Bett, weil wir beide anstrengenden Tätigkeiten nachgingen und uns der gesunde Nachtschlaf viel bedeutete.
Tags drauf hatte ich die Angelegenheit aus dem Fitness-Studio bereits vergessen. Berufliche Abschlussarbeiten für ein Projekt beanspruchten mich intensiv und lenkten von allem anderen ab. Einen Bericht zu verfassen, eine Präsentation anzufertigen und eine Pressekonferenz vorzubereiten waren so ziemlich die letzten Dinge, die ich im Rahmen einer befristeten Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule zu leisten hatte. Ende Juni würde mein Vertrag auslaufen; eine Verlängerung war nicht in Sicht. Dann würde ich drei gute Jahre als frisch absolvierter Psychologe in einem Forschungsinstitut hinter mich gebracht, vieles gelernt und einige Projekte mit verantwortet haben. Die angestrebte Doktorarbeit hatte ich in dieser Zeit zwar nicht beenden können, aber ich nahm mir fest vor, sie bis zum Jahresende fertigzustellen und mich parallel dazu auf eine neue Anstellung zu bewerben. Einige gesparte Euro würden mich über die Runden bringen, zumal ich mit Alex mietfrei im Obergeschoß unseres Elternhauses lebte und keinem Luxus frönte. Meine verwitwete Mutter lebte im Erdgeschoß; ihr brauchten wir nur anteilige Betriebskosten abzutreten und ab und an etwas zu den Lebensmitteln beizusteuern.
So schliefen die rosafarbenen Pastillen und der zerknüllte Zettel unter den Vordersitzen meines Autos den Schlaf des Gerechten, neben anderen heruntergefallenen Papierschnipseln, kleinen Steinen vom spätwinterlichen Straßensplit und einem verlorengegangenen Tampon (ungebraucht). Dort wären sie wochenlang liegengeblieben, höchstwahrscheinlich bis zum anstehenden Frühjahrsputz kurz vor Ostern, wenn mich nicht in der übernächsten Woche eine Aktion des Fitness-Studios an sie erinnert hätte.
‚Unser Kamerad braucht Hilfe. Wir sammeln für Vojtech!‘, war auf einem aufgestellten Poster neben dem Eingang zu lesen.
Unterhalb der Kopfzeile hatte jemand ein – im wahrsten Sinne des Wortes – Brustbild von Vojtech platziert: eine stolze halbnackte Pose aus einem Wettkampf für Bodybuilder, bei der seine hypertrophierten Muskeln schier zu platzen drohten und Adern wie aufgeklebt herausstachen. Vojtechs Abbild sprang direkt in die Augen – nicht wegen der zur Schau gestellten überzüchteten Muskeln, sondern weil das verkniffene Vogelgesicht und die zottigen Augenbrauen seine affektierte Körperhaltung leicht ins Lächerliche zogen und dabei markant auffielen. Das Brustbild zeigte niemanden Anderes als den mittelgroßen Muskelmann vom Gerangel auf dem Parkplatz.
Wie ein erläuternder Text darstellte, hatte es Sportkamerad Vojtech am letzten Wochenende beim Motorradfahren schwer erwischt. Als der Muskelmann einen PKW überholen wollte, war der Wagen seitlich ausgeschert, woraufhin das Motorrad über den linken Straßenrand schoss. Vojtech war knapp dem Tod entronnen, allerdings zwischen dem vierten und fünften Lendenwirbel hoffnungslos querschnittsgelähmt. Der Unfallverursacher war unerkannt geflohen. Aufgrund von Zeugenaussagen hatte die Polizei zwar den PKW identifiziert, aber der betreffende Ford Mustang, war drei Tage zuvor als gestohlen gemeldet worden. Sein Besitzer käme als Täter nicht in Frage, weil er laut Polizei ein bombensicheres Alibi besaß, wie die Schreiber des Posters anmerkten.
Vojtech hatte von Hilfsarbeiten in einer Vorarlberger Rohrfabrik gelebt. Weder besaß er große Ersparnisse noch eine unterstützende Familie oder eine Unfallversicherung. Gemäß der Darstellung auf dem Poster benötigte er daher viel Geld, um sich das restliche Leben im Rollstuhl einigermaßen erträglich einrichten zu können.
Wäre ich nicht zufällig Zeuge einer heftigen Auseinandersetzung zwischen dem Unfallopfer und zwei anderen Kerlen gewesen, hätte ich etwas Geld gespendet und die Angelegenheit rasch vergessen. So aber brannte das schlechte Gewissen förmlich in meiner Brust, weil ich dem Sportkameraden mangels Zivilcourage neulich nicht beigestanden war.
2. Dropse
„Ist ja eine üble Sache“, meinte ich mit Blick auf das Poster zum Typen, der im Fitness-Studio die Spindschlüssel ausgab.
„Kann man wohl sagen.“
„Nimmst du die Spenden für den Kameraden an?“, fragte ich, während ich einen Zehner aus der Brieftasche fummelte.
„Kannst du mir geben. Kommt alles in eine Kassette.“
Ich schob den Zehner über die Theke: „Aber nicht damit durchbrennen“, versuchte ich einen Scherz zu landen, was mir kaum mehr als einen mitleidigen Blick einbrachte. Der Angestellte des Studios, ein gewisser Karl, nahm den Schein wortlos an, verstaute ihn unter dem Tresen in einer Metallkassette und schob einen Schlüssel für die Herrenumkleide herüber.
„Wie geht es dem Kameraden denn so? Ist er in der Reha und kann man ihn besuchen?“, fragte ich nach.
„Weiß nicht.“
Karl zuckte mit den Schultern. Nicht nur heute war er einsilbig unterwegs. Aus ihm war weniger als nichts herauszuholen, aber ich hatte längst nicht alle Versuche aufgebraucht:
„Wen kann man denn fragen? Ich würde Vojtech gerne besuchen, wenn es ihm einigermaßen geht.“
„Weiß nicht.“
Ruhig Blut! Bloß nicht aufregen, das würde nicht weiterhelfen.
„Und an wen geht die Kassette, wenn sie voll ist? Vielleicht kann man den fragen.“
Karl zögerte kurz und überlegte, ob er mir die Geheiminformation geben durfte oder nicht. Antwortete er jetzt wieder ‚weiß nicht‘, wäre meine fernöstlich geprägte Geduld auf eine lange Probe gestellt. Doch Karl gab sich einen Ruck:
„Die holt Bozidar am Freitagabend ab“, gab er die erwünschte Auskunft. „Wie jeden Freitag. Mindestens einen Monat lang.“
Inzwischen waren andere Freunde der Körperertüchtigung eingetrudelt, und Karl beschäftigte sich einige Minuten damit, neue Mitgliedsausweise auszustellen, Schlüssel und Kleinkram zu übergeben und zwei Spenden anzunehmen. Ich wartete derweil am Ende des Tresens.
„Wer ist Bozidar?“, fragte ich, als wir wieder unter uns waren.
Karl regte sich inzwischen mächtig auf: „Mann, du nervst. Kennst du nicht. Geh lieber trainieren anstatt mich hier vollzulabern“, versuchte er mich in rüdem Ton und mit einer knappen Wischbewegung seiner Hand abzuwimmeln.
Da hier offensichtlich mit Freundlichkeit kein Weiterkommen war, und ich mich nicht veranlasst sah, andere Methoden anzuwenden, gab ich nach, wohl meinend, der Klügere zu sein. Ab in den Umkleideraum und sich für die übliche Einheit an den Geräten umziehen. Der nächste Freitag kommt bestimmt.
Und er kam. Meiner Verlobten gegenüber, mit der ich oft Freitagabends essen ging, um den Ausklang der Arbeitswoche zu feiern, musste ich beim gemeinsamen Frühstück eine kleine Ausrede gebrauchen. Nur eine halbe Lüge unter Auslassung hintergründiger Motive, denn ich wollte ihr für den kommenden Freitag absagen. Beziehungsweise gebrauchte ich eine schwammige Andeutung, ich sei hinter einer Sache her, die mir komisch vorkam. Alex kannte mich seit unserem gemeinsamen Bachelorstudium der Psychologie ebenso gut wie ich sie. Das lag weniger an unserer Profession, mehr an unserem absolut offenen und liebevollen Umgang miteinander und ein wenig auch an gemeinsamen Erfahrungen mit ‚schrägen‘ Vorkommnissen, wie ich vergangene Aktionen verharmlosend bezeichnete. Anders formuliert: Alex ahnte Böses.
„Wenn du, Felix Moosburger ...“, es hatte nichts Gutes zu bedeuten, wenn sie mich mit vollem Namen ansprach, „... am Freitag nichts Besseres zu tun hast, als dich mal wieder Hals über Kopf in kriminelle Machenschaften zu verstricken, kann ich das keinesfalls dulden!“
Spielerisch drohte sie mit dem Zeigefinger. Eine herrische Geste, klassisches Zeichen von Dominanz, das Alex in dieser Situation bewusst einsetzte. Zwar hatte meine Freundin ihr Bedenken halb ernst-, halb scherzhaft hervorgebracht, aber ihren Ton kannte ich zu gut. Obwohl keinesfalls ich es gewesen war, der bei den angedeuteten ‚Machenschaften‘ als kriminell bezeichnet werden konnte (ihr Einwand bezog sich auf Personen, deren kriminelle Handlungen ich aufgedeckt hatte), schlug Alex einen Ton an, als hätte ich die Nationalbank ausgeraubt.
Interessanterweise spielte sich unsere Paardynamik bei einer Kontroverse immer so ab, dass wir entweder anstehende Problematiken ausdiskutierten. Dabei kam es keinem darauf an, Recht zu behalten oder die eigene Ansicht durchzusetzen. Vielmehr suchten wir meist gemeinsam eine optimale Lösung. Oder einer signalisierte eindeutig durch Wortwahl und Gesten, wie ernst der eigene Standpunkt war. Bislang gab dann meist der andere nach, weil unseres Erachtens keine Meinungsverschiedenheit es wert war, die Stimmung zu verderben und die Beziehung aufs Spiel zu setzen. So auch heute.
„Ich möchte doch nur einen Sportkameraden fragen, der am Freitag eine Spende für einen verunglückten anderen Sportler abholt, ob ich den Verunglückten in der Reha besuchen kann. Eventuell geht das ratz-fatz und wir können später noch ausgehen.“
Alex mochte Schlimmeres ahnen oder nicht, erklärte sich aber einverstanden. Bis spätestens zwanzig Uhr sei sie abrufbereit. Wenn ich nicht käme, würde sie ohne mich zu Abend essen, eventuell mit meiner Mutter, mit der wir seit einiger Zeit im traditionellen Vorarlberger Bauernhaus friedlich unter einem Dach lebten. Also trumpfte ich am Freitag bereits gegen sechzehn Uhr im Fitness-Studio auf und harrte des Bozidars, der da kommen sollte.
Im Studio nicht aufzufallen gestaltete sich schwieriger als gedacht, weil unklar war, wann Bozidar die Spende abholen würde. Vor dem Tresen zu warten wie bestellt und nicht abgeholt, kam nicht in Frage, denn Karl brauchte nicht unnötig nervös gemacht zu werden. Auch konnte ich allein wegen der irgendwann nachlassenden Kondition nicht stundenlang trainieren, und zudem musste ich den Tresen im Auge behalten. Also drückte ich mich trotz des ungemütlichen Märzwetters – nur wenige Grade über Null aber trocken – auf dem Parkplatz herum. Tat, als würde ich telefonieren, und positionierte mich dabei seitlich an einer Fensterscheibe mit Blick auf Karl und den Tresen. Die Posse währte geschlagene zwei Stunden, wobei mir nach und nach Kälte in die Glieder fuhr.
Kurz vor achtzehn Uhr wurde die Ausdauer endlich belohnt. Fast hätte ich es übersehen: Karl unterhielt sich mit jemandem, dessen Rückansicht mir trotz dicker Kleidung aufgrund des Haarschnitts bekannt vorkam. Kurze Bürste wie beim Militär, die Stoppeln platinblond gefärbt wie eine billige Hafennutte. Diese charmante Frisur hatte ich neulich durch zwei Saunascheiben bewundern dürfen. Sie gehörte dem Wortführer der beiden aggressiven Muskelmänner. Karl stellte die Kassette auf den Tresen, fischte ein Bündel Scheine heraus und drückte sie dem anderen in die Hand. Wenn ich noch an ihm gezweifelt hätte, würden den Geldempfänger seine tellergroßen Pratzen verraten haben. Platinbürste fackelte nicht lange, steckte das Zeug in die Jacke und ging zum Ausgang. Jetzt oder nie.
„Mensch, sag: Wie geht es Vojtech denn inzwischen?“, fragte ich den Platinblonden, als wir uns an der Tür über den Weg liefen.
„Was willst du?“, entgegnete der Kerl. Er war etwas größer als ich und besaß deutlich mehr Muskelmasse. Seine Aussprache verriet den Osteuropäer, sein Gesicht das Erbe des Urmenschen. Mindestens dreißig Prozent betrug der Anteil, schätzte ich.
„Wollte ihn mal in der Reha besuchen. Grüße von den Sportkameraden überbringen und alles Gute wünschen.“
„Brauchst nicht. Mach ich schon.“
Die männliche Blondine ließ mich grußlos stehen und verschwand Richtung Parkplatz, ohne sich umzusehen. Ich zögerte vielleicht zwanzig Sekunden und ging Bozidar nach. Hielt wieder mein Handy zur Tarnung ans Ohr und führte damit Selbstgespräche. Platinbürste enterte derweil einen schwarzen Porsche Cayenne und fuhr angeberisch vom Parkplatz auf die Straße, wobei er einen seitlich ankommenden Kleinwagen rücksichtslos zum Abbremsen nötigte. Der Porsche verschwand im Feierabendverkehr. Leider war sein Nummernschild nicht zu erkennen gewesen.
Jetzt blieb nur noch eine Sache zu tun übrig. Wenn alles glatt lief, konnten Alex und ich heute Abend wie gewohnt das Wochenende in einem netten Restaurant einläuten. Ich betrat das Fitness-Studio und versuchte Karl zu überrumpeln.
„N‘abend Karl. Sag, wie heißt Vojtech eigentlich mit Familiennamen? Ich wollte ihm eine Karte zur Genesung schreiben.“
Die Taktik funktionierte. Karl hinterfragte mein Ansinnen nicht und nannte mir automatisch den Namen, ohne dafür im Computer nachschauen zu müssen: „Pavlevska.“
„Danke. Und: Guten Abend.“
Ich drehte mich um und verschwand rasch, bevor Karl auf die Idee kommen könnte, dumm nachzufragen. Jetzt führte ich endlich ein richtiges Telefonat und verabredete mich mit Alex in der ‚Mühle‘, einem kleinen aber feinen gutbürgerlichen Restaurant bei uns in der Nähe, das wir öfter aufsuchten, weil die Bewirtung nett und das Essen überdurchschnittlich gut waren.
„Warst du erfolgreich?“, fragte mich Alex, nachdem wir den ersten Schluck unseres Aperitifs genossen hatten. Der Kir Royal prickelte angenehm im Gaumen und gab sein beeriges Aroma frei.
„Ja und nein“, grübelte ich.
„Hmm. Ich hasse es, wenn du so bist. Um was geht es eigentlich?“, wollte sie wissen. „Aber binde mir bitte keinen Bären auf. Die Geschichte mit der Reha kannst du deiner Professorin erzählen.“
Alex spielte auf meine Chefin an der Fachhochschule an, Frau Professor Doktor Grafl, an deren Forschungsinstitut ich als Assistent arbeitete. Wie immer, durchschaute mich meine Freundin (und seit einem Vierteljahr Verlobte) sofort, was mich überhaupt nicht störte, weil das ein Zeichen unseres Gleichklangs war.
„Hab da so einen Verdacht“, suchte ich die Offenbarung hinauszuzögern.
„Nicht so verstockt, mein Lieber. Raus mit der Wahrheit!“
Während einer deftigen Tiroler Speckknödelsuppe breitete ich aus, was sich in der Sauna und auf dem Parkplatz um Vojtech abgespielt hatte.
„Und du folgerst daraus?“, fragte Alex.
„Will ich noch nicht sagen. Möchte erst deine Meinung dazu hören. Du bist überdurchschnittlich clever und hast in der Vergangenheit immer hervorragende Einfälle beigesteuert. Meine Hypothesen sollen dich nicht in eine bestimmte Richtung lenken.“
„Danke für die Blumen. Hast du die Pillen noch?“
„Es sind eher eine Art Pastillen oder Tabletten.“
„Völlig egal. Hast du sie noch?“
„Wieso fragst du?“
„Lass bitte ausnahmsweise das alberne Spiel mit den Gegenfragen sein.“ Seit wir uns kennengelernt hatten, führten wir ab und an in lustiger Stimmung unseren persönlichen Running Gag mit provozierenden Gegenfragen durch. Heute schien Alex daran keinen Spaß zu finden. „Hast du also noch die Pastillen und den Zettel?“
„Ja. Die schwirren im Auto herum, sofern es niemand seit letztem Herbst gereinigt hat.“
„Wer, zum Ariel, sollte das auch tun?“, lachte Alex auf.
Nach dem Hauptgang, Zwiebelrostbraten mit Blaukraut und Spätzle, sprach meine Liebe einen Gedanken aus, der mir bereits durch den Kopf gegangen war. Ab und an dachten wir annähernd zeitgleich dasselbe. Durch diese schönen Momente entstand für einen kleinen Augenblick das Gefühl völliger Harmonie.
„Wir könnten und sollten weitere Informationen sammeln, bevor wir gewagte Vermutungen anstellen“, schlug sie vor, „über die Pillen, die drei Männer und so.“
„Eben“, bestätigte ich, „darum wollte ich ja heute mehr über diesen Vojtech erfahren.“
Wir entwarfen ein paar Ideen, betrachteten sie von verschiedenen Seiten, verwarfen einige Ansätze und wechselten das Thema, als ihm nichts mehr abzugewinnen war. Stattdessen unterhielten wir uns über Familiäres und die Gestaltung der näheren Zukunft.
Nach dem Restaurantbesuch kramte ich als Erstes die Pastillen und den Zettel unter dem Vordersitz des Polos hervor. Während allerlei Abfall zu Tage kam, ließ sich Alex die Gelegenheit nicht entgehen, mir ein paar Seitenhiebe über äußere und innere Pflege von Autos in Bezug auf deren Langlebigkeit und Ästhetik zu verpassen. Ich schenkte ihr dafür den ungebrauchten Tampon, denn der war garantiert nicht aus meiner Tasche gefallen, was die spöttischen Bemerkungen meiner Freundin rasch beendete.
„Lass sehen“, sagte sie, als ich meine Fundstücke in der Hand hielt. Alex faltete den zerknitterten Zettel auseinander: „Kiril 4000. Was soll das denn heißen?“
„Was weiß ich. Hört sich wie die Typenbezeichnung eines Gefrierschranks an. ‚Kaufen Sie den Kiril-Viertausend. Er ist kälter als Mutti, wenn Pappi ihr wieder ungefragt an die Wäsche will’.“
„Blödquatscher!“, kommentierte Alex die spontane Werbeparodie und gab mir die drei Fundstücke zurück. Ich versenkte alles in der Hosentasche. Würde das Zeug später zu Hause in meinem Geheimversteck bunkern.
In der darauffolgenden Woche stellte es sich komplizierter heraus als gedacht, Informationen über den Verunglückten zu beschaffen. Erst nach einer Woche und etlichen Telefonaten bekam ich seinen aktuellen Aufenthalt heraus. Zwischen Bad Waldsee in Oberschwaben und diversen Kliniken in Oberösterreich kamen rund ein Dutzend Reha-Einrichtungen in Frage, in die er nach seiner Operation theoretisch hätte verlegt werden können. Ich ging davon aus, weil der Unfall sich bei uns in Vorarlberg ereignet hatte und Vojtech höchstwahrscheinlich in Österreich krankenversichert war. Mit Ausnahme der Klinik in Bald Waldsee kamen nämlich keine weiteren deutschen Einrichtungen in Frage, da die Gebietskrankenkasse Kosten im Ausland nicht übernahm.
Stets musste am Telefon die Geschichte eines geplanten Besuchs für Herrn Vojtech herhalten. Ob er denn in der Klinik sei, wie angeblich mitgeteilt, und wann man ihn besuchen könne. War ich erfolglos am Ende der Liste angekommen, fing ich zwei Tage später wieder am Anfang an und weitete die Suche aus. Schließlich wurde ich am Samstag darauf in Tirol fündig. Just einen Tag zuvor war Sportkamerad Vojtech nahe Kufstein in einer Privatklinik für Orthopädie aufgenommen worden. Nach dem Telefonat summte ich beglückt das Kufsteinlied.
Der verunglückte Bodybuilder würde mindestens vier Wochen in der Klinik bleiben, also eilte es nicht ihn zu besuchen. Um das kommende Wochenende mit Alex und unsere geplante Wanderung mit Freunden nicht aufs Spiel zu setzen, zog ich vor, am darauffolgenden Donnerstag nach Kufstein zu fahren. An der Fachhochschule konnte ich meine Anwesenheit eigenständig bestimmen, solange die Arbeitsergebnisse zeitgerecht und in erforderlicher Qualität vorlagen, was meist funktionierte. Somit sprach nichts dagegen, ein bis zwei Tage für einen Krankenbesuch zu opfern. Spätestens Freitagabend wäre ich wieder daheim. Beziehungsweise würde ich mich diesmal mit Alex nach Feierabend in einer Sushi-Bar im Rheintal treffen, da sie ‚unten‘ arbeitete, wie wir Gebirgler die große Talschaft zwischen Liechtenstein und dem Bodensee nannten. Ich würde direkt aus Tirol dazu stoßen.
Die Fahrt nach Kufstein über die A14, durch den Arlbergtunnel und die Inntalautobahn entlang, dauerte etwa drei Stunden. Kurz vor dem Mittagessen trudelte ich in der Klinik ein. Das ‚Medical Resort‘ in Thiersee war nicht zu verfehlen, dafür zu meinem Leidwesen der gesuchte Sportkamerad.
„Grüß Gott. Mein Namen ist Felix Moosburger, und ich hätte gerne Herrn Vojtech Pavlevska besucht“, offenbarte ich der dirndlbekleideten älteren Dame am Empfang.
Die Theke war überdimensioniert hoch. Ohne sich unseriös weit darüber zu beugen, war nicht zu erkennen, was die dahinter sitzende Empfangsdame tat. Gerade noch ragten ihr Kopf und ihr faltiger Halsansatz bis zum wenig erbaulichen Ausschnitt im Dirndl hervor.
„Wie heißt der Herr?“
„Pav-lev-ska.“
„Wie schreibt sich das?“
„Paul, Anton, Viktor, Ludwig, Emil, Viktor, Siegfried, Karl, Anton.“
„Ich wollt‘ nicht wissen, wie er mit Vornamen heißt, sondern wie sich sein Familienname schreibt. Wer gibt seinem Kind überhaupt so viele Vornamen? Und dann noch zweimal denselben.“
Ich wusste nicht, ob ich lachen oder lauthals schreien sollte. Entschied mich dann dafür, nichts davon zu tun, um den Erfolg nicht zu gefährden. Kommunikation ist bekanntlich immer das, was beim anderen ankommt, also lag der Übermittlungsfehler bei mir, weswegen ich die Taktik wechselte.
„Ich buchstabiere Ihnen mal seinen Nachnamen“, schlug ich vor. „P-A-V-L-E-V-S-K-A.“
„Sagen Sie das doch gleich. Momentchen.“
Die Empfangsdame betätigte ihren Computer mit der Zwei-Finger-Adler-Suchtechnik. „Ist nicht bei uns“, vermeldete sie nach drei Minuten erfolglosen Tippens.
„Das hatte mir aber gestern eine Ihrer Kolleginnen mitgeteilt.“
„Schon recht. Gestern stimmte das vielleicht noch.“
Als die Empfangsdame ihren schwarz gefärbten Schopf senkte, schimmerte mir im Haaransatz schmutziges Grau entgegen. Zum gnädigen Ausgleich verschwand ihr zerknittertes Dekolleté aus dem Gesichtsfeld. Papiere raschelten auf der Schreibablage. Wenn ich gedacht hätte, die Angestellte würde weitere Informationen für mich suchen, musste ich mich nach etlichen Sekunden enttäuscht sehen. Ich räusperte mich merklich.
„Ist noch was?“, fragte das zünftig gekleidete Unikum.
„Wenn Herr Pavlevska nicht bei Ihnen ist, könnten Sie mir vielleicht sagen, warum? Und ob er vielleicht woanders untergekommen ist? Ich komme extra aus Vorarlberg, weil mir gestern jemand aus dieser kompetenten Einrichtung gesagt hat, er sei am Montag bei Ihnen aufgenommen worden.“
„ ‚Warum‘ kann ich Ihnen nicht sagen.“ Die Dame knisterte weiter in ihren Unterlagen.
Langsam regte mich der Drachen wirklich auf. Wahrscheinlich hatte der Sportkamerad wegen der zermürbenden Aufnahmeprozedur Hals über Kopf Reißaus genommen.
„Wenn Sie wissen, ob er jetzt in einer anderen Klinik behandelt wird, wäre es ausgesprochen nett von Ihnen, mir die neue Adresse zu nennen“, säuselte ich in entgegenkommendstem Sozial-Sprech.
Um meine Bitte aufzupeppen, ließ ich einen Zehn-Euro-Schein über die Theke nach unten auf die Schreibunterlage flattern.
„Für die Kaffeekasse“, fügte ich erläuternd hinzu.
Die schien sich im Ausschnitt des Dirndls zu befinden, denn dorthin wanderte der Schein mit Mach-3-Geschwindigkeit.
„Sonderkrankenanstalt Bad Schallerbach“, tönte es kaum vernehmlich hinter dem Tresen. Und ewig raschelten Papiere.
Wortlos, denn sie hatte keinen Gruß verdient, verabschiedete ich mich von der Empfangsdame. Im Auto überlegte ich kurz, wie weiter vorzugehen wäre. Sicherheitshalber rief ich zunächst bei der genannten Klinik an. Deren Daten waren rasch im Netz recherchiert. Diesmal bestätigte man mir den Aufenthalt des Sportkameraden sofort. Er sei gestern eingetroffen und würde sich garantiert über einen Besuch freuen. Herr Pavlevska benötige dringend etwas Aufmunterung, fügte die Person am anderen Ende indiskret hinzu.
Bad Schallerbach liegt in Oberösterreich bei Wels, etwa achtzig Kilometer östlich der deutsch-österreichischen Grenze und etwa hundert südlich der österreichisch-tschechischen. Von Thiersee bei Kufstein nach Bad Schallerbach konnte ich einschließlich einer Mittagspause weitere drei Stunden veranschlagen, wenn ich sofort startete. Da der morgige Freitag sowieso für den Krankenbesuch verplant war, fuhr ich kurzentschlossen los. Brötchen an der Tankstelle und eine Flasche Wasser mussten als Mittagsmahl genügen.
Voijtech Pavlvska machte wirklich einen erbärmlichen Eindruck. Sein überdimensionierter Körper wirkte im Rollstuhl völlig deplatziert, so, als ob er das Gefährt spaßeshalber ausprobieren wollte. Äußerlich war ihm die Querschnittslähmung nicht anzumerken, weil die Rumpf- und Beinmuskulatur noch nicht übermäßig verkümmert war. Sein Gesicht sprach dagegen Bände. Trauerbände. Dramen altgriechischen Ausmaßes mussten in ihm ablaufen. ‚Niedergeschlagen‘ war gar kein Ausdruck dafür. Ich fing Vojtech kurz nach dem Abendbrot ab, als er durch die Lobby rollte. Klinikpersonal, das anscheinend früh nach Hause gehen wollte, hatte die letzte Mahlzeit des Tages bereits auf halb Sechs festgelegt.
„Hallo Vojtech“, rief ich dem Reha-Patienten zu und kreuzte seine Fahrbahn.
Der Verunglückte schaute auf, schien mich nicht zu kennen.
„Ich bin’s: Felix. Aus dem Studio. Ich soll dich ganz herzlich von den Sportkameraden grüßen.“ Aus einer kleinen Umhängetasche fummelte ich eine extragroße Packung Pralinen hervor, die ich auf dem Herweg an der Tankstelle erstanden hatte, und legte sie ihm auf den Schoß. Darauf klebte ein Umschlag mit einer Grußkarte, angeblich von den Jungs aus dem Studio geschrieben, in Wahrheit aber von mir verfasst. Erkennen zeichnete sich in Vojtechs Augen ab.
„Was machst du denn hier?“, fragte er mich.
„Wollte dich besuchen und alles Gute wünschen. Alle lassen Grüßen. Karl und so weiter.“ Da ich kaum einen der anderen Muskelprotze mit Namen kannte, musste der Angestellte des Fitness-Clubs für meine Legende herhalten.
Vojtech konnte mich jetzt einigermaßen zuordnen: „Du bist der, der da immer für sich seine verbissenen Runden dreht.“ Ich nickte. „Was willst du hier?“
„Na hören, wie es dir so geht. Dir Grüße überbringen.“
Ich hoffte, durch die Wiederholung würde er mir die Geschichte eher abnehmen. Bei der schwarzen Zuckerbrause funktioniert diese Werbemasche seit über hundert Jahren bestens, warum also nicht auch bei mir? Die Leute kaufen bekanntlich den letzten Mist, wenn er nur attraktiv verpackt ist, die Werbung uns den Kram permanent um die Ohren haut und alle meinen, das überflüssige Zeug sei trendy.
„Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten?“, fragte ich.
Vojtech kämpfte mit sich, aber meine Gegenwart schien ihm dann doch angenehmer zu sein als ein Abend ohne Besuch: „Auf meinem Zimmer. In einer halben Stunde kommt die Visite.“
Er rollte voran. Ich trabte nebenher und suchte einen Smalltalk in Gang zu setzen, worauf Vojtech nicht wirklich einging. Maximal konnte ich erfahren, dass es bei der Organisation seiner Reha ein Missverständnis gegeben hatte, weswegen er zunächst in der falschen Klinik gelandet war. Auf seinem Zimmer wollte ich zum Kern meines Besuchs vorstoßen.
„Wie ist das denn passiert? Erzähl mal.“
„Gleich. Will zuerst sehen was du mitgebracht hast.“
Vojtech öffnete das Kuvert, in dem die Grußkarte steckte. Beim Lesen der Zeilen traten ihm Tränen in die Augen. Vor Scham wären sie beinahe auch mir ins Gesicht gestiegen. Ich schluckte schwer.
„Reich mir bitte den Block und den Kugelschreiber vom Schreibtisch“, bat mich der Querschnittsgelähmte.
Mit einem schlanken silbernen Lamy-Kugelschreiber in klobigen Händen mühte sich Vojtech unter Tränen eine Antwort für seine Sportkameraden ab. Minuten später reichte er mir den Zettel und steckte sich den Kugelschreiber in die Brusttasche des Oberhemds. Um die für uns beide aus unterschiedlichen Gründen peinliche Situation zu überspielen, fragte ich ihn nach dem Schreibgerät.
„Schickes Stück da. Ist das Ding nicht zu schmal für dich?“
„Eigentlich schon. Das sauteure Teil hab ich als Preis für meinen ersten Landestitel in Physique gewonnen.“
„Wusste gar nicht, dass du Physiker bist. Ich dachte, du arbeitest irgendwo in einer Firma als Lagerist.“
„Mensch: Physique! Hast du Topfen zwischen den Ohren oder bist du so blöd? Das ist ein angesagter Wettkampf beim Bodybuilding. Ohne die üblichen Posen mit Brustbild und so. Nach festgelegten Schrittmustern. Da kannst du nicht mit vorher Abkochen oder Kontraktionen beim Wettkampf tricksen. Da kommt’s auf deine Gesamtästhetik an. Pur sozusagen.“
Ich war so blöd. Wusste aber immerhin, was er mit ‚Abkochen’ meinte, nämlich den stark gesundheitsgefährdenden Flüssigkeitsentzug des Körpers durch Einnahme von Entwässerungspillen. Weniger gut trainierte Sportler machen das gerne vor einem Wettbewerb, um auf ihr Kampfgewicht zu kommen oder, wie beim Bodybuilding, um die Muskeln härter hervortreten zu lassen, wobei sie mögliche Nierenschädigungen billigend in Kauf nehmen.
„Hab ich sogar eine Gravur drauf“, meinte Vojtech.
„Auf dem Brustbild?“, fragte ich naiv.
„Du bist anscheinend wirklich so blöd. Auf dem Stift natürlich, du Idiot. Schau!“
Vojtech hielt mir den Kugelschreiber hin. Tatsächlich war sein Nachname mit haardünner Linie auf dem Clip eingraviert. Kaum zu erkennen, wenn man nicht gezielt danach suchte. Nach gebührender Bewunderung gab ich ihm das Teil zurück und verfolgte mein eigentliches Anliegen.
„Ja, und wie hast du nun den Motorradunfall gebaut?“
Nur mühsam rückte Vojtech mit der Geschichte heraus. Er hatte sein Motorrad aus dem Winterschlaf geholt und im Rheintal die erste Frühlingstour unternommen. Obwohl bei uns in den höheren Lagen noch Schnee lag, war er auf der L-200 in den Bregenzerwald hineingefahren. Die ganze Zeit raste ein roter Sportwagen hinter ihm her, der sich nicht abschütteln ließ. Kurz hinter Müselbach hatte ihn der Wagen überholt. Vojtech hatte sich provozieren lassen und wollte vor Egg am Sportwagen vorbeiziehen, was dieser aber durch leichte Schlangenlinien unterband. Hinter Bersbuch hatte sich endlich eine Gelegenheit ergeben, und als Vojtech auf gleicher Höhe war, scherte der Wagen plötzlich nach links aus und drückte Vojtech über die Fahrbahn ins lichte Unterholz. Vojtech war gestürzt und die Maschine halb auf seinem Rücken gelandet. Aus die Maus. Nur der Rückenprotektor hatte Schlimmeres verhütet, wenngleich die unwiderrufliche Querschnittslähmung wahrlich schlimm genug war.
„Meinst du, das war Absicht?“, fragte ich.
„Was sonst? Die Straße war völlig frei, schnurgerade, und ich hatte genügend Platz zum Überholen.“
„Wer könnte das gewesen sein? Hast du Feinde?“
Auf einmal klappte Vojtech zu wie eine Miesmuschel, wenn sich der Seestern nähert. Keine Antwort. Ich zupfte ein durchsichtiges Plastiktütchen aus meiner Hosentasche und hielt es ihm hin.
„Könnte es etwas hiermit zu tun haben?“, wollte ich wissen. Locker schwangen im Tütchen zwei rosa Pastillen vor seiner Nase.
Schneller, als ich ‚haps‘ sagen konnte, rupfte mir Vojtech die Tüte aus der Hand. Er riss sie auf und schob sich die Dropse in den Mund. Ein Schluck, und weg waren die Dinger. Völlig perplex starrte ich ihn an. Mit dieser Reaktion hatte ich wahrlich nicht gerechnet. Mit der darauffolgenden auch nicht. Vojtech war jetzt eindeutig vergrätzt. Seine nächste Bemerkung konnte nicht missverstanden werden, zumal er sie lauthals herausschrie:
„Verpiss dich! Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß!“
„Aber ...“
„Verschwinde endlich!“
„Ich wollte doch nur ...“
Der behinderte Muskelmann wollte auch. Und zwar mir aus dem Rollstuhl heraus deftig in die Seite boxen. Obwohl ich knapp ausweichen konnte, streifte mich sein Schwinger unangenehm an den Rippen. Da ich sofort erkenne, wenn ich unerwünscht bin, und auf dezente Hinweise sensibel registriere, machte ich mich kommentarlos aus dem Staub.
Außer Spesen nichts gewesen. Ärgern. Ärgern. Ärgern. Mit den verkosteten Pastillen hatte ich mir den einzigen Trumpf schnöde aus der Hand reißen lassen. Eine der von Alex und mir ausgebrüteten Ideen war es nämlich gewesen, die Pillen in einem Labor untersuchen zu lassen. Das konnten wir uns nun definitiv abschminken.
Verdrossen machte ich mich auf die Suche nach einer kleinen Pension in der Nähe, rief zuvor Alex an und berichtete von meinem Misserfolg. Am Telefon vermittelte meine Verlobte den Eindruck, als sei ihr die Entwicklung gar nicht so unangenehm. Sie befürchtete nur, ich würde mich wieder Hals über Kopf in eine dubiose Geschichte stürzen. Alex kam der Wahrheit damit ziemlich nahe. Im Nachhinein betrachtet, lag sie damit sogar absolut richtig.
Zwei Kilometer entfernt gab es eine freie Unterkunft und nach einem weiteren Kilometer eine gutbürgerliche Gaststätte. Anmelden. Zimmer beziehen. Ausgiebig duschen. Ein wenig im Bett dösen. Essen gehen. Im Gasthof lange entspannen. Gegen elf Uhr zurück ins Hotel schlendern. Zähneputzen. Ein wenig lesen. Und ab in die Heia.
Sturkopf, der ich manchmal bin, suchte ich Vojtech anderntags erneut auf, weil ich ihn ob seiner ungehaltenen Reaktion und der verspeisten Pastillen noch einmal angehen wollte. Das hatte bereits jemand Anderes erledigt, nur wusste ich das noch nicht, als ich den Polo auf dem Parkplatz der Klinik abstellte.
Vor dem Eingang standen Polizeifahrzeuge. Patienten und Angestellte liefen aufgeregt palavernd hin und her. Hektische Herren in Weiß suchten Ordnung ins Chaos zu bringen. Lässige Uniformierte in Mitternachtsblau und mit rot umrandeten weißen Schirmmützen dirigierten den Hühnerhaufen mit bürokratischem Gehabe. Von allen unbemerkt glitt ich ins Innere der Anstalt, um jemanden zu finden, der mir sagen konnte, was hier abging.
Einige Nachfragen später offenbarte sich das Drama. Vojtech war letzte Nacht tödlich verunglückt, mit seinem Rollstuhl eine lange Treppe ins Untergeschoß hinuntergestürzt … und aus die Maus.
3. Detektive
„Das ist er, Herr Inspektor!“
Eine Angestellte fuchtelte aufgeregt mit dem ausgestreckten Zeigefinger in meine Richtung, als ich gerade die Reha verlassen wollte. Köpfe drehten sich nach mir um. Ich blickte über die Schulter, war aber leider der Letzte im Gang zur Lobby. Schauspielern half nicht, wegrennen zwecklos. Zwei Männer mit offiziellem Gesichtsausdruck und zerknitterten Anzügen hielten mich an.
Die Angestellte rief hinterher: „Der hat sich gestern nach Herrn Pavlesvska erkundigt und mit ihm gesprochen. Eindeutig!“
„Gruppeninspektor Schneider“, stellte sich der eine Herr vor und hielt mir für drei Zehntelsekunden einen Ausweis unter die Nase. „Ihre Papiere bitte.“
„Um was geht es denn?“, fragte ich, machte aber keine Anstalten, meinen Pass herzuzeigen.
„Wir können Sie auch zur Einvernahme aufs Revier mitnehmen, wenn Ihnen das lieber ist“, soufflierte der Kompagnon des Inspektors mit leicht aggressivem Unterton und vorgebeugter Körperhaltung.
Ich seufzte, denn die primitivpsychologische Scharade von im Duett auftretenden Exekutivorganen kannte ich zur Genüge. Recht und Gesetz. Gut und Böse. Waldorf und Statler. Stan und Ollie. Dem Theater konnte man nicht entkommen, höchstens die Herren ein wenig auf den Arm nehmen oder einen Anwalt zu Rate ziehen oder ihre Floskeln kommentarlos erdulden. Weil ich nicht auf Stress aus war, entschied ich mich fürs Erdulden und zückte den Ausweis.
Inspektor Schneider und sein Kollege führten die übliche Fragerei durch. Wer ich sei. Was ich beruflich tat. Woher ich Herrn Pavlesvska kannte. Was ich von ihm gewollt hatte. Von wann bis wann ich ihn besucht hatte. Ob ich wisse, was seine Tätowierungen zu bedeuten hatten. Ob ich auch tätowiert sei. Ob sie das kurz überprüfen könnten. Über was wir gesprochen hatten. Was ich den Rest des Abends gemacht hatte. Ob das jemand bezeugen könne.
Ich antwortete wahrheitsgemäß – also zumindest, was den offensichtlichen Hergang der Ereignisse und meine nicht vorhandenen Tattoos anbelangte. Von den verschluckten Pillen brauchten sie nichts zu wissen. Um neunzehn Uhr hatte ich mich vom Sportkameraden verabschiedet. Eine halbe Stunde später war ich im nahegelegenen Parkhotel einquartiert gewesen, und von zwanzig bis zweiundzwanzig Uhr hatte ich im Gasthof zum Stiegenwirt gesessen, gegessen und mit meiner Verlobten telefoniert. Eine halbe Stunde später hatte mich der Nachtportier des Hotels als letzter Zeuge des Abends auf mein Zimmer gehen sehen.
Völlig klar, dass mich meine Aussage in den Augen der Polizei längst nicht entlastete, selbst wenn sich alle Angaben bestätigten. Denn erstens dürfte unklar sein, ob es sich um einen Unfall oder um Fremdverschulden, eventuell einen Mord, handelte. Und zweitens konnte dieser spätnachts stattgefunden haben, als ich ohne Zeugen im Hotelbett gelegen hatte. Die Varianten waren mir bereits durch den Kopf gegangen, als die Polizisten im Klinikflur auf mich zugesteuert waren. Ihnen gegenüber half nur, den unbescholtenen Bürger zu spielen, der ich im Grunde genommen war.
„Halten Sie sich bitte für eventuelle nachgängige Befragungen zur Verfügung“, wies mich Gruppeninspektor Schneider in neutral-bestimmendem Tonfall an, als er mir zum Abschied die Papiere aushändigte. Der Mimik seines Kollegen nach zu urteilen, schien ich Vojtech ermordet zu haben.
„Selbstverständlich. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ich freue mich, wenn ich etwas zur Aufklärung beitragen kann.“ So sprach der beflissen mit der Polizei Kooperierende, der ich bei vergangenen Vorkommnissen nicht wirklich gewesen war. Wenigstens hatte ich den letzte Satz ernst gemeint, wenn auch zweideutig.
Es bestand keine Chance, am Tatort weiterführende Informationen zu bekommen ohne unangenehm aufzufallen, also rief ich Alex auf ihrer Arbeit an und bestätigte unseren auf Samstag verschobenen Termin in der Sushi-Bar. Nach früheren Anlässen, bei denen ich in Kontakt mit kriminellen Machenschaften gekommen war, hatte ich ihr hoch und heilig geloben müssen, Informationen und Gedanken mit ihr zu teilen, wenn ich irgendwo Unsauberes witterte. Würde ich mich stattdessen ‚mal wieder‘ in Gefahr begeben, ohne es ihr zu sagen, und müsste sie erneut Todesängste um mich ausstehen, könnte sie es ‚auf gar keinen Fall‘ länger mit mir ertragen.
Alex hatte noch gemeint, mich zwar nicht ändern zu können und auch nicht zu wollen – wobei sie auf meine ausgeprägte Risikobereitschaft und Sturheit anspielte. Aber wenigstens wollte sie eine gewisse Kontrolle behalten. Nachdem ich versprechen musste, mich künftig an unsere Abmachung zu halten, hatte sie noch hinzugefügt, es sei für sie einen gravierender Vertrauensbruch, wenn ich dagegen verstieße. Unausgesprochen blieb die damit verbundene indirekte Drohung, sich in diesem Fall ohne Bedenken von mir zu trennen.
„Du bist aber auch ein Trottel!“ Über ein Muguro-Nigiri, das sie mit Stäbchen in den Mund schob, blickte mich Alex am Samstagabend vorwurfsvoll an, wobei ihre wunderschönen braunen Augen erregt funkelten. Spielerisch wischte sie mit der freien Hand eine schwarze Haarsträhne hinter das linke Ohr.
„Wie kann ich denn ahnen, dass der Kerl die Tüte aufreißt und das Zeug einfach runterschluckt?“, suchte ich mich zu verteidigen.
Alex kaute auf dem fischigen Reisbällchen herum und nuschelte: „Ham wir keim Beweis. Kömm keim Analyse durchführ.“
„Du präzisierst es auf unnachahmliche Art, weiße Taube.“
Das Sushi schien verspeist: „Liegt uns ausgebufften Py-schologen einfach im Blut.“
Meine Verlobte grinste frech. Allein für diesen listigen Gesichtsausdruck liebte ich sie wie keine andere. Es gab durchaus mehrere Gründe dafür, und ich meine nicht nur ihre hübschen braunen Augen, ihren hellwachen Verstand und den hintergründigen lieblichen Duft nach Maiglöckchen (hervorgerufen durch eine äußerst dezente Note von ‚Lily of the Valley‘, wie sie mir irgendwann offenbart hatte). Alles Dinge, die mir bereits im ersten Semester aufgefallen waren, als wir uns im Bachelorstudium der Psychologie erstmals unglücklich über den Weg gelaufen waren.
„Meinst du, du könntest derartiges Zeugs nochmal beschaffen?“, fragte Alex.
„Entnehme ich deiner ausgebufften Fangfrage, du hättest nichts dagegen, wenn ich weiter in der Sache recherchiere?“
„Glaubst du denn, ich würde annehmen, dich irgendwie davon abhalten zu können?“
„Nö“, sagte ich wider besseren Wissens. Denn, wenn Alex eine eventuelle Trennung in die Waagschale werfen würde, wäre ich Wachs in ihren Händen. Das wusste sie genau. Heute war sie einfach nur höflich und bot mir die Chance, das Gesicht zu wahren.
„Will sehen, was sich machen lässt“, räumte ich ein, „es kommen außerdem noch ein, zwei andere Möglichkeiten in Frage. Du weißt, welche. Wir haben letztens darüber gesprochen.“
Alex nickte, während ein Sake-Sashimi in ihren Mund wanderte. Ich fasste das als Besiegelung unseres Pakts in der Angelegenheit auf, womit wir uns endlich privaten Themen zuwendeten, wie beispielsweise der Hochzeitsplanung und altindisch anmutenden Szenen von verschiedenen Varianten der Hochzeitsnacht.
Neben den abschließenden Arbeiten für das Forschungsinstitut und dem letzten Viertel meiner Doktorarbeit hatte ich mir mehrere Ansatzpunkte vorgenommen, wie im Fall des verunglückten und kurz darauf verstorbenen Bodybuilders weiter vorgegangen werden konnte. Die Polizei würde garantiert ihrerseits Spuren verfolgen, sofern ein Selbstmord oder Mord vorlag. Weil sie über mehr technische und personelle Möglichkeiten verfügte als ich, konnte ich nur alternative Wege beschreiten.
Den rosafarbenen Pastillen nachzuspüren, lag damit auf der Hand. Dann blieb noch die Möglichkeit Bozidar aufzutreiben, den Muskelmann, der Vojtech im Fitness-Studio und auf dem Parkplatz zugesetzt hatte. Eventuell ließe sich etwas Interessantes über den Begriff ‚Kiril-4000‘ herausbekommen, der auf dem zerknitterten Zettel stand. Zwar zeichnete sich eine vage Vorstellung ab, wie Bozidar aufzutreiben wäre, aber worüber ich dann mit ihm sprechen würde, war unklar. Konnte ihn ja kaum fragen, ob er den armen Vojtech in seinem Rollstuhl die Kellertreppe hinuntergeschubst hatte.
Drittens brachte mich die Nachfrage der Polizisten nach Tätowierungen auf eine weitere Idee. An Vojtech hatte ich kein Tattoo bemerkt, weil er in der Klinik und im Studio langärmlig bekleidet gewesen war. Doch in meinem Kopf zeichnete sich eine vage Vorstellung der Gravierung ab, die den Oberarm des zweiten Muskelmannes zierte. Das Bild sah aus wie drei symmetrisch angebrachte Rotorblätter eines Windrades zur Stromerzeugung, nur dass an ihnen im spitzen Winkel zusätzlich ein kürzerer Schenkel nach rechts unten zeigte. Das Symbol erinnerte mich an Runen, doch trotz emsiger Suche war es nicht im Internet aufzufinden. Unter dem Symbol hatte der zweite Muskelmann Buchstaben und Zahlen tätowiert, an die ich mich beim besten Willen nicht erinnern konnte. Ich hatte den Bizeps auch nur kurz durch zwei Saunascheiben hindurch gesehen und mich in dem Moment nicht auf ihn konzentriert, sondern auf die Auseinandersetzung zwischen den drei Kraftmeiern.
Bevor ich besagte Recherchen in Angriff nahm, erhielt die Arbeit Vorrang. Zum wiederholten Mal führte ich zwei Seminare im Grundstudium der Psychologie durch. Diese für Nachwuchsakademiker einmalige Chance hatte sich vor über einem Jahr durch meine betreuende Professorin und Chefin ergeben, und ich hatte damals keine Sekunde gezögert, den Job anzunehmen. Von Beginn an machte mir die Lehre Spaß. Es gab viele interessante Beispiele aus der alltäglichen Forschungspraxis, anhand derer in die Grundlagen der Wissenschaft eingeführt werden konnte. Einige Studierende zeigten sogar über die Pflicht hinaus reges Interesse an dem Fachgebiet, obwohl die Materie zu Beginn nicht unbedingt einfach zu verstehen ist und zum Leidwesen der Meisten reichlich mit Statistik zu tun hat.
In dieser Zeit tanzte ich gleichzeitig auf mehreren Hochzeiten – und auf einem Todesfall, was mich schwer an die nette Komödie mit Hugh Grant und Andie Mac Dowell erinnerte. Doch damit hatte es sich auch. Andere Parallelen zu diesem erbaulichen Film gab es nicht. Die einzige reale Hochzeit, auf der ich hoffte bald zu tanzen, war meine eigene mit Alex. Alexandra Wieblinger, Personalpsychologin eines größeren Elektronikunternehmens in unserem Land, Angebetete seit dem ersten gemeinsamen Semester, Freundin seit dem dritten und inzwischen dreijährige Mitbewohnerin. Nun waren wir endlich so weit. Jedes Wochenende feilten wir minutiös an unseren Hochzeitsvorbereitungen. Die Vorfreude war fast schöner, als es vielleicht die eigentliche Feier im Herbst sein würde. Wir hatten bei der Festlegung der Gäste, der Auswahl der Location, der geplanten Menüfolge und dem Niederschreiben von Vorschlägen für sinnvolle Geschenke Spaß wie kaum zuvor.
Beruflich ging der Abschlussbericht zum aktuellen Forschungsprojekt am leichtesten von der Hand. Daten waren in Schriftsprache zu übersetzen und logische Schlüsse daraus abzuleiten. Eine Abschlussarbeit, die stets herausfordert aber überaus befriedigend sein kann, wenn sich neue Erkenntnisse gut begründet darstellen lassen.
Eng damit verbunden war die zu planende Pressekonferenz. Weil eine Politikerin einen kaum erwähnenswerten Beitrag aus öffentlichen Geldern beigesteuert hatte, musste sie unbedingt an der ‚PK‘ teilnehmen. Und das bedeutete, sie würde mit gewinnendem Lächeln und massivem Ehrgeiz alles daransetzen, zu diesem Anlass in der Tagespresse abgebildet zu werden, um die Gnade ihrer Förderung zur Schau stellen zu können. Denn nach der Wahl ist bekanntlich vor der Wahl. Und vor allem ist kurz vor der nächsten Wahl ‚vor der Wahl‘, was nicht nur die besagte Dame heißer als eine rollige Katze nach positivem Medienecho lechzen ließ.
Der PK-Termin war durch ein halbes Dutzend Anrufe schnell festgelegt. Er setzte allerdings meine Professorin und mich unter starken Beschaffungsdruck, denn der Bericht musste selbstverständlich eine Woche vorab vorgelegt werden. Also hatte diese Arbeit absolute Priorität, worunter mal wieder meine Doktorarbeit litt. Wie so oft in den vergangenen Monaten musste sie hintan stehen. Eigentlich wollte ich die Dissertation bis zum Jahresende fertiggestellt haben, denn bereits im letzten Jahr hatte mich meine Neugier beim Verfolgen krimineller Machenschaften unnötig Zeit gekostet. Und das, obwohl ich nie Pater gewesen war oder werden wollte. Bereits Ende März war abzusehen gewesen, dass ich auch heuer den erweiterten Zeitplan nicht halten konnte. ‚O tempora, o Moses‘, hätte mein guter alter Freund Karl-Heinz verballhornend dazu gesagt.
Wichtiger, weil ebenfalls zeitkritisch, war es, Unterlagen für die beiden Seminare anzufertigen. Als ich dafür alte Materialien sichtete und neue erstellte, kam mir eine glorreiche Idee. Warum nicht das Notwendige mit dem Nützlichen verbinden? Doch, bevor ich den Einfall verfolgen wollte, stand eine Séance bei Alex an.
In der Vergangenheit hatte meine Freundin ab und an ihre psychologischen Fähigkeiten beigesteuert, wenn es bei jemandem aus unserer Clique darum ging, geistig Verschüttetes ans Tageslicht zu befördern. Alex hätte eine gute Psychoanalytikerin abgegeben, wäre sie nicht stärker der Arbeits- und Organisationspsychologie zugeneigt. Wie ich sie kannte, würde sie in jedem psychologischen Gebiet brilliert haben. Am folgenden Samstag wagte ich daher einen Ausflug in ihr Hobby – die Hypnose.
Wir machten es uns in unserem Wohnzimmer bequem, ich im aufklappbaren Fernsehsessel, sie auf einem Stuhl seitlich hinter mir. Mutter hatte sich einen Tagesausflug mit ihrer Cousine gegönnt, also konnten wir das Haus gemütlich für unsere Zwecke nutzen.
Die Stereoanlage verbreitete dezente Hintergrundmusik. Weil wir eng mit ihnen befreundet waren und sie lange nicht mehr getroffen hatten, waren auch Karl-Heinz Rogalla und seine Freundin Helga anwesend. Karl-Heinz, alter Studienkumpel, repräsentiert den eher gemütlichen Typ. Viele unterschätzen ihn aufgrund seines gesunden Appetits und seines (auf Churchills angebliches No-Sports-Zitat zurückzuführenden) kompakten Erscheinungsbilds. Seine Klugheit und freundschaftliche Loyalität bis hin zur Selbstüberwindung und seine enorme betriebswirtschaftliche Kompetenz lernt man an Karl-Heinz erst nach einiger Zeit kennen. Mit seiner Überdosis an schrägem Mutterwitz wird man – teilweise zum Leidwesen pikierter Anwesender – bereits fünf Minuten nach der ersten Begegnung konfrontiert. Freundin Helga war angesagte Programmiererin, wobei man ihr das ebenfalls nicht ansah. Von der Statur her erinnerte sie eher an eine professionelle Schlamm-Catcherin, innerlich besaß sie aber ein Herz aus Gold. Von daher passten die beiden bestens zusammen.
Mit sanfter Stimme führte mich Alex durch eine Traumreise.
„Schließe jetzt deine Augen. Du bist völlig entspannt.“
Kaum angetreten, wurde die Reise jäh unterbrochen.
„Rogge“, redete Alex meinen Freund mit seinem ungeliebten Spitznamen an, „du hörst jetzt bitte auf, so übel auf deinem Kaugummi zu schmatzen. Wie soll sich Felix dabei entspannen?“
Prompt verstummten Hintergrundgeräusche, die ich anfangs für Verschmutzungen auf der Esoterik-CD gehalten hatte.
„Du bist völlig entspannt.“
Na ja, dazu benötigte es wohl noch eine Weile.
„Deine Arme werden schwer. ... Du atmest tief und ruhig. Deine Beine werden schwer. ... Dein Körper ist angenehm warm. ...“
Stimmt.
„Gedanken ziehen dahin wie Wolken. ... Sie kommen und gehen. ... Nichts bleibt haften. ... Du warst gerade in der Sauna. Nun liegst du im Fitness-Studio auf einer Liege. ... Du entspannst dich tiefer und tiefer und tiefer ...“
Kurz bevor ich einnickte, führte mich Alex zur Schlüsselszene: „Vor der Sauna streitet sich jemand. ... Was hörst du?“
„Fremdsprache.“
„Langsam stehst du von der Liege auf. ... Was siehst du?“
„Streiten.“
„Wer streitet sich?“
„Muskeln.“
„Sind es drei Männer?“
„Hmmm.“
„Was macht der linke Mann?“
„Fäuste.“ Unbewusst ballte ich die Hände.
„Du bleibst völlig entspannt. Die Männer können dich nicht sehen. Du siehst dagegen alles sonnenklar. ... Deine Muskeln lockern sich. ... Mehr und mehr. ... Mehr und mehr. ... Was hat der linke Mann auf dem Oberarm?“
„Komische Windmühle.“
„Schau dir den Arm genau an. Was befindet sich unter der Windmühle?“
„Zeichen.“
Alex‘ Stimme schmeichelte seidenweich wie nie: „Beschreibe die Zeichen.“
„Alpha. ... “
„Welche Zeichen hat der Mann auf dem Arm?“
„W. P.“
Alex ließ eine längere Pause verstreichen. Plötzlich sprudelte es aus mir heraus:
„B. H. Kringel.“
„Hat er ein ‚B‘ und ein ‚H‘ auf dem Arm?“
„Hmmm.“
„Hat er dahinter einen Kringel auf dem Arm?“
„Hmmm.“
„Und am Anfang hat er Alpha auf dem Arm?“
„Hmmm.“
„Kannst du den Kringel sehen?“
„Hmmm.“
„Ich halte dir jetzt meine Handfläche hin. Zeichne den Kringel mit deinem Zeigefinger auf meine Hand. ... Und jetzt spürst du langsam wieder deine Beine. ... Und deine Arme. ... Du kommst langsam zu dir. ... Die Müdigkeit fällt von dir ab. ... Wenn du gleich auf mein Zeichen hin die Augen öffnest, bist du hellwach und völlig erfrischt.“
Jemand klatschte in die Hände. Ich richtete mich verwundert im Fernsehsessel auf, der sanft in seine Sitzposition zurückglitt.
„Was ist denn los?“, fragte ich. „Warum fängst du nicht an?“
Karl-Heinz lachte: „Mensch, Felix. Du hast eine unglaubliche Vorstellung abgeliefert. Alpha, Kappa, Omega und so weiter. Mit der Nummer könnt ihr im Zirkus auftreten.“
„Erzähl kein Stuss. Was war jetzt wirklich los?“
Ich konnte mich definitiv an nichts erinnern. Alex weihte mich ein, indem sie mir ein Blatt Papier mit kryptischen Zeichen vor die Nase hielt. ‚Alpha. W. P. B. H. ƞ‘. Ich stierte auf das Blatt wie das Schwein ins Uhrwerk. „Soll das heißen, wir sind schon fertig, und ich habe das da von mir gegeben?“
Karl-Heinz sprach eine seiner denkwürdigen Anerkennungen aus: „Du bist heute aber auch wieder ein Blitzmerker, Felix. So kennen wir dich.“
„Hör doch auf, ihn zu hänseln, mein Guter. Er hat das ganz prima gemacht“, rügte Helga sanft ihren Partner. Der gute Karl-Heinz schmolz förmlich dahin, als sie ihn am Genick kraulte.
„Das da habe ich nicht gesehen“, kommentierte ich.
„Quatsch nicht, haben wir alle drei so gehört“, widersprach Karl-Heinz. Helga nickte.
„Dann ist es falsch aufgezeichnet“, gab ich leicht erregt zurück.
Alex suchte unseren Disput konstruktiv zu lenken:
„Ruhig Blut, Jungs. Felix – nimm doch bitte einen Stift und male darunter, wie du es gesehen hast.“
Ich konnte mir zwar nicht vorstellen, wie mir das gelingen sollte, da ich mich an nichts erinnerte. Aber als ich den Bleistift in der Hand hielt und auf Alex‘ Vorbild schaute, flossen die Zeichen wie von selbst von der Hand: ∝) WP-BH η‘.
„Hast Recht, ist nicht genau dasselbe“, gab Karl-Heinz zu. „Das erste und letzte Zeichen sieht aus wie aus dem griechischen Alphabet. Und die Buchstaben dazwischen sind anders gruppiert. ‚Alpha‘ ist allgemein bekannt, aber was bedeutet das letzte Symbol? Ich schau schnell nach.“ Karl-Heinz bediente sein Smartphone. Kurz darauf tönte er: „Eta.“
„Ich kenne nur Alpha und Omega – Anfang und Ende. Omega sieht aber völlig anders aus“, meinte ich. „Habt ihr einen blassen Schimmer, was das alles soll? Ich jedenfalls nicht.“
Wir rätselten ergebnislos an den Zeichen herum. Ich kannte Alpha und Eta als Begriffe der Statistik. In diesem Zusammenhang besagte das rein gar nichts. Nach Recherchen im Netz schlossen wir KFZ-Zeichen ebenso aus wie mathematische oder physikalische Formeln und gaben nach neunzig Minuten entnervt auf. Alex war es zu verdanken, dass der Nachmittag dennoch gerettet wurde.
„Also, wir haben zumindest einen Ansatzpunkt gefunden. Vielleicht sollten wir uns für heute damit zufrieden geben. Lasst uns lieber unser Wiedersehen geruhsam ausklingen. Vielleicht mit einem Eis oder einem Stück Torte im Café Natter.“
Nicht nur bei Karl-Heinz rannte der Vorschlag offene Türen ein. Und so wurde es im von Touristen und Senioren frequentierten Ausflugslokal dann noch ein lustiger Nachmittag. Wir tauschten alte und neue Geschichten, lachten gemeinsam und schmiedeten Pläne für ein erweitertes Wiedersehen, bei dem auch unser genialer Informatiker Alfi und ein befreundeter junger Profiboxer dabei sein sollten.
Helga und Karl-Heinz waren zudem die ersten außerhalb der Familie, denen wir von unserer geplanten Hochzeit erzählten. Alex‘ Eltern, meine Mutter, meinen jüngeren Bruder Benny, Onkel Jodok (väterlicherseits) und seine Frau Sieglinde hatten wir bereits kurz nach unserer Entscheidung informiert. Naturgemäß drehten sich die restlichen Gespräche des Nachmittags um unsere außerordentliche Lebensentscheidung. Helga schaute dabei ihren ‚Guten‘ bedeutungsschwer an, was dieser aber völlig ignorierte.
„Guten Morgen allerseits!“
Wie immer schoss sich die Konzentration der rund vierzig Studenten um kurz nach acht Uhr in der Früh nicht sofort auf mich ein. Einige kauten selbstvergessen Brötchen. Andere rieben sich die Augen, checkten ihr Smartphone, unterhielten sich über anstehende Klausuren oder steckten die Köpfe zusammen und kicherten. Gefühlte zwanzig Prozent der Anwesenden stellten Augenkontakt her und gaben mir damit das Gefühl im Raum zu sein.
Mein eigenes Studium war noch nicht allzu lange her, als dass mir diese Verhaltensweisen unbekannt gewesen wären. Sie hatten nichts mit mangelnder Wertschätzung gegenüber der Lehrperson zu tun, eher mit individuellen studentischen Prioritäten an einem durchschnittlichen Morgen. Dozenten, die darauf hysterisch reagierten, konnten einpacken. Wer dagegen ein Kaninchen aus dem Hut zauberte, durfte zumindest anfängliches Interesse erwarten. Ich wollte heute ein pinkfarbenes Kaninchen mit grünen Streifen präsentieren.
„Wie kann man besser die Prinzipien seriöser Forschung verstehen, als selbst ein Forschungsprojekt von A bis Z umzusetzen?“
Eine kurze Spannungspause verstrich.
„Aus diesem Grund möchte ich mit Ihnen ...“, ich siezte alle, obwohl ich keine zehn Jahre älter war als die meisten, redete sie aber einzeln mit Vornamen an, „... ein Experiment starten, das ich in dieser Form noch nie realisiert habe. Und zwar geht es um eine knifflige Fragestellung, die Ihren Intellekt garantiert herausfordert. Bevor wir zur eigentlichen Aufgabe kommen, erläutere ich den organisatorischen Ablauf. Da die verschiedenen Lösungen prüfungsrelevant sind, empfiehlt es sich, die Ausführungen zu notieren.“
Man konnte einen Kugelschreiber vom Tisch fallen hören.
„Wissenschaft ist wie Detektivarbeit“, setzte ich die Instruktion fort. „Am Anfang steht eine offene Frage, ein Fall sozusagen. Und es liegen Spuren vor, deren Zusammenhang wir nicht kennen. Wir sammeln Indizien, entwickeln Theorien – zum Beispiel, wer der Mörder sein könnte – prüfen sie anhand der Fakten, verwerfen sie, wenn Fakten dagegen sprechen, und so weiter, bis der Mörder feststeht. Will sagen, bis die offene Frage mit neunundneunzigprozentiger Wahrscheinlichkeit durch Fakten beantwortet werden kann.“
In der folgenden halben Stunde stellte ich die Aufgabe. Es ging darum, von mir vorgegebene Anhaltspunkte zu verwenden, um Informationen zu sammeln und daraus eine Forschungsfrage zu entwickeln. Das war der für mich nützliche Teil. Die Veranstaltung endete jedoch nicht damit. Die Studierenden mussten dann eine passende Forschungsmethode skizzieren, Zielgruppen definieren, Kosten kalkulieren und erwartete Ergebnisse umreißen. Die Arbeit sollte in einen Entwurf für ein größeres Forschungsprojekt münden, würde aufgrund fehlender Ressourcen aber nur theoretisch durchgeführt werden. Anhand der Teilschritte und Zwischenergebnisse wollte ich mit den Studenten Herausforderungen wissenschaftlichen Arbeitens diskutieren. Das war der für sie notwendige Teil des Seminars.
In vorbildlicher Selbstorganisation entwarfen die Seminaristen Ideen für das weitere Vorgehen und teilten sich in Arbeitsgruppen auf. Eine Studentin, die zu jeder Jahreszeit kurzärmelig herumlief, um bunte Bildchen am linken Arm zur Schau zu stellen, sammelte Interessierte um sich. Die Gruppe wollte sich in Tattoo-Studios nach dem Windmühlen-Symbol und den Zeichen erkundigen.
Eine andere Gruppe beschäftigte sich mit dem griechischen Alphabet und der Bedeutung von Alpha und Eta. Eine dritte suchte den Sinn der Windmühle und der Zeichenfolge übers Internet herauszufinden, eine vierte wollte soziale Netze aktivieren. Die letzte Arbeitsgruppe plante, diverse gesellschaftliche und politische Vereinigungen zu befragen, inwiefern ihnen Symbol und Zeichen bekannt seien. Während die Studenten in Kleingruppen diskutierten, kam ich mir vor wie Emil, nur dass Erich Kästner ihm weniger Detektive zugestanden hatte als die Fachhochschule mir mit diesem Seminar.
Während der nächsten Wochen, in denen die Gruppen eigenständig recherchierten, verfolgte ich einen anderen Plan. Irgendwie mussten das Geheimnis der rosafarbenen Pastillen und die Identität von Bozidar, dem Muskelmann mit dem Porsche, gelüftet werden.
4. Domains
Was ist ‚Kiril‘? Was bedeutete die Zahl 4.000 in diesem Zusammenhang? Und worum konnte es sich bei den rosafarbenen Pastillen handeln? Während die Studenten in ihren Kleingruppen arbeiteten, suchte ich etwas über die Wort-Zahlen-Kombination herauszufinden, die auf dem Zettel stand, den ich zusammen mit den Pillen auf dem Parkplatz des Fitness-Studios aufgeklaubt hatte.
Die erste Frage konnte durch das WWW relativ schnell beantwortet werden, nur brachte das kein aufschlussreiches Ergebnis. Kiril war entweder ein altgriechischer, russischer oder mazedonischer männlicher Vorname oder ein kürzlich verstorbener bulgarischer Geistlicher des zwanzigsten Jahrhunderts, oder ein noch lebender mazedonischer Handballspieler, ein osteuropäischer Musiker oder ein Professor der Universität von Chicago oder der Avatar eines Online-Spiels oder, oder, oder ...
Nach Durchsicht der ersten dreißig Treffer (von über einer Dreiviertelmillion) war ich bereits bedient. Tausende von Kirils lebten auf dieser Welt. Auch eine umfangreiche Recherche in verschiedenen Suchmaschinen für Bilder verlief enttäuschend. Der besagte Bozidar aus dem Fitness-Studio war nirgends aufzutreiben. Weder Bozidar noch Kiril oder Kombinationen der Worte mit der Zahl 4.000 ergaben einen brauchbaren Hinweis. Auch war niemand namens Kiril in Vorarlberger Online-Telefonbüchern verzeichnet.
Alles zusammen machte mich stutzig, denn wer heutzutage nicht im Netz präsent ist, lebt wahrscheinlich als tibetanischer Eremit oder ist absolut von vorgestern. Oder er verfügt über nicht alltägliche technische Kenntnis, wie Hinweise auf die eigene Identität im WWW gelöscht werden. Bekanntlich legen einem die Datenbetreiber diesbezüglich wahre Felsbrocken in den Weg.





























