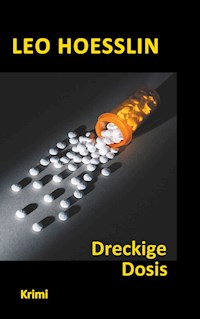Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Innerhalb einer Woche stürzen drei Vorarlberger Informatiker unabhängig voneinander beim Wandern zu Tode. Das war kein Zufall, vermutet Felix Moosburger, denn die drei galten als erfahrene Alpinisten. Der junge Psychologe geht der Sache nach, weil ein Verunglückter ein Kollege von ihm gewesen war. Dabei erhärtet sich Felix' Verdacht. Nur kurzzeitig kann ihn eine anonyme Morddrohung davon abhalten, tiefer zu bohren. Einer rücksichtslosen Wettmafia geht das hochgradig gegen den Strich ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Pia
Inhaltsverzeichnis
Chimäre
Credo
Carungas
Cassius
Cornichons
CCC
Clemens
Casino
Chang
Chinesen
Chance
Cash
Curry
Cologne
Chuzpe
Christfest
Cro-Magnon
Cervesa
Comisario
Chinasyndrom
Chopin
Chaos
Clou
Courage
Cum tempore
Cut
Conclusio
Danksagung und Allfälliges
Wie es weitergeht …
Bisher von Leo Hoesslin erschienen:
1. Chimäre
„Lothar ist tot!“
„Wer? Matthäus?“, fragte ich.
„Nein, nicht Matthäus, sondern Lothar. Lothar habe ich gesagt, hörst du nicht zu? Lothar F. Klunkerer.“
Ziemlich genervt von der aufdringlichen Art jener Person, die mich grob aus meinen Gedankengängen herausgerissen hatte, versuchte ich, sie durch eine pampige Replik loszuwerden.
„Sollte man den etwa kennen?“
Doch Sibylle Kanich war nicht so leicht abzuschütteln. Vor dem fleischgewordenen Kommunikationsmedium unserer Fachhochschule war kein hochschulinternes Geheimnis sicher. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin unseres Fakultätsvorsitzenden hatte nicht davor zurückgeschreckt, mein Büro ohne anzuklopfen zu entern und grausam den harmonischen Arbeitsrhythmus eines Kollegen zu stören. Ihre Körperhaltung drückte aggressives Pressing aus.
„Mensch, Lothar F. Klunkerer! Der mit dem F in der Mitte, auf das er so viel Wert legt. Tu nicht so, als wüsstest du nicht, wen ich meine. Wimi von der Informatik. Stand beim letzten Grillfest hinter dem Rost und hat Schweinenacken aufgelegt.“ Sibylle sah ziemlich genervt aus.
Ich musste das Grillfest verschlafen haben, weil sich kein Bild in mir abzeichnete, aber so ungefähr war klar, wen sie meinte: einen bestimmten wissenschaftlichen Assistenten eines Forschungsinstituts, der beim Sprechen nuschelte und durch die polypenverseuchte Nase sprach.
„Ja, und?“
„Und nun ist er tot.“
„Sagtest du bereits. Ist er beim Grillen auf den Rost gefallen und eingeschlafen, oder was?“
Entrüstet fuhr mich Sibylle an: „Selten so gelacht. Über Tote macht man keine Scherze, Felix. Hat dir das niemand beigebracht? Nein, er ist gestürzt. Vom Abhang gestürzt. Bergwanderung. Hundert Meter tief. Einfach so. Tot.“
Langsam sickerte die Botschaft durch meine Gehirnwindungen, obwohl ich andere Probleme hatte. Seit Tagen gab ich tausende Zahlencodes aus einer Umfrage in eine Datenbank ein. Die stupide Arbeit musste übermorgen laut Plan fertiggestellt sein – egal, wann und wo ich sie leistete. Denn außer dem Zeitplan meiner betreuenden Professorin war ich niemandem Rechenschaft schuldig, wie ich meine Pflichten erledigte. Nur mussten die Ergebnisse absolut pünktlich und fehlerfrei vorliegen. Jede Unterbrechung ‚à la Sibylle Kanich‘ erschwerte diese Aufgabe.
Sibylles blonder Pferdeschwanz wippte, während sie mit ihrer kleinen rundlichen Figur aufgeregt hin und her tänzelte und auf meine Reaktion wartete.
„Hat er denn den Berg unterschätzt?“, fragte ich pro forma nach.
„Glaube nicht. Ist Mitglied im Alpenverein … gewesen. Sogar Bergführer. Kletterqualifikation für Fortgeschrittene. Langjährige Praxis.“
„Ist ja übel.“
„Sag ich doch. Hinterlässt eine Frau. Das ganze Institut ist entsetzt. Kollegen organisieren eine Sammlung für die Witwe.“
Sibylles Art, im Telegrammstil zu reden, half ihr, die schier unendlichen Informationsmengen zu bewältigen, die sie täglich in den Gängen und Kaffeeküchen der Fachhochschule ventilierte. Mit der Todesnachricht hatte sie zweifellos einen Knaller gezündet. Auf jeden Fall wusste ich nun, was los war und aus einem unerklärlichen Grund trug meine Reaktion dazu bei, Sibylles Kommunikationssucht kurzzeitig zu befriedigen. Weil es außer Betroffenheitsbekundungen nichts hinzuzufügen gab, zog sie nach fünf Minuten endlich von dannen – um sich bei anderen Kollegen den nächsten linguistischen Orgasmus zu verschaffen, nahm ich an.
Tragische Bergunglücke mit tödlichem Ausgang kommen in den Alpen jährlich im unteren dreistelligen Bereich vor. Das trifft Anfänger beim Klettern, Rentner beim Wandern, Skifahrer abseits der Pisten, Radfahrer bei der Pause am reißenden Wildbach – von dem sie beim Trinken mitgerissen werden – wie erfahrene Bergsteiger gleichermaßen. Die einen kommen aus Unkenntnis vor den Bergen oder dem eigenen Körper oder aus fehlendem Respekt vor der Natur um, andere aus falschem Sicherheitsgefühl. ‚Einfach so’ stirbt im Gebirge niemand, weil es immer eine Ursache für einen Absturz oder Fehltritt gibt. Nicht selten liegt die eher beim Menschen als bei der Natur. Ich musste es wissen, hatte ich doch vor Jahren meinen leichtsinnigen Vater durch einen Blitzschlag verloren, als er während eines Gewitters auf der Alm einer verirrten Kuh nachgelaufen war.
‚Wirklich Pech für Lothar’, dachte ich anteilnehmend und entschloss, für heute keine weitere Minute auf die Arbeit zu verwenden. Auch meine Doktorarbeit, an der ich schon seit über einem Jahr herumbastelte, musste ausnahmsweise auf mich verzichten. Stattdessen wollte ich den Rest des warmen Sommertags nutzen, um einen kleinen Ausflug in die Berge zu unternehmen; Wanderzeug lag stets griffbereit im Auto.
So fuhr ich den PC herunter, schloss das Büro ab und lenkte den alten Polo in Richtung Elternhaus, in dem meine Freundin Alex und ich seit längerem die erste Etage bewohnten. Wie vor über dreihundert Jahren, als es gebaut worden war, steht das hölzerne Bauernhaus noch heute im kleinen Bergdorf Rotenstein an den Ausläufern der Alpen. Meine Vorfahren hatten dort ihr Lebtag Viehwirtschaft betrieben. Seit dem Tod ihres Mannes lebte Mutter allein im Erdgeschoss des alten Gebäudes. Obwohl vor knapp einem Jahr mein jüngerer Bruder wegen seines Jurastudiums nach Wien gezogen und Mutter im Alltag verstärkt auf sich gestellt war, kamen wir entgegen aller Vorurteile zu dritt bestens miteinander aus.
Unterwegs hielt ich auf einem Aussichtsparkplatz, von dem man laut Wegbeschreibung in neunzig Minuten bis zu einem zweitausend Meter hohen Gipfel genüsslich wandern konnte. Allerdings wollte ich Kondition bolzen und keinen Seniorenspaziergang unternehmen. In der Hälfte der angegebenen Zeit war ich oben, in noch kürzerer Zeit wieder unten. Beim schwungvollen Abwärtsfedern ging mir, wie so oft, die szenische Beschreibung von Jack Kerouac durch den Kopf, wie er in den kalifornischen Bergen, die Schwerkraft nutzend, von Fels zu Fels hinabtanzte und sich in der Weite der Rocky Mountains frei und ungebunden fühlte.
Meine neunzigminütige Minimalvariante von Freiheit und Abenteuer war zwar nichts gegen eine mehrtägige Wanderung in den Rockies, sie musste aber für heute reichen. Verschwitzt und glücklich kam ich zu Hause an und schwatzte nach dem Duschen zur gemeinsamen Erbauung mit meiner Mutter, bevor ich mich noch einmal an den Laptop setzte, um Literatur für die Doktorarbeit nachzutragen.
Gegen halb acht kam Alex nach Hause. Oft kochte Mutter für uns drei, und dann rekapitulierten wir beim Abendessen unseren Tag und nahmen Anteil an den Ereignissen der anderen. So auch heute. Mutter servierte eine leichte fleischlose Mahlzeit mit gemischtem Salat, Riebl und Kräutertopfen. Zum Nachtisch gab es Reste eines Kirschkuchens vom Wochenende. Nach dem Abendbrot spazierten meine Freundin und ich ums Dorf, weil sie heute ‚einen dieser typischen Bürotage’ hatte und den Kopf freibekommen wollte.
„Stell dir vor, stürmt doch Meisner-Schönfelder einfach so ins Büro und will mir …“
„Ist das der vom Einkauf oder der von der Buchhaltung?“
„Weder noch. Das hab ich dir doch mehrfach erklärt. Hörst du nie zu? Meisner-Schönfelder leitet die Abteilung Ausland. Und der nervt mich immer mit seiner ewigen Litanei, wir sollten mehr Fachkräfte aus Südeuropa werben. Dabei haben wir Spanien bereits von oben bis unten nach brauchbaren Ingenieuren abgegrast. Für die nächsten zwei Jahre ist da kaum mehr herauszuholen. An Italien sind wir dran und Griechenland kommt sowieso nicht in Frage. … Also, stürmt der unangemeldet ins Büro und will von mir die Recruiting-Quote des letzten Quartals. Obwohl er mir nichts zu sagen hat und eigentlich über meinen Chef gehen müsste, wenn er Auskünfte einholen will.“
Alex war seit knapp zwei Jahren als Assistentin im Personalwesen bei einem größeren technischen Unternehmen Vorarlbergs beschäftigt. Eine lukrative Stelle, die sie quasi direkt nach Abschluss ihres Psychologie-Masters angeboten bekam, worauf sie zu Recht mächtig stolz war.
„Ja und? Wie ich dich kenne, hast du ihm das sicher sofort auf die Nase gebunden.“
„Natürlich. Ich habe mir dadurch aber einen neuen Gegner eingehandelt.“
„So, wie du es öfter erzählst, ist dieser Meierfelder …“
„Meisner-Schönfelder!“
„Okay, Meisner-Schönfelder ... ist er eh nicht zu deinen Anhängern zu zählen.“
„Nicht, seit ich ihm auf der letzten Weihnachtsfeier auf die Finger geklopft habe, weil er mir besoffen am Schenkel herumfummelte.“
An die Geschichte erinnerte ich mich gut. Alex hatte dem Typen kräftig auf den Handrücken geschlagen und entschuldigend gemurmelt, sie dachte, ihr sei eine Fliege am Kleid hinaufgekrabbelt.
„Mir ist heute auch jemand einfach so ins Büro gestürmt“, knüpfte ich an ihre Erzählung an, „Sibylle Kanich hat mal wieder meine Kreativphase gestört und erzählt, ein Wimi aus dem Informatikbereich ist im Berg tödlich verunglückt. Die Quatschtante ist sowas von nervig, das kannst du dir nicht vorstellen.“
„Informatiker in diesem Land wollen wohl alle hoch hinaus.“
„Wieso?“
„Von uns sind letzte Woche auch zwei beim Bergwandern abgestürzt. Zwei von der IT-Abteilung. Beide erfahrene Alpinisten. Mitglieder im Alpenverein. Übten den Bergsport angeblich seit ihrer Jugend aus.“
Das machte mich stutzig, denn dasselbe traf laut Sibylle auch auf den verstorbenen Kollegen zu: „Waren die zusammen, als es passierte, und sind sie vielleicht gemeinsam abgestürzt?“
„Keine Ahnung. Die Todesnachrichten landeten an unterschiedlichen Tagen auf meinem Tisch. Muss so letzten Mittwoch und Freitag gewesen sein. Oder Dienstag und Freitag. Stand in der Zeitung.“
„Heute ist auch Dienstag“, überlegte ich laut, „also starb je ein Informatiker an einem Sonntag oder Montag, einem Mittwoch oder Donnerstag und erneut an einem Sonntag oder Montag. Die waren also nicht gemeinsam unterwegs. Liegen nicht die Zeitungen von letzter Woche im Stadel? Da stehen doch sicher deren Todesanzeigen drin.“
„Witterst du wieder Unrat?“
„Weiß nicht. Aber das sind mir ein paar Zufälle zu viel – drei Eigenschaften, die auf drei Tote innerhalb einer Woche in gleichem Maße zutreffen. Ich finde solche Fragen einfach spannend. Ist wie bei einer Studie, wenn ich eine bestimmte Hypothese verfolge und anhand der Daten analysiere, ob ich richtig oder falsch liege.“
Wir machten uns gemächlich auf den Heimweg und stöberten später im Heustadel, bis wir im Altpapier auf die entsprechenden Zeitungsmeldungen stießen. Sonntag und Mittwoch waren die beiden Informatiker aus Alex’ Firma abgestürzt. Jetzt wollte ich auch den genauen Todestag von Lothar herausfinden.
Anderntags stand ich bereits vor meiner Mutter auf, um einen kurzen Blick in den Lokalteil unseres Anzeigers zu werfen, der uns täglich, mit Ausnahme des Sonntags, vor die Tür gelegt wird. Wie zu lesen war, verstarb Lothar F. Klunkerer tragischerweise am Sonntagnachmittag unterhalb eines Grates zu einem Schweizer Berggipfel – vermutlich war er vom Grat gestürzt. Seine Frau hatte ihn abends vermisst und die Bergrettung alarmiert. Die hatte ihn zwei Tage später tot im Gelände aufgefunden. Sonntag, Mittwoch, Sonntag und das hintereinander innerhalb einer Woche – wenn das kein überzufälliges Muster darstellte ...
Drei tote Informatiker innerhalb einer Woche. Jeweils ein Absturz im Gebirge. Alle waren erfahrene Bergführer und Mitglieder des Alpenvereins gewesen. Alle übten denselben Beruf aus.
‚Gott würfelt nicht’, hatte Albert Einstein angeblich gemeint. Mir schien, jemand anderes würfelte hier ebenfalls nicht. Oder lief bei mir nur Kopfkino ab?
2. Credo
„Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und …“
Die kleine Wallfahrtskirche im Bergdorf Ebnit war gut besucht. Gut vierzig Personen erwiesen Lothar beim abendlichen Rosenkranz die letzte Ehre. Abwechselnd leierten die links und rechts im Kirchenschiff Sitzenden altbekannte Formeln herunter: das Ave Maria und das Vaterunser.
Während ich den im Langzeitgedächtnis unauslöschlich verankerten Text herunterleierte, blickte ich mich heimlich um. In der ersten Reihe, die verweinte Hochschwangere mit dem unförmigen schwarzen Kleid und dem breiten Halstuch, das konnte nur Lothars Frau sein. Trauernde neben ihr waren entweder männlich oder zu alt. Dass die Witwe ein Kind erwartete, hatte selbst unsere Klatschbase Sibylle nicht gewusst.
Unter den restlichen Gästen kamen mir einige Gesichter von der Fachhochschule her bekannt vor. Soweit ersichtlich, war kein Mörder anwesend. ‚Ha, wie schauen denn Mörder aus, du Schlaumeier?’, fragte mich mein innerer Professor Boerne.
Nach einer knappen Stunde endete die Zeremonie. Die Schwangere weinte ununterbrochen. Angemessenen Schrittes verließen wir hinter ihr die barock ausgestattete Kirche und stiefelten zur Friedhofskapelle. Trauergäste kondolierten nacheinander am Sarg, sprenkelten Weihwasser und legten ihr monetär ausgestattetes Beileidskärtchen auf einer Messingschale ab. Lothars Verwandtschaft stand mit bitteren Mienen hinten im Halbkreis. Die meisten von Lothars Freunden und Bekannten verflüchtigten sich, nachdem sie ihre Gesten dargeboten hatten. Einige standen vor der Kapelle zusammen und unterhielten sich leise. Einzelgänger wie ich hielten sich nach der Beileidsbekundung dort wie bestellt und nicht abgeholt auf. Ich war geblieben, weil ich noch etwas vorhatte. Mit einem Assistenten unserer Fachhochschule wechselte ich einige unverfängliche Worte, bis die Witwe als letzte Person hinter dem Sarg hervortrat.
„Mein aufrichtiges Beileid“, sprach ich die Trauernde an, während ich eine schlaffe Hand schüttelte. „Ich bin ein Kollege von Lothar. Felix Moosburger. Von der Fachhochschule. Viele Kollegen trauern aufrichtig um Ihren verstorbenen Gatten.“
Frau Klunkerer nahm mich kaum wahr, schluchzte nur schwer verständlich in ihr Taschentuch: „Vielen Dank für Ihre Anteilnahme.“
Formal konnten der Verstorbene und ich als Kollegen angesehen werden, tatsächlich hatten wir jedoch nichts miteinander zu tun gehabt. Immerhin war meine Beileidsbekundung nicht gelogen.
Am Rosenkranz hatte ich nicht etwa teilgenommen, weil dort eventuell ein Mörder ausfindig zu machen war. Das wäre völliger Blödsinn gewesen. Nein, vielmehr wollte ich einen Kontakt zur Witwe herstellen, an den sie sich vielleicht im Nachhinein erinnerte, denn ich hatte vor, sie nach einer angemessenen Zeit zu besuchen und über Lothar auszufragen. Aus demselben Grund hatte ich meiner Beileidskarte einen selbstverfassten Text und fünfzig Euro für einen karitativen Zweck beigefügt. Das sollte fürs Erste genügen, um mich später bei ihr in Erinnerung zu bringen.
Die nächsten Tage gingen ins Land, ohne etwas zu diesem Fall beizutragen. Für mich war der Bergtod von drei Informatikern so lange ein ‚Fall’, bis sich trotz intensiver Spurensuche kein weiterer Zusammenhang ergeben würde. Dabei folgte ich dem alten Muster, ein Ende des Fadens aufzurollen und Staub aufzuwirbeln. Eventuell entstünde ein Knäuel und es zeichneten sich hinter der Staubwolke Silhouetten ab. Dann würde ich meinen anfänglichen Verdacht als erhärtet ansehen.
Doch zunächst schrieb ich, neben üblichen Arbeiten für das psychologische Forschungsprojekt meiner Professorin, von Zeit zu Zeit an einem Kapitel meiner – ebenfalls psychologischen – Doktorarbeit. Diese Gelegenheit hatte sich nach Abschluss des Masterstudiums eröffnet, als Frau Professor Doktor Grafl mir eine auf drei Jahre befristete Assistentenstelle in ihrem Forschungsinstitut angeboten hatte. Weil es sich um eine Teilzeitstelle handelte, bekam ich daneben genug Spielraum, um die Doktorarbeit über ein internationales Universitätsnetzwerk anfertigen zu können.
Mein Privatleben lief in jenen Tagen nach einem wiederkehrenden aber erfüllenden Schema ab: Wenn Alex von ihrer Arbeit nach Hause kam, waren bis zum Schlafengehen Partnerschaft und Familie angesagt. Manchmal joggten wir vor dem Abendessen und an den Wochenenden gönnten wir uns eine längere Bergtour. Zudem nahm ich seit etwa eineinhalb Jahren zweimal wöchentlich abends an einem Spezialtraining teil: Streetfighting für jung und alt. Ich dachte, bei meinem Hang, ab und an auf schräge Typen zu stoßen, könne das nicht schaden. Außerdem hielt das Training gehörig fit.
Acht Tage nach der Trauerfeier besuchte ich Frau Klunkerer. Sie wohnte in Nüziders, einer Gemeinde weit im Oberland Richtung Arlberg. Das stattliche Anwesen befand sich in bester Südlage, oberhalb der Kirche am auslaufenden Hang des Muttersbergs. Von hier aus hatte man einen guten Überblick über das sich verengende Tal und die Dächer von Nüziders. ‚Keine schlechte Lage‘, dachte ich, während ich mehrmals den Klingelknopf betätigte. Die etwas in die Jahre gekommene Gegensprechanlage schnarrte:
„Ja, bitte?“
„Felix Moosburger hier, der Kollege von Lothar von der FH. Wir haben uns letzte Woche beim Rosenkranz getroffen. Erinnern Sie sich? Hätten Sie vielleicht kurz Zeit für mich? Wir wollen einen Nachruf auf unseren Kollegen verfassen und dazu hat man mich gebeten, Details von Ihnen beizusteuern.“
„Muss das jetzt sein? Ich weiß nicht.“
„Ich kann auch später wiederkommen, wenn Sie wollen. Allerdings sind wir schnell fertig, falls Sie gerade Zeit haben.“
Nach einigen Sekunden ertönte der Türsummer. Hinter der Buchsbaumhecke verbarg sich ein für diese eng bebaute Gegend relativ geräumiges Grundstück in Hanglage. Der Bungalow im Stil der siebziger Jahre umschloss auf drei Seiten einen Patio mit freiem Blick nach Westen, wie mir nach Betreten des Wohnzimmers auffiel.
Die schwangere Dame des Hauses trug eine dunkle, stark gewölbte Latzhose mit schwarzem T-Shirt, das nett zu ihren brünetten halblangen Haaren passte. Im Gesicht sah Frau Klunkerer deutlich mitgenommen aus, doch das war kein Wunder.
Meine Geschichte mit dem Nachruf war gut vorbereitet – dem Institut hatte ich diese Idee nahegelegt. Und wie in akademischen Kreisen oft üblich: Wer einen brauchbaren Vorschlag einbringt, bekommt aufgrund der Konvention über geistige Freiheit an Hochschulen keine Steine in den Weg gelegt, ihn umzusetzen. Will heißen: Die Professoren freuten sich, dass ich die aufwendige Detailarbeit übernahm und sie ohne zusätzliche Mühen von den Ergebnissen profitieren durften.
Anfänglich reagierte Frau Klunkerer etwas zurückhaltend. Sie wollte zunächst mehr über mich wissen, was ich ihr in Bezug auf meine Tätigkeit an der Fachhochschule und oberflächliche Informationen über mein Privatleben bereitwillig darlegte. Nur bei der Frage, welche Verbindung ich zu Lothar hatte, musste ich dichterische Freiheit walten lassen. Ich gab mich als Teilnehmer einer seiner Bergkurse für Anfänger aus, die er – das war den Darstellungen des Alpenvereins zu entnehmen – seit Jahren regelmäßig abgehalten hatte.
Laut und deutlich sprach Frau Klunkerer in das Mikrofon des digitalen Aufnahmegeräts, das zwischen uns auf dem Esstisch stand. Nach einigen Aufwärmfragen, welcher Mensch denn Lothar so im allgemeinen gewesen war, seit wann sie zusammenlebten und verheiratet waren, welche Hobbys er sonst betrieb (keine weiteren außer Bergwandern und ständig am PC sitzen) schoss ich meine erste investigative Frage ab:
„Und seit wann leben Sie hier in diesem Haus?“
„Ach, erst seit knapp einem Jahr.“
„Wie kommt man denn an solch eine schöne Lage bei den Bodenpreisen heutzutage? Die sind ja seit der letzten Finanzkrise ins Unermessliche gestiegen. Haben Sie oder Lothar das Grundstück geerbt?“
„Nein, haben wir nicht. Wir hatten einfach Glück. Grundstück und Haus waren zum Kauf angeboten. Niemand außer uns wollte die Sechshundertfünfzigtausend dafür aufbringen.“
In Gedanken stieß ich einen überraschten Pfiff aus. Sofern sie oder er nicht einer regionalen Industrie- oder Brotbackdynastie angehörten oder anderweitig reich geerbt hatten, wäre das Haus unbezahlbar gewesen. Ein kleiner wissenschaftlicher Assistent mit etwa dreitausend Euro Brutto monatlich würde die Hütte ein Jahrhundert lang abbezahlen müssen, wenn seine Frau nicht arbeiten ging.
„Da ist sicher das Ersparte für draufgegangen, wie es scheint. Oder haben Sie eine leitende Position inne?“
Die Witwe zögerte mit der Antwort, kam aber schließlich auf den springenden Punkt, nicht ohne stolz auf die Leistung ihres Verflossenen zu verweisen: „Wissen Sie, unsere Eltern und wir sind nicht reich oder so. Ich arbeite nicht. Knapp die Hälfte hat Lothar aus einem lukrativen Geschäft beigesteuert, das er vor über einem Jahr abgeschlossen hat. Ich durfte das nur nicht weitererzählen. Damit wir keine Neider auf den Plan rufen, hat er gesagt. Nun lebt er ja nicht mehr … und … hu, hu, hu …“
Die Witwe schüttelte es vor Gram. Als ihre Tränen einigermaßen getrocknet waren, knüpfte sie mühsam an ihrer Erzählung an: „Das Haus muss ich nun verkaufen. Mit Verlust. Kann die Abzahlung nicht leisten. Die Hinterbliebenenrente langt kaum für eine kleine Mietwohnung. Zusätzlich noch die Schwangerschaft und … hu, hu … Bitte schreiben Sie nichts darüber. Es wäre Lothar sicher nicht recht.“
Auf keinen Fall hatte ich vorgehabt, diese bedeutende Information unter die Leute zu bringen, also konnte ich ihrer Bitte locker entsprechen. Die Erzählung der Witwe erklärte einiges aber nicht alles: „War denn Lothar lebensgefährlich erkrankt – Krebs oder so?“
Ich dachte vage an einen Versicherungsbetrug, einen als Unfall getarnten Selbstmord mit vorheriger Absicherung der Hinterbliebenen.
„Auf gar keinen Fall. Er ist noch vor einem Monat einen Dreitausender uffi wie ein Junger. Hat ein Vereinskamerad gesagt.“
Im weiteren Gesprächsverlauf erkundigte ich mich nach Lothars beruflichem Werdegang. Abgesehen von der Mitgliedschaft im Alpenverein, dem er nicht aus Vereinsmeierei angehört hatte, sondern weil er in den Bergen groß geworden war, schien Lothar ein ziemlicher Einzelgänger gewesen zu sein. Er hatte keine reine Hochschullaufbahn hinter sich. Immerhin war er vierunddreißig Jahre alt geworden und erst seit einem halben Jahr bei uns an der Fachhochschule tätig. Vorher hatte er bei verschiedenen Firmen im deutschsprachigen Ausland und in Vorarlberg gearbeitet. In den letzten drei Jahren war er freischaffend unterwegs gewesen. In dieser Zeit hatte er auch seinen lukrativen Auftrag abgewickelt.
Frau Klunkerer konnte mir allerdings nicht mitteilen, wem Lothar damals den Auftrag zu verdanken hatte und worum es sich dabei handelte; das erfuhr sie nie. Es musste auf jeden Fall jemand gewesen sein, der nicht unbedingt dafür bekannt werden wollte. Geheimhaltungsstufe und so, habe ihr Lothar erklärt. Klang ein wenig nach James Bond, meinte sie. Sie habe es nie hinterfragt.
„Hat denn Lothar darüber etwas auf seinem Rechner?“
„Weiß nicht. Wissen Sie, bei uns ist letzte Woche eingebrochen worden. Elektrogeräte sind weg und auch Lothars Stand-PC und sein Notebook. Auch die HiFi-Anlage. Die Polizei meint, das war bestimmt eine rumänische Bande, die gerade quer durch Österreich reist. Auf ihr Konto gehen mindestens dreißig Villeneinbrüche. Kaum eine Chance, etwas wiederzubekommen. Wenigstens sind wir gegen Diebstahl versichert.“
Schade, da war jemand deutlich schneller gewesen als ich. Wenn ich das Gehörte zusammennahm und nur die relevanten Aspekte betrachtete, wurde mein Verdacht, hier gehe nicht alles mit rechten Dingen zu, eher bestärkt denn entkräftet.
Viel Nützliches kam dann nicht mehr bei diesem Gespräch heraus. Lothar sei stets ein begabter Schüler und hochbegabter Informatiker gewesen. Er wäre sicher ein toller Vater geworden, meinte seine Witwe, weil er sich in jeder Phase der Schwangerschaft rührend um sie und den zu erwartenden Nachwuchs gesorgt habe. Momentan wisse sie nicht, wie sie das alles alleine weiter durchstehen solle. Zum Glück lebten ihre und seine Eltern in der Nähe, das würde vieles erleichtern. Sie freue sich, dass Kollegen der Fachhochschule ihren verstorbenen Gatten in bester Erinnerung behalten würden.
Ich bedankte mich für die zur Verfügung gestellte Zeit – immerhin hatten wir fast neunzig Minuten miteinander verbracht – packte das Aufnahmegerät ein, verabschiedete mich höflich und fuhr heim.
Zu Hause klöppelte ich aus dem Gehörten einen Nachruf, wohlweislich unter Auslassung aller Passagen, die auch nur entfernt in einen Zusammenhang mit Lothars Bergunfall gebracht werden konnten, und sandte die Datei an einen Assistenten des Informatikinstituts, der sie auf deren Homepage stellen wollte.
Am Ende des Tages tauschten Alex und ich Gedanken aus. Wir konnten uns nicht einigen, ob Lothar nun eines natürlichen Unfalltodes gestorben war oder nicht. Alex meinte, ich würde ein reines Hirngespinst verfolgen und das garantiert bald einsehen. Ich schwankte und war unsicher. Die bisherigen Anhaltspunkte waren mehr als dürftig. Doch das spornte eher an, als dass es mich von weiteren Nachforschungen abhielt.
3. Carungas
„Bist du des Wahnsinns?!!“
Alex zeigte sich nicht erbaut über meinen Vorschlag. Meine Queen des Herzens war eindeutig ‚not very amused’.
„Du kannst doch ganz in Ruhe nachforschen“, schlug ich vor, „ist doch nichts dabei.“
„Von wegen ist nichts dabei. Denkst du dabei überhaupt an mich? Ich komme in Teufels Küche, wenn das herauskommt.“
„Wieso? Du interessierst dich halt für die bisherigen beruflichen Tätigkeiten und Profile der beiden Informatiker, weil du immerhin deren Stellen adäquat nachbesetzen willst. Dafür musst du halt genau wissen, was sie so alles in eurem Unternehmen zu tun hatten. Am Besten, du sprichst mit ihrem bisherigen Chef und erstellst ein Tätigkeits- und Persönlichkeitsprofil von den beiden verunglückten Bergwanderern.“
„Spinnst du? Auch noch ein Persönlichkeitsprofil. Das haben wir noch nie gemacht.“
„Dann eben nicht, aber für eine Stellenbeschreibung müsste es doch reichen. Die solltet ihr eh in euren Unterlagen haben, wenn die Bude so professionell arbeitet, wie sie in der Werbung auftritt. Und dann klärst du anhand der Tätigkeiten der beiden toten Informatiker, ob die Stellenbeschreibung aktuell ist.“
„Das glaubst nur du, dass wir so etwas für alle Mitarbeiter haben“, entgegnete Alex. „Das System bin ich gerade am Aufbauen.“
„Wie? Ihr habt keine Stellenbeschreibungen für eure Fachkräfte? Bei euch kaufe ich keinen Motor mehr“, spielte ich mich künstlich auf.
„Als ob du je im Leben einen computerbetriebenen Elektromotor benötigt hättest. Außerdem bastelst du gar nicht und hast zwei linke Hände“, empörte sich Alex zum Schein.
Ich hatte keine Lust, das verbale Spielchen fortzusetzen, denn meine Bitte um Hintergrundauskünfte zu den zwei verunglückten Informatikern aus ihrem Unternehmen war durchaus ernst gemeint. „Kannst du denn gar nichts in der Sache unternehmen?“, bettelte ich.
„Wohl, doch ich weiß genau, worauf das hinausläuft. Du verbeißt dich wieder in etwas, das sich hinterher als brandgefährlich für dich und andere herausstellt. Bisher hast du immer Glück gehabt und …“
„Glück ist das, was man mit seinen Möglichkeiten aus den Gegebenheiten macht, die einem das Leben bietet“, unterbrach ich ihren energiegeladenen Redefluss.
„Jetzt werde bitte nicht stammtisch-philosophisch“, wies mich Alex scharf zurecht. „Du weißt genau, was ich meine. Wenn wirklich mehr hinter den drei Abstürzen steckt als purer Zufall, dann …“ Alex sprach den Gedanken nicht aus, weil er ihr Angst einflößte.
„… dann war es eindeutig dreifacher Mord. Warum auch immer.“
„… dann bohrst du tiefer und tiefer, bis wieder ein Monster aus dem Untergrund empor kriecht, das dich zu verschlingen droht.“
„Solange es nur droht, kann nichts passieren“, versuchte ich, ihre Bedenken durch einen kleinen Scherz abzuschwächen. Leider vergaß ich dabei, wie gut ich Alex kannte. Meine Taktik war direkt zum Scheitern verurteilt, denn jetzt hatte ich meiner Freundin erst recht einen Anlass geliefert, sich mächtig aufzuregen:
„Zieh das bitte nicht ins Lächerliche, Felix Moosburger! Versprich lieber, dass du sofort zur Polizei gehst, sobald sich der Verdacht über den Tod der Informatiker erhärtet. Ich möchte diesmal keine Alleingänge von dir erleben. Das ist mein voller Ernst.“
Nutzlos, Alex darauf aufmerksam zu machen, dass ich bei früheren Ereignissen, auf die sie anspielte, überhaupt nicht alleine gewesen war. Nicht nur sie, auch einige gute Freunde und sogar Teile der weiteren Familie hatten mir bei zwei vergangenen Abenteuern hilfreich zur Seite gestanden. Alex jetzt daran zu erinnern, würde sie eher noch mehr anstacheln. Denn ihren Worten war auch zu entnehmen, dass sie unter gewissen Umständen bereit war, meiner Bitte zu entsprechen. Tatsächlich verspürte ich momentan tatsächlich keine gesteigerte Lust, einem Mordkomplott nachzuspüren, falls es sich als ein solches erweisen würde, also konnte ich es ihr ohne Hintergedanken versprechen:
„Das können wir gerne so handhaben. Du recherchierst also in deiner Firma. Sollte etwas dabei herauskommen, gehe ich zur Polizei und lege alles in deren Hände. Abteilungsinspektor Leipoldsheimer wird der Sache dann sicher seriös nachgehen, und ich bin fein raus.“
Leipoldsheimer war ein kompetenter, korrekter und absolut sachlicher Polizist auf mittlerer Verantwortungsebene, mit dem wir bis dato beste Erfahrungen gemacht hatten. Wenngleich ich früher ihm gegenüber nicht immer mit offenen Karten gespielt hatte, war er weit davon entfernt gewesen, mir das übel zu nehmen. Allerdings dürfte es auch eine Rolle gespielt haben, dass meine Einmischung in polizeiliche Angelegenheiten wesentlich dazu beigetragen hatte, Verbrechen aufzuklären.
„Er wird sich darüber freuen, wenn du diesmal gleich zu ihm kommst und nicht wieder der Polizei dazwischenfunkst“, meinte Alex.
Ich fühlte mich etwas gekränkt, denn ohne mein ‚Dazwischenfunken’ hätte die Polizei damals kaum Wesentliches zustande gebracht. Zugegeben, ich hätte sie früher informieren können, doch das wollte ich angesichts Alex’ momentaner Gefühlslage nicht mit ihr ausdiskutieren.
„Geht in Ordnung“, meinte ich abschließend.
„Gut, dann können wir uns endlich an den Abstieg wagen.“
Wir saßen allein am Gipfelkreuz des Golm, unter dem sich im Winter das erste Skigebiet im Montafon ausbreitet. Die Talwanderung würde mindestens zwei Stunden beanspruchen, und der mittlere Nachmittag war schon angebrochen, also wurde es wirklich Zeit. Zügig stiefelten wir talwärts. Nachdem alles zwischen uns ausgesprochen war, verlief der restliche Tag harmonisch wie gewohnt.
Alex hielt ihr Versprechen und setzte sich in den folgenden Tagen tatsächlich mit dem Vorgesetzten der beiden verunglückten Informatiker zusammen. Einige Hinweise konnte sie ihren eigenen Unterlagen entnehmen, wie zum Beispiel deren Lebensläufe und bisherige Beurteilungen. Meine erste Idee war es zu schauen, ob die zwei Werdegänge vielleicht vor der Beschäftigung in Alex’ Firma ‚Optitorus’ eine Gemeinsamkeit aufwiesen, aber da war nichts zu entdecken. Ein Informatiker hatte in der Schweiz, der andere in Deutschland, an unterschiedlichen Universitäten studiert. Beide hatten in mehreren unterschiedlichen Firmen gearbeitet und nur zufällig vor einem halben Jahre im selben Monat bei Optitorus angefangen, als das Unternehmen wegen einer Markterweiterung auf einen Schlag über dreißig Programmierer eingestellt hatte.
Das Gespräch mit dem Vorgesetzten ergab zumindest eine vage Vorstellung davon, wes Geistes Kind die Verunglückten gewesen waren und welche Kompetenzen sie für ihre Arbeit mitgebracht hatten. Beide waren angeblich hervorragende Experten auf dem Gebiet gewisser Software-Entwicklungen gewesen, über deren Funktion Alex’ Kollege aus Gründen der betrieblichen Geheimhaltung keine Auskunft geben durfte. Er hatte die Verstorbenen als pünktlich, zuverlässig, in der Sache positiv verbissen, ein wenig in sich gekehrt und insgesamt eher unauffällig beschrieben, womit er das Wort ‚langweilig’ beschönigend vermied. Dass die zwei Informatiker Bergwandern als Hobby ausgeübt hatten, wussten wir bereits. Im Unterschied zu Lothar waren beide Single. Ob sie Freundinnen gehabt hatten, konnte ihr Vorgesetzter nicht sagen. Wie bei introvertierten Technikern eher üblich, hatte man sich kaum über Dinge außerhalb des Arbeitsgebiets unterhalten. Alex brachte noch deren bisherige Wohnanschriften mit, was mich anregte, auf jeden Fall dort vorbeizuschauen.
Inwiefern alles auf zwei potenzielle Morde hinwies, konnten wir trotz gemeinsamer Analyse des Materials nicht wirklich erkennen. Insofern drängte mich meine Freundin auch nicht, damit zur Polizei zu gehen. Mit ihrer ausdrücklichen Zustimmung durfte ich sogar weiter recherchieren, wobei nach wie vor das Versprechen im Raum stand, relevante Erkenntnisse sofort zu melden.
Wo die beiden Informatiker zuletzt gewohnt hatten, wollte ich mir später anschauen, denn zuvor war eine andere Aktion vordringlicher. Und zwar hatte der Alpenverein bereits vor über einer Woche eine breite Traueranzeige im Vorarlberger Tagesblatt platziert. Neben üblichen Bekundungen war dort zu lesen, Vereinsmitglieder würden am kommenden Wochenende gemeinsam mit einem Pfarrer einen Trauermarsch bis zu jener Stelle unterhalb des Gipfels durchführen, an der Lothar abgestürzt war. Diese Ortsbesichtigung durfte ich mir nicht entgehen lassen.
Wie durch Nachfragen zu erfahren war, plante der Alpenverein eine Prozession auf den Sur Carungas, einem Berg im Schweizer Kanton Graubünden. An der Unfallstelle wolle der Pfarrer eine Trauerrede halten.
Auf meine Frage, ob denn jeder daran teilnehmen dürfe, teilte man mir mit, das sei grundsätzlich niemandem zu verbieten, weil es sich um einen öffentlichen Platz handele. Gemeinsame Anfahrt und Unterkunft wie auch das anschließende Trauerfest in einem Gasthof seien aber nur für konditionsstarke und bergerfahrene Mitglieder des Alpenvereins gedacht. Also trat ich kurzentschlossen dem Verein bei, ließ mich für die Tour einschreiben und überwies zweihundert Euro Teilnahmekosten auf das Vereinskonto. Als Antwort erhielt ich eine Bestätigung und eine Liste mit Anschrift und Mailadresse angemeldeter Wanderkameraden.
Am frühen Freitagnachmittag fuhren um die vierzig Personen mit einem geräumigen Reisebus vom Bahnhof in Feldkirch los, unter ihnen etwa ein Drittel Frauen. Ich kannte niemanden – die vier Angestellten der Fachhochschule vom Rosenkranzbeten nahmen jedenfalls nicht an der Fahrt teil. Bereits vor dem Einsteigen machte man sich gegenseitig bekannt, und ich wiederholte mehrmals mein Sprüchlein, Lothar näher von der Fachhochschule her zu kennen. Allerdings verzichtete ich auf den Zusatz, ich sei mit ihm gewandert, weil das in diesem Umfeld schnell widerlegt werden konnte.
Unterwegs erfuhr ich einiges darüber, wie Mitreisende Lothars Absturz einschätzten. Ich brauchte gar nicht groß durch dummes Nachfragen aufzufallen, denn das ein oder andere Gespräch drehte sich naturgemäß um dieses Thema. Die mehrheitliche Meinung war, Lothar müsse ziemlich unaufmerksam gewesen sein, denn die Stelle, an der er abstürzte, war für einen erfahrenen Wanderer und Kletterer wie ihn sooo gefährlich nicht – der maximale Schwierigkeitsgrad liege dort im letzten Abschnitt bei ‚T4’, einem Anspruchsniveau, das zwar gute Alpinkenntnisse voraussetzt, aber durchaus ohne Seil und Verankerungen zu bewältigen ist. Ein Teilnehmer meinte, auf dem Gipfelweg des Sur Carungas, wo Lothar abgestürzt war, kämen zwei Personen prima aneinander vorbei, wenn einer einen halben Schritt seitwärts machen und der andere ihn vorsichtig passieren würde. Diese Strecke sei zwar steil und durchaus nicht zu unterschätzen, doch für jemanden wie Lothar nicht gerade lebensgefährlich. Es wurden Vermutungen geäußert, was die Ursache für seinen Absturz gewesen sein könnte. Niemand ging dabei von Fremdverschulden aus.
„Und wenn ihn jemand absichtlich oder unabsichtlich beim Vorbeigehen geschubst hat?“, unterbrach ich die Gespräche.
Die Diskussionen auf den benachbarten Sitzen verstummten schlagartig, als ob jemand die Stimmen der Mitreisenden abgeschaltet hätte. Weil mich niemand kannte, und die anderen wenigstens mit einer Person zusammen waren, saß ich alleine an einem Fensterplatz mit dem Rücken zum Fenster. Dabei konnte ich die vor und hinter mir Sitzenden gleichzeitig wahrnehmen.
„Wie kommst’ denn darauf?“, fragte mich ein älterer Herr mit sonnengebräunter Halbglatze und kantigem, wettergegerbtem Gesicht auf dem Sitz hinter mir, „wieso sollt’ ihn denn um Gott’s Willen jemand den Berg abistoßen?“
„Keine Ahnung. Ich hab halt gedacht, weil Lothar so erfahren war, und es keinen wirklichen Grund gibt. Er wird kaum volltrunken den Berg hinaufgestiegen sein.“
„Keineswegs“, meinte der knorrige Alte, der sich als ‚i bin d’r Tone‘ vorgestellt hatte. „Er ist quasi mein Ziehsohn am Berg; das hätt’ er nie g’macht. Aber ’s gibt auch koan Grund, ihn abizustoßen.“
„Sag ich doch, es kann unabsichtlich gewesen sein. Man braucht sich nur vorzustellen, dass da ein mittlerer Anfänger nervös wird und beim Vorbeigehen ausrutscht und dabei Lothar umstößt. Und dann macht der andere sich heimlich aus dem Staub, als er merkt, dass Lothar unten am Abhang liegt. Ist nicht so unwahrscheinlich.“
Die anderen nahmen die These dankbar an und spannen den Faden gemeinsam fort, doch für mein Empfinden kamen dabei nur weitere Spekulationen statt gesicherte Erkenntnisse heraus. Irgendwie machte dann das von mir in die Welt gesetzte Gerücht, Lothar sei vielleicht gestoßen worden, eine Weile die Runde durch den Bus, wie ich hier und dort mitbekam. Jetzt hatten sie etwas zu knabbern, dachte ich, und vielleicht destillierte sich im Verlauf unserer Gedenkwanderung ein brauchbares Tröpfchen Wahrheit aus dem Kommunikationsmus.
Abends bezogen wir im kleinen Bergdörfchen Ausserferrera unsere Hotelzimmer und verabredeten uns für sechs Uhr in der Früh zum gemeinsamen Aufbruch. Rucksackbepackt zog die Prozession bergan. Immerhin waren bis zum Gipfel tausendfünfhundert Höhenmeter zu bewältigen, womit die Ankündigung, es mögen nur konditionsstarke Mitglieder an ihr teilnehmen, voll und ganz berechtigt schien. Unterwegs bildeten sich wechselweise Grüppchen, die mich relativ rasch integrierten.
Die altersmäßig bunt gemischte Truppe bestand aus passionierten Bergwanderern und Alpinisten mit völlig unterschiedlichen Berufen. Neben Verwaltungsangestellten und Handwerkern waren auch zwei Altenpflegerinnen, ein Trafikbetreiber, zwei Rechtsanwälte, drei Lehrerinnen, ein Busfahrer, Hausfrauen, Selbständige und drei Gastronomen Teil der Wandergruppe. Tone und zwei andere Weggefährten lebten hauptberuflich als Wanderführer und Skilehrer. Alle Beteiligen waren sportlich und mit ihren drahtigen bis muskulösen Figuren bestens zu Fuß. Auch der Pfarrer konnte problemlos mithalten; er stiefele seit vielen Jahren durch die Berge, wie er meinte, um Gott näher zu sein. Insgesamt trauerten alle ernsthaft um ihren Vereinskameraden, dem sie mit der gemeinsamen Wanderung die letzte Ehre erwiesen.
Beim Anstieg sprach man über dies und das und natürlich wieder über den unerklärlichen Absturz. Ich unterhielt mich zuerst mit einer jungen Lehrerin namens Ursula Breitschneider, deren Ambitionen zu möglichen gemeinsamen Bergwanderungen ich nur vage beantwortete. Überhaupt schien sich in der Gruppe alles ums gemeinsame Wandern zu drehen. Der Trafikbetreiber, ein gewisser Ralf Hartner, kam aus dem Montafon und schwärmte für eine Gruppenwanderung im steinernen Rätikon oberhalb der Baumgrenze. Zwei Unternehmensberater würden gerne mit mir im hinteren Bregenzerwald herumstiefeln. Leonhard Huber, kantiger Neubesitzer eines Haubenrestaurants im mondänen Skiort Lech, lud mich zur Tour über die Krabachspitze hinab nach Zürs ein, mit anschließendem Gourmet-Abend in seiner Gaststätte. Und das Ehepaar Schallert hatte in der nächsten Woche eine siebentägige Wanderung auf dem Jakobsweg organisiert, bei der sie Ersatz für einen erkrankten Kollegen suchten. Ihnen allen sagte ich freundlich mit der stets gleichen Ausrede ab, momentan habe ich an der Fachhochschule einfach zu viel zu tun.
Fast alle Alpinisten wollten wissen, was ich dort so tue, und wie ich zu Lothar gestanden habe, was ich meinen wechselnden Gesprächspartnern bereitwillig erläuterte, ohne mehr als Oberflächliches preiszugeben. Außerdem berichtete ich von meiner jugendlichen Vergangenheit als Snowboardfahrer im österreichischen Auswahlteam und meiner Liebe zum Bergsport im Allgemeinen, was mich den Mitwanderern näher brachte. Das aufgebaute Vertrauen nutzte ich für Rückfragen, wie man Lothar so erlebt habe, doch Antworten und Geschichten über gemeinsam Erlebtes fügten meinem Anfangsverdacht nichts Neues hinzu.
Nach etwa fünf Stunden hielt die inzwischen langgezogene Gruppe fünfzig Höhenmeter unter dem Gipfelkreuz an. Die Stelle war relativ eng, und der Berg flachte auf einer Flanke steil mit anfänglich leichter Rundung ab. Als ich die Absturzstelle von Nahem sah, bestätigte sich der Eindruck der Gespräche aus dem Bus: Wenn sie Obacht gaben, konnten hier zwei Personen absolut gefahrlos aneinander vorbeigehen. Ein spezieller Grund für einen Absturz war nicht zu erkennen. Lothar hätte schon wie ein Schilfrohr im Wind schwanken müssen, um aus Versehen danebenzutreten und auf der steilen Seite hinunterzufallen. Selbst wenn er aus Unachtsamkeit oder Mattigkeit über die eigenen Füße gestolpert wäre, musste er nicht zwangsläufig über die Kante gehen. Er wäre vielleicht maximal auf der abgerundeten Seite hingeschlagen.
Die Hälfte unserer Gruppe baute sich oberhalb, die andere Hälfte unterhalb der Absturzstelle auf. Der Pfarrer hielt dazwischen seine ergreifende Trauerrede; anschließend fügte der knorrige Tone weitere Gedenkworte bei. Zum Abschluss sprachen wir gemeinsam das Vaterunser und bewältigten die letzten Meter zum Gipfelkreuz. Nachdem das herrliche Schweizer Panorama ausreichend bewundert und letzte Vorräte konsumiert waren, machten wir uns an den Abstieg, der immerhin weitere vier Stunden und einiges an Muskelschmalz kostete. Ich hielt passabel durch, hatte allerdings lange keine derart anstrengende Tagestour mehr absolviert. So nahm ich nach dem Abendessen nur kurz an der gemeinsamen Veranstaltung teil und genoss es lieber, ein ausgiebiges Bad zu nehmen und etwas früher ins Bett zu gehen.
Die Rückfahrt am nächsten Morgen war nett, ergab allerdings keine neuen Gesichtspunkte für den vermeintlichen Fall. In Feldkirch verabschiedeten sich alle herzlich mit Handschlag voneinander. Einige Mitglieder des Alpenvereins, mit denen ich mich unterhalten hatte, luden mich erneut auf eine ihrer nächsten Wanderungen ein, was ich nach wie vor offenließ, und dann ging es mit einem gehörigen Muskelkater nach Hause.
Meine Familie, also Mutter, Alex und mein jüngerer Bruder Benny, der in seinen Semesterferien für eine Woche heimgekommen war, wartete wie verabredet mit dem sonntäglichen Mittagessen auf mich. Seit längerem verbrachten wir vier mal wieder einen gemeinsamen Sonntagnachmittag mit Erzählungen und Kartenspiel. Den wahren Hintergrund meines längeren Ausflugs hielt ich gegenüber Mutter und Benny zurück.
Am Montag machte ich früher Feierabend als sonst. Alle Fragebögen der aktuellen Untersuchung hatte ich inzwischen in die Datenbank übertragen und auf mögliche Eingabefehler überprüft. Die ersten Analysen konnten locker bis Dienstag warten, da ich besser in der Zeit lag als geplant. Also fuhr ich nach Hard, der kleinen Gemeinde am Bodensee zwischen Bregenz und der Rheinmündung. Dort hatte nämlich Rudolf Kiesberger gewohnt, einer der beiden Informatiker aus Alex’ Firma.
Die Wohnung befand sich in der oberen Etage eines zweistöckigen Mehrparteienhauses. Die nette Lage mit Blick über den See war durchaus zu beneiden. Da, wie zu erwarten gewesen war, niemand auf mein Läuten bei ‚Kiesberger’ öffnete, probierte ich es bei den Nachbarn und traf eine Etage tiefer sofort jemanden an.
„Grüß Gott, hier ist Reginald Muxeler“, flötete ich durch die Sprechanlage. „Ich bin ein Studienkollege vom Rudolf. Von der Uni Köln. Wissen Sie vielleicht, wann Rudolf wiederkommt?“
Eine leicht gebrochene Frauenstimme säuselte durch die Gegensprechanlage: „Wer sind Sie, junger Mann? Sie müssen lauter reden. Ich kann Sie nicht gut verstehen.“
Woher kannte die Person mein Alter? Mit erhobener Stimme plärrte ich ins Mikrofon: „Ich bin ein alter Studienkollege von Rudolf. Wann ist er denn wieder zu Hause?“
„Welcher Rudolf?“
„Rudolf Kiesberger. Ihr Nachbar über Ihnen. Aus der zweiten Etage. Können Sie mir sagen, wann er anzutreffen ist?“
„Na, der ist doch neulich beim Bergsteigen abgestürzt und tödlich verunglückt. Wussten Sie das nicht?
Selbstverständlich wusste ich das, denn das war der Anlass, seine Wohnung in Augenschein zu nehmen. „Was? Tödlich verunglückt? Das ist ja furchtbar. Wären Sie so nett und könnten mir mehr darüber erzählen? Vielleicht nicht hier in der Öffentlichkeit, wo alle mithören. Das wäre sehr nett. Ich mache Urlaub in Lindau und habe extra einen Abstecher gemacht, um meinen alten Freund wiederzusehen.“
Wenn das nicht zog, war bei der Mieterin nichts auszurichten. Doch ich hatte Glück und konnte die Dame überreden mich hereinzubitten, obwohl immer davor gewarnt wird, als alleinstehender älterer Mensch jemanden Fremdes in seine Wohnung zu lassen.
Nachdem mich die geblümt gekleidete Seniorin ausgiebig durch den Türspalt inspiziert und mir anschließend einen Tee und harte Plätzchen serviert hatte, berichtete sie aufgeschlossen, was sie über ihren Obermieter wusste. Für meinen Geschmack kam wenig Ergiebiges dabei heraus. Rudolf Kiesberger hatte sich insgesamt unauffällig verhalten. Er war kaum zu sehen oder zu hören gewesen, hatte alleine gelebt und war nicht gesprächig gewesen, wie die alte Dame mit leichtem Bedauern feststellte.
Nebenbei fragte sie mich nach meiner Verbindung zum Informatiker aus, und ich erfand eine kleine Räuberpistole über lustige Studentenzeiten in Köln und den dortigen Karneval. Als sie meines Erachtens nichts Gravierendes mehr beitragen konnte, war es gar nicht so leicht, sich von der netten Gastgeberin zu lösen, da sie in mir einen dankbaren Zeitvertreib gefunden hatte. Nur mit Verweis auf meine Frau und das anstehende Abendessen konnte ich mich mühsam loseisen.
Einige Informationen der Seniorin waren letztlich ausreichend bedeutsam, um an der Sache dranzubleiben: Das Mehrparteienhaus bestand seit fünf Jahren. Alle Einheiten waren Eigentumswohnungen. Die des Informatikers war mit gut hundert Quadratmetern auf vier Zimmern genauso geschnitten wie die der alten Dame. Rudolf Kiesberger hatte erst seit etwa einem halben Jahr dort gelebt. Und in seine Wohnung war vor zwei Wochen eingebrochen worden. Unten im Flur notierte ich mir Informationen von einem schwarzen Brett. Damit hatte ich für heute genug erfahren.
Ein zusätzlicher Check der Wohnadresse des zweiten verunglückten Informatikers aus Alex’ Firma passte tags drauf ebenfalls ins Bild. Wie Lothar und Rudolf lebte der dritte Verstorbene in einer exquisiten bürgerlichen Wohngegend, die nicht gerade für den normalen Geldbeutel erschwinglich zu sein schien. Obwohl ich bei Nachbarn klingelte, fand ich niemanden, der weitere Auskünfte geben konnte. Ich musste wohl später noch einmal vorbeischauen.
Anschließend fuhr ich zur Hausverwaltung von Rudolf Kiesberger, deren Adresse ich im Flur vom schwarzen Brett abgeschrieben hatte. Dort gab ich an, vom Freiwerden seiner Wohnung gehört zu haben und fragte, an wen ich mich wegen eines möglichen Ankaufs wenden könne. Die Verwaltung wollte mir die Adresse seiner Erben wegen des Datenschutzes nicht mitteilen. Doch durch eine Nachfrage nach dem möglichen Wert der Wohnung erfuhr ich das Wesentliche: Rudolf Kiesberger hatte dem ursprünglichen Eigentümer die Wohnung plus Keller und Tiefgaragenplatz für weit über fünfhunderttausend Euro abgekauft und angeblich die Summe auf einen Schlag überwiesen. ‚Noch so eine Hütte, die sich niemand so leicht leisten konnte, der nicht den Jackpot im Lotto geknackt oder begütert geerbt hatte‘, dachte ich.
Um die bisherigen Erkenntnisse abzusichern, fuhr ich erneut zum Haus des zweiten Informatikers und versuchte es bei dessen Nachbarn. Auf der rechten Seite kanzelte mich eine Männerstimme an der Gegensprechanlage rüde ab. Mit dem Nachbarn habe man nichts zu tun und ihn überhaupt nie gesehen. Das verwunderte nicht, denn Hausbesitzer schützten sich hier durch hohe Hecken vor gegenseitigen neugierigen Blicken. Doch auf dem gegenüberliegenden Grundstück sprach ein rüstiger Senior in beigem Outfit freundlich mit mir am Gartentor.
Herrn Zäuner – so hieß der Informatiker – habe man selten gesehen. Er sei erst seit kurzem hier eingezogen, etwa vor vier Monaten. Das Haus habe zuvor eine längere Zeit zum Verkauf gestanden und würde jetzt sicher auch wieder lange leer stehen, weil es nicht eben preiswert sei. Einige Leute, vermutlich Verwandte, hätten letzte Woche Möbel durch eine Umzugsfirma abholen lassen. ‚Ländle-Transport‘ habe auf dem LKW gestanden, teilte mir der Pensionist mit. Wenn ich mich für das Haus interessiere, könne mir die Umzugsfirma vielleicht weiterhelfen. Ich bedankte mich höflich und fuhr heim, denn mir langten die Indizien.
„Damit gehst du sofort zur Polizei“, wies mich Alex an, als ich ihr am Abend die gesammelten Neuigkeiten mitteilte.
„Ja, mein Schatz“, war die einzig akzeptable Antwort, wollte ich einen unnötigen Beziehungsstreit vermeiden.
Am Mittwochvormittag stellte ich daher brav mein Auto am Festspielparkplatz in Bregenz ab. Von dort sind es nur wenige Gehminuten bis zur Vorarlberger Landespolizei. Im Amtsgebäude wollte ich unbedingt Abteilungsinspektor Leipoldsheimer sprechen. Doch der, so teilte man mir mit, sei in der Hierarchie aufgestiegen und seit Monaten in Oberösterreich als Chefinspektor tätig. Ich könne mein Anliegen Abteilungsinspektor Loderer vortragen, er sei genauso kompetent wie der ehemalige Kollege.
Das mochte durchaus stimmen, dachte ich während des Gesprächs mit dem Abteilungsinspektor, aber warum glaubte mir Loderer offensichtlich nicht? Vordergründig war er aufmerksam und höflich. Die Polizei habe die Abstürze der drei Personen bereits näher untersucht, nur gebe es zwischen ihnen keinen Zusammenhang. Nichts weise auf Fremdverschulden hin. Er nehme aber immer gerne Hinweise aus der Bevölkerung entgegen und ermunterte mich, ruhig wieder bei ihm vorzusprechen, wenn ich ein Anliegen hätte. Und mit salbungsvollen Dankesworten komplimentierte mich der Abteilungsinspektor aus dem Amtsgebäude hinaus.
Der aufkommende Ärger ließ sich schlecht unterdrücken. Kaum wollte ich einmal in meinem Leben sofort – na ja, fast sofort, wenn man es genau betrachtete – mit der Polizei kooperieren, nahm sie mich überhaupt nicht ernst. Übellaunig stapfte ich zum Auto zurück.
Bereits einige Meter davor fiel auf, dass die Seitenscheibe des Polos eingeschlagen war. Das fehlte gerade noch zu meinem Glück! Was glauben denn die Idioten, was sie in einer alten Kiste mit uraltem Autoradio Wertvolles mitnehmen können? Heute ging wirklich alles schief. Heiße ich Murphy, oder was?
Beim Aufklauben der Scherben fand ich auf dem Boden der Beifahrerseite einen papierumwickelten dicken Flusskiesel. Ich war nahe dran, das Ding wegzuwerfen, als mir das Papier auffiel. Jemand hatte etwas darauf gekritzelt. Einen sinnigen Spruch, der an das Erkennungslied der Sesamstraße erinnerte:
‚Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum?
Wer viel fragt, kommt um.‘
Mir schlug plötzlich das Herz bis zum Hals: Hinter dem von mir aufgewirbelten Staub zeichnete sich zweifellos eine Silhouette ab. Ich war mir nicht sicher, ob ich das Monster schärfer sehen wollte.
4. Cassius
„Ich würde gerne Abteilungsinspektor Loderer noch einmal sprechen.“
„Moment bitte.“ Der Portier bei der Landespolizei versuchte, den Abteilungsinspektor telefonisch zu erreichen. „Ist in der Mittagspause. Wenn Sie vielleicht einen Moment warten wollen? Sie können drüben auf der Bank Platz nehmen.“
„Gerne. Vielen Dank.“
Ich ließ mich auf der Holzbank in der schmalen Lobby gegenüber der Empfangsloge nieder. Von hier aus ging es nur dann weiter ins Innere des Gebäudes, wenn der Portier einen Summer betätigen oder man die schusssichere Glastür mit einer Panzerfaust zerlegen würde. Es war kurz nach zwölf, und so richtete ich mich mit meinem Stein in der Hosentasche auf ein knappes Wartestündchen ein.
Loderer musste von Kollegen informiert worden sein, denn er kam vor eins in die Lobby, um mich zu sprechen: „Was gibt es denn? Ist Ihnen noch etwas eingefallen?“
„Ja, die Scheibe meines Polos. Auf der Beifahrerseite. Jemand hat mir einen Flusskiesel durch die Seitenscheibe geworfen.“
Loderer schaute perplex. Ich pfriemelte den Klotz mit dem Papierfetzen aus der Hosentasche und hielt ihn dem Abteilungsinspektor vor die Nase. Er sah sich nicht bemüßigt, das gute Stück in die Hand zu nehmen.
„Sachbeschädigung ist nicht mein Aufgabengebiet“, antwortete er. „Wir sind hier bei der Mordkommission, wie Sie wissen.“
„Eben drum. Auf dem Papier hat jemand eine eindeutige Morddrohung an mich gerichtet. Ich möchte daher eine Anzeige gegen Unbekannt aufgeben und dass Sie sich das Ganze näher anschauen.“
Loderer blickte mich skeptisch an und rang mit sich, für wie ernst er mich jetzt nehmen sollte. Dann siegte sein Pflichtbewusstsein und wir stiefelten erneut in sein Büro. Dort legte ich das Beweisstück auf seinen Schreibtisch und entfaltete den Beipackzettel, der leider nicht darauf verwies, was man im Fall unerwünschter Nebenwirkungen anstellen sollte.
Loderer las sich den Spruch durch, ohne das Papier anzufassen, startete seinen PC, öffnete eine Formulardatei, trug etwas darin ein und fragte: „Haben Sie den Stein und das Papier berührt? Und wann war das genau?“
„Vor etwa eineinhalb Stunden. Ja, natürlich hab ich das Ding berührt. Ich wollte den Stein wegwerfen und habe dann erst den Zettel entdeckt und ihn gelesen.“
„Dann finden wir auf jeden Fall Spuren von Ihnen auf dem Papier?“
„Schätze, ja.“
Loderer seufzte, als ob er es mit einem geistig Minderbemittelten zu tun hätte oder mit jemandem, der Dinge erfindet, um sich bei der Polizei wichtig zu machen. Wie konnte ich denn wissen, was auf dem Zettel stand, wenn ich den Stein nicht in die Hand genommen hätte? Kurz darauf nahm mir ein Gehilfe des Abteilungsinspektors die Fingerabdrücke ab. Ich verriet ihnen nicht, dass sie eigentlich noch von einer früheren Begebenheit in ihrer Datenbank vorhanden sein müssten. Allerdings hatten sich damals bestimmte Verdachtsmomente der Polizei gegen mich nicht bewahrheitet – ich war also keineswegs bei ihnen als Krimineller geführt, zumal alle damaligen Informationen unter höchster Geheimhaltungsstufe standen. Tatsächlich sprach mich auch niemand auf frühere Geschehnisse an.
Loderer nahm meine Personalien und die von mir berichteten Umstände kommentarlos auf. Anschließend begleiteten er und ein Fotograf mich zum Parkplatz und schossen Aufnahmen von meinem Polo. Ich zeigte ihnen, wo der Stein gelegen hatte, und sie meinten, mehr könnten sie leider nicht veranlassen, es sei nichts weiter passiert als eine geringe Sachbeschädigung, und überhaupt mochten die Zeilen auf dem Papier eher ein Dummerjungen-Scherz sein. Eine Morddrohung könne man daraus wirklich nicht ablesen. Sie würden auf jeden Fall Papier und Stein auf Fingerabdrücke untersuchen, machten mir jedoch keine Hoffnungen, ob dabei etwas Erkennungsdienliches herauskäme. Den Wagen auf Spuren zu untersuchen, hielten sie für überflüssig. Und Polizeischutz komme überhaupt nicht in Frage. Dann verabschiedeten sie sich und ließen mich auf dem Parkplatz konsterniert zurück.
Was nun? Um Gedanken zu sortieren, flanierte ich ziellos durch die Bregenzer Fußgängerzone, gönnte mir im Café Pinocchio einen großen Früchtebecher mit Eis. Wie stets an diesen warmen Sommertagen wurde die Bregenzer Innenstadt schwer von Touristen in Beschlag genommen, doch ich fand noch einen freien Hocker an der Bar, um dort genüsslich am Eis schlabbern zu können. Für mich stand inzwischen der Zusammenhang zwischen den drei angeblichen Bergunglücken ziemlich fest, was die Nachricht mit dem Pflasterstein eindeutig unterstrich. Was sollte ich nun tun? Weitergraben und eventuell auf das gefürchtete Monster stoßen oder den Kopf in den Sand stecken und die Sache auf sich beruhen lassen?
So, wie ich an diesem Tag, kommt der Mensch im Leben öfter an einen Scheideweg, bei dem die Wahl der Abzweigung künftige Ereignisse wesentlich beeinflusst. Beim Eis kamen mir Gedanken aus dem Geschichtsunterricht in den Sinn. Wie hätten wir uns vor Jahrzehnten verhalten? Hätten wir Flugblätter verteilt wie die Geschwister Scholl, oder weggeschaut und die beobachteten Deportationen der Juden aus dem individuellen und kollektiven Gedächtnis gelöscht?
Bevor ich das aktuelle Thema mit Freunden besprechen und mich nach einem gemeinsamen Resümee definitiv entscheiden würde, wollte ich einen weiteren Versuch starten, es der Polizei nahezubringen. Dafür musste ich wohl oder übel Verbindung mit Oberösterreich aufnehmen. Vorher fuhr ich bei einer Werkstatt vorbei, die sogleich den Polo einbehielt, um die Scheibe zu reparieren und mir für zwei Tage einen Ersatzwagen stellte. Zu Hause kostete es mich eine Recherche im Netz und zwei Telefonate, bis ich die zutreffende Dienststelle an den Apparat bekam.
„Leipoldsheimer!“
„Grüß Gott, Herr Chefinspektor. Felix Moosburger. Erinnern Sie sich noch an mich, und haben Sie kurz Zeit? Herzlichen Glückwunsch übrigens zu Ihrer neuen Funktion in Oberösterreich.“
„Ja, der Herr Moosburger. Schön, Sie zu hören. Wie sollte ich Sie je vergessen? Was führt Sie zu mir? Ich hoffe, Sie haben keinen neuerlichen Ärger mit der Vorarlberger Polizei. Und lassen Sie bitte den Chefinspektor weg. So gut kennen wir uns inzwischen schon.“
Entgegen vieler Zeitgenossen trug Leipoldsheimer seinen neuen Titel und Dienstgrad nicht angeberisch vor sich her, was ihn überaus sympathisch machte. Seine Begrüßung am Telefon war zackig wie immer, wenn er dienstlich unterwegs war.
„Ärger mit der Polizei habe ich nie gehabt“, lautete meine schelmische Antwort. „Nein, heute habe ich ein Anliegen, mit dem ich schon bei uns vorstellig war. Mir scheint, daran sind Ihre Kollegen nicht wirklich interessiert. Und da wollte ich quasi ein zweites unabhängiges Gutachten einholen, so würden wir in der Wissenschaft dazu sagen. Sie sind der einzige Polizist, dem ich diesbezüglich großes Vertrauen entgegenbringe.“
„Das ehrt mich. Ich kann Ihnen zehn Minuten einräumen, dann haben wir eine Einsatzbesprechung. Kommen Sie bitte zügig auf den Punkt.“
Zehn Minuten waren mehr als genug. Oftmals erhielten Professoren auf wissenschaftlichen Kongressen nur fünfzehn Minuten, um Ergebnisse langjähriger Studien prägnant vorzustellen, also sollte mir das mit dieser Geschichte auch gelingen. Ich schilderte meine wesentlichen Erkenntnisse zu den drei Bergabstürzen und zur Attacke auf mein Auto sowie die Reaktion der Bregenzer Polizei. Leipoldsheimer hörte zu ohne zu unterbrechen. Nach meinem knappen Bericht antwortete er nicht.
„Haben Sie alles mitbekommen?“, fragte ich nach.
„Ja, ja. Bin am Überlegen.“
Ich wartete auf seine nächste Reaktion.
„Also, ich räume ein, dass Sie mit Ihrer detektivischen Intuition eventuell auf etwas gestoßen sind. Sie müssen bitte Eines verstehen: Ich kann mich keinesfalls in Belange ehemaliger Kollegen einmischen. Und für Vorgänge in Vorarlberg ist nun mal die dortige Polizei zuständig. Da kann ich von hier aus nichts unternehmen, selbst wenn ich wollte. Um es wirklich zu wollen, müsste ich wenigstens alle Fakten persönlich durchsehen, damit ich den Gehalt Ihrer Vermutung nachvollziehen kann. Gibt es denn eine Verbindung nach Oberösterreich? Das würde mein Interesse an diesen Vorkommnissen legitimieren.“
„Soweit ich weiß, leider nicht. Ein Unfall ereignete sich in Graubünden, die beiden anderen hier bei uns in Vorarlberg. Einer davon im Bregenzerwald, der andere im Rätikon. Alle drei Informatiker arbeiteten hier in Vorarlberg. Eine Verbindung der drei abgestürzten Informatiker nach Oberösterreich ist mir bisher nicht untergekommen.“
Leipoldsheimer schien mich tatsächlich ernst zu nehmen: „Schade“, antwortete er, „nun kann ich der Sache nicht offiziell nachgehen. Wenn Sie mir Ihre Informationen zukommen lassen …“, wohlweislich ermunterte er mich nicht direkt weiter zu graben, „… und wenn sich eine Verbindung nach hierher abzeichnet oder sich Ihr Verdacht für mich erhärtet, kann ich mit den Kollegen in Vorarlberg sprechen. Wäre das für Sie in Ordnung?“
„Was soll ich sagen? Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen. Damit Sie mich nicht missverstehen: Ich weiß das zu würdigen, hatte aber gehofft, Sie würden vielleicht direkt einschreiten. Ich schicke Ihnen morgen eine knappe Zusammenfassung von dem, was ich erzählt habe. Wenn Sie mir bitte Ihre Mailadresse mitteilen ...“
Leipoldsheimer diktierte mir seine neue Dienstanschrift und verabschiedete sich: „Leider kann ich momentan nichts für Sie unternehmen, Herr Moosburger. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden. Und passen Sie gut auf sich auf!“
„Das werde ich, Herr Leipoldsheimer. Vielen Dank“
„Servus.“
Leipoldsheimer hatte die Verbindung unterbrochen. Mit gemischten Gefühlen starrte ich auf das Smartphone, das mir mein Freund Alfi vor gut zwei Jahren geschenkt hatte, zusammen mit einer Flatrate, die er fortlaufend bezahlte. Für mein Dafürhalten hatte ich alles getan, um die Vorfälle an die Polizei zu übergeben. Für die Entscheidung, ob ich dazu weiter recherchieren sollte oder nicht, hatte mir das aber keinen Deut geholfen. Das Gespräch ließ mich einigermaßen ratlos zurück – hin- und hergerissen von den beiden sprichwörtlich gewordenen Seelen in meiner Brust.
Am Abend kam ich nicht dazu, das Thema mit meiner Freundin zu vertiefen. Sie meinte, sie habe bald ihren Eisprung, und diese sensitive Phase sollten wir nicht mit albernen Gesprächen vertändeln. Gesagt, getan. Zur gemeinsamen Entspannung half ich Alex, ihren monatlich wiederkehrenden hormonellen Ausnahmezustand unbeschadet zu überstehen.
Die nächsten Tage vergingen in leichter Starre; wissenschaftliche Aufgaben an der Fachhochschule erfüllte ich nur halbherzig. Inzwischen werteten wir die Daten unseres Projekts aus. Das interessierte mich eigentlich am meisten, weil die Analysen stets spannend sind. Sie zeigen nämlich, ob man mit seinen Annahmen richtig liegt oder nicht, was einen Rattenschwanz unterschiedlicher Interpretationen und Folgeanalysen nach sich zieht. Dennoch lenkte mich der Spruch auf dem Pflasterstein immer wieder von der Arbeit ab.
Meine Chefin und Betreuerin, Frau Professor Grafl, ging mit mir den Studienplan durch und ließ mich weitere zwei Wochen alleine werkeln. Da die Auswertungen nicht allzu schwierig waren, konnte ich sie auch mit halbem Einsatz gut bewältigen. Doch solange ich im Unklaren war, ob ich zu den drei Bergabstürzen weiter recherchieren sollte oder nicht, bekam ich den Kopf nicht wirklich für andere Dinge frei. Hier konnte vielleicht eine Sporteinheit helfen.
Nach wie vor stand ich zweimal wöchentlich auf der Matte beim Streetfighting-Kurs. Nachdem wir im ersten Jahr Fallübungen und simple Ablenkungstricks gelernt hatten, mit denen man sich unvermutet aus einer brenzligen Situation lösen konnte, um dann wohlweislich die Beine in die Hand zu nehmen und sein Heil in der Flucht zu suchen, ging es im zweiten Jahr um grundlegende Stoß, Hebel- und Wurftechniken. Unser Trainer, ein ehemaliger Ausbilder des österreichischen Sondereinsatzkommandos ‚Cobra’, ermunterte unsere bunt gemischte Truppe aus Hausfrauen, Studenten, Polizisten, Lehrern und Mitbürgern ohne erkennbare Berufsausübung, zunächst wie wild Kondition zu bolzen, damit man im Falle einer Auseinandersetzung möglichst schnell weglaufen konnte. Auf keinen Fall sollten wir seiner Meinung nach so vermessen sein zu glauben, mit ein paar dummen Tricks hätten wir gegen ernsthafte Schläger auch nur den Hauch einer Chance. ‚Recht hat er’, pflichtete ich ihm im Stillen bei. Solche Typen durfte ich zu meinem Leidwesen bereits kennenlernen, daher teilte ich seine Einschätzung voll und ganz.
Nach fünfundsiebzig Minuten Training nutzte ich oft das Zusatzangebot der Sportschule, im angrenzenden Fitnessbereich etwas für die Muskeln zu tun. Durch regelmäßiges Bergwandern, im Winter durch Snowboarden und Schneeschuhlaufen, war meine allgemeine Kondition recht gut ausgeprägt. Mit dem Streetfighting und den anschließenden Schnellkraftübungen an den Geräten gesellte sich langsam eine gewisse muskuläre Zähigkeit dazu. Außerdem liebte ich es, nach der Anstrengung ausgepumpt und ermattet, aber glücklich und stressfrei, nach Hause zu kommen und müde ins Bett zu fallen. Alex freute sich ebenfalls über ihre zwei ‚freien’ Abende, an denen sie ab und an mit Freundinnen unterwegs sein konnte oder ihre Eltern in Oberschwaben besuchte.
Im Fitnessstudio trieb sich manch absonderliche Gestalt herum: blasse Jüngelchen, die endlich etwas gegen ihre schlaffe Figur unternehmen wollten. Muskelbepackte Kleinwüchsige, die glaubten mangelndes Längen- durch übertriebenes Breitenwachstum ausgleichen zu können. Dieselbe Gattung, nur einen halben Meter größer und entsprechend mehr Muskelmasse zur Schau tragend. Und nicht eine einzige Frau, was ich bei diesem testosterongeschwängerten Haufen wenig verwunderlich fand. Neulinge erkannte man am brav mitgeführten Trainingsplan in der Hand, in den sie jedes Übungsergebnis eintrugen. Alte Hasen stolzierten breitbeinig durch den Saal, als ob sie eine Hodenentzündung hätten, wobei sie ihre mehr oder weniger austrainierten Muskelberge zur Schau stellten.
Mir war’s ziemlich egal. Jeder schwitzte und keuchte an den Stationen vor sich hin, und ich hatte nicht vor, mit den buntgemischten Anwesenden näheren Kontakt zu pflegen. Zog meine Übungen straff hintereinander durch und machte mich stets ohne Konversation vom Acker.
Ein dunkelhaariger und braungebrannter Typ mit beidseitig an den Schläfen ausrasierter Frisur und alberner Kraushaarmatte dazwischen war besonders auffällig. Er war einige Zentimeter größer als ich und brachte mindestens einhundertzehn Kilo auf die Waage. Alles Knochen und reine Muskelmasse. Kein Gramm Fett war unter seinem weit ausgeschnittenen Trägerhemdchen zu erkennen. Als Ausgleich dafür baumelte diesem Gladiator eine fette Goldkette vor der Brust.
Sein gehobener Status im Studio war deutlich an den devoten Begrüßungen der anderen Muskelprotze abzulesen. Ob Muskelzwerg oder Muskelberg – alle erwiesen ihm die Ehre, während ihres Pensums wie beiläufig vorbeizuschlendern und mit ihm die Handflächen zu kreuzen. Nachdem ich das Ritual mehrfach beobachten konnte, schaute ich nicht mehr hin. Diese Typen prägten den Stil des Etablissements ebenso wie die darin aufgestellten Kraftmaschinen.
Ich war gerade bei der dritten Serie Bankdrücken à fünfzehn Wiederholungen mit dreißig Kilo, als der Obermacker auf mich zukam. Wollte er etwa von mir die unterwürfige Begrüßungsformel einfordern? Das würde mich in einen ziemlichen Konflikt bringen, denn weder war ich geneigt, mich ihm anzubiedern, noch wollte ich ihn provozieren und mir dadurch die Möglichkeit für das anregende Muskeltraining verbauen. Der Gladiator blieb neben der Bank stehen und wartete stur, bis ich meine Übung beendet hatte.
Ich stemmte die Langhantel in ihre Gabel zurück, richtete mich auf, wischte mir mit dem Handtuch den Schweiß von der Stirn und nahm einen tiefen Zug aus der Wasserflasche.
„Warum trainierst‘ net mit Gewicht?“, fragte mich der Gladiator mit kehliger Stimme, die seinen Migrationshintergrund verriet. Im Hintergrund lugten Protze verstohlen herüber. Ich fand, vierzig Kilo waren durchaus als Gewicht anzusehen und antwortete lakonisch:
„Ist doch Gewicht drauf.“ Wenn er sich auf Sophisterei einlassen wollte, kam er mir gerade recht.
„Mein ich richtig Gewicht. Achtzig bis hunnert Kilos. Seh dich seit über ein Jahr immer nur mit wenig Gewicht üben.“
„Weil ich mir keine Muskelberge antrainieren will“, erwiderte ich wahrheitsgemäß, ohne weitere Erläuterungen hinzuzufügen. Irgendwann würde er mit seinem wahren Anliegen herausrücken.
„Und warum nicht?“