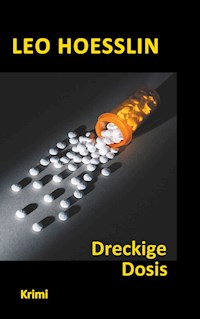Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die heile Welt von Felix Moosburger, einem unbescholtenen Studenten aus Vorarlberg, bricht jäh zusammen. Während er mit seinem Kleinwagen auf einer schneebedeckten Bergstraße heimfährt, stößt ihn ein unbekannter SUV den Abhang hinunter. Nur knapp kann Felix dem Anschlag entkommen. Weil er seit Längerem unter Druck steht, verdrängt der Student rasch den Vorfall und meldet ihn nicht der Polizei. Zu sehr beanspruchen den Halbwaisen seine depressive Mutter, sein jüngerer Bruder, ein Nebenjob und das nur mühsam zu bewältigende Studium. Doch die Attentäter kehren zurück und entführen den jungen Mann. Schmerzhaft veranschaulichen sie ihm, dass sie hinter etwas her sind, das er angeblich besitzen soll. Nun beginnt ein mörderisches Versteckspiel. Um es gegen skrupellose und übermächtige Gegner nicht zu verlieren, müssen Felix und seine Freunde voll auf Risiko gehen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Onkel Willi
Inhaltsverzeichnis
Abfuhr
Almabtrieb
Alma Mater
Alarm
Alkohol
Alexandra
Anschlag
Aufgeschmissen
Ausbruch
Alpenstock
Auszeit
Ausnahmezustand
Angriff
Außendienst
Aua
Aufbruch
Aufgedeckt
Alarm
Autorennen
Abfindung
Amtshandlungen
Ausgeschlafen
Ausbaldowert
Abschreibung
Autoreparatur
Akademismus
Aufwärts
Attacke
Abwärts
Abendessen
Aikido
Abschlussritual
Aus …
1. Abfuhr
Als der SUV das Heck meines Polos rammte, vermutete ich, dass der Fahrer hinter mir auf der schneeverwehten Bergstraße die Kontrolle verloren hatte. Trotz neuer Winterreifen brachte der unvermittelte Stoß meine alte Schüssel sofort ins Schlingern. Bei totalem Schneetreiben waren wir mit dreißig Stundenkilometern dicht hintereinander bergauf Richtung Rotenstein unterwegs. Schneller heimzufahren ging nicht, denn in der stockdunklen Nacht rauschten Schneeflocken im Abblendlicht wie Kometensplitter an der Frontscheibe vorbei. Durch das flirrende Weiß war der kurvige Straßenverlauf kaum zu erkennen.
Die miesen Sichtverhältnisse trugen ebenso wenig zu meiner guten Laune bei wie die Aussicht, mitten im unbebauten Nirgendwo am Rand der Westösterreichischen Alpen bei Minusgraden und pfeifendem Westwind zu warten, bis die Polizei den Unfall aufgenommen haben würde. Ich ärgerte mich mächtig, denn eine demolierte Karre konnte ich gerade überhaupt nicht gebrauchen.
Der SUV hatte mich bereits minutenlang genervt, weil er deutlich flotter vorankam als mein altes Auto und der Fahrer permanent drängelte. Nun hatte er auf einem relativ ebenen Teilstück überholen wollen, was aber gehörig schiefgegangen war. Nach dem Aufprall fiel der SUV etwas zurück. Ich ging vom Gas und wollte den Polo neben dem am Straßenrand aufgehäuften Schnee austrudeln lassen, denn dahinter geht es überall bergab. Tief verschneite Almwiesen und dichte Mischwälder warten nur darauf, dass sich junge Männer in ihnen zu Tode fahren. Immerhin gehörte ich mit meinen einundzwanzig Jahren zur Hochrisikogruppe unter den motorisierten Verkehrsteilnehmern, was mir durchaus bewusst war. Und obwohl ich mich seit Monaten in einem seelischen Tief befand, wollte ich hier und heute noch nicht den Löffel abgeben.
Als der SUV den Polo ein zweites Mal rammte, konnte das kein Auffahrunfall mehr sein. Das wurde mir auch deshalb schlagartig bewusst, weil sich das Lenkrad plötzlich blitzschnell drehte, ich den Griff verlor und mir eine Speiche punktgenau aufs rechte Handgelenk donnerte. Stechender Schmerz trieb mir Tränen in die Augen, aber wenigstens stand der Wagen nun. Geschockt tastete ich mit der Linken die angeschlagene Rechte ab, während mein Gehirn das Erlebte zu verarbeiten suchte. Voll bewusst wurde mir die tödliche Lage aber erst, als der SUV mit brüllendem Motor mein Auto durch die Schneewechte hindurch trieb.
Seit Längerem schon waren meine Tage nicht mehr das Gelbe vom Ei gewesen. In diesem Augenblick strebten sie ihrem negativen Höhepunkt entgegen. Nach einem langen Studientag an der Vorarlberger Fachhochschule hatte ich etwas zu essen für meine Mutter, meinen jüngeren Bruder Benny und mich eingekauft. Daheim wollte ich uns Abendbrot zubereiten, um danach im Dorfkrug bis Mitternacht für eine Handvoll schwarzer Euro auszuhelfen. Stattdessen bangte ich nun in der alten Karre meines viel zu früh verstorbenen Vaters um mein jämmerliches Leben. Dabei ahnte ich nicht im Geringsten, warum gerade mir jemand an den Kragen gehen wollte. Denn mein Lebtag lang hatte ich niemandem etwas Ungutes angetan. Soweit ich wusste, hatte ich auch keine Feinde. Als Student der Psychologie war ich vielleicht gegenüber Kommilitonen und Professoren stets etwas zu vorwitzig unterwegs. Doch das wäre höchstens ein Grund, mich nicht zu mögen oder mir eine schlechtere Note zu verpassen, nicht jedoch mich umzubringen.
Hätte mein Auto inzwischen nicht bereits den Schneehaufen passiert, wäre ich wohl ausgestiegen, um die Verwechslung aufzuklären. Das konnte ich mir aber schenken, denn von nun an ging’s bergab. Auf einer tiefverschneiten Wiese rutschte der Wagen gemächlich hangabwärts, wobei er dicke Schneemassen vor sich aufhäufte. Zum Glück war ich in keinem Steilstück gelandet, sondern ‚nur‘ auf einem relativ flach abfallenden Hang. Dennoch zog die Schwerkraft den Polo unaufhaltsam talwärts, was der auftürmende Schnee maximal ein wenig abbremsen konnte.
Plötzlich wandelte sich Schock in Heidenangst. Weniger wegen der Rutschpartie als wegen der Lage unserer Bergwiesen. Meist enden sie nämlich in einem steilen Tobel, einem Felssturz oder einem abfallenden Waldstück. Als ich mir die Konsequenzen ausmalte, zog nicht etwa mein bisheriges Leben an mir vorbei. Stattdessen führten mir die grauen Zellen blitzschnell aber sinnlos heutige Aktivitäten vor Augen.
Der Tag hatte bereits nett angefangen – allerdings nur, wenn man Unmengen an Schnee nett findet. Bereits um halb sechs musste ich mich nämlich mit der Schneefräse entlang unserer Hofeinfahrt mühsam durch kaum bezwingbare Schneemassen kämpfen. Lawinenwarnstufe vier war derzeit Normalzustand. Schneetreiben ohne Ende. Laut Wetterbericht würde uns das Atlantiktief Julia noch vier weitere Tage im Ausnahmezustand bescheren. Dann musste ich mindestens zweimal täglich die Hofeinfahrt und den Gehweg vor dem Grundstück räumen. In der Früh und zwölf Stunden später, manchmal sogar zwischendurch, wenn tagsüber ein halber Meter Neuschnee gefallen war.
Wahrscheinlich kratzte ich seit einigen Wochen nicht nur deshalb am Burnout, sondern auch, weil ich auf die anstehende Psychologieklausur schlecht vorbereitet war. Wenn ich mir gegenüber ehrlich war, machten mir mehrere Belastungen gleichzeitig massiv zu schaffen. Um das zu erkennen, hätte ich meine bisherigen drei Semester Psychologie nicht zu studieren brauchen.
So war der Akku schon vom Beginn dieses beschissenen Tages an annähernd leer gewesen. Familiäre Verpflichtungen, Studium und Nebenjob hatten die Energiereserven längst geleert. Ich hatte einfach keine Kraft mehr gefunden, mich auf die anstehende Klausur vorzubereiten. Denn seit mein Vater vor drei Jahren unglücklich verstorben war (ihn traf der Blitz, als er während eines Gewitters auf der Alm eine verirrte Kuh einfangen wollte), lag unsere Mutter meist depressiv im Bett. Seit Monaten musste ich täglich sie, den kleinen Bruder und mich versorgen. Auf Großeltern konnten wir nicht mehr zurückgreifen, und nachbarschaftliche Hilfe lehnte Mutter strikt ab, sogar, wenn ihr Schwager Jodok sie anbot.
Da Mutters Witwen- und meine Halbwaisenrente plus der meines fünfzehnjährigen Bruders für uns drei vorn und hinten nicht langten, arbeitete ich zusätzlich abends im Dorfkrug. Letztlich war mir bereits zu Semesterbeginn klar gewesen, dass trotz aller Verpflichtungen Lamentieren nichts nützt. Also hieß es, im Winter noch früher aufzustehen, um halb sechs Schnee zu fräsen, um viertel nach sechs in die Bücher zu schauen, um viertel nach sieben ein guter Sohn zu sein und Brote für uns drei zu schmieren, meinen Bruder zur Schule zu schicken und um acht Uhr loszufahren, damit ich pünktlich um neun im Seminar hocken konnte.
Die nächste Klausur stand nun kommenden Freitag an. Da heute auch Freitag war, blieb mir theoretisch noch eine knappe Woche zur ‚intensiven‘ Vorbereitung. Dass der Tiefpunkt des Tages trotz Übermüdung längst nicht erreicht war, hatte ich an der Fachhochschule noch nicht ahnen können.
Zäh hatte ich mich den lieben langen Tag durch eigentlich interessante Veranstaltungen gequält und anschließend gestresst den Abendeinkauf getätigt. Hatte ich etwa für die Familie monatelang am Rand der Belastungsgrenze gelebt, nur um heute Abend im unwirtlichen Gelände abzukratzen?
Inzwischen surfte der Polo hangabwärts auf einer Mini-Lawine. Als ich das erkannte, erwachte ich jäh aus dem lähmenden Tagtraum und suchte mich fieberhaft aus dem abgleitenden Wagen zu befreien. Mit der nicht geprellten Linken fummelte ich umständlich am Türgriff, weil ich mich aus dem Wagen werfen wollte, so lange es noch ging, denn garantiert würde der Hang bald steiler werden. Ein völlig zweckloser Versuch, denn die Tür war durch den Aufprall verzogen, wie ich nach erfolglosem Rütteln fassungslos feststellen musste.
Keine Zeit, weitere Rettungsversuche zu unternehmen. Plötzlich schlug der Wagen rechts vorne auf junges Holz, was ihn abrupt abbremste. Während ich in den Sicherheitsgurt gerissen wurde, suchten sich verschneite Äste den Weg ins Wageninnere. Rechts klirrte die Seitenscheibe. Ein Ast stieß kratzend hindurch. Der Polo drehte die rechte Flanke talwärts und drohte dabei jeden Moment umzukippen. Von einer Sekunde auf die andere hing das Auto schräg im Gelände.
Ich hing schräg im Sicherheitsgurt und verfluchte den Tag.
2. Almabtrieb
Büsche und junge Bäume vor und neben dem Polo waren kaum zu erkennen. Ein Scheinwerfer hatte den Geist aufgegeben, der andere stach erbärmlich in den aufgeworfenen Schneehaufen hinein. Als ich geschockt im Gurt hing und mühsam das Fassungslose zu verarbeiten suchte, ergriff nie gekannte Angst von mir Besitz. In seltener geistiger Klarheit blitzte die Erkenntnis auf, dass mein Leben hier rasch zu Ende gehen konnte, wenn ich nicht endlich aus dem Polo hinaus kam. Dafür boten sich nur zwei kleine Chancen: Zum einen hatte sich der Wagen nicht überschlagen. Zum anderen war er auf eine sanfte Weide eingebrochen und nicht in ein Steilstück. Die zwar gefährliche aber nicht direkt tödliche Lage musste ich dennoch schleunigst nutzen, denn der Polo befand sich nur in einem labilen Gleichgewicht und um ihn herum tobte ein gewaltiger Schneesturm bei etwa minus zehn Grad. Außerdem war das Fahrmanöver des SUV zweifellos ein Anschlag gewesen. Ein weiterer Grund, den Polo hurtig zu verlassen, da das Vorhaben des Unbekannten durchaus erfolgreich enden konnte.
Während der Hangpartie hatte ich wohl automatisch den Zündschlüssel gedreht. Der Motor und die CD vom im Hubschrauber verunglückten Stevie Ray mit seiner Band ‚Double Trouble‘ liefen nicht mehr. Totenstille. Außer heulendem Wind und knarrenden Geräuschen, wenn ich mich im Fahrersitz bewegte, war nichts zu hören. Einerseits wollte ich mich zwar sofort aus der gefährlichen Lage befreien, doch andererseits wäre ich am liebsten sofort eingeschlafen. Träumen. Ausruhen. Aufwachen. Und alles ist wieder gut. Heftiges Reißen in der Brust, wo mich der Gurt gepackt hatte, brachte mir allerdings die Realität schonungslos zurück.
Nun vorsichtig bewegen und die Rippen abtasten, ob dort ein messerscharfer Schmerz sticht. Breitflächiges Ziehen im Oberkörper erinnerte mich an starken Muskelkater. Es schien, als ob der Brustkorb heftig geprellt wäre. Das beunruhigte mich allerdings kaum, denn Prellungen kannte ich von meiner wilden Snowboardzeit als Jugendlicher und wusste, auch wenn nichts gebrochen ist, tun die Rippen höllisch weh. Die Schmerzen würden sich nach etwa vier bis sechs Wochen legen, doch so viel Zeit stand mir im Augenblick leider nicht zur Verfügung. Wiederholt verfluchte ich den Tag und versuchte krampfhaft, das Geschehen zu realisieren.
Verdammt! Was, wenn jemand den SUV verließ und mich verfolgte, um mir hier den Rest zu geben? Angst steigerte sich zu ausgewachsener Panik. Kaum hatte ich den Gurt mit zitternden und steifen Fingern gelöst, zog mich die Schwerkraft rechts hinunter, begleitet von lautem Knirschen. Zentimeter um Zentimeter rutschte der Polo weiter bergab. Hektisch fummelte ich mit der Linken an der Fahrertür, suchte den Griff zu fassen, was nach einigen schmerzhaften Verrenkungen endlich gelang. Die rechte Hand konnte ich bei der Aktion vergessen, denn sie tat fast mehr weh als der Brustkorb. Hoffentlich geht die Tür auf!
Ich war nie besonders gläubig und trotz einer Einlage als Ministrant und der üblichen Firmung eher wissenschaftlich unterwegs als religiös veranlagt. Auch in dieser Ausnahmesituation war ich weit davon entfernt, aufgrund der Umstände plötzlich die Weltanschauung aufzugeben und eine höhere Macht um mein kümmerliches Leben zu bitten. Dennoch hoffte ich auf eine einfache Lösung, da mir kein anderer Ausstieg blieb. Die Seitenscheibe lässt sich nämlich ohne passendes Werkzeug nicht so einfach einschlagen. Mir wäre maximal der linke Ellenbogen geblieben, den ich nicht auch noch lädieren wollte. Wie ein Wilder am Türgriff zu ruckeln war ebenfalls sinnlos, da die Fahrertür nach wie vor verzogen war. Das Ding bewegte sich keinen Millimeter.
Irgendwie schaffte ich es, mich mit den Füßen unten abzustützen, mit der Schulter aufwärts gegen die Tür zu stemmen und gleichzeitig am Griff zu ziehen. Beim zweiten Versuch gab das verdammte Ding endlich nach. Knarrend und mit reichlich Widerstand öffnete sich die Tür Zentimeter um Zentimeter. Angemessen langsam, damit der Wagen nicht noch mehr erschüttern und dadurch weiter abrutschen würde, schob ich die Fahrertür auf. Zuvor hatte ich meinen Rucksack mit den Studiensachen vom Beifahrersitz geklaubt. Mich an der Tür festhaltend und über den Sitz quälend erreichte ich eine halb liegende, halb kniende Position auf dem Schweller. Mit letztem Schwung stieß ich mich von der Todesfalle ab und richtete mich im tief verschneiten Hang auf.
Es stürmte und schneite immer noch wie verrückt. Zu allem Überfluss steigerte sich der saukalte Westwind zu einer heulenden Bö. Sobald ich mein treues Auto losgelassen hatte, verschwand es in einem riesigen Schneeberg. Beide hatten Gefallen aneinander gefunden und sich entschlossen zusammenzubleiben. Ein letztes metallenes Kratzen, dann brach der Polo unaufhaltsam durchs Unterholz und fiel dahinter ins Nichts. Mit dem Wagen verschwand auch mein Handy, das sinnigerweise noch in der Freisprechanlage steckte. Stevie Ray Vaughan war nun ein zweites Mal abgestürzt, diesmal mit dem alten Auto meines verstorbenen Vaters.
Plötzlich gaben meine Knie nach wie zerlassene Butter. Ich musste mich kurz in den Schnee hocken und tief durchatmen. Die Betonung lag zwangsläufig auf ‚kurz‘, denn die Frage nach eventuellen Verfolgern war lange nicht geklärt, und außerdem kroch langsam aber sicher eine Saukälte in mir hoch. Schnell die Handschuhe aus dem Rucksack gefischt und übergestülpt, denn lange wäre es ohne sie nicht auszuhalten. Wenigstens wärmte die Kapuze des Parkas, den ich wegen der leicht unterdurchschnittlichen Heizkraft des alten Polos anbehalten hatte. Auch die Winterstiefel wusste ich heute mehr denn je zu schätzen. Allein die Jeans waren für eine längere Schneepartie nur bedingt geeignet. Der Hosenstreifen zwischen oberer Wade und Knie nässte bereits eiskalt durch und das würde mich unten herum rasch auskühlen.
Was war jetzt mit dem Kerl aus dem Geländewagen? In den Wind hinein horchen. Den Kopf aus der Kapuze nehmen und drehen, auch wenn die Kälte förmlich die Ohren abbeißt. Noch mal horchen. Und noch mal. Der Wind trug unverständliche Sprachfetzen herüber. Also doch. Ich war ausreichend misstrauisch, um nicht fälschlich anzunehmen, dies sei die Rettungsmannschaft. Die Laute konnten nur vom Fahrer des Geländewagens kommen. Und es waren mindestens zwei Personen. Warum sollte einer im Gelände Selbstgespräche führen?
Die Situation stellte sich wie folgt dar: Der Polo war eine unbestimmte Strecke bis ans Ende der Wiese hinuntergerutscht. Ich wusste nicht genau, um welche Weide es sich handelte. Um sie wiedererkennen oder anhand des Straßenverlaufs bestimmen zu können, war das Wetter zu schlecht. Schätzungsweise stand ich auf einer Wiese etwa in der Mitte des Heimwegs. Wenn ich mich recht erinnerte, war sie etwa hundertfünfzig Meter lang und endete an einer senkrecht abfallenden Steilwand. Die Bauern hatten einige Meter Unterholz bis zur Kante stehen gelassen, damit niemand, vor allem das Vieh, dem Rand zu nahe kam. Das Unterholz war heute mein Glück im Unglück gewesen, und so nahm ich innerlich den Fluch von vorhin zurück.
„Hallo! Ist … jemand? … ich Ihnen helfen?“
Akustisch scheinbar fern, wegen des scharfen Winds in Wirklichkeit näher als mir lieb war, drangen Sprachfetzen durch. Ich musste mich scharf zurückhalten, um nicht freudestrahlend zu antworten. Denk nach! Eben war dir doch klar geworden, dass das innerhalb der kurzen Zeit keinesfalls die Rettungsmannschaft sein kann. Zu sehen war allerdings wegen der tosenden Schneeflocken und der fast vollständigen Dunkelheit niemand. Einsetzende Gedanken strebten einer einzig sinnvollen Schlussfolgerung entgegen: Hier kam jemand, um sich vom Erfolg seiner Tat zu überzeugen oder sie andernfalls erfolgreich zu beenden. Ich vermutete zwei Verfolger. Sollte es nur einer sein, schadete es keinesfalls, auf Nummer sicher zu gehen und sich auf zwei Personen einzurichten.
Mein armer Polo hatte eine tiefe Schneise durch das Unterholz gefräst und den Schnee auf Autobreite mitgerissen. Ein Attentäter verfolgte mich garantiert auf der Wagenspur. Ein anderer hätte sich seitlich bewegen können, was bei der schlechten Sicht und dem hohen Schnee eigentlich unmöglich schien, denn es war zu nass und zu kalt, um sich ohne Ausrüstung durch hüfthohen Schnee zu arbeiten. Im Dunkeln konnte zudem leicht die Orientierung verloren gehen. Der Weg nach oben war einigermaßen klar, weil man nur dem Gefälle der Wiese und der Wagenschneise aufwärts folgen musste. Doch vielleicht waren sie ausreichend dumm und schlugen sich seitlich der Schneise nach unten. Wie auch immer, ich musste meinen Platz schleunigst verlassen, durfte dabei keine Spur legen, denn sie hätte direkt verraten, dass ich noch lebte.
Die einzig sinnvolle Möglichkeit war mehr als riskant, doch eine andere sah ich nicht. Mein Fluchtweg bestand darin, in der Schneise des Polos wenige Schritte abwärts zu gehen, um dann seitlich ins Unterholz auszubrechen und zu hoffen, die Spur würde nicht direkt ins Auge fallen. Käme ich dabei dem Rand der Schlucht zu nahe, verschätzte ich mich oder rutschte ab, wäre das der sichere Tod. Doch hatte ich oben Besseres zu erwarten? Wer auch immer bei diesem Sauwetter herabkam, konnte nur zu jenen gehören, die meinen Polo mit voller Absicht den Hang hinuntergestoßen hatten.
Während ich noch grübelte, hatte sich jemand genähert: „Hallo! So antworten Sie doch. Können wir Ihnen helfen?“, war nun deutlicher zu verstehen, wenngleich wegen der fast vollständigen Dunkelheit und des Schneetreibens niemand zu sehen war.
Etwas weiter bergauf tanzte nun ein kleines Licht. Höchste Zeit, Land zu gewinnen, zumal die Frage eine zweite Person verriet. Vorsichtig schlurfte ich seitlich drei Schritte die Schneise hinab, um sicher aufzutreten und möglichst keine Abdrücke zu hinterlassen. Soweit zu erahnen war, endete die Wagenschneise vor mir nach knapp drei Metern an einem Abgrund. Wenn ich jetzt ausrutschte oder die Felskante übersah, wäre es das gewesen. Zeit, sich endlich seitlich davonzumachen. Mit der linken Hand spürte ich tief hängende Äste einer Tanne. Der Baum befand sich direkt neben mir, ebenfalls etwa drei Meter vom Abgrund entfernt. Er konnte mir vielleicht Schutz bieten, denn im tief verschneiten Winter bilden untere Äste von ausgewachsenen Tannen eine Art Wall, so dass dicht am Stamm Mulden entstehen.
Mit leichter Verrenkung griff ich einen weiter hinten liegenden Ast, zog ihn herüber und legte, seinen Rückschwung ausnutzend, eine Art Fechterflanke seitlich zum Baum hin. Satt landete ich mitten im Schneewall. Jetzt schnell unter das Dach der Äste kriechen und hinter mir das Schneeloch verwuseln, um die Spur zu tilgen. Von außen dürfte mein Versteck auch bei besseren Wetterverhältnissen kaum zu erkennen sein, weil Äste und Schnee nahtlos ineinander übergingen. Allerdings waren die unteren Zweige meiner Tanne vom Auto angefetzt und schneefrei.
In der hastig gewählten Notunterkunft zeugten Zweige und Winterlosung von einem Unterschlupf für ein Reh. Wahrscheinlich war es durch den Polo von seiner Ruhestätte vertrieben worden.
„Hallo! … hier?“
Das kam jetzt direkt von leicht oberhalb des Baumstamms. Einzelne Wörter verschluckte der Wind. Ein Lichtstreif irrte durch Zweige und Schnee.
„Moinsch, er … sich irgend… verschobba?“
Eine grauenhaft schwäbelnde Stimme tönte nicht weit vom ersten Sprecher entfernt von der anderen Seite der Schneise herüber. Ein sonorer Bariton. Der Typ vermutete wohl, ich hätte mich in der Nähe versteckt, was mich nicht gerade beruhigte. Durch die schneefreien Zweige hindurch war ab und an sein Umriss zu erahnen, wenn ihn ein Lichtstrahl traf. Der Schwabe sah aus wie ein Klafter Holz, was meine Unruhe beförderte.
„Nö, schau dir doch ... hat sich hier … Kante gegeben … im … Sinne des Wortes. Brauchen wir halt nicht ... ha, ha!“, tönte es von weiter oben.
Die Erkenntnis schockte wie Haydns Paukenschlag bei der Uraufführung: Hier trachteten tatsächlich zwei Menschen nach meinem Leben. Ich hatte keinen blassen Schimmer, warum sie mich jagten und befand mich längst nicht außer Gefahr. Nur zur Hälfte zitterten meine Beine und Arme wegen der beißenden Kälte. Zur anderen Hälfte jagte mir die wiedergekehrte Panik Eiswellen durchs Rückenmark.
„Scho? Bisch sicher?“
„Sieh doch selbst“, ein Licht tastete längs der Autoschneise. Jetzt wurde deutlich, warum die beiden nebeneinander herliefen. Sie besaßen nur eine Taschenlampe.
„Der Wagen … volle Wucht …. Möchte nicht wissen, wie ... Willst‘ mal nachsehen?“
Der erste Typ artikulierte sich gehobener, nicht nur wegen seines fast fehlenden Dialekts. Er war auch vom Sprachniveau weniger platt als der schwäbische Troglodyt, wenngleich der Wind jedes dritte Wort entführte. Seine Lampe machte mir momentan am meisten zu schaffen. Permanent strich sie wie ein Suchscheinwerfer hin und her. Systematisch streifte dabei das Licht die Außenseite meines Unterschlupfs und brach sich an den Zweigen.
‚Ich bin ein Baumstumpf. Ein Baumstumpf.‘ Selten dürften buddhistische Mönche dieses Mantra rezitiert haben. Obzwar kein Mönch, vertraute ich in der damaligen Lage auf Autosuggestion. Tief auf den Boden gekauert wurde ich zum Baumstumpf.
„Noi, des mog i net riskiern; ‘s geht schteil abwärts … dahinner sicher … nunner“, war die erstaunlich langatmige Antwort. Immerhin konnte ich ihr entnehmen, dass der Kerl das Gefälle als ‚steil‘ interpretierte. Also konnte zumindest der Schwabe kein Bergmensch sein.
„Herr … Freude haben. … können ihm … alles geklärt ist. Nu kehr mal … saukalt“, war vom Ersten zu hören. Der schwäbische Urmensch nuschelte Unverständliches, an dessen Ende ich noch: ‚Oooh-keeh Schorsch’ mitbekam. Dann verschwand das Suchlicht, und der Wind trug den Rest mit sich fort.
Wie lange brauchen die bis oben? Ein Kontrollblick auf die Armbanduhr: Ich würde sicherheitshalber eine halbe Stunde warten. Wahrscheinlich waren die Attentäter in der Wagenschneise aufwärts gegangen. Langsam verwandelte sich panische Angst in ungeheuerliche Wut. Adrenalin suggerierte Aktionismus. Mein Verstand dagegen funkte, dass ich auch in weniger geschwächtem Zustand keine Chance gegen zwei zu allem entschlossene Angreifer haben würde. Zudem erhielt ich vom Brustkorb und der rechten Hand ein schmerzhaftes Feedback. Also blieb nur übrig, zu warten und deutlich später als die Verfolger den Berg hochzustapfen, denn lange wäre es im Freien nicht mehr auszuhalten. Kälte und Wind waren durch den Kapuzenanorak und die Winterstiefel und durch die tannengeschützte Lage gerade noch erträglich. Auf Dauer würden sie mich aber schwer schädigen. Unterkühlung ist kein Kindergeburtstag. Solange ich keine Eisenstangen verbiegen musste, waren zumindest die Schmerzen in der Brust und im Handgelenk auszuhalten. Echte Sorge bereitete mir jedoch die Unterkühlung und nicht zu wissen, wo sich die Gegner befanden.
Ein weiterer Blick auf die Uhr: Vor zehn Minuten waren die Kerle verschwunden. Wie lange ein sicherer Zeitabstand dauern kann, war mir bislang nicht wirklich klar gewesen. Irgendwann war die gefühlte Stunde vorbei (die in Wirklichkeit nur zwanzig Minuten gedauert hatte). Es konnte losgehen. Zunächst kroch ich oben aus der Tannenmulde hinaus. Dann blieb ich trotz brettharter und eiskalter Beine stehen und lauschte weitere fünf Minuten, ob die Verfolger auch wirklich nicht mehr zu hören oder zu sehen waren.
Nun steckte ich mitten im uralten Jäger-und-Beute-Spiel. Das hatte ich noch nie leiden können, und an diesem Tag erst recht nicht, weil ich auf der falschen Seite stand. Ich hege eine tiefe moralische Abneigung gegen das Jagen, obwohl mich Onkel Jodok in meiner Jugend öfter auf die Jagd mitgenommen und mir Pirschen, Ansitzen, Spuren lesen, das Leben im Wald und auch das Schießen beigebracht hatte. Er war nur enttäuscht, dass ich nach meinem ersten tierschutzgerechten Abschuss eines Kaninchens nicht dieselbe Leidenschaft fürs Töten entwickeln konnte wie er, hatte aber letztlich meine ablehnende Haltung akzeptiert.
Jäger sind eine besondere Spezies. Und mein Onkel war ein fanatischer Vertreter seiner Art. Er lebte sein Hobby als Berufung. Den Beleg lieferten Dutzende von Trophäen in seiner Wohnung. Sehr zum Leidwesen von Tante Sieglinde, denn sie musste Gamshörner, Zwölfender, ja sogar den Kopf einer Antilope regelmäßig abstauben. Kein Stück durfte angefasst oder anderswo platziert werden, da wäre Onkel Jodok ganz schön sauer geworden. Mit demselben Nachdruck hatte er mich zwischen meinem vierzehnten und siebzehnten Lebensjahr ins Weidwerk eingewiesen, bis ich ihm eines Tages gestanden hatte, die Dinge seien zwar aufregend, aber das Schießen von Hirschen und Gämsen stimme mich eher traurig denn euphorisch – wenngleich ich rein rational den Sinn einer nachhaltigen Forstwirtschaft bestens nachvollziehen könne.
In der jetzigen Lage wusste ich aber Onkels damalige Mühen sehr zu schätzen. Wenn die beiden Ganoven auch nur semiprofessionelle Großstadtjäger waren, gaben sie sicher nicht sofort auf. Als aber nach wie vor nichts außer dem Wind zu hören war, machte ich mich übervorsichtig an den Aufstieg. Etwa nach neunzig Tippelschritten entsprang aus dem Selbsterhaltungstrieb eine weitere Idee: Was, wenn ich die letzten fünfzig Meter rechts ausbrechen und mich abseits durch den Tiefschnee nach oben wagen würde, um nicht auf dem Präsentierteller zu erscheinen? Eigentlich müsste ich dann hinter dem Auto, also talwärts, herauskommen. Das Ganze musste nur gut geschätzt werden. Solange ich in der Autospur blieb, war der Weg zwar nicht zu verfehlen, ich aber auch nicht, wenn sie oben auf mich warteten. Weiter rechts konnten mich die Kerle schlechter ausmachen, dafür war der Aufstieg riskanter. Ich hoffte, die Weide würde keine überraschenden Senken aufweisen, denn mich nachts im White-Out zu verlaufen oder gar im Tiefschnee abzurutschen, konnte nur den Attentätern in die Hände spielen.
Also rechts raus und die letzten fünfzig Meter Schritt für Schritt nach oben gekämpft. Tiefschnee klebte wie Zuckerrübensirup an den Beinen. Ihn bergauf mit cowboyartigen Ausfallschritten aus dem Unterkörper beiseite zu schieben, ging schwer auf die Muskulatur. Außerdem nässte inzwischen die Jeans bis in den Schritt hinein. Ein unguter Vorgeschmack aufs höhere Alter, der schnell in massive Unterkühlung umschlagen konnte, wenn ich nicht bald ins Warme käme. Diesen Effekt hatte ich bei meinem Plan nicht bedacht und ärgerte mich über die eigene Dummheit.
Plötzlich sah und hörte ich relativ dicht über mir ein Auto vorbeifahren. Eigentlich konnten es nicht die beiden Verfolger sein, trotzdem widerstand ich der Versuchung, aufzuspringen und wild mit den Armen zu fuchteln. Wenn nicht gerade ein Beifahrer seitlich hinunter schaute, wäre ich in jenem Sekundenbruchteil, in dem das Auto vorüberfuhr, sowieso nicht zu sehen gewesen. Hätten mich andererseits die Attentäter entdeckt, würde ich mein Leben definitiv verspielt haben. So duckte ich mich und wühlte mich kurz danach die restlichen Meter zur Straße hinauf.
Unterhalb der Böschung spähte ich zunächst auf und ab. Die Straße lag ruhig und friedlich da, nur eisiger Wind pfiff nach wie vor durch den Wald und trieb kristallene Flocken vor sich her. Inzwischen machte er mir etwas weniger aus, denn durch das Bergaufkämpfen war mir trotz nasser Hose warm geworden, und mein Kopf war in der gefütterten Kapuze mollig verstaut.
Von hier aus ging es auf der Straße geschätzte sechs Kilometer in die Stadt nach unten wie auch in der entgegengesetzten Richtung zum Heimatdorf nach oben. Eine der Strecken zu laufen kam in meinem angeschlagenen Zustand nicht wirklich in Frage. Wenn mich nicht alles täuschte, müsste zwei bis drei Kurven weiter unten ein Gehöft liegen, von dem aus diese Weide bewirtschaftet wurde. Damit stand die Richtung der abendlichen Wanderung fest.
Plötzlich fielen mir Mutter und Benny wieder ein. Sicher hatten sie sich längst gefragt, wo ich abgeblieben sei, denn inzwischen war es garantiert bereits halb acht, und weder ich noch das Abendessen waren anwesend. Da ich meist pünktlich und zuverlässig bin und zumindest einen von beiden in unvorhersehbaren Fällen anrief, würden sie sich auf jeden Fall ängstigen.
Kaum hatte ich einen leichten Bärentrab gestartet, kam von unten ein größeres Gefährt entgegen. Was nun: Verstecken oder winken? Da der Wagen zügig fuhr und vom schabenden Geräusch als Schneeräumer zu erahnen war, entschied ich mich fürs Winken. Sicherheitshalber wechselte ich auf die andere Straßenseite, denn die Dinger brettern ziemlich forsch über die verschneite Fahrbahn, und ich hatte keine Lust, nach überstandenem Beinahe-Absturz unter die ausladende Schaufel zu geraten. Meine wilden Armbewegungen waren im fetten Scheinwerferlicht für den Fahrer gut zu erkennen. Einige Meter oberhalb von mir kam ein mit Baumstämmen beschwerter Unimog zum Stehen.
Auf der Fahrerseite kurbelte ein Bekannter aus unserem Dorf das Fenster herunter. Ich rannte die wenigen Meter zu ihm hinauf.
„Was machst du denn hier, Felix?“, rief Toni fassungslos.
„Grüß Gott, Toni. Lässt du mich mitfahren? Mir ist saukalt.“
Im Winter räumt Toni Schnee auf Landstraßen; zu anderen Jahreszeiten sammelt er Müllsäcke ein, die jeder Haushalt zu bestimmten Tagen an den Straßenrand stellt. Alle Servicedienste waren in unserem Land bestens organisiert, und Toni trug seinen wichtigen Teil zu einem funktionierenden Gemeinwesen bei. Anders ginge es auch gar nicht, denn in den ausgedehnten Seitentälern wären weder Mobilität noch Versorgung für die etwa hundertfünfzigtausend Menschen gewährleistet, die dort weit verstreut in kleinen Dörfern leben. Und selbst dann konnte ein höher gelegenes Bergdorf in besonders harten Wintern für mehrere Tage eingeschneit werden. Einwohner wie Touristen mussten bei einer derartigen Wetterlage einige Zeit von Vorräten leben und würden weder hinein noch hinaus gelangen.
Toni öffnete die Beifahrertür: „Steig ein!“
Ich folgte ihm, und er fuhr los. Selten war ich froher gewesen, ihn zu sehen. Kaum ein Gefühl lässt sich mit jenem vergleichen, das in der schwallwarmen Fahrerkabine in mir hochkam. Eine Mischung aus Erleichterung, Erschöpfung, kindlicher Freude und spontaner Zuneigung zu einem Bekannten glich den soeben durchlebten Schock zumindest ansatzweise aus.
„Was ist los mit dir? Was hast‘ bei diesem Wetter mitten auf der Strecke verloren?“ fragte Toni.
Ich weiß nicht genau, warum ich ihm daraufhin nicht die Wahrheit steckte. Das war wieder mal so eine Gefühlssache. Denn eigentlich müsste ich froh gewesen sein, jemandem das Herz ausschütten und mit ihm zur Polizei fahren zu können. Stattdessen band ich Toni eine Räuberpistole auf. Mein Auto samt Handy sei gestohlen worden. Ich sei mit einem Anhalter mitgefahren, einem Touristen, der sich als alkoholisiert entpuppt hätte. Nach kurzem Streit habe ich mich aus Sicherheitsgründen auf die Straße setzen lassen, und da sei ich nun.
„Warum hast du nicht den Bus genommen?“ fragte Toni. Schon schien mein Jägerlatein am Ende.
„Na, wollt halt Zeit sparen. Der Bus war gerade weg. Weißt ja, dass er nur alle Stunde vorbeikommt“, fiel mir gerade rechtzeitig eine müde Ausrede ein.
Damit Toni keine weiteren inquisitorischen Fragen stellen konnte, drehte ich den Spieß um und fragte ihn nach seiner Frau und den drei Kindern. Volltreffer. Zum Glück bohrte Toni nicht nach, sonst hätte er vielleicht meine dünne Story hinterfragt. Manchmal hilft ein Psychologiestudium halt auch im Alltag. Die Ablenktechnik ist allerdings der älteste Kommunikationstrick der Welt. Ihn beherrschen besonders kleine Kinder und Frauen, was beweist, dass speziell dafür kein Studium notwendig ist.
Während der restlichen Fahrt berichtete Toni Neues von seiner Familie. Seine Schwiegermutter habe neulich eine Sonntagstorte gebacken und zur Freude der Angehörigen Zucker und Salz verwechselt, was erst bei Tisch auffiel. Der Jüngste zahnt gerade. Der Collie musste wegen einer Darmkolik zum Tierarzt gebracht werden. Was das überzüchtete Tier einen an Zeit und Geld koste, gehe auf keine Kuhhaut. Und so weiter und so fort.
Obwohl ich gedanklich absolut nicht bei ihm war, bemühte ich mich, freundlich zu nicken und ab und an zustimmend zu grunzen. Außerdem bat ich Toni, das warme Gebläse noch etwas höher zu stellen, und richtete alle Düsen der Beifahrerseite auf mich.
Nach zwanzig Minuten waren wir am Dorfrand angekommen. Meine Jeans waren nicht mehr bretthart und auch etwas wärmer, wenngleich noch ziemlich nass. Der Parka war dagegen dank Imprägnierung fast trocken, doch inzwischen machten sich Hand- und Brustschmerzen deutlich bemerkbar. Sie zu ignorieren half leider nicht.
„Ich muss wieder abwärts. Fahr dich bis vor die Kirche. Von da an musst’ laufen“, bot mir Toni an.
Toni war ausschließlich für die Räumung von Landesstraßen zuständig, Gemeindestraßen gehörten nicht dazu. Seit einigen Tagen waren er und Dutzende seiner Kollegen im Großeinsatz.
„Servus, Toni. Vielen Dank fürs Mitnehmen“, verabschiedete ich mich und riss die Fahrertür auf.
„Servus Felix. Keine Ursache. Komm gut heim“, antwortete er knapp angebunden.
„Du auch. Hauptsache du kehrst wieder“, bemühte ich einen abgedroschenen Scherz. Toni grunzte nur, und nachdem die Beifahrertür zugeschlagen war, fuhr er um die Kirche herum und langsam wieder Richtung Dorfeinfahrt. Ich blickte auf die Uhr: Kurz nach acht. Nun wurde es Zeit.
Während Tonis Familiensaga hatte ich mir die nächsten Schritte überlegt. Zunächst wollte ich zur Polizeiwache gehen und dort mein Auto als gestohlen melden, um die Legende aufrechterhalten zu können. Von der Wache aus hätte ich kurz daheim anrufen und die Sachlage schildern wollen, um Benny und Mutter zu beruhigen und sie zu bitten, statt der geplanten Spaghetti improvisierte Käsebrote zu essen. Zum Glück trug ich seit einem Einbruchdiebstahl, bei dem sie mir in einem Mailänder Hotelzimmer einige Wertsachen gestohlen hatten, stets Schlüssel, Papiere und Geld in der Jacke mit. So blieb wenigstens die Rennerei zu den Ämtern und zum Schlüsseldienst erspart.
Doch warum kommt es immer anders als gedacht? Auf dem kurzen Weg von der Kirche zur Polizeiinspektion sah ich aus dem Augenwinkel, wie ein roh zusammengesetzter Klafter Holz auf zwei Beinen gerade im Begriff war, den Dorfkrug zu entern. Neben ihm schritt ein schlanker Mann kräftig aus. Die massige Silhouette des ersten Mannes werde ich mein Lebtag nicht vergessen: Mitten in meinem friedlichen Heimatdorf enterte der mörderische Schwabe – der Schlanke war vermutlich sein Spießgeselle ‚Schorsch‘ – die Gaststätte, in der ich gerade meinen Abenddienst antreten wollte.
3. Alma Mater
Augenblicklich bekam ich wieder weiche Knie wie gerade eben am Abgrund. Ich zögerte. Das Dilemma bestand darin, wegzulaufen und die Polizei zu holen oder hinzulaufen und am Ball zu bleiben. Die erste Möglichkeit barg viele Risiken und bot wenig Chancen. Die örtliche Polizei würde mir keinesfalls sofort glauben, dafür war die Geschichte einfach zu skurril. Bestenfalls würde mich ein Gendarm in den Krug begleiten, wo er vermutlich beinharten Kerlen gegenüberstünde, die sich seiner Autorität garantiert nicht beugen würden. Außerdem hätten mich die Kerle unweigerlich gesehen und gewusst, dass ihr Plan gescheitert war. Die Konsequenzen aus Variante eins lagen somit auf der Hand.
Die zweite Möglichkeit war ebenfalls nicht gefahrenfrei (einfach abzuhauen kam mir überhaupt nicht in den Sinn). Die Ganoven konnten, wenn ich mich hier herumtrieb, plötzlich auftauchen und mir den Rest geben. Sicher kannten sie mich von irgendwoher, eventuell von einem Bild her, andernfalls hätten sie mich nicht gezielt verfolgt. Mir war völlig unklar, ab wann sie hinter mir her gewesen waren, schätzungsweise bereits ab der Fachhochschule. Denn dort konnte man mich bis auf die Wochenenden tagsüber leicht auffinden. Wenigstens bot die zweite Handlungsalternative die Chance, etwas über die Kerle herauszufinden.
Zunächst wollte ich mich auf dem Parkplatz des Gasthauses ‚Zum Krug’ umschauen. Obacht! Jetzt bloß Deckungen ausnutzen und seitlich aufs Ziel zustoßen, damit dich niemand sieht. Ich beschrieb einen Halbkreis auf der anderen Straßenseite um die Kirche herum. Dabei zog ich die Kapuze vor die Stirn und versuchte, möglichst natürlich zu wirken und forsch auszuschreiten.
Mein Heimatdorf Rotenstein wurde ursprünglich im fünfzehnten Jahrhundert als klassisches Reihendorf am Ende einer Bergstraße gegründet, wiewohl es wegen der vielen Neuansiedlungen heute eher den Charakter eines breit besiedelten Dorfes zeigt. Nach der Anfahrt besteht vor der Gemeinde die Möglichkeit, entweder links herum zum Skigebiet oder geradeaus zur Ortsmitte zu fahren, von der aus nur noch Stichwege zu weiter hinten liegenden Weilern im Talkessel führen. Die Straße zur Ortsmitte zieht sich etwa eineinhalb Kilometer in die Länge, beidseitig liegen Bauernhöfe.
Weil der Gemeinderat bereits vor vierzig Jahren so schlau gewesen war, den Skiverkehr linkerhand ums Dorf herumzuleiten, liegt der alte Ortskern recht ruhig. Er konnte zudem gut erhalten werden. Die obligatorische Pfarrkirche steht in der Mitte des historisch ältesten Dorfteils auf einem relativ großen Platz. Hinter der Apsis befindet sich an ihrer Stirnseite unser alter Friedhof. Um die Basilika und den Friedhof herum führt ein breites Oval, ein Straßenzug mit seitlichen Siedlungen. Die beiden Teilstraßen stoßen vor und hinter dem Dorfzentrum zusammen.
Rechts neben der Kirche liegen die Hauptgebäude unserer Gemeinde: das Hotel Hubertus, der Dorfkrug, das Gemeindehaus mit Sitz von Bürgermeister und hohem Gemeinderat, das Tourismusbüro und das Postlädele. Nebenan ist die Gendarmerie stationiert. Seit der Tourismus Mitte der sechziger Jahre zu blühen begonnen hatte, breiteten sich auf der anderen Seite der Kirche und in den Seitenstraßen kleinere Geschäfte und weitere Hotels aus.
Zum Glück liefen heute trotz des Wetters einige Leute im Dorfzentrum herum, unter ihnen fiel ich weniger auf. Der heftige Sturm hatte inzwischen deutlich nachgelassen und es schneite weniger intensiv. Allem Anschein nach waren eher Touristen unterwegs, denn sie stiegen da und dort zu mehreren Personen aus ihren Autos und hasteten Gaststätten entgegen. Überdies konnten es kaum Dorfbewohner sein, denn die meisten Einheimischen sitzen in der Regel um zwanzig Uhr zu Hause beim Abendessen oder vor dem Fernseher. Nur ewige Stammtisch-Hocker genehmigen sich zur besten Familienzeit in der Schänke ihre Biere, Schnäpse und Viertele. Gesittete Rotensteiner tun das im Allgemeinen dezent zu Hause, oft sogar bevor die Kinder im Bett liegen.
Der Halbkreis um die Kirche war schnell beschrieben. Das Gasthaus ‚Zum Krug’ liegt etwa in der Mitte auf der anderen Seite. Auf dem Gästeparkplatz glaubte ich aus der Entfernung einige Fahrzeuge sowie den Traktor von Alois und ein Vehikel auszumachen, das dem Auto meiner Verfolger ähnelte. Alois betreibt mit seinem Gasthaus in der Nachfolge seines Ur-Ur-Großvaters die erste der beiden traditionellen Dorfschänken im Ort. Das konkurrierende Gasthaus ‚Zum Löwen’, steht auf der gegenüberliegenden Seite der Kirche. Wie oft bei uns üblich, sind die beiden Gasthäuser politisch streng getrennt – der Krug ist eher ‚rot‘, der Löwe eher ‚schwarz bis blau‘ –, was jedoch nur für Einheimische eine Rolle spielt und nicht für Touristen. Weil Rotenstein überwiegend konservativ angehaucht ist, sind im Krug stets weniger Dorfbewohner anzutreffen als im Löwen. Skifahrer, im Sommer Wanderer und Biker, bewahrten allerdings Alois vor dem Ruin. Ich arbeitete dort nicht aus politischen Gründen, die waren mir ziemlich egal, sondern weil mir die Touristen in ihrem Ferienrausch höhere Nebeneinkünfte brachten als die Einheimischen, denn die meisten Rotensteiner wissen nicht, wie man ‚Trinkgeld‘ schreibt.
Tatsächlich: Auf dem Parkplatz stand ein extrem hoch gebockter Geländewagen, ein amerikanischer Ford-Pick-Up mit abgedeckter Ladefläche. Vor seinem Grill wölbte sich ein aus dicken Metallbügeln längs- und querverstrebter Stoßfänger, mit dem sie im Outback Kängurus abpuffern. Es lag kaum Schnee auf dem Wagen, die Angeberkiste stand also erst seit Kurzem hier. Zudem lief ihre Standheizung, denn der Schnee schmolz sofort auf der Windschutzscheibe. Wer auch immer den Pick-Up hier abgestellt hatte, wollte ihn entweder allgemein präsentieren oder schnell damit verschwinden, denn das Monstrum parkte frontal Richtung Straße. Glücklicherweise saß niemand darin.
Obzwar die vier auf den Parkplatz weisenden Seitenfenster des Krugs von den Toiletten und der Küche abgehen und kaum damit zu rechnen war, dass ‚Schorsch‘ und sein schwäbischer Urmensch dort hinausblickten, schlich ich übervorsichtig voran. Immerhin konnten sie jeden Augenblick um die Ecke biegen, außerdem steckte mir noch zu sehr der Schock in den Gliedern. Also verzog ich mich sofort hinter den Pick-Up.
Grundgütige Mutter! Mein Herz pumpte wie wild, als mir aus dem Wageninnern ein bestialisches Bellen aus weit aufgerissenem Rachen entgegenschlug und mich ein schwarzer Rottweiler angeiferte. Reflexartig sprang ich hinter dem Wagen in Deckung, wo ich mit der Nase auf ein eingeschneites Nummernschild stieß, es aber zunächst nicht realisierte. Nach einigen Schrecksekunden nahm ich das ‚S‘ auf dem Schild wahr – der Wagen war in Stuttgart zugelassen. Die restlichen Ziffern und Buchstaben bedeckte der Schnee. Als ich ihn abgewischt hatte, konnte ich das Kennzeichen erkennen. Mein geplanter Rückzug hinter die Kirche wurde leider durch die sich öffnende Gasthaustür und die daraus Austretenden vereitelt.
„Hoi, wos solle mer nu mache, wo mer den Hermann net wie geplant antroffe ham? “ urtümelte es aus Richtung des Eingangs. „Jo wos isn mimm Wotan uff oamol los? Warum tobt der so?“
Eindeutig waren Stimme und Dialekt des zweiten Attentäters zu vernehmen. In dieser Situation half nur noch der volle Parkplatz. Unbemerkt verschwand ich direkt hinter den nächsten beiden Autos. Fußspuren ließen sich leider nicht vermeiden, Hauptsache, ich kam unentdeckt nach hinten und von dort aus auf die andere Seite in Richtung Kücheneingang.
„Siehst du wen?“, fragte Schorsch.
„Noi, Schorsch“, antwortete der Schwabe.
„Dann lass uns nachschauen. Und du, such den Parkplatz ab, vielleicht ist da jemand.“
„Oooh-keeh, Schorsch.“
„Und hör auf, ständig meinen Namen rauszuposaunen. Das habe ich dir schon tausendmal verklickert.“
„Oooh-kee, Sch … Oooh-kee, oooh-kee.“
Anscheinend war Schorsch der Anführer und der Troglodyt sein Mann fürs Grobe, jedenfalls nicht fürs Schlaue, soviel stand fest. Den darauffolgenden Dialog verstand ich nicht, weil ich sofort in gebückter Haltung quer über den Parkplatz spurtete und mich hinter den dort geparkten Wagen zum Kücheneingang vorarbeitete. Die Attentäter schnüffelten jetzt am Pick-Up herum. Der Anführer behielt dabei die Dorfstraße fest im Auge, während das Kantholz unter den Wagen spähte. Das war meine Gelegenheit.
Die Küchentür vom Krug ist nie abgeschlossen, das wusste ich, weil tagsüber geliefert wurde und die Crew zwischendurch ihren Müll und anderes Zeug von dort in den anschließenden Stadel karrte. Tür auf und hineinschlüpfen waren eins. Vorsichtig zog ich die Tür hinter mir ins Schloss.
Drinnen folgte ich dem kurzen Flur bis in die Küche. Es herrschte übliche Hektik. Drei Mann waren unter der Regie von Egon am Bestellungen annehmen, Köcheln, Abschmecken, Rühren und Teller garnieren. Egon dirigierte sie wie Daniel Barenboim das Wiener Sinfonieorchester. Er huschte hierhin, um eine Soße zu verfeinern, sprang dorthin, um den Lehrling anzuweisen, wie die Spritztüte besser zu gebrauchen sei und registrierte dabei das gesamte Treiben. Kein Wunder, dass er mich zuerst bemerkte.
„Was kommst’ denn hintenrum ini?“ rief er mir quer über die Herdplatten zu. „Weißt doch selbst, der Chef sieht’s nicht gern, wenn alle durch den Reinraum schleichen und Bazillen verteilen.“
„Schon gut, Egon. Draußen tobt’s wie wild, und ich wollte ausnahmsweise den Weg abkürzen“, redete ich mich raus.
Mit einem kurzen, nicht wirklich ärgerlichen, Wink deutete Egon an, mich nach vorne zu trollen. Seit ich denken kann, gehört er zum Krug wie das Bier darin. Nach mehrjähriger Gesellenzeit im Ausland hatte es ihn vor Jahren in die Heimat zurückgezogen, weil seine Mutter an Krebs erkrankt war und nur noch wenige Jahre zu leben hatte. Bis zu ihrem Tod hatte er sich rührend um sie gekümmert. Seitdem ist Egon in der Heimat geblieben. Er musste so um die sechzig sein. Ich erinnere mich heute noch an viele gute Essensüberbleibsel, die ich als Kind gerne von ihm angenommen hatte.
In der Gaststube tobte der Touristenbär. Ein Hallodri und Rambazamba vom Lautesten, das eigene Wort kaum zu verstehen. Wenigstens durfte seit der Gesetzesänderung nicht mehr im Krug geraucht werden, immerhin minimierte das unser Krebsrisiko um neunzig Prozent. Die grottige Hip-Hop-Urlaubs-Mucke war aber leider gesetzlich erlaubt. Zum Ohrenverdruss hatte sie auch in den Krug Einzug gehalten. ‚Hört DJ Alpli! Tausende angesäuselte Dumpfbacken im Après-Ski-Outfit können nicht irren!‘ Spät am Abend legte Alois als Kontrastprogramm regelmäßig postmodernen Heimat-Pop und Schnulzen auf: Fritzi Überfelder mit seinen steirischen Holzhackerbuam und ähnlicher Schmus bis zum Erbrechen. Erarbeitetes Geld stinkt zwar nicht, wird aber durch Gehörfolter schwerer erkauft als nötig. Als ich die Gaststube betrat, trauerte ich unter anderem auch meiner verlorengegangenen Blues-CD nach.
Wie bei vielen von uns war meine Haltung gegenüber dem Tourismus ambivalent. Wir lebten von ihm und waren einerseits froh, das harte Landleben unserer Altvorderen durch neue Einkünfte endgültig beenden zu können. Andererseits entwickelten wir den Touristen gegenüber, je nach Individualität, auch eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Hassliebe. Vor allem, weil einige Urlauber glauben, sich in der Fremde völlig danebenbenehmen zu dürfen. Wie bei anderen Dingen auch, ist diese Einstellung keinesfalls zu verallgemeinern, weil es mehrheitlich nette Urlaubsgäste gab und gibt. Ich fragte mich nur, warum die Netten sich seltener im Krug aufhielten als die Angeber.
Im kleinen Pausenraum schlüpfte ich schnell aus dem Parka, schmiss ihn über einen freien Stuhl, band mir eine weiße Schürze um – nicht so fest, das vertrugen die Rippen heute nicht – und begrüßte Alois hinter der Theke:
„N‘Abend, Alois. Hier bin ich.“ Alois ist genau der Richtige für sein Gewerbe. Ein Stoiker par excellence und ein gutmütiger Kerl. Mit seiner dunkelbraunen Lederschürze und der imposanten Gestalt gibt er hinter der Theke den Idealtyp eines Dorfwirts ab und macht dabei einen unaufgeregten Job.
„Servus Felix. Du, deine Familie hat schon nach dir g‘fragt. Warst’ denn nicht daheim?“, fragte er mich.
„Nein. Mir haben sie unten blöderweise das Auto direkt vom Supermarkt weg geklaut. Wollte grad noch was nachkaufen, da war es weg. Hat lange gedauert, bis ich hier war. Ich konnte noch nicht mal eine Anzeige bei der Gendarmerie aufgeben, weil das noch länger gedauert hätte. Das mache ich morgen“, log ich ihn an.
„Ist ja verrückt. Ich sag ja: Unten im Tal wird’s immer krimineller. So was gibt’s bei uns nicht. Na dann ruf doch als Erstes Elfriede an. Sie hat dich zum Essen erwartet. Und geh anschließend Steffi mit der Bedienung zur Hand. Übernimm Tisch sechs bis zehn, sie kann eins bis fünf nehmen.“
Elfriede heißt meine Mutter. Ich konnte mir ihre Besorgnis gut vorstellen, weil ich Zusagen üblicherweise einzuhalten suche. „Alles klar, Aloisius!“ Ich griff das Telefon hinter der Theke und wählte unsere Nummer.
„Moosburger.“
Mutter war am Telefon kurz angebunden, zumindest bei der Begrüßung und seit Vater nicht unter uns weilte. Früher konnte sie durchaus lang und breit schwätzen, doch das kam in letzter Zeit immer seltener vor.
„Mutter, ich bin’s. Du glaubst nicht, was passiert ist.“
„Felix. Endlich. Wo warst du? Was ist los? Du wolltest doch für uns kochen. Sonst bist du doch immer zuverlässig. Warum heute nicht?“
Mutter klang besorgt, ich wusste nur nicht, ob die Sorge mir galt oder eher dem eigenen Wohl. Ich tischte ihr meine Ausrede auf und fragte, ob sie denn etwas gegessen hätte, und wenn nicht, ob sie für sich und Benny nicht Brote schmieren könne. Mutters anfängliche Besorgnis schwang sogleich in Selbstmitleid um.
„Ach weißt du, ich kann das nicht. Eigentlich habe ich keinen Hunger. Benny ist ja schon groß. Ich sag ihm, er soll sich etwas zubereiten. Mir geht’s heut nicht gut. Ich liege auch schon im Bett.“
Meine Reaktion war verhalten, denn sie lag jeden Tag stundenlang im Bett und übernahm so gut wie gar keine gemeinsamen Aufgaben mehr: „Ist gut. Wenn du meinst. Ihr kommt also ohne mich klar“, beantwortete ich selbst meine Frage.
„Nicht wirklich, aber was sollen wir sonst machen? Wir haben keine Wahl. Du bist dauernd beim Studieren oder Arbeiten und kümmerst dich immer weniger um mich.“
Diese Antwort regte mich mächtig auf, erstens weil Mutter unsere finanzielle Lage genau kannte und wusste, ich würde das verdiente Geld nicht für mich ausgeben, sondern fast ausschließlich für Ernährung oder Erfordernisse am und im Haus. Zweitens hatte sie aus meiner Sicht immer eine Wahl, sich professionell helfen zu lassen und aus der Depression auszubrechen. Und drittens lud sie mehr und mehr Verantwortung auf mich ab, ohne es zu bemerken oder zu honorieren. Ich war jedoch zu kaputt für eine Grundsatzdiskussion und ignorierte den Vorwurf, obwohl er innerlich heftig weh tat.
„Hat Benny seine Hausarbeiten gemacht?“, wollte ich wissen.
„Weiß nicht. Beeenny …“, schrie sie durchs Haus und durch den Hörer, „Felix fragt, ob du deine Schularbeiten gemacht hast.“ Und nach einigen Sekunden: „Antworte gefälligst, wenn deine Mutter dich was fragt, Rotzlöffel.“ Im Hintergrund war Bennys Stimme leise zu vernehmen. Klang verdächtig trotzig.
„Du sollst dich nicht rausreden, sondern deinem Bruder die Wahrheit sagen.“ Jetzt fuhr sie mich als schwereres Geschütz ins Feld, wohl weil ihr Einfluss auf den Pubertierenden schwand. Erneut war Benny zu hören. Mutter wandte sich wieder an mich:
„Er sagt, bis jetzt noch nicht. Er will sie gleich machen, wenn er seinen Block popostet hat. Was ist ein Block – meinst du, er macht damit unanständige Dinge? Ich dachte, die schreiben heute nicht mehr auf Blöcken, sondern mit dem Computer?“
Ich klärte meine Mutter oberflächlich über die Selbstdarstellung im Internet auf und erklärte ihr, Benny treibe damit wohl nichts Unanständiges, weil das jeder im Internet lesen könne. Außerdem wollte ich meinem Bruder glauben und die Geschichte nicht lange hinterfragen. Also beendete ich rasch das Telefonat und wandte mich dem normalen Wahnsinn in der Gaststube zu.
Der restliche Abend verlief wie gewohnt, was die Arbeit betraf. Mit Ausnahme dessen, dass ich permanent zur Tür und zum Kücheneingang schielte, ob die Attentäter vielleicht erschienen. Außerdem quälten mich starke Schmerzen. Meine Bewegungen wurden zusehends steifer, und das Tablett ließ sich auch nicht optimal tragen und halten, was als Rechtshänder gerade noch so zu schaffen war, weil ich es eh links trug. Die Biere konnte ich dagegen nur stemmen, wenn ich das Tablett vorher auf dem Tisch abgestellt hatte. Heute machte ich anscheinend alles mit links. Dafür war wenigstens das Trinkgeld in Ordnung. Mehrere feuchtfröhliche Runden ergaben insgesamt knapp vierzig Euro extra, die zu den fünfunddreißig dazukamen, die mir Alois in die Hand drückte. Wenigstens konnte ich durch diesen Abend den heutigen Verlust an Lebensmitteln einigermaßen ausgleichen. Was allerdings eine Milchmädchenrechnung war, da ich die Tageseinnahmen ansonsten gespart hätte.
In der Küche spendierte mir Egon nach seinem Feierabend ‚übrig gebliebene‘ Wienerle mit Kartoffelsalat, die ich gierig verschlang. Zuvor hatte ich mich zwischendurch ausnahmsweise mit Süßgetränken und einer steinharten Brezel aufrecht gehalten. Kurz vor Mitternacht fragte ich Alois, ob er mich heimfahren könne. Unser Hof war zwar nur fünfzehn Minuten zu Fuß entfernt, doch die wollte ich mir nicht auch noch antun. Alois war so freundlich, und daher lag ich dann endlich gegen eins im Bett. Nicht, ohne zuvor einen kurzen Blick in Bennys Schlafzimmer geworfen zu haben. Mein lieber Bruder atmete ruhig und unbeschwert. Nur Mutter lag noch wach in ihrem Bett. Neben sich, auf der mir abgewandten Seite, versuchte sie das Glas zu verstecken, das sie soeben in der Hand gehalten hatte. Doch davon ließ ich mich nicht täuschen. Mutters neuer Freund Jimmy Beam hauchte mich süßlich an.
„Grüß Gott, Mutter.“ Ich ging zu ihr ans Bett und küsste sie auf die Wange, die sie störrisch abwandte. „Habt ihr heute lange auf mich gewartet?“, stellte ich die unsinnige und nur rhetorisch gemeinte Frage, weil ich nicht wusste, wie ich reagieren sollte.
„Na, was denkst du wohl? Glaubst wohl, du kannst einfach machen, was du willst, und uns vernachlässigen“, wiederholte sie die bekannten Vorwürfe.
Ihr Gram war nicht auf mich bezogen und entsprang immer noch der Trauer um ihren verstorbenen Mann. Großherzigkeit fiel mir dennoch nicht leicht, denn ausgerechnet jetzt, als der Stress nachließ, traf mich blankes Entsetzen darüber, wie knapp ich heute dem Tod entronnen war. Ich hatte einen Unfall überlebt, der nicht zufällig, sondern durch böse Absicht provoziert worden war. Von der Gefühlslage her hätte ich daher lieber alles erzählt und mich von meiner Mutter trösten lassen, anstatt umgekehrt. Was mich jedoch davon abhielt, war ihr mürrisches Granteln. Auf einmal reagierte ich wieder wie ein zu Unrecht angeklagtes Kind und suchte mich aus einer Abwehrhaltung heraus zu rechtfertigen. Im Gegensatz zur ausgedachten Geschichte war jedoch mein Tonfall authentisch.
„Das war überhaupt nicht meine Schuld! Woher soll ich denn wissen, dass jemand das Auto klaut samt Handy? Ich bin so schnell zurückgekommen, wie es ging, war noch nicht mal auf der Gendarmerie. Der Einkauf ist auch weg. Wir brauchen das Geld, das ich verdiene. Ich bin ja nicht absichtlich spät heimgekommen.“
„Wie willst dann, bitt’schön, immer zum Studieren kommen?“ Mutters spitzer Tonfall suggerierte meine Teil-, wenn nicht sogar Vollschuld am fiktiven Autodiebstahl.
„Mit dem Bus natürlich, der fährt alle Stunde. Morgen früh gehe ich als erstes zur Gendarmerie. Vielleicht fahre ich dann aber nicht zur FH und lerne lieber mit Karl-Heinz. Wir haben nächsten Freitag eine wichtige Prüfung.“
Keinesfalls hatte ich vor, morgen den ganzen Tag zu lernen oder tagsüber zu Karl-Heinz zu fahren, der im dritten Semester Betriebswirtschaft studierte und Wahlseminare in unserem Psychologiestudium belegt hatte. ‚Rogge’, wie er mit Anspielung auf seinen Nachnamen ‚Rogalla’ nicht gerne, dafür von vielen, genannt wurde, fiel durch nie ermüdende Fröhlichkeit und eine kegelförmige Statur auf, die er im Gegensatz zu seinem Spitznamen gelassen aufnahm.
Statt mich mit ihm zu treffen, wollte ich mich im Dorf vorsichtig über meine beiden Verfolger erkundigen. Alois wäre vielleicht der richtige Ansprechpartner, eventuell hatte Steffi die beiden bedient und konnte sich an etwas erinnern.
Außerdem schwirrte mir eine Idee mit der Stuttgarter Autonummer durch den Kopf. Ich hatte sie im Krug auf einem Zettel notiert und in die Hosentasche gesteckt. Auf jeden Fall würde ich bei Doktor Feuerlein vorbeischauen, unserem Dorfarzt. Sollte er sich mal meine Hand ansehen.
„Na, wenn du meinst.“ Mutters Interesse war erloschen, und ich sah mich nicht veranlasst, es künstlich in die Länge zu ziehen.
„Gute Nacht, Mutter“, winkte ich ihr zu.
„Gute Nacht, Felix.“ Sie drehte sich um und zeigte mir ostentativ die Rückansicht ihres Nachtkleids.
Ich nahm eine heiße Dusche, fummelte einen notdürftigen Verband mit einem Schuss Verstauchungssalbe um mein rechtes Handgelenk und fiel total kaputt ins Bett. Den Funkwecker stellte ich wie immer dieser Tage auf fünf Uhr ein, ohne lange darüber nachzudenken, dass die Nachtruhe bald vorbei sein würde.
4. Alarm
Wenn einen der Wecker aus dem Tiefschlaf hart empor reißt, scheint der Tag bereits vor dem Aufstehen gelaufen zu sein. Lebertranig quälte ich mich am nächsten Morgen aus den Federn. Hinter mir lag ein zu kurzer und zu leichter Schlaf, permanent unterbrochen durch schmerzhafte Bewegungen. Als ich gerade eine gewisse Ruhe gefunden hatte, pfiff mich das Funksignal in die Wirklichkeit zurück. Seit der Schulzeit war ich allerdings auf das zu Beginn erst leise, dann nach einigen Sekunden der Ignoranz stetig lauter werdende nervtötende Piepen geeicht. Aus einer alkoholischen Absturzerfahrung heraus kannte ich die Intensität dieser Konditionierung, denn selbst im Eins-Komma-Fünf-Promille-Koma hatte mich der spitze Ton unbarmherzig geweckt. Ich durfte nur nicht auf die Snooze-Funktion tippen. Denn die kostet mehrere Zehnminuten-Einheiten an Zeit und wirkt spätestens beim dritten Mal wie russische Schlafentzugsfolter im Gulag. Da war es schon besser, gleich aufzustehen, was ich auch an diesem Morgen tat.
Zunächst stand tägliche Routine an: Zähneputzen. Handgelenksverband wickeln (heute neu dabei). Arbeitskleidung anziehen. Mit der Schneefräse kräftig zupacken. Zurück ins Haus. Rasieren. Ausziehen. Duschen. Umziehen. Frühstück für alle vorbereiten. Benny um sechs wecken. Benny um zehn nach sechs erneut wecken, diesmal mit Nachdruck, bis er muffelnd ins Bad abschiebt. Schließlich ein Käsbrot verdrücken und darauf zwei Tassen Kaffee gießen.
In dieser kurzen Ruhephase konnte ich die Erlebnisse vom Vortag nicht mehr verdrängen. Nach und nach breitete sich starkes Unbehagen aus. Warum hatte man mich den Hang hinuntergestoßen? Wie lange würde es dauern, bis die Ganoven mitbekamen, dass ich noch lebte? Was wären ihre nächsten Schritte? Plötzlich schoss mir ein beklemmender Gedanke durch den Kopf: Was, wenn sie Mutter und Benny etwas antäten? Ich kam nicht dazu, weiter darüber zu grübeln, weil mein Bruder auftauchte.
„Guten Morgen, Benny. Auch schon auf?“, frotzelte ich unsicher, als er zur Küchentür hereinkam. Wie jeden Morgen war mein Bruder mehr als maulfaul. Wortlos schlurfte er an den Küchentisch, wo er sich breitmachte, so gut er konnte.
„Sorry für gestern Abend, aber sie haben mir das Auto geklaut“, versuchte ich ein Gespräch in Gang zu bringen und ihm die Lage zu erklären. Daraufhin wachte er endlich auf.
„Den Polo?“, fragte er zurück.
„Ja, Vaters alten Polo“, sagte ich. „Sie haben ihn unten direkt vor dem Supermarkt weggeschnappt. Mit allen Einkäufen, meinem Handy und einer Stevie-Ray-CD drin. Verfluchter Mist. Zum Glück ist der Laptop zu Hause, sonst wäre der auch noch weg.“
„Ist ja ein Ding. Hast du gesehen, wer’s war?“
„Leider nicht. Muss zur Gendarmerie, die Sache melden. Hatte gestern keine Zeit“, spann ich die zurechtgelegte Geschichte fort.
Nachdem sich Benny für Einzelheiten interessiert hatte, wobei ich beim Ausspinnen geschickt Halbwahrheit und Lüge miteinander verknüpfte, machte er sich für den Schulweg bereit. Zuvor erkundigte ich mich, was in der Schule so abgehe. Benny erklärte mir, es gebe nichts Besonderes und er erwarte Mitte Februar ein gutes Zeugnis. Ich lobte ihn für seine Eigenständigkeit und gab ihm die moralische Weisheit mit auf den Weg, dass wir alle nun durch Vaters Tod mehr zupacken müssten als früher. Wahrscheinlich ging es ihm dabei wie mir einst, wenn ältere Familienmitglieder gut gemeinte Belehrungen von sich gegeben hatten: Die Botschaft erreichte ihn, wenn überhaupt, dann nur oberflächlich. Benny packte seine Pausenbrote ein und zog ab, ohne sich zu verabschieden.
Mein Bruder musste, wie ich früher, spätestens um Viertel nach sieben an der Bushaltestelle im Dorfzentrum stehen, damit er kurz vor acht unten beim Bundes-Oberstufen-Realgymnasium eintreffen konnte. Der Bus sammelt Gymnasiasten und einige Pendler aus Rotenstein auf, zwischendrin nimmt er Anwohner der abseits am Berg liegenden Weiler mit und zu den jeweiligen Stoßzeiten hinauf wie hinab Unmengen an Skifahrer. Heute sputete sich mein Bruder, weil wir uns beim Frühstück etwas verquatscht hatten.
Ob Mutter wach war, blieb nach Aufräumen der Frühstücksreste unklar. Von ihr war nichts zu hören. Ich hatte auch keine Lust, ihr nachzuspüren und von ihr angeraunzt zu werden, hinterließ deshalb nur auf einem Zettel eine Nachricht über geplante Aktivitäten. Dann steckte ich Einkaufstaschen in den Parka und suchte die örtliche Gendarmerie auf.
Gendarmerie wird die österreichische Polizei nur noch im Volksmund genannt als Überbleibsel der napoleonischen Teilbesatzung. Die ‚gens d’armes‘, also die armierten Männer, waren eine aus der Französischen Revolution hervorgegangene Militärtruppe. Seit der Gesetzesnovelle 2005 gibt es diesen Begriff offiziell nicht mehr. Stattdessen fungiert jetzt eine Landespolizei mit Bezirkskommandos und die mehr als siebenhundert nationalen Polizeiinspektionen.
Die Rotensteiner Außenstelle der Polizei hat meist mit kleineren Diebstählen rund um den Skizirkus zu tun oder mit Ladendieben und Raufereien unter angetrunkenen Gästen. Außerdem führen die Polizisten zum Ärgernis einiger Dorfbewohner und mancher Après-Ski-Löwen Verkehrskontrollen durch und überwachen die Sperrstunde. Wie alle Gasthäuser und Hotels war auch der Dorfkrug von ordnungspolizeilichen Maßnahmen betroffen, denn er hatte von unserer Gemeinde seit Gedenken die Erlaubnis zum Ausschank bis vierundzwanzig Uhr bekommen. Ab und an drohten zwar wechselnde Gemeinderäte damit, ihm die Sperrstunde auf zweiundzwanzig Uhr vorzuverlegen, wenn wieder einmal angetrunkene Gäste randalierten und Nachbarn die Gendarmen bemühen mussten. Da aber die Ratsmitglieder aus Gründen des Dorffriedens auch ab und an bei Alois anstießen, blieb es allerdings bei Ermahnungen.
Größere Kriminalfälle kamen dagegen nicht vor, zumindest nicht, solange ich denken kann. Es kursierten auch keine Geschichten darüber, und das soll auf dem Lande etwas heißen. Einzig meine Großeltern hatten vor langer Zeit von einem Eifersuchtsdrama mit Totschlag im Affekt berichtet. Das war es auch schon. Böse Zungen behaupteten sogar, der eine oder andere Gendarm würde in unsere Gemeinde strafversetzt, weil er hier optimal über seine Dienstvergehen meditieren könne, doch das hielt ich für ein Gerücht.
Ich trabte also zur Polizeidienststelle am Dorfplatz und meldete mein Auto als gestohlen an. Hinter dem Empfang saß Rosmarie, eine Polizistin der benachbarten Talschaft, die ich früher zu meinen intensiven Sportzeiten ab und an auf der Piste getroffen hatte.
„Grüß Gott, Rosi. Wie geht’s? Hab dich lang nicht mehr auf Skiern gesehen“, eröffnete ich das Gespräch mit einer Floskel, wobei ich geschickt meinen Handverband vor ihr verbarg, um nicht überflüssige Fragen zu provozieren.
„Heil Felix“, antwortete sie, „was gibt’s denn?“
Die historisch belastete Formulierung ‚Heil‘ ist keinesfalls mit dem Hitlergruß zu verwechseln und in einigen Gegenden bei uns üblich, absolut ohne politische Hintergedanken. Sie war von Rosi auch keinesfalls als Aufforderung gedacht, mich selbst zu kurieren, sondern drückte unsere freundliche Nachbarschaftsbeziehung aus.