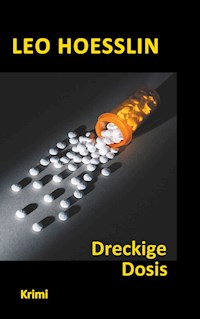Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Anführer einer Vorarlberger Gruppe von Tierschützern wird vor den Augen von Felix Moosburger erschossen. Mit seinem letzten Atemzug flüstert der Sterbende Unverständliches und drückt Felix einen Schlüssel in die Hand. Der erweist sich als Schlüssel zur Aufdeckung einer Schweinerei von internationalem Ausmaß. Felix und seine Freunde spüren dem Mord und dem ungeklärten Verschwinden weiterer Tierschützer nach. Riskante Operationen legen das Geschäftsgebaren international vernetzter Fleischhändler offen, die für ihre zum Himmel stinkenden Geschäfte nicht nur über Tierleichen gehen. Als die Verbrecher Felix enttarnen, ist sein Leben kein Kilo Faschiertes mehr wert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Tante Franziska
Inhaltsverzeichnis
Berufsrisiko
Blues
Buschwein
Berufspraktikum
Besserwisser
Beängstigend
Bio-Gambit
Beamtenbeleidigung
Befragung
Bussi
Besuch
Bertrand
Boulevard d‘Anvers
Belege
Bierbäuche
Biografisches
Beistand
Busenwunder
Beleidigt
Beiried
Besuch
Beamte
Beschattung
Bekannte
Beweise
Bio-Betrug
Blackbox
Beladen
Belohnung
Bestrafung
Böses Erwachen
Begraben
Bankrott
Boss
Beobachtet
Botschaft
Befreit
Buschwerk
Bestattung
Bestanden
Barbecue
1. Berufsrisiko
Zu fünft pirschten wir uns verstohlen an den Bauernhof heran. Trotz sternklarer Nacht ließ der halb aufgegangene Mond kaum Konturen erahnen. Hinter uns lag eine bewaldete Bergflanke, Ausläufer der westösterreichischen Alpen, über die wir uns in der letzten Stunde angeschlichen hatten. Mit jedem Schritt zeichnete sich das stockdunkle Gehöft deutlicher ab. Im Haupthaus brannte kein Licht. Nur dürftig ließ eine grüne Notfunzel das Gelände zwischen dem traditionellen Vorarlberger Bauernhaus und den etwa fünfzig Meter seitlich liegenden Stallungen erahnen. Von dort wehte uns der Nachtwind einen stechenden Gestank entgegen: Ammoniak mit undefinierbar modrigem Beigeschmack.
Karin räusperte sich kräftig, was ihr einen geflüsterten Rüffel von Rolf einbrachte: „Ich hab euch oft genug gesagt: Wem’s schlecht wird, der soll sich gefälligst ein Tuch mit Zitronensaft um die Nase binden.“
„Hab ich vergessen“, jammerte Karin.
Zoë war wieder einmal am härtesten von allen drauf und verpasste Karin eine volle Breitseite: „Wir hätten die Rookies nicht mitnehmen sollen. Sag ich das nicht von Anfang an? Am besten, du gehst gleich zurück und nervst hier nicht länger mit deinem Gezicke. Übrigens bin ich immer noch dagegen, dass der da weiter dabei ist.“
Zoë erreichte knapp die ein Meter sechzig, gab sich aber mit Kleidung und Gehabe am radikalsten und härtesten von der Gruppe, womit sie Rolf als deren Anführer mächtig unter Druck setzte. Mit der da meinte sie unmissverständlich mich, was mich im Moment allerdings nicht störte.
„Hier, nimm meines. Ich bin inzwischen daran gewöhnt.“
Sebastian, ein freundlicher Jüngling, der stets Karins Nähe suchte, hatte sich eingemischt. Er reichte ihr ein Tuch, das sie ungeschickt um Nase und Mund band.
Rolf sondierte den Bauenhof und wies uns an, ruhig zu blieben. Nach einigen Momenten der Sammlung und Beobachtung war dort nach wie vor alles ruhig. Niemand hatte unser Intermezzo mitbekommen. Als Rolf das Zeichen gab, weiter vorzudringen, wollte mich Zoë immer noch loswerden. Obwohl sie flüsterte, kam ihre Aggression klar herüber: „Ich finde, der da bleibt jetzt hier. Ab hier machen wir alleine weiter“, befahl sie nicht weniger barsch als zuvor.
Nun musste Rolf reagieren und gegenhalten, wollte er seine Führungsposition nicht verlieren. Bislang hatte er sich nämlich in der Frage, ob ich dabei sein durfte oder nicht, stets für mich eingesetzt. So, zu meiner Erleichterung, auch diesmal.
„Auf keinen Fall. Felix schreibt über uns, und das kann er nur korrekt machen, wenn er bis zum Schluss dabei ist. Ruhe jetzt!“
Mein Status war damit fürs Erste geklärt; wer weiß jedoch, wie lange er unangefochten Bestand haben würde. Mit abgeblendeten Taschenlampen leuchteten wir den Boden aus und näherten uns den Stallungen von hinten im Halbkreis, so dass uns die Bauten vor eventuellen Blicken aus dem Bauernhaus schützten. Sebastian spielte den Kameramann. Rolf organisierte alles und sorgte für Rückendeckung. Zoë hatte im Vorfeld das Objekt ausgespäht und dirigierte nun die Gruppe stringent zum Ziel. Karin war neu dabei und seit Kurzem fürs Schreiben und Dokumentieren zuständig. Ich gehörte nicht zu den Aktivisten, vielmehr waren sie nach einigen inquisitorischen Sitzungen mit mir als Angeklagtem letztlich bereit gewesen, sich als Fallstudie für meine Abschlussarbeit zur Verfügung zu stellen. In diesem Zusammenhang wollte ich einen ihrer Einsätze begleiten, um bis dahin gesammelte Eindrücke zu vervollständigen.
Hinter der Stallung wurde es ernst. Rolf gab die nächsten Schritte vor: „Wie besprochen: Eng am Stall nach vorn und alle hinein. Sebastian geht mit Zoë und Karin weiter und macht die Aufnahmen; Zoë und Karin leuchten ihm aus. Ich bleibe mit Felix vorne stehen, um zu sehen, ob ihr klarkommt oder uns braucht. Falls nicht, halten wir vor dem Tor Wache. Wenn jemand kommt, rufe ich euch, dann brecht ihr sofort ab, und wir schlagen uns hinter dem Stall durchs Gelände. Jeder einzeln und auf verschiedene Wege verteilt. Wird jemand geschnappt, hält er den Mund. Verrat bedeutet Ausschluss. Geht alles gut, treten wir ab, wie wir gekommen sind. Alles klar? Noch Fragen?“
Dem war nicht so, und so zogen wir im Gänsemarsch los: Zoë vorne. Ihr folgten Sebastian, Karin, Rolf und ich. Bereits hinter dem Stall war der Gestank bestialisch. Als wir das Scheunentor aufschoben und in den Stall schlichen, steigerte er sich um das Fünffache.
In diesem Moment wusste ich nicht, was mich mehr anwiderte, die olfaktorische Mischung aus ätzender Schweinepisse und Aasgeruch oder der erbärmliche Anblick. Eng gedrängt tummelten sich Dutzende von Schweinen in Betonpferchen auf durchgängigen harten Spaltenböden. Sie hatten keinen kotfreien Sonderplatz, konnten sich nirgends sauber hinlegen, was sie unbedingt müssen, weil der Betonuntergrund für ihre Hufe auf Dauer zu hart zum Stehen ist. ‚Dreckiges Schwein‘ ist ein unangebrachtes Schimpfwort, denn die intelligenten Tiere leben bei artgerechter Haltung sauber und sozial und wälzen sich nur unter den üblen Bedingungen einer Massentierhaltung im eigenen Kot, weil der durch die Spalten nicht richtig in den Boden sickert. Außerdem standen sie in diesem Stall dermaßen eng zusammen, dass ab und an kleinere Sauen und Ferkel erdrückt wurden. Doch auch ausgewachsene Tiere befanden sich in dem engen Pferch unter Dauerstress. Deren Hormone mochte ich nicht in meinem Schnitzel haben, soviel war bereits beim ersten Eindruck klar. Der Anblick der geschundenen Kreatur war selbst im gnädig verhüllenden Halbdunkel grauenhaft. Seitlich vorne, am Rand einer Box, lagen zwei Sauen. Eine schien längst gestorben zu sein. Auch die übrigen Tiere hinterließen einen arg mitgenommenen Eindruck.
Als wir näherkamen, wurde der Pulk zusehends unruhig. Das Quieken schwoll mächtig an, als Rolf und Zoë sich den Verschlägen näherten.
„Boaah, ist das eklig!“ Karin fiel ab und bemühte sich tapfer, das Abendbrot unter ihrem Zitronentuch zurückzuhalten, doch letztlich gewann der Kartoffelsalat. Zielstrebig flutschte er nach draußen.
Unbeeindruckt von Karins Brechanfall, begann Sebastian mit dem Dreh, wobei Zoë ihm leuchtete. Dabei fuhr sie Karin herrisch an, sich nicht so kleinmädchenhaft zu benehmen und gefälligst mitzumachen. Langsam schritten Zoë und Sebastian vor dem Betonknast für arme Schweine in die Tiefe der düsteren Stallung hinein. Karin tippelte ansatzweise hinterher. Es schien, als würde jeden Augenblick Hades auftauchen, um unsere Gruppe für immer in sein Reich zu entführen. Mir langte das jetzt. Im wahrsten Sinne des Wortes hatte ich die Schnauze von der Location voll. Hatte genug gesehen und gerochen, auch ohne die zigfache Sensibilität eines Schweinerüssels zu besitzen. Wie mussten dann erst die Tiere ihre erbärmliche Situation empfinden? Das Bild mit dem schändlichen Schweinepferch würde ich sowieso den Lebtag nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Im Moment versuchte ich nur, meinen Abgang einigermaßen würdevoll zu gestalten.
„Ich halte draußen Wache, wie geplant“, sprach ich unbestimmt in die Runde und schob mich durch den Torspalt auf den Hof. Die Luft vor dem Stall schien plötzlich sauber und klar wie im Hochgebirge, was mal wieder zeigt, wie adaptiv doch der menschliche Geruchssinn ist.
Eigentlich wollte Rolf mit mir Wache schieben, doch er kam nicht sofort hinterher, sondern erst ein bis zwei Minuten später. Vielleicht hatte er von Natur aus weniger Geschmacksknospen im Gaumen als ich. Inzwischen inspizierte ich das Bauernhaus durch ein Fernglas; alles war ruhig. Das Glas gehörte meinem Onkel väterlicherseits, der früher passionierter Jäger gewesen war und mir sein topmodernes Nachtsichtgerät für die gut bestandene Bachelor-Prüfung in Psychologie geschenkt hatte. Er meinte, er brauche es sowieso nicht mehr, und mir habe das gute Stück bereits hervorragende Dienste geleistet, also sei es bei mir besser aufgehoben. Ich fühlte mich mehrfach geehrt, zunächst, weil das Glas nicht gerade preisgünstig gewesen war, doch dann vielmehr, weil Onkel Jodok mir mit seinem noblen Geschenk eine enorme Anerkennung ausgesprochen hatte.
„Nichts zu sehen“, flüsterte ich Rolf zu.
Rolf antwortete per Daumen und Zeigefinger mit dem kreisrunden Okay-Zeichen der Taucher. Wir konnten uns bei der funzligen Notbeleuchtung des Hofs aus nächster Nähe kaum erkennen, denn vorsichtshalber ließen wir die Taschenlampen ausgeschaltet. Rolfs Zeigefinger deutete auf sich und nach rechts, ich sollte dagegen auf der linken Seiten des Stalls bleiben, dann schob er in seine Richtung ab und ich in meine.
Ich kam nicht ganz bis zur Ecke, als im Stall Geschrei laut wurde. Definitiv stammte es nicht von Schweinen. Soweit durch die Wand zu vernehmen, beteiligten sich mehrere Stimmen daran. Grelles Kreischen vermischte sich mit heftigem Gequieke der Säue.
Was war da los? Wegrennen oder nachsehen? Ich zögerte, weil wir abgemacht hatten, bei einer Entdeckung sofort einzeln zu flüchten. Der schrille Aufschrei ließ Schlimmes befürchten. Nachdem ich mich entschieden hatte, schlich ich an der Stallwand entlang zum Tor zurück. Just, als ich einen vorsichtigen Blick durch den Spalt werfen wollte, sprang Karin daraus hervor. Unsanft prallten wir mit den Köpfen zusammen, wobei Karin mir mit ihrer Taschenlampe unangenehm in die Pupillen strahlte.
„Nichts wie weg. Bloß weg hier!“
Karin flüchtete nach ihrem Ausruf auf kürzestem Weg links um den Stall herum, während sie den Boden vor sich ausleuchtete. Aus purer Neugierde schob ich dennoch meinen halben Kopf ins Innere. Weil ich durch Karin geblendet worden war, konnte ich aber nichts erkennen. Kein Laut war zu vernehmen.
Inzwischen gingen bereits im Bauernhaus Lichter an, und jemand trat aus der Vordertür. Zeitgleich erhellten Lampen an der Hauswand den zwischen uns liegenden Hof. Die Gestalt vor der Tür hielt einen längeren Stab in der Hand, der nicht nach einem Besenstiel aussah. Derartiges Gerät kannte ich von Onkel Jodok. Ein Warnschuss in die Luft bestätigte den Verdacht.
Restzweifel wurden brüllend beseitigt: „Macht, dass ihr von meinem Hof verschwindet, ihr Anarchisten! Der Nächste geht nicht mehr in die Luft, darauf könnt ihr wetten.“
Ich war und bin kein Anhänger von Bakunin. Allerdings stand mir in diesem Augenblick auch nicht der Sinn danach, das zu klären und mit dem Schweinezüchter staatsphilosophische Prinzipien zu diskutieren. Hurtig machte ich mich aus dem Schweinedreck.
Um nicht zu stolpern, musste ich notgedrungen die Lampe einschalten. Hoffte nur, der Kerl würde aus dem Licht heraus genauso schlecht ins Dunkel sehen, wie ich in den Stall. Hauptsache, ich kam schnell hier weg. Gerade als ich um die Ecke nach hinten ausbüchste, war mir, als ob sich Schatten aus dem Stalltor lösten. Egal, ich konnte mich jetzt nicht mehr um die anderen kümmern und verließ mich auf unsere Absprache, dass bei einer Entdeckung jeder selber sehen müsse, wie er ungeschoren davonkommt.
2. Blues
Alex wusste, es hätten mich keine zehn Schweine von meinem Vorhaben abbringen können. Eben deswegen hatte sie befürchtet, mir könne beim nächtlichen Einsatz etwas passieren, was beinahe wirklich der Fall gewesen wäre. Mit Alexandra Maria Wieblinger, so der Geburtsname meiner Freundin, war ich nun schon seit über drei Jahren liiert. Zwei davon lebten wir in einer Wohnung in der ersten Etage meines Elternhauses, einem Vorarlberger Bauernhaus das seit Generationen der Familie gehört. Alex hatte nie versucht, mir das Vorhaben auf der Schweinefarm auszureden, dafür ähnelten wir uns in unserer Sturheit zu sehr. Wir liebten uns aufrichtig und akzeptierten die Marotten des anderen, wobei wir wichtige Dinge durchaus kontrovers diskutieren konnten.
Mein aktuelles Interesse bestand darin, für die Master-Thesis eines Psychologiestudiums ein Fallbeispiel zu analysieren. Ich wollte Motivationen von Aktivisten mit besonderen gesellschaftlichen Ansprüchen beschreiben. Die Thesis sollte den schmalen Grat zwischen gerechtfertigtem Protest und kriminellem Überschwang ausloten. Sie sollte zeigen, was Menschen antreibt, sich kompromisslos einer Sache zu verschreiben und gegen Missstände, als ungerecht empfundene Gesetze, dubiose Personen und Windmühlen aller Art mit vollem Einsatz vorzugehen.
Um nicht nur eine literaturgestützte Arbeit zu verfassen, hatte ich Aktivisten gesucht, die bereit wären, sich anonym interviewen zu lassen und mich auf einen oder zwei ihrer Einsätze mitzunehmen. Über das Schneeballverfahren war ich dann an die heimischen Tierschützer geraten.
Zur Gruppe um Rolf hatte ich durch ein bäuerliches Netzwerk Zugang bekommen. Ein in der Landwirtschaft tätiger Cousin von einem Cousin eines Cousins kannte Rolf und wusste in etwa, was ihn aktuell so umtrieb. Zunächst hatte ich zwei Einzelgespräche mit Rolf geführt, wobei er mein Interesse und meinen Hintergrund abklopfte. Dem folgte ein unerquickliches Casting durch einen Teil der Aktivistengruppe, nur mit dem Unterschied, dass ich der einzige Bewerber der Talente-Show war. Die Ausfragerei war ziemlich nervig gewesen. Bereits dabei hatte sich Zoë einfallsreich hervorgetan und mich mit allerlei Äußerungen zu provozieren gesucht. Ich sei von der Schweinelobby als Schnüffelschwein geschickt worden, um die Truppe zu unterwandern. Als Mann sei ich prinzipiell ein Schwein, weswegen mir grundsätzlich nicht zu trauen sei, und so weiter und so fort. Weil Zoë durchgehend schwarz gekleidet war und verchromte Nieten auf der Lederjacke trug, entstand kurz der Eindruck, in der SM-Szene gelandet zu sein anstatt bei Tierschützern. Davon uunbeeindruckt ließ ich die Ausfragerei über mich ergehen. Sicher sagten Zoës Anfeindungen zu einem guten Teil auch etwas über sie selbst aus.
Schließlich hatte sich die Mehrheit für mein Volontariat ausgesprochen, weil sie sich davon ein positives Echo in der Bevölkerung erhoffte, quasi eine Art Marketing-Effekt. So hatte ich zunächst zwei Interviews mit Mitgliedern geführt, bevor ich zum ersten Mal einer nächtlichen Aktion auf einer Schweinezuchtfarm als stiller Beobachter folgen durfte. Da das unerlaubte Filmen in Stallungen trotz der ehrenhaften Absicht, Skandale aufzudecken, nichts Geringeres als Hausfriedensbruch darstellt, sah die Gruppe mein Beisein als Initiationsritus an. Diese Tierschützer unterschieden sich damit in keiner Weise von anderen Geheimzirkeln; den Aspekt wollte ich auf jeden Fall in meine Analyse einbauen.
Als ich von der misslungenen Aktion auf der Schweinefarm gegen fünf Uhr in der Früh zu Hause eintrudelte, wurde Alex unfreiwillig wach. Sie hörte das Wasser der Dusche rauschen, weil ich unbedingt zuerst den Mief loswerden wollte, bevor ich zu ihr ins Bett stieg.
„Alles klar soweit?“, murmelte sie schlaftrunken.
„Erzähle ich dir morgen. Komm, lass uns noch drei Stündchen schlafen.“ Damit gaben wir uns einen Gutenachtkuss und drehten uns auf die Seite. „Gute Nacht, Alex!“
„Gute Nacht, Felix!“
Unser letztes Studiensemester war überwiegend den Abschlussarbeiten gewidmet. Alex befand sich wie ich im vierten Semester des Masterstudiums Psychologie und schrieb ebenfalls an ihrer Thesis. Wir hatten uns im Bachelorstudium kennen und lieben gelernt, als wir mit Freunden und Verwandten üble Machenschaften aufgedeckt hatten, bei denen es um illegale Landkäufe und Schiebereien ging. Momentan absolvierten wir keine Präsenzveranstaltungen. Stattdessen stand der Abgabetermin Ende Juni vor Augen; also konnten wir unsere Tage einteilen, wie wir wollten.
Manch ein Student kommt mit der Freiheit, eine Master-Thesis anzufertigen, nicht so recht klar, da es bedeutet, zwischen März und Juni auf sich gestellt wissenschaftlich arbeiten zu müssen. Wer sich bis dahin im Studium mit Gruppenarbeiten und studentischer Hilfe durchlaviert hatte oder schlecht strukturiert und undiszipliniert war, kam dabei schnell ins Schleudern. Doch auch der Rest mühte sich ab, weil niemand zuvor eine derart anspruchsvolle Arbeit im Umfang von etwa hundert bis hundertzwanzig Seiten hatte anfertigen müssen. Obwohl vier Monate für eine Master-Thesis zunächst lang erscheinen, rinnt einem dabei die Zeit wie Wasser durch die Finger. Knappe Hilfestellungen sind höchstens vom betreuenden Professor zu erwarten. Mit ihm trifft man sich zwei bis drei Mal. Auf Basis der jeweiligen Sachlage bestand die professorale Hilfe jedoch meist aus kritischen Fragen, die im weiteren Verlauf eigenständig beantwortet werden mussten.
Beim Frühstück verklickerte ich Alex, was nächtens vorgefallen war. Wir frühstückten allein, denn meine Mutter und mein Bruder, mit denen wir im kleinen Bergdorf Rotenstein in einem Jahrhunderte alten Bauernhaus lebten – Mutter im Erdgeschoß, Bruder Benny unter dem Dach, wir dazwischen – waren abwesend. Benny ging unten im Tal aufs Gymnasium, wo er sich zur Zeit auf die Matura vorbereitete, Mutter arbeitete halbtags. Unser Vater war bereits vor Jahren im Gewitter umgekommen und fehlte uns überall. Mutters Eltern waren ebenfalls gestorben, und die Großeltern väterlicherseits wohnten weit entfernt. So lebten wir seit einiger Zeit recht zufrieden zusammen.
Alex war über den Vorfall auf der Schweinefarm ebenso perplex wie ich. Beim Frühstück riet sie, mich schleunigst mit Rolf in Verbindung zu setzen, was nicht so einfach war, weil wir uns nie bei jemandem getroffen hatten, und ich weder Adresse noch Telefonnummer eines Gruppenmitglieds besaß. Selbst das Eintrittsverhör und die Interviews hatten in freier Natur auf halber Höhe eines abgelegenen Berges stattgefunden. Dort würde nämlich Ende April kaum jemand hochwandern, weil ab zwölfhundert Höhenmetern noch Schnee lag. Also aktivierte ich die verwandtschaftliche Kommunikationskette, rief Cousin Reinhold an und bat ihn, seinen Cousin von damals zu fragen, ob er über die nächste Person den gewünschten Kontakt herstellen könne. Es sei äußerst dringend, weil ich mit Rolf jüngste Erlebnisse austauschen wolle. Da die Tierschützer ihre richtigen Namen nicht angaben, sondern nur ein Pseudonym, würde ich Rolf ohne Hilfe der Mittelsmänner nie wiedersehen.
Fünf Tage verstrichen ohne Lebenszeichen von ihm. In den Zeitungen war nichts von unserer nächtlichen Aktion zu lesen. Das verwunderte nicht, denn der ominöse Schweinemäster hatte bei den miesen Verhältnissen in seinem Stall garantiert kein Interesse daran, ins Licht der Öffentlichkeit zu geraten. Alex und ich schrieben dieser Tage an unseren Arbeiten, gingen höchstens zwischendurch zur Bibliothek der Fachhochschule, um Bücher zurückzugeben oder auszuleihen. Am sechsten Tag erhielt ich dann eine SMS. Rolf hatte mich auf ein Blueskonzert ins Montafon bestellt.
Höllenlärm. Die Schmerzgrenze war deutlich überschritten; die des guten Geschmacks dagegen lange nicht erreicht. Auf der Bühne mühte sich eine unbekannte Cover-Band, Rock- und Bluesklassiker nicht zu sehr zu verhunzen, was ihr nur bedingt gelang. Gary Moore würde heftig im Grab rotieren und sich in seinem Gitarrenkabel verheddern, wenn er posthum mitbekäme, was die Gruppe mit ‚Still got the Blues‘ Übles anzustellen wusste. Niemand war gnädig genug, Ohrstöpsel zu verteilen, also pfriemelte ich mir notdürftig Fasern eines Papiertaschentuchs in die Gehörgänge. Dann suchte ich Rolf im Publikum. Das sollte eigentlich nicht besonders schwer sein, da seine aufgeschossene Gestalt markant genug war und er außerhalb nächtlicher Aktionen stets in Jeans, T-Shirt und einer Jacke herumlief. Dieses Kriterium traf aber auf neunzig Prozent der Anwesenden zu, was die Suche sichtlich erschwerte. Also stellte ich sie ein, postierte mich in sicherer Entfernung von der Bühne in der Nähe des Eingangs und harrte der Dinge. Hier mussten wir uns am ehesten gegenseitig bemerken, allerdings nur, wenn Rolf tatsächlich kommen würde.
Einstein hatte wahrlich Recht: Zeit ist relativ. Je nach individuellem Standpunkt verstreicht sie unterschiedlich schnell. Für mich verstrich sie an diesem Abend relativ langsam. Wenn es eine Hölle für Bluesmusiker gibt, dann befand ich mich jetzt in ihr und durchlebte eine schier endlose Zeitschleife. Und ewig rauscht Provinzmucke. Uninspiriert nudelte die Band Stück für Stück herunter. Von denen hätte jeder mit seinem Instrument einen Hackklotz bearbeiten können, es wäre in etwa dasselbe dabei herausgekommen. Nachdem sie den Riff eines Songs über Rauch- und Feuerentwicklung am Genfer See asynchron runtergeschreddert hatte, verlor die Band jeglichen Respekt. Ungeniert vergewaltigte sie anschließend Jimi mit einer Anfängerversion von ‚Voodoo Chile‘, für die man in den USA in die Todeszelle gesperrt wird. Beim besten Willen war das nicht mehr auszuhalten, also strebte ich schleunigst nach draußen. Es war zwar Anfang Mai nachts immer noch kühl, aber im Freien deutlich angenehmer, als sich drinnen der Geschmacks- und Gehörfolter auszusetzen.
„Hallo Felix, komm mit!“
Wie aus dem Nichts schlug mir Rolf auf die Schulter. Permanent strömten Leute ein und aus, weswegen ich ihn nicht entdeckt hatte. Rolf trug tatsächlich seine Jeans-Kluft; unter der Jacke lugte ein schwarzes Shirt mit rotem Aufdruck hervor: ‚Nur Schweine quälen Schweine’. Rolf zog mich am Ärmel fort und verbreitete Hektik.
„Was ist los?“, fragte ich ihn, „wieso kommst du jetzt erst?“
„Nicht hier. Bist du mit dem Wagen da?“
„Ja.“
„Lass uns rasch damit abhauen.“
Forschen Schritts stürmte Rolf Richtung Parkplatz voran, schaute sich dabei permanent um, als ob ihn jemand verfolgte. Ich hastete an ihm vorbei und trabte zum Polo. Kaum steckte der Schlüssel im Zündschloss, trieb Rolf zur Eile:
„Mann, fahr endlich los.“
„Wo soll’s überhaupt hingehen?“, wollte ich wissen.
„Erst mal nur weg. Fahr Richtung Götzis.“
Dabei kontrollierte er durch die Heckscheibe das Treiben hinter uns, konnte aber nichts Verdächtiges entdecken. Ich schlug den Weg zur Autobahn ein und sprach zunächst kein Wort, Rolf würde schon von selbst damit rausrücken, was er von mir wollte. Doch er hielt sich ebenfalls zurück, was mich bei der Abfahrt nach Götzis dazu verleitete, das Gespräch aufzunehmen, denn schließlich wollte ich von ihm wenigstens ein paar Informationen über den Ausgang unserer nächtlichen Aktion einholen.
„Wo soll’s denn jetzt hingehen, und was ist aus der Sache neulich auf dem Hof geworden?“
„Hauptstraße, da wohne ich. Neben der Pizzeria. Ich zeig dir wo, wenn wir da sind. Zunächst immer der Zufahrtsstraße hier hinterher.“
„Und unsere Aktion von neulich?“
„Total in die Hose gegangen. Wir müssen vorsichtig sein. Ich erkläre dir alles, wenn wir bei mir sind.“
„Wie? Total in die Hose gegangen?“
„Ja. Sebastian und Zoë sind spurlos verschwunden. Melden sich nicht auf unser verabredetes Zeichen in der Social Community. Und ich habe auch keine analoge Info von ihnen bekommen. Eigentlich wollten sie mir die Aufnahme am nächsten Tag persönlich übergeben. Außerdem verfolgt mich jemand.“
„Konntest du jemanden erkennen?“
„Nein. Ist nur so ’ne Ahnung. Ich merke das an kleinen Dingen, die anders sind als sie sein sollten, zum Beispiel die Post. Da hat sich eindeutig jemand an meinem Briefkasten zu schaffen gemacht. Das Haar steckte nicht mehr im Türschlitz.“
Ich staunte nicht schlecht. Rolfs Misstrauen ließ ihn zu Methoden greifen, wie sie in Spionagefilmen vorkamen. Was hatte er zu befürchten und von wem? Auf einmal fuchtelte Rolf mit dem Zeigefinger:
„Vorne im Kreisverkehr rechts, und nach zweihundert Metern siehst du links die Pizzeria. Da kannst du irgendwo halten.“
Schräg gegenüber der Pizzeria parkte ich den Wagen in einer kleinen Lücke, in die er mit drei Rangierversuchen knapp hineinpasste. Rolf war zuvor aus dem Auto gesprungen. Noch bevor ich den Polo verlassen konnte, schritt er auf die befahrene Hauptstraße und strebte der anderen Seite entgegen. Drüben angelangt, blieb er stehen und winkte ungeduldig, endlich nachzukommen. Doch just nahm der Straßenverkehr auf meiner Seite wieder zu, und es gab keine Lücke, um ihm folgen zu können.
Immer, wenn ich die folgenden Sekunden rekonstruiere, fehlt mir der Beginn. Wahrscheinlich, weil ich mehr nach links schaute, um die nächste Möglichkeit zum Überqueren der Straße auszumachen und dadurch weniger auf Rolf achtete. Ich bekam nur noch zwei Schüsse mit, und wie auf der anderen Seite ein schwarzer Mercedes mit quietschenden Reifen Richtung Autobahn durchstartete. Da die andere Fahrbahnseite wegen einer Ampelphase frei war, kam der Mercedes schnell voran.
Rolf war nicht mehr zu sehen.
3. Buschwein
Meine Muskeln schalteten schneller als der Verstand. Im fließenden Verkehr enterte ich eine viel zu kleine Lücke und stoppte einen heranbrausenden Kleinwagen, der daraufhin saftig in die Bremsen stieg und quäkend hupte. Auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig versammelten sich bereits Fußgänger im Halbkreis und stierten auf den Boden. Auf Rolf, der breitflächig aus dem Oberkörper blutete. Alle gafften, keiner half – wie leider so oft. Ich schrie die Sensationssucher an, gefälligst die Rettung anzurufen und ihm zu helfen, was eine junge Frau beherzigte; sie griff zum Handy und funkte den Notruf an. Dann kniete ich mich neben Rolf nieder und legte meine Hand an seine Halsschlagader; sein Puls flatterte kaum spürbar. Rolfs Lebenssaft floss zügig aus ihm heraus und bildete bereits eine ausgedehnte Lache.
„Bschwsch.“
Rolf hatte die Augen leicht geöffnet und mir etwas zugezischt. Ich legte mein Ohr an seinen Mund, um ihn besser zu verstehen. Es kam kaum ein Flüstern daraus hervor.
„Buschwein.“
Das war das Letzte, was ich von Rolf vernahm. Mit seinem vorletzten Atemzug packte er meine Hand und führte sie zu seiner Jackentasche. Dann erschlafften Hand und Körper, Rolfs Kopf fiel auf die Seite und sein Schließmuskel versagte den Dienst. Meine Hand lag immer noch auf der Außentasche seiner Jeans-Jacke. Erst jetzt spürte ich etwas Hartes durch den Stoff. Mensch, garantiert wollte mich Rolf mit seiner letzten Geste darauf aufmerksam machen! Um nicht aufzufallen, wenn ich den Gegenstand herausnahm, musste ich die Umstehenden ablenken.
„Ich glaube, er ist tot. Sehen Sie denn die Rettung kommen?“
Während die meisten Köpfe reflexartig zur Seite ruckten, glitt meine Hand in seine Jackentasche und zog einen kleinen Schlüsselbund hervor, den ich unauffällig in der Faust hielt. Ein Idiot schoss Fotos mit der Handykamera. Rasch wendete ich das Gesicht ab.
„Wo bleibt nur die Rettung?“, rief ich, während ich mich vom Acker machte und durch die anwachsende Menschenmenge Richtung Pizzeria drängte.
Mehr und mehr Schaulustige strebten zum Tatort. Wie die Fliegen zum Aas. Ich strebte dagegen der Pizzeria entgegen. In einem der beiden anschließenden Häuser müsste Rolf nach eigener Aussage wohnen, also könnte ein Schlüssel vielleicht zu einer Haustür und einer Wohnung passen. Das musste ich sofort ausprobieren, bevor andere – Polizisten wie Verbrecher – auf dieselbe Idee kämen und Rolfs Wohnung aufsuchten.
Glück winkt manchmal auch dem Frechen. Bereits die erste Tür ließ sich mit einem von Rolfs Schlüsseln öffnen. Insgesamt hingen vier am Bund. Sie waren schnell durchprobiert. Ich betrat ein kleines Stadthaus mit zwei Etagen, das in ein Haus für drei Parteien umgebaut worden war. An den Briefkästen standen zwar Namen, ein ‚Rolf’ war jedenfalls nicht darunter. Ich setzte stark auf die Wohnung eines Gerald Mattikowski, denn die restlichen Namen klangen südländischer.
Mattikowski wohnte im Dachgeschoß, wie das Türschild verriet. Während aus den darunter liegenden Etagen fremdländische Musik und Stimmen in den Flur drangen, war vom Dachgeschoß nichts zu vernehmen. Vorsichtig inspizierte ich das Schlossfabrikat. Der dazu passende Schlüssel am Bund funktionierte. Beim Aufschließen war mir unwohl in meiner Haut, denn es konnten sich gefährliche Leute in der Wohnung aufhalten. Dass nicht alle Zeitgenossen den Tierschützern wohlgesonnen waren, bewies der Mord an Rolf. Selbst, wenn nicht gerade weitere Mörder anwesend waren, wollte ich radikalen Tierschützern in diesem Moment auch nicht gerade begegnen. Doch alles schien ruhig und still.
Leise betrat ich die Dachwohnung und zog die Eingangstür zu, wobei ich tunlichst vermied, Fingerabdrücke zu hinterlassen. In einer kombinierten Einheit von Wohnraum und Küche mit Dachschräge zweigten zur Rechten zwei weitere Türen ab. Um sicherzugehen, musste ich wohl oder übel nachsehen, ob sich jemand in den angrenzenden Räumen befand. Hinter der ersten Tür verbarg sich eine kleine Duschkabine mit Toilette und Waschbecken, hinter der zweiten ein Schlafzimmer, alles recht überschaubar. Definitiv war niemand außer mir in der Wohnung, somit konnte ich sie genauer durchsuchen.
Sofort fielt das karge Ambiente auf. Die kleine Bude unter dem Dach vermittelte kaum den Eindruck, hier würde jemand gemütlich zu Hause sein, selbst wenn ich andere Maßstäbe an behagliches Wohnen anlegen würde als die eigenen. Kein Foto zierte die Wand, keine Pflanzen waren aufgestellt, kein Gegenstand verwies auf ein Hobby. Anscheinend las der Bewohner noch nicht einmal Zeitschriften oder Bücher. Das konnte es doch nicht sein, oder? Wozu, außer zum Schlafen, benutzte Rolf diese Wohnung? Systematisch öffnete ich die wenigen, in die Dachschräge eingebauten, Unterschränke, inspizierte sogar die Küchenzeile. Dabei nutzte ich ein herumliegendes Küchenhandtuch als Schutz vor Fingerabdrücken. Doch außer Geschirr, Töpfen und Kleidungsstücken fand ich nichts Besonderes. Also durchsuchte ich das Schlafzimmer, klopfte überall Wände und Böden auf eventuelle Hohlräume ab. Nichts.
Der Spülkasten im Bad war hinter Fliesen eingebaut, was mich einige Nerven kostete, bis ich ihn erfolgreich freigelegt hatte. In diesem klassischen Versteck fand ich nichts außer Wasser, das berechtigterweise darin gespeichert war. Fündig wurde ich erst unter der Duschkabine. Eine Doppelfliese am hinteren Rand der Duschwanne war lose und ließ sich mit etwas Geschick aus der Einfassung lösen. Ohne Angst vor Schlangen oder Ratten langte ich mit dem Unterarm in den Hohlraum und zog ein in Plastik eingepacktes Gerät hervor. Dessen Funktion erschloss sich sofort: Es war ein Tablet mit Netzstecker. Nun nichts wie weg von hier.
Lalü-Lalü, Lalü-Lalü – die Sirenen der Einsatzfahrzeuge waren nicht zu überhören. Vom Dachgeschoß aus war die Hauptstraße leider nicht einzusehen. Weil ich die Lage nicht einschätzen konnte, riet mir mein Unbehagen, schnellstens zu verschwinden. Im Flur zog ich die Wohnungstür zu und schlich möglichst leise nach unten. Jemand musste mich trotzdem gehört haben, denn als ich auf dem Absatz zwischen der mittleren und der unteren Etage war, öffnete sich hinter mir die Wohnungstür. Eine Männerstimme schrie durch den Flur.
„He! Was machen da?“
„Merhaba! Bugün hava çok güsel“, antwortete ich mit kehliger Aussprache.
Das ist so in etwa der einzige zusammenhängende Satz, den ich auf Türkisch einigermaßen originalgetreu von mir geben kann. Er besagt nicht mehr oder weniger, als dass heute sehr schönes Wetter sei. Ich hoffte, der Ausspruch würde reichen, um den Mann auf der Treppe über mir für einen Moment zu verblüffen und hüpfte die Stiege hinunter. Von seinem lauten türkischen Redeschwall, den er mir hinterher rief, verstand ich kein Wort. Inzwischen musste auch der letzte Schläfer in diesem Haus aufgeweckt worden sein. Nun nichts wie weg, bevor noch die gesamte Gemeinde auf mich aufmerksam werden würde.
Auf der Straße wandte ich mich sofort nach links, weg von der Szene, die inzwischen von Feuerwehr, Rettung und Polizei dominiert wurde. Die Polizei war gerade dabei, den Tatort mit ihrem Einsatzband abzusperren. Zwei Polizisten forderten die Gaffer auf, weiterzugehen und die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern. Das passte bestens. Ich lief etwa hundert Meter in Richtung Dorfmitte weiter, querte die Hauptstraße, stiefelte den Weg auf der anderen Seite zurück und schwang mich in den Polo. Nach drei Rangierversuchen kam ich frei und setzte mich unauffällig ab.
Eine knappe Stunde später trudelte ich zu Hause ein, wieder weit nach Mitternacht. Dieses Mal gelang es mir, Alexandra nicht zu wecken. Dass der anschließende Nachtschlaf wenig erquickend war, lag sicher nicht an einem überfüllten Magen.
„Aufstehen, Faulpelz! So wird es nie was mit deiner Master-Thesis. Los, raus aus den Federn. Ein bisschen hoppla!“
Die Stimme meiner Herrin weckte mich streng, als ich gerade dabei war, einen wilden Elefanten zuzureiten. Das störrische Tier versuchte mich andauernd abzuwerfen. Bei solch einem gefährlichen Ritt würde ich doch niemals schlafen! Wie kam sie nur darauf? Es dauerte einige Sekunden, bis stattdessen ich darauf kam geträumt zu haben. Die Stimme war aber real; sie holte mich widerspenstig in die Wirklichkeit zurück. Alex hockte neben dem Bett und brachte die Matzratze mit den Unterarmen in Schwingung, was die Wildheit des Elefantenritts erklärte. Auf Rückfrage versicherte sie mir, es sei bereits zehn Uhr und selbst für begnadete Studenten langsam Zeit, ihren üblichen Tagesrhythmus zu starten.
Als erstes griff ich unters Bett, um mich zu vergewissern, die Ermordung von Rolf nicht geträumt zu haben. Dem war leider nicht so, denn das Tablet befand sich nach wie vor dort, wo ich es vor dem Einschlafen deponiert hatte. Als zweites folgte die Morgentoilette und als drittes das gemeinsame Frühstück, bei dem ich Alex von meinem Erlebnis in der letzten Nacht berichtete.
Bereits in der Mitte der Geschichte fuhr mich meine Freundin entsetzt und vorwurfsvoll an: „In was bist du denn da schon wieder hineingeraten?“
„In gar nichts“, versicherte ich ihr, „verstehe überhaupt nicht, was das soll. Tierschutz kann kaum ein Menschenleben wert sein, selbst wenn Tierschützer illegal in Scheunen einsteigen.“
„Anscheinend doch“, meinte Alex. „Hast du eine Ahnung, warum jemand Rolf auf offener Straße abknallt?“
„Wenn ich das wüsste, hätte ich die Täter“, meinte ich zu ihr. „Aber ich habe sein Tablet erbeutet, vielleicht finden wir darauf eine Antwort. Sonst hätte er es doch nicht so aufwendig unter der Dusche versteckt. Außerdem heißt er nicht Rolf, sondern wahrscheinlich Gerald Mattikowski. Schätzungsweise geben sich alle Tierschützer einen Decknamen.“
„Na, was sabbelst du dann hier noch rum? Lass uns lieber das Gerät unter die Lupe nehmen.“
Das liebte ich an Alex: Sie strebte immer vorwärts und war sofort engagiert dabei, wenn es darum ging, eine knifflige und herausfordernde Aufgabe zu lösen. Während meine Freundin Essenskram beiseite räumte, brachte ich das Tablet zum Frühstückstisch und schloss es ans Stromnetz an. Nach dem Einschalten poppte eine Eingabemaske auf. Im Hintergrund entfaltete sich eine idyllische Landschaft: hügelige Wiesen im saftigen Kerrygold-Grün, auf denen die glücklichsten Kühe der Welt weideten. Die Maske zierte eine Eingabezeile und darüber ein Willkommensspruch: ‚Wer das gekreuzte Schwein eingibt hat Schwein’.
„Was ist das für ein Quatsch?“ Alex schüttelte den Kopf.
„Schätze, das ist ein Hinweis darauf, in die Zeile das Passwort einzugeben“, sagte ich. „Und ich habe schon eine Idee. Hab dir doch eben erzählt, dass mir Rolf – oder meinetwegen Gerald, wenn das seine wahre Identität ist – quasi mit dem letzten Atemzug etwas ins Ohr geflüstert hat.“
„Ja, und?“
„Ich denke, das war das Passwort. Etwas anderes macht für mich keinen Sinn, vor allem zusammen mit dem Hinweis auf die Schlüssel.“
„Du erinnerst dich hoffentlich, wie das Wort heißt?“
„Klar. Bin doch nicht blöd. ‚Buschwein’ hat er deutlich gesagt – geflüstert, wenn ich’s genau nehme. Aber Buschwein habe ich trotzdem deutlich gehört. Ich gebe das jetzt ein. Soll ich? Ich finde nur, das macht wenig Sinn – es gibt keinen Wein, der an Büschen wächst, und Holunder wird er nicht damit gemeint haben. Oder nennen die Weinbauern ihre Reben neuerdings Büsche?“
„Ist doch egal“, meinte Alex, „ist doch nur ein Passwort. Kann doch nichts passieren, wenn das Wort falsch ist.“
Also gab ich frohen Muts das Wort ein. Nur, um damit vor demselben grünen Hintergrund einen neuen Text heraufbeschworen zu haben: ‚Da waren’s nur noch zwei … ei, ei’.
Ich schrie auf: „Was ist denn das für ein Mist? Ich denke, da kann nichts passieren? Jetzt haben wir garantiert nur noch zwei Versuche übrig. Und wer weiß, was passiert, wenn alle Versuche ungültig sind.“
„Sorry, das konnte ich wirklich nicht ahnen.“ Alex reagierte inzwischen reservierter und sichtlich konsterniert. „Es macht keinen Sinn, einfach weitere Wörter auszuprobieren. Lass uns lieber an dem ersten Hinweis herumknobeln. Wie lautete der noch mal?“
Ich grübelte: „Äh … Wer Schwein hat … nein, warte. Wer Schweine gekreuzt hat, hat Schwein gehabt. Oder so ähnlich.“ Mein Kurzzeitgedächtnis war auch nicht mehr das Beste.
Alex erinnerte sich konkreter: „Nein, so hieß das nicht. Wir hätten uns das aufschreiben sollen. Es hieß so ähnlich wie: Wer das Schwein …, nein, das gekreuzte Schwein ... Jetzt hab ich’s: Wer das gekreuzte Schwein angibt hat Schwein.“
„Eingibt“, korrigierte ich. „Es muss ‚eingibt’ heißen. Wer das gekreuzte Schwein eingibt hat Schwein. Das ist es. Ist das irre. Der Typ ist ja total abgedreht … war.“
„Sollen wir ‚Jesus’ eintippen?“ Alex’ Synapsen drehten Kapriolen.
„Ich weiß nicht. Rolf schien kein radikal-faschistoider Islamist zu sein. Ist auch sprachlich zu weit hergeholt – es müsste dann ja ‚gekreuzigte’ heißen. Außerdem denk dran: Wir haben nur noch zwei Versuche und wissen nicht, ob wir überhaupt einen weiteren Anlauf starten können.“
„Ich tippe jetzt ‚Jesus’ ein.“
Manchmal handelt Alex genauso verbohrt wie ich, was uns gegenseitig durchaus sympathisch war. Ein Streit mit ihr war in der Situation aber völlig sinnlos, ich würde ihn auf jeden Fall verlieren. Außerdem lohnte der emotionale Aufwand nicht für dieses läppische Lebensdetail, also schob ich das Tablet hinüber: „Bittesehr.“
Und Alex tippte.
„Ach, du ahnst es nicht!“ Meine Freundin schlug die Hände vor dem Mund zusammen und blickte starr auf den Bildschirm.
Ich lugte über ihre Schulter. Nun hatte sich ein neuer Spruch auf der grünen Wiese entfaltet: ‚Achtung: Die Festplatte formatiert sich automatisch bei der nächsten Fehleingabe. Anscheinend hatten Sie bis jetzt nicht das richtige Schwein. Übrigens: Eine Stromunterbrechung bewirkt bei Neustart denselben Effekt.’
4. Berufspraktikum
Minutenlang saßen wir wie bedrömmelt am Küchentisch und stierten wortlos auf das Tablet.
„Alfi!“, rief Alex plötzlich aus.
„Du sagst es!“
Alfons Winterstein, genannt Alfi, konnte uns in dieser verzwickten Situation garantiert helfen. Er war uns zum guten Freund geworden, den man einfach nehmen musste, wie er sich gab, ansonsten wäre der Umgang mit ihm kaum auszuhalten. Alfi hatte sich auf Software aller Art spezialisiert, und das durfte wörtlich genommen werden. Früher war nicht jede Aktion von ihm koscher gewesen. Seit er mit einem unserer Freunde an einer Geschäftsidee arbeitete, bekamen wir den Eindruck, er würde häufiger auf dem Pfad der Tugend wandeln als je zuvor. Wenn überhaupt jemand eine Lösung für dieses Passwortproblem parat hätte, dann sicher Alfi. Also riefen wir ihn an und hinterließen eine Bitte um Rückruf auf seiner Mobilbox, weil er mal wieder auf der Suche nach fremden Lebensformen unerreichbar im Kosmos der Bits und Bytes unterwegs war.
Da Alfis Rückruf Tage später eintrudeln konnte, sicherten wir zunächst das Tablet. Wir stellten es auf das Nachtkästchen neben unserem Doppelbett, steckten den Stecker in die Dose und klebten einen mit dickem Filzstift beschriebenen Zettel darauf, der darum bat, das Ding weder zu berühren, noch darum herum Staub zu wischen oder den Stecker zu ziehen. Den Rest des Tages verbrachten wir mit Schreib- und Lesearbeit. Mutter kam nachmittags nach Hause, Benny etwas später. Wir baten sie, auf dem Nachtkasten nicht den Stecker oder das Tablet zu berühren, weil eine falsche Eingabe unwiderruflich Daten löschen würde. Falls ich gemeint hatte, unsere Bitte würde unhinterfragt befolgt werden, hatte ich mich geschnitten. Mutter kannte mich zu gut und wurde hellhörig:
„Was brütest du aus? Ich hoffe, es ist nicht gefährlich.“
Weil ich sie und Benny nicht in die Sache hineinziehen wollte, versuchte ich es mit einer Ausrede:
„Iwo. Es ist nur ein Tablet von einem Kollegen. Bei der nächsten Falscheingabe werden alle Daten gelöscht. Bis ich das Passwort besorgt habe, darf nichts eingegeben oder abgeschaltet werden.“
Doch Mutter war nicht so einfach beizukommen. Vielleicht ahnte sie etwas, doch gottlob sie vertiefte sie das Thema nicht. Stattdessen legte sie den Tagesanzeiger auf den Tisch und fragte, ob wir ihn lesen wollten. Außer Mord und Totschlag in aller Welt, und neuerdings auch bei uns im Ländle, stünde wieder nichts Vernünftiges darin. Um ihr nicht auf den Leim zu gehen, wiegelte ich ab und sagte, sie könne das Ding zum Altpapier bringen. Alex und ich würden lieber den restlichen Nachmittag nutzen und eine Fitnesstour ins Maisäß – der traditionellen Berghütte auf mittlerer Almhöhe – unternehmen.
Auf unserem Power-Walk zur Almhütte stritten wir zum ersten Mal in unserer Beziehung kurz und heftig miteinander. Alex wollte mich überreden, die Feldstudie sausen zu lassen und das Einverständnis der betreuenden Professorin einzuholen, eine literaturgestützte Arbeit zu schreiben. Einerseits seien zwei Interviews viel zu wenig für eine Master-Thesis. Andererseits würde der Mord an Rolf oder Gerald, oder wie er nun hieß, und das Verschwinden der beiden anderen Aktivisten darauf hinweisen, dass da wirklich eine gefährliche Sache abging.
Ich wollte natürlich längst nicht aufgeben, schrie, es sei noch immer meine Sache, ob und wie ich meine Masterarbeit schreibe. Ich würde mich in ihre Arbeit auch nicht einmischen. Die sei im Gegenteil zu meiner völlig harmlos, giftete sie zurück, welche Mörder interessierten sich denn schon für psychische Aspekte von Betriebsräten in Unternehmen. Eine ganze Menge, pflaumte ich sie an, sie habe wohl noch nie von mafiösen Strukturen bei den Gewerkschaften amerikanischer Firmen gehört.
Widerworte wechselten wie Bälle im Tennismatch, doch irgendwann fanden wir unseren Disput nur noch lächerlich und schraubten langsam die emotionale Anspannung herunter.
„Ich habe doch nur Angst um dich“, schlug meine vernünftige Freundin als erste einen versöhnlicheren Ton an.
„Ich weiß“, stimmte ich ein, „werde schon aufpassen. Versprochen. Psychologenehrenwort!“
Dann klammerten wir uns aneinander wie in den ersten Tagen und marschierten nach einer längeren Umarmung zügig bergan. Während der Wanderung sprachen wir wenig, weil das Gehtempo einigermaßen ambitioniert war. Bei der körperlichen Beanspruchung gelang es mir, Gedanken zu sammeln und Erlebnisse zu rekapitulieren. Mir war, als ob ich in diesem Zusammenhang etwas übersehen hatte. Nach einer Weile fiel es mir ein: Richtig! In meiner anderen Jacke steckten noch Rolfs Schlüssel. Vier verschiedene hingen an seinem Bund. Zwei schlossen das Stadthaus und die Wohnung auf. Welche Funktion die beiden anderen besaßen, musste ich unbedingt herausfinden. Ich war es Rolf einfach schuldig, die Hintergründe seiner Ermordung aufzuklären.
Für mich blieb der Ermordete ‚Rolf’, auch wenn er wahrscheinlich anders hieß. Rolf war ein engagierter Zeitgenossen gewesen, der etwas zur Weltverbesserung beitragen und Skandale aufdecken wollte. Das fand ich überaus ehrenhaft, wenngleich seine Methoden nicht immer offiziellen Regeln folgten. Mit Sicherheit waren Rolf und ich in diesem Punkt seelenverwandt; vielleicht hatte er das gespürt und sich unter anderem deshalb stark für mich eingesetzt. Außerdem war er als Anführer der Tierschützer immer um Ausgleich zwischen Hardlinern wie Zoë und den anderen bemüht.
Als Erstes wollte ich Rolfs wahre Identität herausbekommen, obwohl die Antwort auf der Hand lag. Dann war die Frage mit den beiden restlichen Schlüsseln zu klären und, nicht als Unwichtigstes, die mit dem vermaledeiten Passwort. Unklar blieb weiterhin, wohin Zoë und Sebastian verschwunden waren. Es gab also viel zu recherchieren, ich wollte nur noch wissen, ob Alex weiter dabei sein würde oder nicht, und ob sie mir trotz berechtigter Sorge die Absolution zum Weitermachen erteilen würde. Denn ohne ihren Zuspruch könnte ich nur mit gebremster Kraft agieren oder müsste das Vorhaben sogar aufgeben. Auf der Panoramabank im Vorsäß sprach ich meine Freundin darauf an.
„Jetzt mal Hand aufs Herz, Alex: Ich weiß, dass du dich sorgst, und deine Sorgen sind berechtigt. Rolf ist in meinen Armen gestorben, und die Schlüssel und das Tablet sind so etwas wie sein Vermächtnis. Er wollte mir sowieso an dem Abend etwas Wichtiges mitteilen, wozu er nicht mehr kam. Es geht doch dabei nicht allein um meine blöde Thesis …“
Alex unterbrach mich sanft und legte ihre Hand auf meinen Unterarm: „Ist schon gut, Felix. Dein Gerechtigkeitsgefühl, gepaart mit dem für dich typischen Eigensinn, verbietet dir natürlich, mit allem zur Polizei zu gehen. Wie sollte es anders sein? Hinzu kommt in diesem speziellen Fall noch dein besonderes Erlebnis mit Rolf. Ich kann das gut nachvollziehen.“
„Und was heißt das für dich?“
„Kannst du dir doch denken, Schatz. U-W-S.“
„Wie bitte?“
„United we stand – divided we fall. Steht auf irgendeiner Zigarettenpackung, glaube ich.“
„Ich dachte, da steht nur drauf, wie schnell man abnippelt, wenn man das Kraut pafft. Heißt das, du stehst hinter mir?“
„Neben dir, voll und ganz. Hinter dir wäre nicht fair, wenn du am Abgrund stehst. Soll heißen, ich bin dabei und unterstütze dich, soweit ich kann. Weil wir zusammengehören. Du kannst aber nicht von mir verlangen, bei gefährlichen Sachen mitzumachen. Ich wünsche mir nur, dass du immer gut auf dich aufpasst.“
„Versprochen! Und: Danke vielmals, meine Liebe!“
Nachdem wir eine Weile händchenhaltend die wunderschöne Aussicht ins hintere Tal genossen hatten, machten wir uns auf den Heimweg. Der Abend verlief angenehm mit einem Abendessen zu viert – heute gab es kalte Platte mit Gürkchen und Tomaten, dazu ein kühles Bier – und mit Gesprächen über den Tag. Danach verzog sich jeder in seine eigene Welt. Alex und ich wollten ausnahmsweise früh zu Bett gehen, weil zumindest ich vom Schlafmangel und der Tour rechtschaffen müde war. Zuvor klaubte ich im Stadel den heutigen Tagesanzeiger aus dem Altpapierkorb.
Tatsächlich wurde der Anschlag auf Rolf im Lokalteil ausgeschlachtet: ‚Wer erschoss Gerald M. in Götzis?’ stand dort zu lesen. Unter der Schlagzeile fand sich eine kühle Schilderung des Sachverhalts, gespickt mit einem etwas heißeren Begleitkommentar aus Sicht eines reaktionären Wutbürgers, dessen normativen Ausbrüchen ich zumindest ansatzweise etwas abgewinnen konnte. Ansonsten wartete die Presse mit keiner neuen Information auf, doch der Artikel klärte eindeutig Rolfs Identität.
Im Bett knobelten wir an seinen zwei verbliebenen Schlüsseln herum. Einer war klein und flach mit üblichen Bartzacken, der zweite deutlich größer, massiver und ebenfalls flach, mit kleinen Einkerbungen am Rand und wurmstichig anmutenden Riefen und Kerben auf beiden Flachseiten. Damit schienen wir einen Sicherheitsschlüssel für eine Tür und einen für etwas Kleineres in der Hand zu halten. Da mich eine ungelöste Aufgabe stets juckt, schaute ich kurz die beiden Marken im Internet nach. Demnach wies der Sicherheitsschlüssel topmoderne Technologie auf. Er konnte nur vom Hersteller durch Spezialmaschinen nachgemacht werden. Außerdem durfte nur der über eine Codekarte legitimierte Besitzer einen verlorengegangenen Schlüssel nachmachen lassen. Diese Technik kam in Gebäuden ebenso zum Einsatz wie bei Sicherheitsschränken, die knapp unterhalb der Liga eines Tresors fungierten. Der kleine Schlüssel schien dagegen eine Kassette aufzuschließen.
Jetzt musste ich nur noch an Milliarden Türen dieser Welt den größeren der beiden Schlüssel ausprobieren, bis sich eine davon öffnen ließ. Sollte ich in Mexiko City anfangen, oder wäre Neu Delhi günstiger? Vielleicht hatten die beiden Schlüssel überhaupt nichts miteinander zu tun, und ich brauchte nur Trilliarden von Schmuck- und Geldkassetten zu überprüfen. Oder der Weihnachtsmann hatte die Schlüssel zu seiner geheimen Spielzeugwerkstatt im nicht mehr ganz so ewigen Eis über dem Nordpol auf einer Schweinemastfarm in Vorarlberg verloren, und es gibt einen opulenten Finderlohn, mit dem ich für den Rest des Lebens ausgesorgt hätte. Mit derart schrägen Gedanken schlief ich erschöpft ein.
Am nächsten Tag war ans Weiterschreiben an der Master-Thesis natürlich nicht zu denken. Während Alex brav an ihrer Arbeit werkelte, versteckte ich den Schlüsselbund in einem alten Wandversteck unseres Schlafzimmers hinter einer hohlen Täfelung. Nun zum schwierigeren Teil: Ein Blick in die Landkarte und ins Telefonbuch verriet Adresse und Namen des Schweinezüchters, auf dessen Farm unser Fiasko begann: Emil Trittke. Um etwas über die Vorkommnisse von neulich in Erfahrung zu bringen, wollte ich mich auf dessen Bauernhof ein wenig umsehen, diesmal allerdings auf legalem Wege. Ich musste nur noch am Computer meine Legende vorbereiten, dann konnte ich auf der Schweinemastfarm anrufen und dem Züchter auf den Zahn fühlen.
„Grüß Gott! Moosburger, Alois. Bin ich mit Herrn Emil Trittke verbunden? Fein. Hätten Sie einen kurzen Moment Zeit für mich am Telefon? Ich hab da ein spezielles Anliegen. Und zwar studiere ich Agrarpädagogik in Wien und bin auf der Suche nach einem Praktikumsplatz in der Landwirtschaft.“ Pause. „Agrarpädagogik bereitet auf das Lehramt in land- und forstwirtschaftlichen Berufsschulen vor. Und in dem Zusammenhang müssen wir ab nächster Woche ein zweiwöchiges Berufspraktikum zur Orientierung bei einer Landwirtschaft eigener Wahl absolvieren. Unbezahlt.“ Pause. „Ja, ja, ich bin Vorarlberger und selber in der Viehwirtschaft groß geworden. Interessiere mich für Ihren Betrieb.“ Pause. „Kühe – bis zum Tag als mein Vater starb, da hab ich täglich mitgeholfen.“ Pause. „In Rotenstein.“ Pause. „Moosburger, Alois. Sohn vom Babeles Dünser Josef. Ich bin zur Abwechslung an der Schweinezucht interessiert und würde mich Ihnen gerne persönlich vorstellen, wenn Sie überhaupt Interesse haben.“ Pause. „Das ist sehr nett von Ihnen. Ginge es denn heute noch?“ Pause. „Fein, dann komme ich abends kurz vorbei.“ Pause. „Übers Internet. Ich wollte unbedingt in Vorarlberg bleiben und einen renommierten Großbetrieb kennenlernen.“ Pause. „Ebenfalls. Pfüeti.“
Ich wählte den zweiten Vornamen für die Legende, weil mich dann der Züchter vielleicht nicht sofort zuordnen konnte, denn durch eine Aufdeckungsgeschichte vor drei Jahren war ich eine Zeitlang im Land bekannt gewesen wie Lady Gaga. Prima! Ich hatte tatsächlich ein Vorstellungsgespräch bewirkt. Sollte mein Plan aufgehen, würde ich zwei Wochen auf der Schweinefarm arbeiten und hinter die Kulissen gucken. Vielleicht gab es dort sogar Schlösser, zu denen der Sicherheitsschlüssel passte.
Ich informierte Alex über den Erfolg und schrieb bis um drei Uhr an meiner Arbeit weiter. Zwei Stunden später machte ich mich auf den Weg zur Schweinezüchterei.
Trittke war nicht unbedingt der Größte seiner Art. Bei der Show ‚Sei dein Geschichtsvorbild’ hätte er mit einem quer aufgesetzten Zweispitz und einer Hand unter der Jacke die Konkurrenz locker aus dem Feld geschlagen. Im Unterschied zu Napoleon trat er jedoch eine Spur bescheidener auf. Trittke bat mich in die Küche des Hauses, wie es bei Besuchen zweiter Ordnung üblich ist, und bot mir etwas zu trinken an. Ich spulte mein Garn ab. Er stellte Rückfragen nach meiner Herkunft und Erfahrung mit der Viehhaltung, die ich wahrheitsgemäß und anscheinend zur Zufriedenheit beantwortete. Dann verlangte er Hintergrundinformationen zum Berufspraktikum, die ich ihm anhand meiner Vorbereitung bestens liefern konnte. Der Schwindel würde nicht auffliegen, denn wegen des Datenschutzes gaben die Unis keinem Außenstehendem Informationen zu ihren Studenten heraus, das wusste ich von unserer Fachhochschule.
Mit berühmter Handschlagqualität besiegelten wir mein Berufspraktikum in der Schweinezucht ab kommendem Montag um sechs Uhr in der Früh. Handschlagqualität gehört in unserem Land zum alemannischen Kulturgut; sie bezeichnet eine verbindliche mündliche Absprache, die mit Handschlag besiegelt und von beiden Parteien eingehalten wird. Obwohl Handschlagqualität stets von allen verbal hochgehalten wird, existieren doch hier und dort Zeitgenossen, denen sie nicht wirklich etwas wert ist und die sie getreu dem Motto: ‚Was schert mich mein albernes Geschwätz von gestern?’ beliebig brechen, wenn es dem eigenen Vorteil dient. So musste zum Beispiel ein guter Bekannter meines Onkels Jodok vor vielen Jahren die üble Erfahrung machen, einen politisch zugesagten Job (‚auf unser Wort kannst du dich felsenfest verlassen’) nicht zu erhalten, weil ein paar graue Eminenzen hintenherum erfolgreich ihren destruktiven Einfluss an oberster Stelle geltend machen konnten. Bereits als Knabe lernte ich durch diese oft wiederholte Erzählung eine grundlegende Lektion: Auf Menschen ist nur begrenzt Verlass – und auf machtbesessene nie.
Nach dem Deal mit dem Schweinezüchter verabschiedete ich mich höflich von meinem künftigen Arbeitgeber: „Haben Sie herzlichen Dank, Herr Trittke. Sie helfen mir wirklich weiter. Ich bin froh, bei einem anerkannten Betrieb unterzukommen. Hätte nie gedacht, dass ein renommierter Viehwirt wie Sie gegenüber einem Studenten so aufgeschlossen ist.“
„Ach, wissen Sie, Bescheidenheit gehört zum Kulturgut unseres schönen Landes – und damit vermutlich auch zu mir. In aller Bescheidenheit darf ich von unserer Zucht behaupten, dass sie einen wichtigen Beitrag zur regionalen und überregionalen Fleischversorgung leistet. Er wird in der Öffentlichkeit allerdings kaum wahrgenommen. Aus Bescheidenheit betreiben wir nur in geringem Ausmaß Öffentlichkeitsarbeit, so kennt uns der Endverbraucher kaum. Deshalb sind wir immer froh darüber, wenn sich junge, aufstrebende Menschen mit der richtigen Gesinnung, wie Sie sie mitbringen, für diesen wichtigen Wirtschaftszweig interessieren. Da fällt es leicht, jemandem wie Ihnen gegenüber aufgeschlossen zu sein.“
Mit dieser schwiemeligen Salbaderei entließ mich Trittke, und ich fuhr geläutert nach Hause.
Von wegen!
5. Besserwisser
Nun arbeitete ich schon den fünften Tag auf der Schweinefarm, ohne in der Sache ein Ergebnis vorweisen zu können. Dafür war ich vom ersten Moment an von den schweinischen Tätigkeiten voll bedient. Natürlich teilte mich Trittke zu allen denkbar schlechten Arbeiten ein. Zunächst zeigte ein Vorarbeiter, den sie Schulli nannten und der irgendwann wegen der Arbeit aus dem grauen Essen ins bunte Vorarlberg gezogen war, wie es ging, bevor er mich einer kleinen Gruppe zuteilte: Füttern in der Früh. Schweine zum Schlachtwagen des Viehtransporters treiben. Hof fegen. Streugut in Zentnersäcken vom Hänger herunterhieven. Massenhaft Antibiotika ins Futter geben. Sickergruben unterhalb des Spaltbodens ausspülen. Tote Schweine aus ihren Pferchen in Kühlräume schleifen und vorher waschen. Den Schweinen Spritzen verabreichen, ihnen Zähne ziehen, ihre Schwänze abschneiden – alles nichts für zartbesaitete Gemüter, denn bei den meisten Tätigkeiten wehrten sich die Tiere und schrien wie am Spieß, auf dem einige Ferkel mit Sicherheit landen würden.
Zu allem Überfluss herrschte überall bestialisch stechender Gestank. Und die Feinstaubbelastung war so hoch wie im Auspuff eines getürkten Diesels bei viertausend Umdrehungen. Unsere Arbeitsbrigade führte auch Tätigkeiten von Veterinären aus, womit der Züchter eine gute Stange Geld sparte, das er sonst für ausgebildete Fachkräfte hätte hinlegen müssen. Wenigstens war ich so schlau, Mund- und Nasenschützer zu kaufen und ab dem zweiten Tag alle paar Stunden einen neuen Schutz aufzusetzen, der das Gröbste abhielt. Sehr zum Gespött meiner Mitstreiter, doch ich hatte nicht vor, mir bei meiner Undercover-Aktion asthmatische Krankheiten oder Schlimmeres einzufangen.
Einen Vorteil besaß die Arbeit allerdings: Ich konnte mich ab und an in jenem Saustall umschauen, in dem Zoë und Sebastian ihren Film drehten, bevor wir aufflogen. Doch es war hoffnungslos. Kein noch so kleiner Anhaltspunkt war dort zu entdecken. Und kein Schloss entsprach dem Fabrikat von Rolfs Schlüsseln.
Insgesamt verliefen die Tage eklig-monoton. Es arbeiteten fünf kleinere Trupps auf der Schweinefarm an Hunderten von Schweinen. Die Hilfstätigkeiten waren schnell erlernt und erforderten keine besondere intellektuelle Leistung, dagegen ein gehöriges Maß an Rohheit, das sich deutlich im Gebaren der Arbeiter abzeichnete. Der dialektische Bezug zwischen den erforderlichen Tätigkeiten einer unethischen Massentierhaltung und dem Typ Mensch, der sie verrichtete, war leicht zu erkennen. Ich grübelte eine Weile darüber, ob diese spezielle Arbeit auf Dauer die Menschen verroht oder sich eher verrohte Menschen zu ihr hingezogen fühlen. Wahrscheinlich verhält es sich wie überall in despotischen Regimen, und beides ist gleichzeitig der Fall.
Mich hatten die anderen Hilfskräfte mehr schlecht als recht in ihren Reihen akzeptiert. Ich hütete mich, ihnen gegenüber den akademischen Besserwisser raushängen zu lassen, dann wäre ich nämlich schnell Zielscheibe unfeiner Tricks geworden. Also hielt ich das Maul, solange ich nicht gefragt wurde, und bewältigte die Arbeitsrealität in Gedenken an Rolfs gewaltsamen Tod. Weil mir permanent vor Augen stand, warum ich hier war, ließen sich alle Widrigkeiten ertragen.
Am sechsten Tag geschah etwas außerhalb der Routine. Vorarbeiter Schulli, zwei weitere Typen und ich trieben gegen Mittag gerade einiges Schlachtvieh vom Stall auf einen Hänger, als ein quittegelber Bentley auf den Hof fuhr. Dem Sportwagen entstieg eine aufgetakelte Rothaarige mittleren Alters im knappen Leopardenrock, passend zur schlanken Taille. Ein goldfarbener Blouson betonte ihren ausladenden Oberkörper. Eine klimpernde Ansammlung längerer Halsketten sollte zusätzlich das Auge des Betrachters in Richtung Busen lenken. Damit Mann auch von ihrem Abgang noch etwas hatte, trug die aufgeplusterte Henne unten herum Netzstrümpfe und rote Pumps.
Affektiert stelzte die Fregatte aufs Haupthaus zu. Trittke schien sie erwartet zu haben, denn er öffnete die Haustür, bevor sie einen Stöckelabsatz auf die unterste Stufe der Eingangstreppe setzen konnte. Insgesamt war ihre Erscheinung hier so fehl am Platze, wie wir Hilfsarbeiter mit unseren schweinedreckbesudelten Gummistiefeln und Blaumännern bei der Eröffnungsfeier der Bregenzer Festspiele.
„Wusste gar nicht, dass die ihr Gewerbe auch auf einer Schweinefarm betreiben“, meinte ich zu meinem Nachbarn, einem gewissen Patzke, wie mein Mitstreiter von seiner Gruppe genannt wurde.
„Doch, doch. Das ist die Alte vom Zurbrügger. Größter Vertreiber von Biofleisch im Umkreis von dreihundert Kilometern. Trittke arbeitet mit denen zusammen. Rattenscharf, die Alte, sag ich dir. Aber für unsereins nicht zu haben. Kannst dir gleich mal abschminken, das Teil.“
Offensichtlich hatten wir uns missverstanden. Kommunikation ist halt immer nur das, was beim anderen ankommt. Dieses konstruktivistische Theorem von Altmeister Watzlawick bestätigte sich erneut, was ich jedoch mit Patzke nicht weiter erörterte. Seine Information war allerdings interessant.
„Sie ist wohl nicht von hier. Hab den Namen nie gehört“, meinte ich.
„Freilich nicht. Die leben in Südtirol. Fette Villa in einem Seitental. Haben dort eine riesige Fabrik und noch zwei bis drei in Luxemburg und Süditalien und sonst wo. Hab denen mal Unterlagen vorbeigebracht. Nun pack weiter hier mit an, wir wollen heute zeitig Feierabend machen.“
Was suchte die Frau eines steinreichen Fleischgroßhändlers im Outfit einer gehobenen Hafennutte auf einer Schweinefarm, die zumindest durch radikale Tierschützer in den Verdacht geriet, Schweine unter Bedingungen wider die Genfer Konvention zu halten? Diese gute Frage drängte danach beantwortet zu werden. Vielleicht sollte ich dem Fleischgroßhändler auf die Wurstpelle rücken. Doch wie? Das musste ich unbedingt mit meinen Freunden besprechen. Zu dritt oder zu viert waren wir selten um eine Idee verlegen.
Unsere kleine, aber feine Clique bestand aus Alex und mir auf der einen, sowie Alfi und Karl-Heinz auf der anderen Seite. Karl-Heinz hatte mit Alex und mir vor eineinhalb Jahren an unserer Fachhochschule im Ländle den Bachelor-Abschluss gemacht – er in Betriebswirtschaftslehre, wir in Psychologie. Er hatte nur mit mäßigem Erfolg bestanden, was ihn nicht weiter störte, da er parallel zu seinem Abschluss bereits mit unserem Computerexperten Alfi an der gemeinsamen Selbständigkeit gearbeitet hatte und nach dem ersten Studium kein zweites beginnen wollte. Karl-Heinz hatte einiges Kapital aus seinem Teil einer Belohnung in das Geschäft eingebracht, die wir uns mit der Aufdeckung krimineller Machenschaften verdient hatten. Alfi hatte seinen Finanzanteil aus dem Erlös dubioser Software-Geschäftchen bestritten. Inwiefern Alfis frühere Computeraktionen legal oder illegal waren, wusste außer ihm keiner so genau. Die neue Geschäftsidee von ihm und Karl-Heinz entsprach allerdings den Buchstaben des Gesetzes – hofften Alex und ich zumindest.
Diese drei mir nahestehenden Menschen waren, jeder auf seine Art, gewitzt und absolut zuverlässig. Gemeinsam Erlebtes schweißte uns über das alltägliche Maß zusammen.
Zwischenzeitlich sandte ich meinen Freunden eine SMS, in der ich um ein wichtiges Treffen bat, am besten noch für denselben Abend, und zwar bei Alfi, um nicht Mutters Neugier zu wecken. Es dauerte keine Stunde, bis alle zugesagt hatten, und so fuhr ich nach Feierabend gegen fünf Uhr zu Alfi. Er lebte alleine in einer Vierzimmerwohnung eines Neubaublocks in Dornbirn, wo wir uns selten trafen, weil fast die gesamte Wohnung mit technischem Schnick-Schnack vollgestopft war, den wir auf gar keinen Fall anrühren durften. Karl-Heinz’ Bude kam nicht in Frage, da er seit dem Studium weiter entfernt im Oberland lebte.
Das Geschäft von ihm und Alfi fing damals langsam an, sich finanziell zu rentieren. Gemeinsam hatten sie Ideen für Applikationen entworfen, von denen eine oder zwei bereits in Smartphones liefen. Alfi übernahm den Programmierteil, und Karl-Heinz kümmerte sich um das kontinuierlich anwachsende Geschäft. Sogar ein paar Unterprogrammierer waren bereits für sie tätig, was als Zeichen der zunehmend positiven Geschäftsentwicklung gewertet werden konnte.
Das Ganze fing mit einer App an, mit der man Barcodes von Waren fotografieren und sich die darin gespeicherten Daten auf dem Display des Smartphones als Text anzeigen lassen konnte. Alternativ dazu konnte man die kleine Nummer unter dem Code eingeben. Alfi hatte vor einiger Zeit erklärt, wie das funktioniert: Die App sendet das Foto oder die Nummer an eine Datenbank mit integrierter Erkennungssoftware. Auf der Datenbank sind alle Produktinformationen gespeichert. Sie analysiert den Code und sendet alle darauf befindlichen Informationen zu diesem Produkt auf das Display zurück. Für die Kunden ist das eine tolle Erfindung und Erleichterung, denn die Produktinformationen sind üblicherweise auf der Verpackung entweder in mikronesischer Schriftgröße, oder nur auszugsweise oder gar nicht aufgelistet. Bei Lebensmitteln sind die Kunden beispielsweise damit in der Lage, Herkunftsland sowie biologische und chemische Inhaltsstoffe einfach zu erkennen. Oder man kann einem Kleidungsstück die Information entlocken, in welchem Land es gefertigt und mit welchen Mitteln es behandelt wurde.
Diese erste Applikation lebte von der Internet-Community. Jeder konnte Informationen zu einem Produkt auf der Datenbank eingeben, so wuchs der Produktbestand relativ schnell. Für die ersten Eingaben hatten sich Karl-Heinz und Alfi ein knappes Jahr eigenhändig in Supermärkten und Warenhäusern herumgetrieben. Als sie einen respektablen Datenbestand zusammengesammelt hatten, gingen sie mit ihrer Applikation an die Öffentlichkeit.
Ein Jahr später beschäftigten sie bereits ein Dutzend Studenten dafür, weil Alfi mit zwei angestellten Programmierern schon an den nächsten Applikationen arbeitete. Wenn jemand die Barcode-Erkennung nutzen wollte, überwies er dafür einen Euro auf das Geschäftskonto von Alfi und Karl-Heinz, und so schrieben beide bereits nach einer Durststrecke von eineinhalb Jahren schwarze Zahlen.
Ich traf von uns Vieren als Letzter ein. Nachdem ich am Hauseingang bei Alfons Winterstein geläutet und nach dem Summen drei Stockwerke hinaufgerannt war, öffnete Alfi die Tür mit dem Kommentar des Tages: „Alter Schwede, stinkst du erbärmlich! Bist du unter die Kloreiniger gegangen, oder was?“
„So ähnlich. Gar nicht so schlecht geschätzt. Ich mache gerade ein Praktikum auf ’ner Schweinefarm, und da kann ich mich nach der Arbeit nicht anständig waschen.“
„Echt, Mann? Keine Spinne? Ist ja ’ne üble Kiste. Hab das sofort gemerkt. Hab halt ’n feines Näschen für so was“, grinste Alfi. „Komm rein. Dusch dich erst mal ab, Alter.“
„Danke. Was macht euer Geschäft?“
„Läuft gut an, zieht sich aber länger hin als man denkt. Wenn’s so einfach wäre, Programme zu stricken, könnte das jede Omi vor dem Holzofen tun. Muss man schon für begabt sein.“
Manieriert ruckelte Alfi seine Brille zurecht. Heute trug er ein goldfarbenes Intellektuellengestell mit schmalen rechteckigen Gläsern. Ersichtlich ließ er der schlacksige Kerl das Starlet raushängen.
„So wie du, meinst du – Alfi der Begnadete?“
„Klar, Alter. Richtig erkannt. Nu komm endlich rein.“
Zum Wohl des Gruppenklimas duschte ich zunächst und zog mich um, bevor ich mich zu den anderen ins Wohnzimmer setzte. Alfis Wohnzimmer konnte nicht mit normalen Maßstäben gemessen werden. Gerade ein Esstisch und vier Stühle entsprachen dem üblichen Einrichtungsstil. Allein der Fernseher sprengte alle Dimensionen, war aber nicht das auffälligste Einrichtungsstück. Drei Monitore, ein paar Working-Stations, Ventilatoren, ein Mega-Drucker und etliches Zusatzgerät füllten an einer Längs- und Querwand auf und unter einfachen Holztischen den Raum. Kabelzeugs hing hinten herunter und verband den ganzen Medienpark. Der Raum wurde durch zwei tragbare Klimaanlagen gekühlt, die den Monatsverdienst eines mittleren Angestellten an Stromkosten verursachen mussten. Es stand zwar viel Technik im Raum, doch insgesamt sah er absolut sauber aus, und die Geräte waren systematisch angeordnet. Sieh an, das hätte ich dem Nerd gar nicht zugetraut. Dachte immer, seine Wohnung würde mit kalten, klebrigen Pizzastücken, leeren Getränkebüchsen, Erdnüssen und Chipskrümeln vermüllt sein – keine Spur davon.