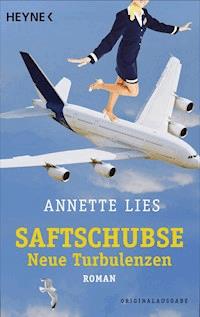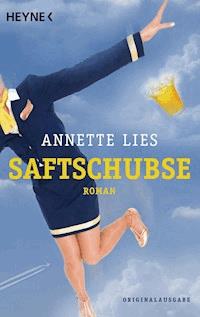4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Henriette, Mieke und Coco haben nichts gemeinsam – außer dasselbe Problem: eine handfeste Lebenskrise! Als alle drei in der psychosomatischen Klinik Seeblick landen, lauern unbequeme Fragen im Gepäck: Warum will ich immer perfekt sein? Sage ich oft genug Nein? Was ist, wenn Muttersein doch nichts für mich ist? Und nicht zuletzt: Wie konnte mein Leben nur so aus dem Ruder geraten?! Sich selbst als Chefin, Ex-Ehefrau und Geliebte zu entfliehen, ist jedoch leichter gesagt als getan. Und am Ende scheint nur eine einzige Therapie anzuschlagen – Freundschaft …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
ANNETTE LIES
ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2018 by Annette Lies
Copyright © 2018 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Steffi Korda
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design, München
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-16691-5V002
www.penguin.de
Zum Buch
Den Gezeiten des Lebens trotzt man am besten zusammen …
Henriette, Mieke & Coco haben nichts gemeinsam – außer einer Lebenskrise! Während Frauenärztin Henriette unter dem Empty-Nest-Syndrom leidet, liebt Mieke einen verheirateten Mann. Die kinderlose Köchin Coco vertraut nur noch der Esoterik. In der psychosomatischen Klinik Seeblick müssen sie sich unbequemen Fragen stellen: Wie konnte ihr Leben nur so aus dem Ruder geraten? Als sie auch innerlich ihre alten Fahrwasser verlassen, entdecken sie, dass Freundschaft vielleicht der beste Kompass ist zu neuen Ufern …
Drei Frauen, die längst auf eigenen Füßen stehen. Doch wie kommt man wieder auf die Beine?
Zur Autorin
Annette Lies wurde 1979 in Herne geboren. Die gelernte Werbekauffrau arbeitete als Texterin und begeisterte Stewardess, bevor sie 2015 ihr Studium der Dramaturgie an der HFF München abschloss. Ihre Romane »Saftschubse« und »Saftschubse – Neue Turbulenzen« wurden für Sat1 verfilmt. Annette Lies lebt in München und Key West.
Lieferbare Titel
Saftschubse
Saftschubse – Neue Turbulenzen
Prolog
»Willst du das wirklich?«, flüsterte er ihr ins Ohr. Der kleine Optimist schwankte sachte unter ihnen, und Wasser platschte in winzigen Wellen gegen das Holz. Über den Bug zogen ein paar dunkle Wolken hinweg. Ein Sommergewitter lag in der Luft.
Henriettes Körper musste nicht lange überlegen. Ihr Kopf schon. Ein Vierteljahrhundert hatte sie das hier gewollt! Es wirklich zu tun war allerdings eine ganz andere Sache. Doch ob sie es taten oder nicht: Ihre Zuneigung füreinander ließ sich nicht mehr leugnen.
Zärtlich fuhr er ihr mit der Hand unter die karminrote Bluse, und sie musste sich schwer konzentrieren, um eine Entscheidung zu treffen, statt sich ihm einfach unbedacht hinzugeben, was sie für den Rest ihres Lebens bereuen könnte. Leider genauso wie den Entschluss dagegen.
Mit klopfendem Herzen legte sie ihre Hand auf seine Hüfte und versuchte, sich ein letztes Mal Georg vorzustellen. Vermutlich dachten nicht viele Frauen beim Sex mit einem anderen Mann an ihren eigenen, aber sie musste es tun. Leider fielen ihr nur seine gestreiften Schlafanzüge ein, die Pollenallergie, seine Grübchen – und sein stummer Gesichtsausdruck, würde er sie jetzt hier so sehen können. Argwöhnisch würde er vermutlich zuerst den Preis ihrer neuen Unterwäsche hinterfragen. Georg war kein Mann der lauten Töne, weder aus Leidenschaft noch aus Wut. Dabei waren Klänge sein Beruf. Überhaupt war er ganz und gar anders als der Mann über ihr, der ihr jetzt leise keuchend zuraunte, auch im strömenden Regen mit ihr schlafen zu wollen, was die Sache nicht einfacher machte. Daran, dass vielleicht genau unter ihnen ihr Ehering lag, durfte sie gar nicht erst denken.
Achtsam horchte sie in sich hinein, wie Frau Küppers es ihr beigebracht hatte, doch Verstand und Instinkt gingen trotzig eigene Wege.
Ein Windstoß erfasste das Segel über ihnen, das eben noch reglos in den Himmel geragt hatte, und erinnerte sie ungeduldig daran, dass ihre gemeinsame Zeit auch heute nicht stillstand. Nachdenklich strich Henriette durch sein Haar, das ihm in glatten, graublonden Strähnen jugendlich über die Stirn hing. Eine unwiderstehliche Mischung, die von Alter, Sonne und Salzwasser herrührte – Jugend und Reife, das war er.
»Erst muss ich in die Klapse, und dann machst du mich verrückt!«, witzelte sie.
»Lenkst du etwa ab?« Konzentriert ließ er seine Finger über ihre Rundungen gleiten. Himmel, diese eisblauen Augen! Sie berührten ihre Seele so intensiv wie seine Hände ihren Körper. Mit ihm hatte sie das Gefühl, dass ihr rein gar nichts passieren konnte – außer er selbst.
Als der erste Donner grollte, wurden seine Küsse auf ihrem Schlüsselbein fordernd, und auch ihr Atem wurde schneller, und zwischen ihren Schenkeln überkam sie etwas, das sie so lange nicht mehr gespürt hatte, das sie es nicht einmal mehr vermisst hatte. Behutsam wanderten seine Finger ihren Bauch hinunter und hielten fragend vor ihrem Schritt an. Jetzt musste sie sich entscheiden! Was wog bloß mehr – ihre niederen Impulse oder zwei Kinder, siebzehn Pauschalreisen und fünfundzwanzig Mal Weihnachten mit Georg? Nicht zu vergessen, dass nur ihr Ehemann wusste, wie sie aussah, wenn sie sich zwei Wochen lang nicht die Beine rasierte.
War es nach all den Jahren an der Zeit, mit sich selber zu brechen? Oder hatte sie das längst getan? Damals, im Taxi?
Noch immer wusste sie nicht, was sie antworten sollte. Nur eins war klar: Was sie jetzt entschied, würde alles verändern. Entweder nur für sie. Oder aber für sie alle.
Dann formten ihre Lippen die Antwort.
1.
Kurz bevor sie den Eingang erreichten, ging ihr die Luft aus.
Georg eilte hinter ihr her und versuchte, den Griff ihres Koffers, den sie emanzipiert umklammerte, in die Finger zu kriegen. Der Bruch der rechten Elle war zwar verheilt, doch noch war sie meilenweit davon entfernt, den Arm wieder normal belasten zu können. Also hatte sie ihren geliebten Weekender in seiner verwitterten Lederoptik auf den abgewetzten Schranktrolley gestapelt, wobei sie Georg versehentlich die Finger eingeklemmt hatte, und zerrte die bleischwere Fracht nun mit beiden Händen über den Kies. Eine Jungfernfahrt, die des Prachtstücks äußerst unwürdig war – wähnte sie sich doch beim Kauf noch mit ihm in einem nostalgischen Zug durch Zentralafrika. Und jetzt das!
Ihr linker, gesunder Arm schmerzte augenblicklich noch mehr als der rechte. Kein Wunder! Sie hatte fast ihren gesamten Schrank eingepackt. Es war tatsächlich mehr ein Umzug als eine Reise, wie Georg es nannte.
»Wie lange wirst du denn weg sein?«, hatte er sie in Anbetracht der leeren und lose hin und her baumelnden Kleiderbügel im Einbauschrank beunruhigt gefragt.
»Nur sechs Wochen«, hatte sie knapp entgegnet und seinen Blick gemieden.
Die ganze Sache passte ihm nicht. Zwar war er unter der Woche ohnehin den ganzen Tag weg, aber abends brauchte er sie neben sich. Manchmal auch auf sich. Letzteres allerdings nur noch selten.
Noch immer war es ihr selbst hochnotpeinlich, wohin sie so kurz nach ihrem fünfundzwanzigsten Hochzeitstag ging. Doch von Georg hätte sie sich ein wenig mehr offizielle Unterstützung – und Bestürzung – darüber gewünscht.
»Den ganzen Sommer über bist du weg?!«, hatte er mit langgezogener Miene weiter protestiert. »Aber Yukuri Rotomori gibt sein Abschiedskonzert, und wir haben Karten!«
Wie immer war klar, dass er, der Dirigent, das berufliche Ende eines wildfremden Musikers über ihren Zustand stellte. Fast hatte sie sich im Laufe der Jahre daran gewöhnt. Doch diesmal ging es nicht darum, dass sie einen Friseurtermin absagen musste, um experimentelle Orchesterkunst in Amsterdam zu bewundern. Diesmal ging es um mehr, um viel mehr. Um ihre Gesundheit, womöglich ihr Leben – nur dieses eine Mal ging es um sie! In einem Crescendo hatte er seinen stärksten Trumpf ausgespielt und schamlos ihre Achillesferse torpediert: »Die Kinder wollen doch auch noch was von dir haben! Es ist ihr letzter Sommer mit uns, danach sind sie flügge! Kuren kannst du noch ewig.«
Ihr schlechtes Muttergewissen hatte zuverlässig hyperventiliert und sie sich gefragt, ob er das Wort Kur absichtlich benutzte, denn sie selbst hatte ganz klar den Begriff Burn-out verwendet, als sie ihre Angetrauten bei der Rückkehr aus dem Krankenhaus vor drei Wochen über ihr Rehabilitationsvorhaben informiert hatte. Zur Untermalung der dramatischen Lage hatte sie seit dem Unfall den Haushalt stark vernachlässigt, was ihr auch das Rosengewächs im Vorgarten nicht verzieh.
Ihre gynäkologische Praxis war bis Herbst geschlossen, und Ines und Clementine, ihre Arzthelferinnen, waren zwar aufrichtig über Henriettes Zustand schockiert, gleichzeitig aber kaum in der Lage gewesen, ihr Glück über den bezahlten Urlaub zu verbergen. Schnell waren ihre Genesungskarten zu Postkarten von Kreta mutiert. Was diese Maßnahme finanziell und imagemäßig anrichten würde, daran versuchte Henriette nicht mehr zu denken, seit sie in einem Zimmer im Kreiskrankenhaus aus ihrer Bewusstlosigkeit erwacht war.
Ihre Kinder nahmen sie vergleichsweise ernst. Zumindest auf ihre sehr direkte Anfang-Zwanzig-Art. Ein Alter, das sich gut unter Alles schon gesehen, alles schon erlebt, lass mich in Ruhe, gähn zusammenfassen ließ – obwohl sie noch gar nichts erlebt hatten. Gottlob! Außer vernichtendem Liebeskummer, wenn sich ein Mädchen, ein Junge oder eine Band trennte. Natürlich wusste auch sie bis heute nicht wirklich, worum es im Leben ging – aber im Unterschied zu ihren Kindern wusste sie zumindest, worum es nicht ging: Männer, Sex, Spaß, Liebe, Partys, Selbstverwirklichung, Freiheit … die Liste war lang. Stattdessen ging es um Hypotheken, Geschirrspüler der Effizienzklasse A, Zahnsteinentfernung, Hortbetreuung, Frühbucherrabatte, Steuerbescheide, Samstagseinkäufe, Elternabende, Rasenmäher und Essigentkalker. So viel stand fest. Und so war es nach dem Vorfall vor vier Wochen mehr als ihr gutes Recht, diesem Wahnsinn für einige Zeit zu entfliehen.
Die Fahrt von München nach Prien war nicht lang. Henriette saß still neben Georg in ihrem eigenen, feuerroten Passat auf dem Beifahrersitz. Gemeinsam hatten sie entschieden, dass er sie brachte und sich die Kinder ihr Auto in den nächsten eineinhalb Monaten teilen konnten, denn die Zwillinge genossen gerade eine Auszeit, eine Annehmlichkeit ihrer Generation. Ab Herbst würde Gabor Physik studieren und Gilda in Australien Work & Travel machen. Oder surfen. Oder bloggen. Das wusste Gilda noch nicht so genau, und Henriette gönnte ihrer Tochter diese Orientierungsphase.
Trotz der angespannten Stimmung im Wagen genoss sie es ihrerseits, unbeteiligt aus dem Fenster zu starren. Von ihr aus hätten sie ewig so dahinrollen können, bis zur Nordsee und zurück. Nichtstun gab es in ihrem Leben schon lange nicht mehr, der Familienalltag bestand fast ausschließlich aus Handlungen: Kochen, putzen, aufräumen, schimpfen, streiten, diskutieren und organisieren. Und daraus, sich Sorgen über das alles zu machen, immer wieder, jeden Montag von vorne.
»Wir sind da!«, war das Erste gewesen, was Georg seit seinem herzhaften »So!« beim Schließen ihrer sonnenblumengelben Doppelgarage in München-Bogenhausen wieder gesagt hatte, als sie vor der Klinik hielten. Und das war ziemlich offensichtlich. »Ette-Schatz, soll ich nicht doch mit reinkommen?« Versöhnlich hatte ihr Göttergatte nach hinten gegrinst, in Richtung des Safari-Weekenders und des Schranktrolleys, die von einem bunten Sportrucksack und einem fleckigen Jutebeutel im Kofferraum flankiert wurden.
Sie hatte sein Lächeln beim besten Willen nicht erwidern können. Wenn er mental keine Begleitung darstellte, konnte er sich seine Manneskraft getrost schenken. »Danke. Aber nein.«
»Wie du meinst«, hatte seine Stimme einen gehörigen Mollton angenommen. Dann war er stillschweigend ausgestiegen, hatte den Wagen umrundet und ihr die Tür aufgehalten. Eine Geste, auf die er seit ihrem ersten richtigen Rendezvous an der Uni bestand und die sie hier, vor den Toren der Seeblick-Kliniken, zum ersten Mal nicht mehr charmant, sondern antiquiert fand.
Damals, am Abend der Examensparty der Mediziner, waren sie nach einer Reihe unverfänglicher Dates zum ersten Mal gemeinsam im Kino gewesen, ein dänischer Arthausfilm im Original. Trotz Untertiteln hatte sie fast nichts verstanden, aber es hatte Spaß gemacht, Georg in seinem Kinosessel von der Seite aus zu betrachten, während er Feuer und Flamme war ob der schauspielerischen Leistung, der Lichtsetzung und der visionären Kameraführung. Ein Teil von ihr mochte die Welt, die er ihr zeigte, ein anderer fand es unfassbar anstrengend, sich ständig zu bilden. Etwas, das in all den Jahren gleich geblieben war. Zum Ausgleich hatte sie sich zunehmend in Banalitäten gestürzt – sehr zur Freude von Gilda, mit der sie nach Jahren der Hausaufgabenermahnung nun entspannt Make-up-Tutorials und Topmodelfolgen konsumierte.
Henriette atmete tief ein. Die Luft hier am Chiemsee war so ganz anders als in der Stadt! Es roch nach Seewasser und frisch gemähter Wiese, und irgendwo hatte jemand einen Holzkohlegrill angemacht. Als die Kinder noch klein gewesen waren, hatten sie hier regelmäßig den Sommerurlaub verbracht und ihre Kindersitze, Feuchttücher, Gläschen und Windelpakete einfach ins Auto gepackt, statt aufwendige Flugreisen auf sich zu nehmen. Damals war sie auch beruflich noch eine brennende Idealistin gewesen und hatte jeden Mückenstich hingebungsvoll verarztet. Georg hingegen konnte kein Blut sehen und hatte nach einem Semester Humanmedizin das Fach gewechselt – und danach nicht mehr allzu viel übrig gehabt für ihre Berufswahl. Nie wieder hatte er sich hinterfragt, während dies zu ihrem Alltag gehörte: War sie eine gute Chefin? Bekamen die Patientinnen von ihr ausreichend Empathie, Kompetenz und schnell genug einen Termin? Sollte sie mal ihr Englisch auffrischen? War für sie Yoga die richtige Sportart, Step-Aerobic oder Pilates? War ihr Körper übersäuert und konnte man dem Gütesiegel der Freiland-Bioeier wirklich vertrauen? Und was zur Hölle würde sie tun, wenn ihre Kinder bald aus dem Haus waren und sie ihnen gar kein Rührei mehr machen musste?! Wie wäre ihr Leben verlaufen, wenn sie bei der Einführungsveranstaltung damals nicht neben Daniel und Georg gesessen und sich nach der Party nicht von Georg hätte mitnehmen lassen?!
Auf eine Art bewunderte Henriette ihren Mann für seine Gradlinigkeit. Niemals würde ein Georg Hendrik Hoppe so wie sie nun vor einem alten, bayerischen Jagdschloss stehen, in dem ein Therapiezentrum untergebracht war, und mit zittrigen Knien auf die große braune Eingangstür aus Holz starren, auf der das einladende Schild Psychiatrie sagte.
»Tschüss!«, sagte sie jetzt und unterband damit, trotz Atemnot, endgültig seine Versuche, ihr zu helfen. »Küss die Kinder!«
»Mach ich«, kapitulierte er neben ihr auf dem Kies. Ein wenig ratlos stand er da. »Erhol dich gut, ja? Geh mal schwimmen und in die Sauna.« Dann ging er zum Auto zurück.
»Warte mal, Georg!« Einer Eingebung folgend, drehte sie sich noch einmal um und lief ihm hinterher.
»Ja?«, signalisierte er aufnahmebereit, in Erwartung, dass sie ihm letzte Instruktionen zu Erziehung, Kühlschrankhygiene oder Postablage gab.
»Vielleicht sollten wir uns neu erfinden? So als Paar, wenn die Kinder aus dem Haus sind?« Sie kam sich richtig verwegen vor, wie sie das so sagte.
Er überlegte. »Klar. Dann gehen wir essen! Und mal ins Kino? Metropolis wird oft wiederholt.« Er nahm etwas aus der Mittelkonsole des Wagens, drückte ihr ein Papier in die Hand, stieg ein – und weg war er.
Sie musterte neugierig den Umschlag. Henriette stand ihr voller Name darauf. Sonst nannte er sie stets Ette. Offenbar hatte Georg doch etwas zu sagen! Vielleicht konnte er es nur besser schreiben? Sie zögerte kurz, beschloss dann aber, den Brief ein anderes Mal zu öffnen.
Sie sah sich um, sog den Geruch nach Lavendel und Flieder in sich auf und lauschte einen Augenblick dem Gezwitscher einer Amsel. Dann schleifte sie ihr Gepäck die Steintreppe hinauf bis zum Empfang.
2.
Die Dame hinter der Rezeption war in etwa so alt wie Henriette – also ein halbes Jahrhundert, um genau zu sein – und trug eine goldumrandete Lesebrille mit einer Kordel, über die sie mit strengem Blick alles und jeden sondierte, nicht jedoch, wer unmittelbar vor ihr stand. Ein Messingschild über dem fülligen Busen verriet ihren Namen. A. Maier. Henriette hatte es stets vermieden, solche Frauen vom Modell Vorzimmerdrachen einzustellen. Puh! Das war kein guter Start.
Unbeeindruckt von Henriettes Erscheinen sortierte A. Maier freudlos ein paar pastellfarbene Karteikarten und schrieb eine Notiz. Erst nachdem Henriette eine Weile unaufhaltsam mit gelegentlichem Räuspern vor ihr gestanden hatte, erbarmte sie sich und sah auf. Missbilligend streifte ihr Blick als Erstes Henriettes bunt zusammengewürfelten, hüfthohen Gepäckberg. »Einchecken?«
»Ja bitte!«, entgegnete Henriette so freundlich wie möglich. Auf der anderen Seite eines Tresens zu stehen war für sie neu, aber sie freute sich, dass Einchecken mehr nach Hotel klang als Einweisung.
Mit routinierter Brutalität zog der Drachen Henriettes Versichertenkarte durch einen Schlitz an der Computertastatur, hackte ein wenig darauf herum und runzelte verärgert die Stirn. Dann griff sie nach einem Stapel mit Formularen. »Das bitte ausfüllen! Nachname, Vorname, Anschrift und vorangegangene Aufenthalte in …«
»Danke!«, unterbrach Henriette sie spitz und riss das Klemmbrett mitsamt Stift an sich. Sie hatte plötzlich extrem schlechte Laune. Georgs ständige Erholungswünsche, seine Gleichgültigkeit und die visuelle Herabwürdigung von A. Maier gepaart mit ihrer exzentrischen Langsamkeit reizten sie furchtbar. Sie ließ ihre Gepäckpyramide etwas abseits stehen und zog sich in eine einfach bestuhlte Sitzecke zurück, in der bereits zwei weitere Frauen die gleichen Bögen beschrieben. Henriette entschied sich für einen Platz am Rand und sondierte das Gebäude.
Das Foyer war äußerst großzügig gehalten. Hohe Decken, Stuck, Säulen und ein schwarz-weiß gefliester Marmorboden, der sicher aus der Gründerzeit stammte, erinnerten sie an die Titanic. Was weiterhin nichts Gutes verhieß. Auf einem runden Tisch in der Mitte prangte ein imposantes Blumengesteck. Es fehlte nur noch ein älterer Herr mit weißen Handschuhen, der emsig das Mahagoni polierte, so wie in den Weihnachtsfilmen, die in New Yorker Grandhotels spielten. Gäbe nicht eine Glasvitrine mit kleinen weißen Buchstaben eine Übersicht über Ärzte und Stationen, hätte Henriette Angst vor der Zimmerrechnung bekommen. Insgesamt wirkte das Ganze wie eine fragwürdige Mischung aus Sanatorium und Wellnessbetrieb. Wo war sie nur gelandet?
Sie sah hinüber zu ihren Leidensgenossinnen. Während die eine – ein junges Mädchen im schwarz-roten Karohemd, aus dem Unterarm-Tattoos hervorlugten – so emsig schrieb, als seien dies die letzten Sekunden einer Klassenarbeit, schien die andere, eine durch und durch divenhafte Erscheinung Anfang vierzig, bereits das Datum für überflüssig zu halten.
»Fertig?« A. Maier stand vor ihnen und blickte auf sie herab, noch bevor Henriette den Stift angesetzt hatte.
»Ich brauche noch Zeit!«, platzte der Teenager heraus. In ihren hennarot gefärbten Haaren trug sie keck ein ebenfalls rotes Bandanahaartuch und sah nach Rockabilly aus.
Die andere Frau schien die Ruhe selbst zu sein und fühlte sich gar nicht erst angesprochen. Eine tiefschwarze Sonnenbrille schützte sie vor fremden Blicken, ein schwarzer Fransenponcho umschmeichelte stilsicher ihre wohlproportionierte Figur, und ihre perfekt rot lackierten Nägel zum Lippenstift in derselben Nuance rundeten das luxuriöse Bild ab. Sicher ein Opernstar, dachte Henriette und ärgerte sich sofort, dass sie die Welt durch den Georg-Filter sah. Im Vorbeigehen legte die geheimnisvolle Diva A. Maier einfach ihr Klemmbrett in die Arme, als wäre die Empfangsdame Luft. Dann winkte sie einen Mann zu sich heran, von dem Henriette sicher war, dass auch er gerade einchecken wollte, drückte ihm einen Schein in die Hand und verwies lapidar auf ihr Gepäck, das dem Henriettes im Umfang in nichts nachstand, jedoch in Form und Farbe das akkurate Gesamtensemble einer französischen Modemarke inklusive klassischem Beautycase bildete. Danach flanierte sie unbeteiligt Richtung Garten.
A. Maier seufzte und ging, mit der Ausbeute von nur einem Formular, wieder zurück auf ihren Posten. Henriette musste fast lachen. Was für eine skurrile Szene!
Als sie fertig war, traf ihr Blick den des Mädchens, das nervös auf ihrem Unterlippenpiercing herumbiss. Sie war unmerklich ein Stück näher an Henriette gerückt, als ob sie abschreiben wollte. Bei näherer Betrachtung war sie wesentlich älter als vermutet, eine Art Kindfrau, mindestens zehn Jahre älter als Gilda. Unter ihrem fröhlichen Pin-up-Girl-Pferdeschwanz wirkte sie dennoch hilflos, und sofort verspürte Henriette ihr gegenüber mütterliche Instinkte, aber auch Unbehagen. Schließlich wusste man nicht, mit wem man es hier zu tun hatte rechts und links! Jeder Arzt in Sichtweite konnte bloß ein Patient sein, der sich als Fachpersonal ausgab.
Die Kindfrau nahm nun Kontakt auf. »Was schreibst du bei Acht?«
Henriette sah auf ihr Formular. Bei dieser Zahl ging es um Vorerkrankungen, eine sehr individuelle Frage also. »Na ja, ich weiß nicht …«, zögerte sie mit der Antwort. Es erschien ihr weder richtig noch hilfreich, von ihrer Spannungsmigräne zu berichten.
»Nicht?«, sagte die Kindfrau verwundert und drehte ihren Pferdeschwanz ein. Dann senkte sie ihren Blick wieder auf das Papier und kaute auf dem Kuli herum.
»Ich hatte mal einen Kaiserschnitt«, wich Henriette auf eine andere Wahrheit aus und war sich sicher, dass ihre Sitznachbarin diese Vita nicht teilte.
Die Kindfrau guckte jetzt noch erstaunter und checkte erneut ihr eigenes Blatt. »Ach so, nein, halt! Neun, meine ich! Frage neun!«
Wieder sah Henriette auf ihr Formular. Wie sind Sie auf unsere Einrichtung aufmerksam geworden? Diesmal entfuhr ihr der Lacher. »Ach so! Durch einen Freund«, gab sie zu und wusste nicht, wie sie Daniels Empfehlung besser umschreiben sollte. Der beste Freund ihres Mannes hatte an ihrem Krankenhausbett gesessen, beruhigend ihre Hand gehalten und den ungeheuerlichen Vorschlag des behandelnden Stationsarztes – sie sei in einer Einrichtung für eine Zeit lang womöglich besser aufgehoben als zu Hause – in ein wohlklingendes Sommerlager für die Seele verwandelt.
Die Kindfrau verzog die Mundwinkel zu einem sympathischen Lächeln. »Ich bin auch wegen einem Mann hier«, gab sie, erfreut über diese Gemeinsamkeit, zurück.
So wie A. Maier Feindseligkeit ausstrahlte, so strahlte die junge Frau Heiterkeit aus, was dem Anlass gegenüber nicht gerade angemessen war. Sie spreizte die silberne Spange ihres Kulis, befestigte ihn am oberen Rand ihres Klemmbretts und stand auf. »Soll ich deins mitnehmen?«, bot sie Henriette an und schien immer noch auf ihre Angaben zu schielen.
»Danke, aber nein!« Sie legte reflexartig die Hand über ihr Blatt und ging mit schnellen Schritten zurück in das Hoheitsgebiet von A. Maier, vor dem sich inzwischen eine kleine Schlange gebildet hatte. Heute, Freitag, war offizieller An- und Abreisetag.
»Ich bin übrigens Mieke«, stellte sich die Kindfrau hinter ihr noch schnell vor, bevor der Mann vor Henriette, ein bulliger Typ mit Jeansweste und nikotingelben Fingern, ächzend den Platz für sie freigab.
»Henriette«, lächelte sie unverbindlich und verzichtete lieber darauf, Mieke die Hand zu geben, was nicht weiter ins Gewicht fiel, da A. Maier ihr im selben Moment die Schlüsselkarte für ihr Zimmer überreichte. Mitsamt der Hausordnung und mahnendem Blick, versteht sich.
Die Nagellackfrau mit Sonnenbrille und Fransenponcho kam aus dem Garten zurück und zupfte sich eine Pusteblumenpolle aus dem ebenholzdunklen Haar, das sich glänzend über ihren Schultern wellte. Für den XXL-Shopper unter ihrem Arm, erinnerte sich Henriette in Gildas Magazinen gelesen zu haben, gab es weltweite Wartelisten.
Sie selbst trug Jeans, eine praktische weiße Bluse, darüber eine wärmende rote Strickjacke und unglaublich hässliche, aber bequeme beigefarbene Slipper, wie sie unter Senioren verbreitet sind, die durch die Akropolis stapfen. Früher waren ihre stets kurzen Haare straßenköterblond gewesen, aber schon mit Ende zwanzig war sie ergraut und hatte sich nach immer häufigeren, zeitaufwendigeren und kostspieligeren Friseurmarathons bald dazu entschieden, ihren Kopf in Würde altern zu lassen. Passend zur Menopause hatte ihre Friseurin in der kleinen Ladenpassage ihr vorgeschlagen, doch etwas Neues auszuprobieren, was letzten Endes gar nicht mal schlecht war, denn der streng geglättete Bob verlieh ihr einfach mehr Autorität im Berufsleben. Herrje – ihr Job!
Plötzlich zirkulierten ihre Gedanken wie die Rotorblätter eines Hubschraubers durch ihren Kopf. Die Ampel. Das Auto. Die entsetzten Gesichter der Passanten. Und die Ahnung, dass dies das Letzte gewesen sein könnte, was sie jemals sah.
»Vielleicht sehen wir uns ja mal?«, gab sie sich einen Ruck, gerade als Mieke ihr einziges Gepäckstück – eine winzige Sporttasche – an sich nahm und sich zum Gehen wandte. Um der Denkschleife in ihrem Innern zu entkommen, war Henriette jedes Mittel recht, und es konnte schließlich nicht schaden, jemanden zu haben, mit dem man gelegentlich beim Essen zusammensaß.
»Gern. Ich bin Coco«, sprach es in diesem Moment ungefragt hinter ihnen aus dem Poncho.
3.
Das Zimmer war karg, die Aussicht wunderschön.
Der Blick ging bis zu den Alpen, und wenn Henriette sich ganz dicht vor das Fensterglas stellte, lag unmittelbar unter ihr der Chiemsee, nur durch einen Streifen Kies von der Hauswand getrennt. Kleine Wellen schwappten ans Ufer, und Henriette presste ihre Nase fasziniert an die Scheibe, bis sie von ihrem Atem beschlug.
Sie hatte eins der oberen Zimmer erwischt, dritter Stock. Mieke, Coco und sie waren bei der Zimmersuche noch so oft aufeinandergeprallt, dass sie schließlich gemeinsam durch die Gänge geirrt waren und versucht hatten, sich zurechtzufinden. Noch schien alles verwirrend, und da Mieke extrem redselig war, sie fragte, woher sie kamen und was sie alles eingepackt hatten, war es Henriette zusätzlich schwergefallen, sich zu orientieren. Den größten Durchblick im Labyrinth der Aufzüge, Zimmertüren und Richtungspfeile hatte schließlich Coco gehabt, und Henriette fragte sich im Stillen, wie sie das machte durch ihre Sonnenbrille. An einem Knotenpunkt hatten sie sich getrennt – Mieke wohnte in der Sanftmut, Coco in der Inneren Stärke und sie selbst in der Ruhe. Andere Trakte hießen Resilienz, Zuversicht, Hoffnung. Sie alle waren im selben Flügel untergebracht, nur auf verschiedenen Etagen. Henriette fragte sich, ob das mit ihren Diagnosen zu tun hatte, und ihr erster Blick beim Betreten des Zimmers hatte dem Fenster gegolten – doch zum Glück war es nicht vergittert.
Nachdem sie eine Weile auf den See hinausgestarrt hatte, sank sie aufs Fußende des schmalen Bauernbetts. Auf den zehn Quadratmetern Zimmer mit dem pflegeleichten Linoleumboden hatte alles sonst einen bayerisch-hölzernen Einschlag. Die Wände waren mit Raufasertapete tapeziert und zartgelb gestrichen, über dem Kopfende ihres Bettes hing ein Jesuskreuz, und Decke und Kissen, mit artigem Knick in der Mitte, dufteten so dezent nach Bergfrühling wie in einer Frühstückspension. Hätte sie es nicht besser gewusst, mutete ihre Umgebung wie die Kulisse einer Vorabendserie an.
Im Sitzen starrte sie auf ihre Slipper. Obwohl ihre Füße sich heiß und geschwollen anfühlten, war sie nicht in der Lage, die Schuhe abzustreifen. Seit dem Kauf kurz nach der Geburt der Zwillinge war sie mit ihnen durch zwei Jahrzehnte ihres Lebens gelaufen – und am Tag des Unfalls auf die Straße.
Mit Mühe und Not zog sie sich ihre Strickjacke von den Schultern, fiel mit dem Rücken nach hinten auf die Matratze und starrte dann an die Decke mit den dunklen Flecken aus Kiefer. Hier gab es nichts, das sie erledigen musste, niemanden, der gerade ein Kind bekam oder Krebs, keinen Georg, der endlich essen wollte oder ihre Meinung zur Auswahl seiner Krawatte brauchte. Keinen geschwisterlichen Streit, den sie schlichten musste. Nur ihre penetranten Helikoptergedanken, die schon wieder einsetzten. Sie musste sich dringend bewegen!
Die Kraft auszupacken fand sie trotzdem nicht. Sie öffnete den Schrank und schob den Weekender einfach im Ganzen hinein. Den Jutebeutel hängte sie über einen Kleiderbügel, und den Rucksack legte sie in ein Fach. Der rote Trolley verharrte aufrecht neben der Tür. Nur den Inhalt ihres Kulturbeutels schüttete sie wahllos auf den kleinen Schreibtisch neben der Heizung, sodass alles jederzeit griffbereit war, und legte ihre Zahnbürste neben das kleine Waschbecken gegenüber vom Bett. Fertig!
Dann war sie schon wieder erschöpft.
Nach einer weiteren Runde auf dem Bett, bei der sie kurz einnickte, ging sie ziellos im Zimmer umher, wusch sich die Hände und presste dann wieder die Nase ans Glas. Erst als es dunkel wurde, zog sie die Vorhänge zu, öffnete sie aber sofort wieder, denn sobald sie geschlossen waren, litten auch die quälenden Gedanken in ihrem Innern an Klaustrophobie und legten einen Zahn zu. Ampel. Auto. Bremsen. Übelkeit. Nichts mehr. Sie konzentrierte sich auf die Aussicht: Ein paar kleine Segelboote schaukelten arglos in der Dämmerung auf und ab. Im Zimmer über ihr wurde geräuschvoll geräumt.
Als sie nur noch schwarze Nacht und ihr eigenes Spiegelbild sah, hörte sie von unten ganz leise Stimmengewirr und Geschirr klappern. Es war Zeit, wieder hinauszugehen. Bestimmt gab es Abendessen, aber Hunger hatte sie nicht. Ehrlich gesagt wusste sie kaum noch, was Appetit war. Früher hatte sie sich den ganzen Praxisvormittag über auf ein einfaches Schinkenbrot mit Eiersalat und Essiggurke in ihrer Tupperdose freuen können, aber irgendwann war ihr diese Fähigkeit verloren gegangen. In den letzten Wochen hatte sie fast nur noch Kaffee getrunken und das Gefühl gehabt, dass sie davon erst recht müde wurde.
Auf ihrem Nachttisch, neben dem Klinikprospekt und zwei idyllischen Ansichtskarten, lag ein Infoblatt, das sie nun zur Hand nahm. Die Zeitfenster für die Mahlzeiten waren großzügig bemessen: Frühstück gab es von sieben bis zehn, Mittagessen zwischen zwölf und vierzehn Uhr, Kaffee und Kuchen von halb vier bis um fünf und Abendessen von sieben bis neun Uhr. Um dreiundzwanzig Uhr herrschte Bettruhe, was als Körper und Seele in Ruheposition umschrieben wurde. Inzwischen musste es also mindestens sieben Uhr sein. Überprüfen konnte sie es nicht, denn eine Armbanduhr trug sie nie, und der Akku ihres Handys war leer. Sie hatte Gabor und Gilda versprochen, nach ihrer Ankunft eine SMS zu schreiben, aber ihr Ladegerät aus dem Gepäck zu kramen erschien ihr plötzlich so schwierig wie die korrekte Ashtanga-Atmung beim Yoga. Durch Georg würden die Kinder wissen, dass sie sicher angekommen war.
Sie nahm den Lageplan und ihre Zimmerkarte an sich und ging, die rote Strickjacke zurücklassend, so, wie sie war, aus der Tür.
Nachdem sie, trotz Wegbeschreibung, desorientiert zuerst in der Sauna, im Fitnessraum und dann in der Bibliothek gelandet war, erreichte sie endlich wieder das Foyer.
Im Speisesaal war es still. Die Stimmen, die Henriette oben gehört hatte, mussten wohl aus der Küche gekommen sein. Hier saßen nur vereinzelt Gäste, schweigend, jeder für sich. Alle schienen ihre private Komfortzone zu genießen, was Henriette wunderbar passte. Die Bestuhlung war spartanisch, das Büfett dagegen reichhaltig, ein Koch verteilte sogar Fleisch unter einer Wärmelampe auf Teller.
Ein wenig verloren stand Henriette noch am Eingang, als sie Coco entdeckte. Interessiert beugte die sich über eine Reihe silberner Kästen mit warmem Essen, doch ihre Mimik glich mehr einer Inspektion. Noch immer trug sie ihre Sonnenbrille, und Henriette überlegte, ob sie das extravagant fand oder einfach nur albern. Sie stand Coco gut, keine Frage, und es war bereits Anfang Juli, allerdings nur tagsüber und draußen. Die hellste Lichtquelle hier drinnen war die dramatische Ausleuchtung der Brokkoliröschen. Vielleicht war Coco blind? Oder ein Opfer häuslicher Gewalt? Henriette wusste es nicht und, zugegeben, es bewegte sie auch nicht allzu sehr. Sie würde sich jetzt einen Teller nehmen und das Essen einfach nur hinter sich bringen.
»Huhu, Henriette! Hier drüben!« Es war Mieke, die ihr hektisch zuwinkte. Mist.
Ebenfalls noch im Anreise-Outfit saß sie an einem Tisch in der hintersten Ecke des Raumes und war bereits beim Dessert, einem Berg Vanilleeis mit heißen Kirschen. Kombiniert mit ihrem Look und der Vorstellung, sie säße auf einer Vespa, erinnerte der Anblick an eine Werbung aus den Sechzigerjahren, hätte sie nicht den Blick sofort wieder gesenkt, um die Kirschen zu zählen.
Henriette hob kurz die Hand zum höflichen Gruß, drehte sich dann aber um und steuerte auf den Koch zu. Wahllos stellte sie ihre Mahlzeit zusammen: ein Stück rotes Fleisch, Tomatensalat und ein paar Radieschen. Dazu Edamer mit roten Trauben, ein Wiener Würstchen mit Ketchup und einen Becher Hagebuttentee.
»Interessante Kombination«, raunte Cocos Reibeisenstimme im Vorbeigehen. Wieso mischte sich diese Frau eigentlich ständig ungebeten überall ein? Kommt eh alles in einen Magen, dachte sie trotzig und beachtete Stevie Wonder nicht weiter. Mit ihrer wilden Mischung suchte sie sich einen Platz neben der Schwingtür zur Küche, wo es äußerst hektisch zuging, unappetitlich nach Chlorreiniger roch und sich sicher niemand außer ihr hinsetzen wollte.
Ihre Rechnung ging auf. Mit gesenktem Blick schlürfte sie den viel zu dünnen, lauwarmen Tee und versuchte, an gar nichts zu denken. Quietschende Reifen. Der Geruch von verbranntem Gummi auf Asphalt. Hinter dem Steuer saß ein Mann. Rot, die Ampel war rot – für Autos. Oder Fußgänger?
Mist! Mist! Mist!
Mieke hatte verstanden, dass Henriette nicht an Kontakt interessiert war, und sah an ihr vorbei, und Coco verließ indes unverrichteter Dinge den Raum. Offenbar war das Essen ihr nicht gut genug. Oder sie hatte eine Essstörung. Vermutlich beides.
Also stand Henriette zügig auf, stopfte sich im Stehen die letzte Traube in den Mund, beschleunigte den Kauvorgang mit dem Rest Tee, biss von ihrem Würstchen ab, das sie hektisch in den Ketchup tunkte, und suchte ebenfalls wieder das Weite.
Zurück auf ihrem Zimmer verzichtete sie in Ermangelung ihres Schlafanzugs, der sich ganz unten im Trolley befand, darauf, sich auszuziehen, und schleuderte lediglich ihre Slipper von sich. Die Bettdecke bis über beide Ohren gezogen, wollte sie einfach nur schlafen. Nicht denken und schon gar nicht fühlen.
Am nächsten Morgen war sie wie gerädert. Theoretisch konnte sie liegen bleiben, denn ihr offizielles Programm begann erst um zehn Uhr dreißig. Doch das Gedankenkarussell begann sich zu drehen, kaum dass sie die Augen aufgemacht hatte. Sie wusste nicht mehr, was sie geträumt hatte, spürte aber deutlich das ungute Gefühl, das die Nacht hinterlassen hatte. Ihr Körper war wie gelähmt, ihr Geist hyperaktiv. Beide rangen eine Weile um sie, dann sprang sie mit beiden Füßen aus dem Bett.
Zu Henriettes Enttäuschung war der Samstag draußen nebelverhangen, und der Blick durch das Fenster auf den See beschränkte sich auf den Kies unter dem Fenster. Alles war grau in grau. Pragmatisch putzte sie sich die Zähne, fischte ein paar kosmetische Utensilien vom Schreibtisch und machte sich notdürftig zurecht.
Das Frühstück, so sagte ihr die gesteigerte Geräuschkulisse von unten, ging bereits seinem Ende entgegen, aber nach dem gestrigen Abend war sie ohnehin nicht scharf darauf, sich schon wieder in den Saal zu begeben.
Einem unbestimmten Antrieb folgend, der sich nur als schlechtes Gewissen erklären ließ, drückte sie im Aufzug nicht EG, sondern die sanftmütige 2, Miekes Stockwerk.
Als sich Sekunden später die Aufzugtüren öffneten, herrschte auf den Teppichen davor nur gähnende Leere. Klar, was hatte sie erwartet? Dann fuhr der Aufzug zu allem Überfluss auch nicht weiter nach unten, sondern erst mal wieder nach oben, bis ins fünfte Stockwerk. Gelassenheit. Henriette stöhnte. Jede auch nur minimale Fremdbestimmung war ihr zurzeit ein Graus.
»Henriette! Was für ein Zufall!« Wie von Zauberhand stand eine ausgeschlafene Mieke vor ihr und stieg ein. Trotz Henriettes abweisendem Verhalten vom Vorabend schien Mieke nichts von ihrer anfänglichen Freundlichkeit eingebüßt zu haben.
»Ich hab mich verfahren«, log Henriette.
»Ich mich auch!«, strahlte Mieke, offenbar wieder froh über Gemeinsamkeiten, wenngleich speziell diese verhieß, dass sie beide gleich verpeilt waren.
Dann surrten sie nach unten. Mieke trug heute ein Boyfriend – Hemd und eine schwarze Jeans im Skinny-Look, wie Henriette von Gilda wusste. Das Haarband war diesmal blau.
Als sich die Türen im Erdgeschoss öffneten, stockte Mieke kurz. »Um ehrlich zu sein, Henriette, hatte ich das Gefühl, zuerst bei einer ungeraden Zahl aussteigen zu müssen«, gab sie zu und sah Henriette nicht an.
Irgendwie war Henriette froh, Mieke zu treffen, auch wenn sie eindeutig durchgeknallt war. Sie verbreitete eine herzerweichende Authentizität.
»Kein Problem«, lächelte sie. »Um ehrlich zu sein, Mieke, hatte ich gehofft, dich zu treffen.«
Gemeinsam wagten sie den Gang in den Speisesaal, in dem jetzt die letzten Minuten des Frühstücks liefen, und fanden einen Tisch in einem netten kleinen Wintergarten, der Henriette am Vorabend gar nicht aufgefallen war.
»Schön hier, nicht wahr?«, fragte Mieke entzückt, schaute hinaus in die endlose Tristesse und machte es sich in einem von drei Korbsesseln gemütlich.
»Ja«, antwortete Henriette und wusste nicht, ob sie die Deko drinnen oder die Natur draußen meinte. Schön traf auf beides nicht zu. Überhaupt hatte sie den Eindruck, dass Mieke sich ihrer Situation nicht bewusst war. Immerhin war dies nicht wirklich ein Sommerlager, auch wenn Daniel das beschwor.
Schnell pflügte Henriette durch Schüsseln und Säfte. Als sie mit ihrem Teller zurückkam, auf dem sich diesmal eine Wassermelone, ein Brot mit Kirschmarmelade und ein Rote-Bete-Smoothie tummelten, scannte Mieke die geschmacklose Zusammenstellung – und nickte wohlwollend. Das machte sie Henriette vollends sympathisch: Im Gegensatz zur Ponchofrau urteilte sie nicht!
Bei Mieke selbst passte alles so perfekt zusammen wie ihr Style: Sie trank eine Tasse Schwarztee mit einem Schuss Milch und Würfelzucker, aß zwei Weizentoasts, die sie akkurat mit Aprikosenmarmelade bestrich, und hinterließ dabei nicht einen einzigen Krümel. Messer und Teelöffel richtete sie genau im rechten Winkel zu den Toasträndern aus. »Zwangsstörung«, verriet sie. »Ich muss jetzt zum Erstgespräch«, fuhr sie fort und zuckte entschuldigend mit den Achseln.
»Ja, ich gleich auch.«
»Oh, cool. Welchen Therapeuten hast du?«
Henriette sah auf den Ausdruck ihres Wochenplans, der vor ihr lag, und las unter ihrem heutigen Vormittagstermin T.Küppers.
»Schade, meiner heißt Reuters«, bemerkte Mieke, enttäuscht über diese entzweiende Kluft zwischen ihnen.
»Warum bist du eigentlich so fröhlich?«, konnte sich Henriette nun doch nicht länger verkneifen. Vielleicht gab es irgendwo kostenlose Stimmungsaufheller, von denen sie noch nicht wusste?
Mieke lachte. »Findest du? Tja, vielleicht weil ich noch nie einen richtigen Urlaub gemacht habe. Und so wie hier stelle ich mir das vor.«
Henriette dachte an ihre Urlaube mit Georg: Ägäis, Amalfiküste, Andalusien, 4-Sterne-Bunker. Nur auf ein Hausboot hatte sie nie gewollt, weil es war wie zu Hause, nur dass das Spülen und Waschen bei Flussgang noch aufreibender war.
»Ja, vom Büfett her ist es ähnlich«, bestätigte sie, und ein spitzbübisches Lächeln huschte über Miekes Gesicht. Man musste sie einfach mögen. Oder zumindest vor dem Schlimmsten bewahren.
Nachdem sie weg war und Henriette ihre Nahrung vernichtet hatte, schlenderte sie über einen der langen Flure, der die Trakte Selbstheilung und Wohlwollen miteinander verband, um frühzeitig den Raum aufzusuchen, den ihr A. Maier lustlos auf dem viel zu dunkel kopierten Lageplan angekreuzt hatte. Dort würde immer dienstags und donnerstags ihre Gesprächstherapie stattfinden. Einmal die Woche, mittwochs, kam eine Gruppentherapie hinzu, die aus organisatorischen Gründen jedoch erst ab der zweiten Woche stattfand. Heute war nur ein kurzes Anamnesegespräch angesetzt. Mit einem Mal stellte Henriette fest, dass sie vor ihrer eigenen Akte noch mehr Angst hatte als vor der Diagnose von Coco und Mieke.
Dipl.-Psych. Küppers stand auf einem Schild am Ende des Ganges. Und die Bitte: Nicht eintreten! Wir rufen Sie auf. Also setzte sich Henriette auf eine kleine Bank mit bunten Kissen im Perustil, die neben der Tür stand.
Als die Tür nach einer Weile aufging, kam Coco heraus.
»Versuchen Sie, jeden Tag eine winzig kleine Entscheidung zu treffen«, schnappte Henriette einen letzten Gesprächsfetzen auf. »Etwas, das Sie beeinflussen können!« Ohne noch einmal auf das Gesagte zu reagieren oder sie zu beachten, eilte Coco vorbei und setzte flugs ihre Sonnenbrille wieder auf. Henriette konnte gerade noch erkennen, dass sie kein blaues Auge hatte. Irgendwie kam ihr die Frau sogar bekannt vor.
»Frau Hoppe?«, kam es von drinnen.
Henriette sammelte sich kurz, dann trat sie ein und nahm die Hand ihrer Therapeutin entgegen, die sie ihr einladend hinhielt.
»Ah«, entgegnete diese, als sei ihre bloße Präsenz bereits ein wichtiger Hinweis.
Der Raum war klein wie ein Schuhkarton, aber das fühlte sich gar nicht mal schlecht an. Durch die niedrige Decke im Innern entstand eine kuschelige Geborgenheit, und allein durch die luftige Möblierung wich bereits ein kleiner Teil der erdrückenden Last von Henriettes Schultern. Zwei schwarze Chromstühle im Bauhausstil standen sich gegenüber, und ein beleuchtetes 3D-Bild mit einem kitschigen Wasserfall hing über dem kleinen Glastisch dazwischen, auf dessen runder Platte ein Stoß weißes Papier lag.
Frau Küppers war eine ebenfalls sehr aufgeräumte Frau Ende dreißig, mit Porzellanhaut, wachem Blick und einer schwarz umrandeten Nerdbrille, wie ihre Kinder die Brillen mit den großen Gläsern immer nannten. Als sie ihr gegenüber Platz nahm, war Henriette der Rollentausch sofort unangenehm. Es war das erste Mal seit Langem, dass sie ihren Kittel vermisste. Sie fühlte sich schutzlos.
»Gut, was führt Sie zu uns?«, verlor ihre Therapeutin keine Zeit.
Und sofort war Henriette mit der Antwort überfordert. Es gab so vieles und doch nichts Konkretes, weswegen sie in diesem Raum saß. Was sollte sie sagen? Weil ich angefahren wurde und seither unter Schock stehe – oder es schon vorher stand.
Auf einmal schämte sie sich, ja, kam sich wie eine Betrügerin vor, denn was waren ihre Probleme schon gegen … echte?
Coco mit ihrer Bulimie oder Anorexie und Mieke mit diesem Zahlending, die waren hier richtig!
Frau Küppers wartete geduldig und half ihr dann auf die Sprünge. »Von Beruf sind Sie?« Von irgendwo her zog sie in Sekundenschnelle Henriettes Aufnahmeformular hervor. »Ah ja – Kapitänin!«
Mist. Henriette hatte nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet ihr Job Basis des Kennenlernens sein würde. Abgesehen davon, dass sie fürchtete, ihr Aufenthaltsort würde unter ihren Patientinnen publik, wollte sie keineswegs dahin gepackt werden, wohin man ihre Berufsgruppe schon immer geschoben hatte: in die Ecke mit dem Helfersyndrom. Also hatte sie etwas gemogelt.
»Meine Probleme liegen eher im privaten Bereich«, versuchte sie eine Ausflucht.
»Inwiefern?« Frau Küppers sah sie unverwandt an.
Wie ihr Interviewstil war auch sie frei von Schnickschnack. Keine Schminke und kein Schmuck, nur ein paar Sommersprossen auf den Wangen. Nichts lenkte ab, wenn man sie ansah.
»Ich muss immerzu aus dem Fenster starren«, umschrieb Henriette wahrheitsgemäß ein Symptom. »Dem … Kabinenfenster.« Während sie sprach, wusste sie nicht, warum sie sich in diese Lüge verrannte, nur dass es unmöglich für sie war, von der gefassten Ärztin auf die Seite der hilfsbedürftigen Patientin zu wechseln.
»Hm«, machte Frau Küppers, nahm ein DIN-A4-Blatt vom Stapel und kritzelte etwas darauf.
»Die … Ansagen an Bord fallen mir schwer.« Henriette dachte daran, wie mühsam es in letzter Zeit für sie gewesen war, schon kurze Patientennamen wie Inga Pfau aufzurufen.
»Noch etwas?« Frau Küppers klang wie eine Kellnerin, die ihre Bestellung aufnahm.
Henriette wurde nervös. Sie konnte mit allem umgehen: Von Trauer über Wut bis zu Enttäuschung war ihr die gesamte Bandbreite menschlicher Emotionen vertraut. Für jeden Gesprächsverlauf in ihrem eigenen Behandlungszimmer hatte sie eine Strategie entwickelt – oder zumindest eine Antwort parat, egal wie viel Tragik darin lag. Alle saßen sie vor ihr: Schwangere, die um eine Abtreibung flehten, Frauen, die sich sehnlichst ein Kind wünschten, Frauen, die zusammenbrachen, weil sie erfuhren, dass sie Gebärmutterhalskrebs hatten, und Frauen, die bereits eine Blasenentzündung für einen Weltuntergang hielten. Und sie alle wollten von ihr Hilfe, Trost und Verständnis. Und die Kassen wollten, dass sie das alles in siebeneinhalb Minuten schaffte, besser in drei.
Dass ihr weibliches Gegenüber emotional neutral war, verunsicherte sie. Das jemand ihr zuhörte, machte ihr förmlich Angst. Denn wenn nicht sie zuhörte, wusste sie nicht, was sie sagen sollte.
»Ein Passagier hat mich verklagt«, kam es aus ihr heraus. Vielleicht konnte sie ihre wahren Probleme einfach auf eine andere Branche übertragen? Denn es war zwar lange her, aber es stimmte, dass eine Patientin sie wegen ihres unregelmäßigen Eisprungs einst vor Gericht gezerrt hatte, wenn auch erfolglos.
»Also doch auch beruflicher Stress?«
»Ja«, gab Henriette sich geschlagen. Ein Drittel der Wahrheit war vermutlich besser als eine ganze Lüge.
Frau Küppers schrieb eifrig mit, ging zu ihrem Erstaunen aber nicht auf ihre Antworten ein. »Verraten Sie mir Ihre Lieblingsroute?«
Jetzt war sie endgültig in der Bredouille. »Was spielt das für eine Rolle?«
»Keine. Es interessiert mich einfach nur.« Frau Küppers lächelte freundlich, und Henriette wurde rot.
Schnell legte sie beide Fäuste gegen ihre glühenden Wangen, um sie zu kühlen. »Rotes Meer«, erfand sie. In Geografie war sie immer schon eine Niete gewesen und konnte nur hoffen, dass sich im Roten Meer überhaupt Kreuzfahrtschiffe tummelten.
»Wunderbar!«, glaubte ihr Frau Küppers. »Dann werden Sie in dem Segelkurs, den ich Ihnen empfehle, keinerlei Schwierigkeiten haben.«
Henriette schluckte. Damit hatte sie nicht gerechnet. Sie wollte reden, nicht segeln – wenn überhaupt. Oder besser noch: einfach bloß ihre Ruhe haben, bis sich der Schreck der letzten Wochen gelegt hatte und sie zur Tagesordnung zurückkehren konnte. »Segelkurs?«, wiederholte sie zaghaft. »Wissen Sie, ich bin mir nicht sicher, ob ich da …«
»Ich verstehe Ihre Sorge, Frau Hoppe. Sie wollen sich von Ihrem Beruf mal erholen. Aber ich denke, dass es für Sie noch besser ist, Ihrer Berufung einmal in einem Umfeld ohne Leistungsdruck zu begegnen«, argumentierte ihre Therapeutin bestimmt. »Immerhin hat etwas daran Sie ja einmal angezogen, nicht wahr?«
»Okay«, beschloss Henriette keinen weiteren Wind um das Thema zu machen.
»Schön. Der Kurs startet Montag um zehn Uhr. Viel Vergnügen!« Resolut erhob sich ihre Therapeutin.
»Das war’s schon?«
»Wir sollten uns noch etwas für die nächsten Stunden aufheben, oder?« Frau Küppers zwinkerte ihr aufmunternd zu. »Ach ja, ich würde Ihnen noch eine kleine Hausaufgabe mitgeben …«
Wie Henriette diesen Pädagogikstil hasste! Eine kleine Hausaufgabe. Sie war fünfzig!
»Schreiben Sie doch bitte kurz auf, was Sie hier bei uns gern erreichen möchten in den kommenden sechs Wochen Ihres Aufenthaltes. Was möchten Sie wieder tun können? Oder fühlen?«
Henriette antwortete nicht, sondern folgte Frau Küppers zur Tür.
Diese nahm etwas von einem Sideboard und reichte es ihr. »Wenn Sie es wissen, schreiben Sie es auf und stecken es hier rein!«
Henriette inspizierte den Gegenstand in ihrer Hand. Es war eine Flasche mit der Nummer Dreiundzwanzig und einem Korken. Eine Flaschenpost!
»Ahoi!«, hielt ihr Frau Küppers zum Abschied wieder die Hand hin.
»Wie bitte?«
»Oh, tut mir leid. Ahoi wollen Sie in Ihrer Freizeit sicher nicht hören?«
»Nein, nein, schon gut!«, winkte Henriette ab und machte, dass sie davonkam. Keine weitere Sekunde würde sie den maritimen Anspielungen von Frau Küppers standhalten können.
Draußen ließ sie sich noch einmal auf die Perubank fallen. Lügen war eindeutig noch anstrengender als die Wahrheit über ihr Leben. Doch wie sah die eigentlich aus? Dass sie kein Schiff je von innen gesehen hatte, bald jüngstes Opfer des Empty-Nest – Syndroms war – das bekamen die Mütter, die nach dem Auszug ihrer Kinder in ein tiefes Loch fielen – und dass sie sowieso schon einmal heimlich überlegt hatte, sich bei Daniel, seines Zeichens selbst Psychiater, auf die Couch zu legen? Vielmehr mit ihm, und sogar ganz ohne Probleme. Ups. Sofort verbot sie sich diesen Gedanken.
»Seeblick ist ein Ort des Bei-sich-Seins«, hatte er zwischen der Kochsalzlösung, die in ihren Arm floss, und Georgs knallgelben Besucherblumen sitzend geworben. »Mit allen Schikanen, immer voll. Aber ich könnte dich reinbringen …«
»Du klingst wie ein Türsteher«, hatte sie ihn nicht ernst genommen.
»Tja, und dich lasse ich sogar im Schlafanzug rein. Eine einmalige Gelegenheit, Henni!«
»Und du meinst, das habe ich nötig?«
»Keine Ahnung. Finde es raus!«
Schlagartig fiel ihr auf, dass sie ihn seit diesem letzten Gespräch vermisste. Daniel. Du lieber Himmel – sie vermisste Daniel, den langjährigen Freund ihrer Familie!
Diese Erkenntnis schockierte sie so sehr, dass sie von der Perubank aufsprang und versuchte, dem Gedanken davonzulaufen, zurück auf ihr Zimmer, das sie diesmal sofort fand.
4.
»Henriette, bist du da?«
Ein unsanftes Klopfen riss sie aus ihren Träumen.
»Wir müssen zum Segeln! Wir kommen zu spät!« Wieder klopfte es eindringlich an ihre Zimmertür. Das war eindeutig Mieke.
Henriette rieb sich die Augen. War es schon Morgen? Dann hatte sie seit dem Sonntagskuchen Abendessen und Frühstück verpasst und rund … sechzehn Stunden geschlafen?! In Ermangelung eines funktionsfähigen Handys hatte sie noch immer keine Uhr im Zimmer. Benommen setzte sie sich im Bett auf, stieß sich den Kopf am Jesuskreuz an und folgte dann dem Klopfen, das nicht abriss.
»Du klingst wie eine Stalkerin«, öffnete sie Mieke die Tür.
»Das sagt mein Freund auch!«, entgegnete Mieke unbedarft wie eh und je, als wäre das ein Kompliment.
Vermutlich war sie eine Allround-Psychopathin, ebenfalls mit allen Schikanen, dachte Henriette und taumelte schlaftrunken zum Spiegel.
»Hast du bis jetzt geschlafen?« Miekes Blick wanderte anerkennend an ihrer zerzausten Erscheinung vorbei bis zum zerwühlten Bett. »Ist ja toll! Ich habe Schlafstörungen«, erläuterte sie, und Henriette verzichtete auf den Tipp, sie möge Schafe zum Einschlafen zählen.
Dann nahm sie etwas mehr Tempo auf, um sich fertig zu machen. Immerhin konnte Mieke plötzlich die Tür zuschlagen, und morgen würde man dann Henriettes Überreste im Chiemsee finden! Miekes Engelsgesicht neben ihren aufgedunsenen Einzelteilen wäre ein echter Quotenhit in den Abendnachrichten.
»Super, du machst auch Spiegelarbeit?«, ließ sich Mieke auf ihr Bett fallen und sah Henriette dabei zu, wie sie versuchte, ihre Schlupflider zu bekämpfen.
»Äh, nein.« Davon hatte Henriette schon mal gehört: Übungen zur Selbstliebe, bei denen man sich im Spiegel betrachtete.
»Du siehst die Welt ziemlich positiv, was?«, versuchte sie Mieke vorsichtig weiter einzuordnen, während sie ihr Gesicht abtrocknete, ihre Besucherin dabei aber lieber nicht aus den Augen ließ.
Heute trug Mieke wieder ihr rotes Haartuch über dem Kopf geknotet und dazu zum ersten Mal offene Haare mit Pony, in Art der Fifties drapiert. Henriette durfte gar nicht daran denken, dass sie den Stil, den Mieke als Retro kopierte, an ihrer Mutter noch im Original auf Fotos gesehen hatte.
»Ja, total!«, freute sich Mieke über Henriettes Einschätzung. »Ich höre eine Menge CDs über positives Denken und lese Affirmationen.«