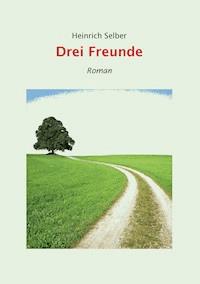
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Der Weg ist das Ziel“ fand Konfuzius, und das kann auch als Motto über dieser Geschichte von drei Freunden stehen. Sie waren 17, als sie Freunde wurden, und ihre Freundschaft hat ein Leben lang gehalten. Der Weg, den jeder für sich finden musste, war spannend, vor allem durch die Zeitereignisse. Es ist die Geschichte der letzten Kriegsgeneration, der „skeptischen Generation“, wie sie Schelsky genannt hat, die hier an uns vorüberzieht. Und so wie sich die persönlichen Schicksale auf dem Hintergrund der Zeitereignisse abspielen, entsteht zugleich eine Chronik der Bundesrepublik aus persönlicher Sicht, die mehr als sechs Jahrzehnte, von 1944 bis 2011, vom Kriegsende bis zur Gegenwart, umspannt. Drei junge Soldaten, Lutz, Hartmut und Friedemar, schließen während ihrer Ausbildung 1944 einen Freundschaftsbund. Doch schon bei ihrem Fronteinsatz trennen sich ihre Wege, aber nach dem Krieg treffen sie sich wieder. Als enttäuschte Idealisten sind sie aus dem Krieg heimgekehrt. Den „Ohne-mich“-Standpunkt lassen sie dennoch bald hinter sich. Als engagierte Demokraten erleben sie das Wirtschaftswunder und die Zeit danach, die verschiedenen Machtwechsel in der Bundesrepublik, die Wiedervereinigung und Europa. Die drei Freunde ziehen am Ende Bilanz. Haben sie es richtig gemacht? Und wie wird die Zukunft aussehen? Auch hier gilt Odo Marquards Wort: Zukunft braucht Herkunft. Wer die Gegenwart verstehen und den rechten Weg in die Zukunft finden will, muss die Vergangenheit kennen. Die Geschichte von den drei Freunden führt sie uns vor Augen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Lutz 1944 – 1948
Hartmut 1945 – 1951
Lisa 1951 – 1963
Kerstin 1961 – 1970
Paschke 1970 – 1975
Reisen 1976 – 1980
Mauerfall 1980 – 1990
Europa 1990 – 2005
Ausklang 2005 – 2011
I
LUTZ
(1944 – 1948)
1
Eigentlich war es eine Idylle – das Häuschen im Branitzer Park. Es stand zwischen hohen Bäumen und von der Veranda aus blickte man auf eine schattige Waldwiese. Ein richtiges hübsches Wochenend-Häuschen, dunkelgrün gestrichen, mit blitzenden Fenstern, und ganz aus Holz.
Genau genommen aber war es eine Baracke, wenn auch in erfreulich neuem Zustand. Sie trug die Nummer 27 und war Teil des „OB-Dorfes“, das aus hundert solchen Baracken bestand, die im Wald verstreut lagen und auf diese Weise gut getarnt waren.
Die Bewohner der Baracke 27 waren zwar nicht unempfindlich für die idyllische Lage ihres Domizils, aber dennoch weit entfernt vom Wochenend-Gefühl. Die drei jungen Männer, die Haus Nr. 27 bewohnten, hatten anderes zu tun, als die Natur zu bewundern. Alle drei waren „OB’s“, Offiziersbewerber, und Teilnehmer des OB-Lehrgangs, dem das Barackendorf als Unterkunft diente. Tagsüber hielt sie der strenge Dienst in Trab, und abends waren sie meist zu müde, um vor dem Zapfenstreich noch viel zu unternehmen.
Aber an diesem milden Sommerabend im Juni 1944 war es anders. Die untergehende Sonne tauchte die Baumkronen in rötliches Licht, es war noch ungewohnt hell für die Tageszeit und irgendwie lag ein Prickeln in der Luft. Die drei waren aufgekratzt wie selten am Abend und kamen nicht zur Ruhe. Sie hockten bei offenem Fenster noch um den Tisch und redeten.
Fast ein halbes Jahr mussten sie hier noch ausharren, bei Unterricht, Gefechtsübungen und Panzer-Exerzieren, ehe sie dann endlich zur Frontbewährung kommen und wirklich dabei sein würden. Dabei war der Krieg doch jetzt offenbar in seine entscheidende Phase getreten. Am Tag vorher war durchgesickert, dass die Landung der Alliierten in der Normandie begonnen hatte, von der man seit längerem munkelte. Aber Rommel würde die Sache schon hinkriegen und Ihnen sicher einen blutigen Empfang bereiten.
„Vielleicht landen wir auch im Westen, wenn wir zur Frontbewährung kommen,“ meinte Lutz Meinburg.
„Aber die Division steht doch an der Ostfront!“ warf Paschke ein.
„Ja, aber bekanntlich muss GD immer wieder Feuerwehr spielen und da wird man sehen, wo es am meisten brennt,“ meinte Harti.
Lutz Meinburg stammte aus Bayern und nach dem Urteil ihres Ausbilders, Oberfeldwebel Schneider, würde er nie ein richtiger Soldat werden, obwohl er durch gute Leistungen glänzte, aber er sei einfach der geborene Zivilist. Anders hingegen Hartmut von Tolk, genannt Harti, dem die Zackigkeit offenbar in die Wiege gelegt worden war. Zwischen den beiden, etwas gegensätzlichen Temperamenten stand Friedemar Paschke, den alle nur Paschke riefen, den Friedemar wollten sie ihm lieber ersparen. Er war ein etwas redseliger und gemütlicher Schlesier, mit leichtem Hang zur Angabe.
„Mir wäre der Westen jedenfalls lieber,“ Paschke grinste. „Denk mal, Frankreich, duftes Essen, dufte Miezen!“
„Bei dir muss alles ‚dufte’ sein“, kommentierte Lutz Meinburg. „Und so was stammt aus einem Pfarrhaus!“
„Als Panzermann hast Du im Osten viel eher die Chance, etwas zu erreichen. Denk nur mal an Oberleutnant Beck von der zweiten Abteilung. Der hat im Mittelabschnitt mit seinem Zug 12 T34 hintereinander erledigt. Und das hat ihm das Ritterkreuz eingebracht!“ argumentierte Harti mit glänzenden Augen.
„Harti träumt jeden Tag vom Ritterkreuz!“ spöttelte Lutz.
„Du vielleicht nicht? Jedenfalls wenn ich erst mal draußen bin, werde ich richtig loslegen.“
„Das kann aber auch schnell ins Auge gehen.“
„Na wenn schon, wer nichts riskiert gewinnt nichts. Ich möchte jedenfalls nicht als 08/15 Offizier herumhängen“, bekräftigte Hartmut von Tolk seinen Standpunkt.
„Bei GD liegst Du da jedenfalls richtig. Wie bist Du eigentlich zu GD gekommen? So viel blaues Blut gibt es da doch gar nicht.“ Lutz Meinburg frotzelte sich gerne mit Hartmut von Tolk, den er anfangs für arrogant gehalten hatte, bis ihm beim näheren Umgang klar wurde, dass Harti im Grunde ein prima Kerl war. GD war die Abkürzung für die Panzergrenadierdivision „Großdeutschland“, die als Elitedivision des Heeres galt und in Berlin das Wachbatallion stellte.
„Na ja, das stimmt schon. Das, was im Kaiserreich die Garde du Corps waren, war dann später ein Potsdamer Regiment, ich glaube Nr. 9. Aber heute ist im Heer GD die Nummer Eins.“
„Ja, aber das was früher die Garde war, ist heute eigentlich die Leibstandarte,“ warf Paschke ein.
„Nee, bloß das nicht! Waffen-SS kam für mich nicht in Frage. Schon wegen der Tradition nicht.“
„Eigentlich merkwürdig,“ meinte Lutz. „Die Waffen-SS und vor allem die Leibstandarte ist doch sicherlich bestens ausgerüstet. Aber ich habe darüber eigentlich auch nie nachgedacht. Für mich kam immer nur das Heer in Frage. Ich will aktiver Offizier werden, aber eben richtiger Offizier. Bei der Waffen-SS hat man immer das Gefühl, dass sie eigentlich eine Organisation der Partei ist.“
„Bei uns war das auch so,“ ergänzte Paschke. „Da hat die Waffen-SS einen richtigen Werbefeldzug veranstaltet, aber keiner wollte hin. Aus meiner Klasse haben sich ein paar schnellstens freiwillig als OB gemeldet, nur damit sie ja nicht bei der Waffen-SS landen.“
„Abgesehen davon, ich wollte zu den Panzern,“ nahm Harti den Faden wieder auf. „Auch deshalb kam für mich nur GD in Frage.“
„Und dann hast du einfach gesagt, ich möchte zu GD, bitteschön? Also mich hat niemand gefragt, wo ich hin will,“ warf Paschke ein.
„Und wie hast Du es wirklich hingekriegt?“ wollte Lutz wissen.
„Geheime Kommandosache!“
„Komm, gib nicht so an, da steckt doch sicher Dein alter Herr dahinter.“
Hartmut von Tolks Vater war General. Er versuchte zwar immer, das unter der Decke zu halten und es war ihm gar nicht recht, wenn er darauf angesprochen wurde. Aber seine Stubengenossen wussten es natürlich.
„Na ja,“ räumte Harti ein. „Mein alter Herr kennt den Manteuffel gut. Das hat vielleicht eine Rolle gespielt.“
Der Divisionskommandeur von GD, Generalleutnant Hasso von Manteuffel, war für die OB’s eine fast legendäre Figur. Lutz hatte ihn nur einmal zufällig bei einer Inspektion gesehen, eine drahtige kleine Gestalt, die Autorität ausstrahlte und was Lutz besonders beeindruckt hatte, waren die strahlenden blauen Augen, deren Blick einem durch und durch ging.
„Ich wollte eigentlich nicht zu den Panzern“, murmelte Lutz versonnen vor sich hin. „Ich wollte zur Kavallerie, als passionierter Reiter. Aber seit der letzten Attacke, die die Polen 1939 gegen unsere Panzer geritten haben, ist das wohl endgültig vorbei. Jedenfalls bin ich dann bei den Aufklärern gelandet, und schließlich irgendwie bei den Panzern.“
„Aber wie bist du ausgerechnet zu GD gekommen?“ wollte Paschke wissen.
„Das weiß ich auch nicht genau,“ entgegnete Lutz. „Ich nehme an, ich habe bei der OB-Eignungsprüfung nicht schlecht abgeschnitten. Jedenfalls habe ich mit der Grätsche als Abgang vom Hochreck offenbar Eindruck geschunden.“
„Vom Hochreck zu GD“, frotzelte Paschke. „Nee, nee, das war’s wohl kaum. Warst Du HJ-Führer?“
„Ja, Stammführer.“
„Siehst Du, das ist wahrscheinlich der Hintergrund, dass sie Dich zu GD gesteckt haben. Jedenfalls hat es mir mal einer so erklärt. Seit Baldur von Schirach bei GD war, landen wohl HJ-Führer vorzugsweise bei GD.“
„Also wäre das jetzt auch geklärt“, beschied Harti. „Aber jetzt mal was anderes. Wie schaffen wir es, an die zwei duften Bienen heranzukommen? Ich weiß inzwischen, wie sie heißen. Die Blonde heißt Eva und die Dunkle heißt Esta.“ Harti berichtete, wie er Evas kleinen Bruder ausgequetscht hatte. Der Junge kam immer mal an den Zaun vom OB-Dorf, der gleich hinter Haus 27 verlief, und wollte Zigaretten gegen Schulterstücke und Rangabzeichen tauschen. So war Harti mit ihm ins Gespräch gekommen.
Eva und Esta waren zwei hübsche Mädchen, die Harti und Lutz bei ihrem letzten Ausgang sehr beeindruckt hatten, allerdings notgedrungen nur aus der Ferne. Nun ging es darum, eine Strategie zu entwickeln, wie man einen gemeinsamen Theaterbesuch zustande bringen könnte. Darüber brüteten sie nun, bis es höchste Zeit war, Schlafen zu gehen.
2
Der Abend im Juni, an dem die Drei in Haus 27 sich zum ersten Mal etwas mehr über Persönliches ausgetauscht hatten, lag nun schon wieder 4 Wochen zurück. Harti und Lutz war es tatsächlich gelungen, mit Eva und Esta in Kontakt zu kommen und für die nächste Woche war ein gemeinsamer Theaterbesuch verabredet. Die beiden waren voll beschäftigt mit Plänen und Vorbereitungen. Harti hatte sogar bereits mit Vogler verhandelt, der ein Lackkoppel besaß und es ihm für den Theaterabend ausleihen sollte.
Dann plötzlich an einem Nachmittag, es war der 20. Juli 1944 und sie waren gerade todmüde von einer Gefechtsübung am Schwarzen Berg zurückgekehrt, hieß es, es sei eine Ausgangssperre verhängt worden. Kurze Zeit später, sie waren eben zurück auf den Stuben und wollten sich waschen, wurde Alarm gegeben. Und dann kamen auch schon die Pfiffe und der Spieß brüllte „Heraustreten“ und „In 10 Minuten steht der ganze Haufen feldmarschmäßig angetreten!“
Das war wohl wieder so eine verrückte Überraschungsübung, dachte Lutz Meinburg, und schloss sich der Schlange vor der Materialausgabe an. Er war als Ladeschütze eingeteilt und nahm die MG-Gurte in Empfang. Er merkte sofort, dass es nicht die üblichen Platzpatronen waren, sondern dass es scharfe Munition war, die man ihm da in die Hand drückte. Da wurde ihm doch etwas mulmig.
Die wenigen Panzer IV, die ihnen zur Ausbildung dienten, waren inzwischen gefechtsbereit gemacht und aufgetankt worden. Und dann setzte sich die Kolonne auch schon in Marsch, aber keiner wusste genau wohin. Es ging nach Norden, Richtung Berlin.
Nach zwei Stunden gab es einen kurzen Halt, Zeit genug, um die verrücktesten Gerüchte auszutauschen. Es hieß, irgendwo seien feindliche Fallschirmjäger gelandet. Andere wieder wollten genau wissen, dass ein Aufstand von Fremdarbeitern im Gang sei. Roland Mahlke, der Funker im Panzer des Kompaniechefs, wollte gehört haben, das Ziel sei Königswusterhausen. Den Namen kannte jeder aus dem Radio, dort stand der stärkste deutsche Sender, der Deutschlandsender. Aber warum sollten sie dorthin? Der Sender war doch sicher gut bewacht, soweit man wusste, von Waffen-SS.
Die Kolonne setzte sich wieder in Marsch und fuhr in die Dämmerung hinein. Dann kam plötzlich ein Kradmelder angeflitzt und die Kolonne wurde gestoppt. Keiner wusste genau was vorging, aber man hatte das dunkle Gefühl, dass irgendetwas Unheimliches im Gang war und die Nerven der jungen Soldaten waren zum Zerreißen gespannt. Inzwischen war die Nacht hereingebrochen, die Besatzungen verließen ihre Panzer und lagerten sich am Straßenrand und warteten, übermüdet und angespannt. Dann kam plötzlich der Befehl zur Umkehr und gegen Mitternacht landete die Abteilung wieder im OB-Dorf.
Im Gemeinschaftsraum gab es ein Radio und die meisten gingen noch dorthin. Und dann kam tatsächlich plötzlich die Meldung, dass in Kürze der Führer spricht. Aus dem Radio hörten sie Hitlers Stimme: „ Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich verbrecherischer, dummer Offiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen und zugleich mit mir den Stab praktisch der deutschen Wehrmachtsführung auszurotten.“ Sein Überleben fasse er als ein Zeichen der Vorsehung auf, sein Lebensziel weiter zu verfolgen. Der ganz kleine Klüngel verbrecherischer Elemente aber werde unbarmherzig ausgerottet. „Diesmal wird nun so abgerechnet, wie wir das als Nationalsozialisten gewohnt sind.“ Mit diesen Worten schloss der Führer seine Ansprache.
Im Gemeinschaftsraum war es still, keiner sagte etwas, keiner wusste was er sagen sollte. Das musste erst verdaut werden. Einer nach dem anderen gingen sie still in ihre Häuser. Sie waren ohnehin zum Umfallen müde.
Im Haus 27 wurde am nächsten Abend die Lage besprochen. Paschke wusste natürlich wieder am besten Bescheid. „Das mit dem Königswusterhausen stimmt. Wir hätten dort den Sender besetzen und die SS festsetzen sollen“, berichtete er. „Und in Berlin hat der Major Remer vom Wachbataillon GD die Lage gerettet und die Verschwörer festgesetzt.“
„Aber das passt doch nicht zusammen,“ meinte Lutz. „Einmal soll GD den Sender besetzen und die SS kaltstellen, und dann wieder hat das Wachbataillon GD den Putsch vereitelt.“
„Ich weiß auch nicht, was man davon halten soll,“ meinte Paschke. „Man weiß nichts Genaues, jeder erzählt etwas anderes. Und wer diese Irrsinnigen waren, weiß man auch nicht genau.“
„Aber es ist wirklich wie ein Zeichen der Vorsehung, dass dem Führer nichts passiert ist,“ sagte Lutz Meinburg mit Ernst und Überzeugung. „Gar nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn der Führer tot wäre.“
„Wahrscheinlich hätte es erst einmal ein Gemetzel zwischen SS und Wehrmacht gegeben,“ vermutete Harti im Ton des kühlen Strategen. „Aber ich zweifle, ob die Wehrmacht den Putschisten gefolgt wäre. Wahrscheinlich hätte sie sie in der Luft zerrissen.“
„Wenn Hitler tot wäre, wäre es jedenfalls mit dem Endsieg auch vorbei. Keine Chance mehr,“ meinte Paschke.
„Es soll ja Leute geben, die am Endsieg zweifeln, auch wenn Hitler lebt“, murmelte Hartmut von Tolk vor sich hin. „Vielleicht ist der Gröfaz gar nicht der geniale Feldherr, für den wir ihn halten.“
„Aber solches Gerede geht doch völlig daneben,“ fuhr Lutz Meinburg auf. „Es bleibt uns doch gar nichts anderes übrig, als mit aller Macht zu kämpfen, damit vor allem die Sowjets nicht weiter vordringen und Deutschland zum Kriegsschauplatz wird.“
„Ist es doch schon längst, warf Paschke dazwischen, „denk nur an die Bombenangriffe.“
„Jedenfalls,“ fuhr Lutz fort, „haben wir noch eine echte Chance. Immer wieder wird von einer Geheimwaffe geredet, aber vor allem, der Führer hat noch immer einen Ausweg aus schwierigen Situationen gefunden. Und man kann sich einfach nicht vorstellen, dass diese ungeheuren Anstrengungen alle umsonst gewesen sein sollten. Nachdem Großdeutschland endlich zustande gekommen ist, muss es auch bestehen bleiben. Und außerdem haben wir alle einen Fahneneid geschworen.“
Keiner wollte mehr weiter diskutieren und so legten sie sich schlafen. Am nächsten Tag hatte sie dann der Dienst schon wieder fest im Griff. Sie zählten die Tage bis zum Lehrgangsende, dann käme der ersehnte Einsatz-Urlaub und anschließend der Fronteinsatz.
3
Dass die rätselhaften Ereignisse vom 20. Juli bald wieder verdrängt wurden, lag nicht nur am harten Dienst, der die jungen Soldaten im OB-Dorf wieder voll im Griff hatte. Im Haus 27 war inzwischen die Episode mit Eva und Esta in den Vordergrund gerückt. Der lang geplante Theaterbesuch hatte endlich stattgefunden und nun, am Tag darauf, saßen die Drei am Abend noch beisammen und ließen die Ereignisse Revue passieren.
Paschke, der nicht mit dabei gewesen war, wollte alles ganz genau wissen, er hatte schließlich auch ein Anrecht darauf, denn er hatte die Theaterkarten besorgt. Das war gar nicht so einfach, dazu brauchte man gute Beziehungen. Aber Paschke hatte sie, irgendwie war seine Familie mit der Familie des Intendanten bekannt.
„Habt Ihr gute Plätze gehabt?“, wollte Paschke wissen.
„Ja, einwandfrei, so ziemlich in der Mitte“.
„Und alle nebeneinander?“
„Nein, immer nur zwei. Harti saß mit Eva ein paar Reihen weiter hinten“, gab Lutz Auskunft.
„Und wie war’s? Lasst Euch doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen!“, schimpfte Paschke.
„Also diese Esta ist ein feines Mädchen“, berichtete Lutz. „Sehr dezent und gescheit, hat sehr vernünftige Ansichten.“
„Und die Blonde?“, wollte Paschke von Harti wissen.
„Ein sonniges Gemüt, wirklich, scheint immer fröhlich zu sein.“
„Und nach der Vorstellung, seid Ihr noch eingekehrt?“, bohrte Paschke weiter.
„Nein, wir haben die beiden zu Fuß nachhause gebracht. Es war doch ein so schöner Abend, ein richtiger schöner Sommerabend!“
„Aha, Gelegenheit zum Nahkampf“, grinste Paschke.
„Du mit deiner verdorbenen Phantasie“, protestierte Lutz. „Das sind doch keine Nutten. Das sind zwei sehr dezente Mädchen!“
„Na ja, einen Kuss hast Du deiner Esta doch wenigstens verpassen können?“
„Wo denkst Du hin, das ist nicht so einfach, das braucht seine Zeit, man muss doch erst ein bisschen warm werden miteinander.“
„Und Du“, wandte sich Paschke an Harti, „bist Du wenigstens weiter gekommen?“
„Ach was, Lutz hat völlig recht, da ist Geduld und Taktgefühl gefragt.“
„Aber so viel Zeit habt Ihr doch gar nicht mehr“, meinte Paschke.
„Es muss doch nicht immer gleich so wild zugehen, wie du es dir in deiner Phantasie ausmalst. Es war einfach schön, mit den Mädchen zusammen zu sein. Und hoffentlich schaffen wir das noch ein paar Mal, bevor wir hier weg müssen“, argumentierte Lutz. Aber im Stillen dachte er, einen Kuss sollte man nächstes Mal schon zustande bringen.
4
Und dann kam der Abend im November, von dem sie wussten, dass es der letzte war, jedenfalls ihr letzter gemeinsamer Abend im Haus 27. Fast 6 Monate lang hatten sie nun zusammen gehaust und trotz der Unterschiede in Herkunft, Temperament und Landsmannschaft fühlten sie sich inzwischen so zusammengehörig, als wären sie gemeinsam aufgewachsen. Dabei hatte sie der reine Zufall hier zusammengewürfelt.
Lutz Meinburg, der als „Stubenältester“ eingesetzt worden war, konnte unabhängig davon sicher sein, dass ihm seine Kameraden Respekt und Vertrauen entgegenbrachten. Er war tatsächlich ein Typ, den man zurecht als „Vertrauen erweckend“ bezeichnen konnte. Besonnen aber nicht tranig, kräftig und zäh aber nicht besonders sportlich, sympathisch aber nicht ausgesprochen schön.
Ein „schöner Mann“ war dann schon eher Hartmut von Tolk, der Lutz um einen halben Kopf überragte, blond mit blauen Augen, straffe Gestalt, „Bauch rein - Brust raus“ hatte noch nie ein Ausbilder zu ihm sagen müssen. Harti, wie sie ihn nannten, war selbstbewusst und wirkte arrogant, wenn man ihn nicht näher kannte. Für Lutz war Harti der typische Preuße. In Berlin geboren, Vater Offizier, aufgewachsen in einem Internat, einem berühmten natürlich. Und dann eben „von Adel“, was Lutz beeindruckte, wenn er es sich auch nicht eingestehen wollte.
Lutz Meinburg hingegen stammte aus einer „gut bürgerlichen“, bayerischen Familie. Sein Vater war das älteste von 8 Kindern einer kleinbäuerlichen Familie gewesen und musste nach der Volksschule eine Lehrstelle antreten, um möglichst rasch Geld zu verdienen. Als kaufmännischer Angestellter arbeitete er sich über die Jahre hin bis zum Fabrikdirektor hoch. Vater Meinburg war bildungsbeflissen und Lutz hatte den Bildungshunger geerbt. Die Büchermengen, die er während seiner Schulzeit vor dem Einrücken verschlungen hatte, waren beachtlich.
Trotz aller Unterschiede hatten sich Harti und Lutz von Anfang an gut verstanden. Inzwischen waren sie wirkliche Freunde geworden, ohne dass man es ausgesprochen hätte.
Friedemar Paschke, der dritte Stubengenosse, wirkte neben den beiden eher anspruchslos. Er war etwas untersetzt und von eher rundlicher Gestalt, sein „Vollmondgesicht“, wie es Harti nannte, wirkte sympathisch, nur dass er so viel „babbelte“, ging seinen Kameraden manchmal etwas auf die Nerven. Aber offenbar hatten die Schlesier das so an sich. So anspruchslos, wie es schien, war Friedemar aber keineswegs. Schließlich stammte er aus einem Pfarrhaus mit entsprechendem Bildungshintergrund und moralischen Grundsätzen. Seine Kameraden wussten, dass er pfiffig und gescheit war und ein enormes Gedächtnis hatte. Sie schätzten ihn durchaus.
Die Stimmung an diesem Abschiedsabend war etwas gedrückt. Sie wollten das zwar nicht wahrhaben und gaben sich betont munter, aber in die Freude, dass sie den Lehrgang gut überstanden hatten, mischte sich natürlich die Ungewissheit über die Zukunft. Vor kurzem waren sie zu Fahnenjunker-Unteroffizieren befördert worden und kamen sich ziemlich wichtig vor. Wenn sie dann aber einem alten Obergefreiten begegneten, der sie grüßen musste, kamen sie sich eher komisch vor. Schließlich waren sie gerade mal 18 Jahre alt und der Gedanke, dass der alte Landser vielleicht Familienvater war, machte sie eher verlegen.
„Glaubt Ihr nicht, dass wir zur gleichen Einheit kommen?“, fragte Paschke.
„Das vielleicht schon“, meinte Lutz. „Aber auf jeden Fall kommt jeder zu einer anderen Panzerbesatzung.“
„Und außerdem sind im Einsatz die Einheiten weit auseinander gezogen“, ergänzte Harti.
„Ganz abgesehen davon, was sonst noch passieren kann.“ Lutz dachte im Stillen, dass sie ja auch verwundet werden konnten, oder den „Heldentod für Führer und Vaterland“ sterben könnten, wie es so schön hieß. Die anderen dachten es auch, aber keiner sprach es aus. Lutz dachte daran, mit welcher Ungeduld er den Fronteinsatz herbeigewünscht hatte, aber jetzt, wo es so weit war, kam bei dem Gedanken doch auch immer ein mulmiges Gefühl auf. So etwas wie Angst, aber das wollte er sich nicht eingestehen.
„Jedenfalls geht’s jetzt erst einmal in den Urlaub!“, rief er aus und verscheuchte die düsteren Gedanken.
„Da hast du Recht“, pflichtete Paschke bei, „und ich hab mir auch schon einiges vorgenommen. Wer weiß, ob es nicht das letzte Mal vor dem Endsieg ist, dass wir zuhause sein können.“
„Jedenfalls sollten wir uns nicht aus den Augen verlieren. Ich geb Dir mal meine Heimatadresse.“ Lutz schob Harti einen Zettel über den Tisch.
„Bei mir ist das schon schwieriger“, meinte Harti. Bei meinem alten Herrn wechselt immer wieder einmal die Adresse.“
„Aber ein Pfarrhaus steht immer am selben Ort!“ rief Paschke dazwischen und warf sich in die Brust. „Ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte!“ deklamierte er mit Pathos.
„’Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn, so nehmet auch mich zum Genossen an’ Es geht doch nichts über eine klassische Bildung, dein Pfarrhaus steht wohl in der Schillerstraße“, mokierte sich Lutz.
„Könnt Ihr’s nicht auch billiger machen? ‚Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste was es gibt auf der Welt!’“ trällerte Harti und versuchte Heinz Rühmann nachzumachen.
„Wie schon Aristoteles über die Freundschaft…“, meldete sich Paschke wieder zu Wort.
„Lass es gut sein“, beschied ihn Lutz. „Hiermit wäre also der Freundschafts-Dreierbund konstituiert.“
Aber zu großen Flachsereien waren sie an diesem Abend nicht mehr aufgelegt. Sie saßen noch eine Weile beieinander, so langsam machte sich auch schon das Reisefieber bemerkbar. Morgen in aller Frühe ging es in den Urlaub.
5
Der Zug, der am 12. Dezember 1944 nach Osten rollte, war vollgestopft mit Soldaten der verschiedensten Wehrmachtsteile. Lutz Meinburg, Hartmut von Tolk und Friedemar Paschke hatten es geschafft, zusammen in das gleiche Abteil zu kommen. Nun saßen sie, eingezwängt zwischen Matrosen und Flaksoldaten, und dösten vor sich hin. Die Landschaft, die am Fenster vorbeizog, war eintönig und eher grau als weiß. Immerhin war schon alles schneebedeckt. Es hieß, es gäbe einen harten Winter in diesem Jahr.
Lutz Meinburg war in Gedanken noch einmal im Heimaturlaub, der nun hinter ihnen lag. Für seine Mutter war der Abschied schwer gewesen. Sie ging noch immer am Stock, nachdem sie sich im Frühjahr das Bein gebrochen hatte. Sein Vater war im Frühjahr gestorben und sein älterer Bruder, der im Südabschnitt der Ostfront stand, hatte seit 8 Wochen nichts mehr von sich hören lassen. Und nun ging auch er an die Front. Seine Mutter war sehr niedergeschlagen und konnte beim Abschied die Tränen nicht zurückhalten.
Aber nicht alles war so traurig wie der Abschied gewesen, in diesen 14 Urlaubstagen. Von den alten Schulkameraden waren zwar die meisten eingerückt, ein paar Jüngere waren aber immerhin noch da, ebenso wie die Mädchen. Bei ihnen konnte man mit der schicken schwarzen Uniform der Panzersoldaten und natürlich mit den silbernen Unteroffiziers-Litzen und dem Ärmelstreifen „Großdeutschland“ Eindruck schinden. Die Tage vergingen viel zu schnell.
Lutz verbrachte die meiste Zeit zuhause bei seinen Büchern, er wollte seine Mutter nicht allein lassen. Außerdem widmete er sich seiner „romantischen Ader“, wie er es nannte. Er schrieb seine Gedichte ins Reine und ordnete sie. Dass er heimlich Verse schmiedete, durfte natürlich niemand wissen. Aber jetzt hatte er Zeit, alles noch einmal kritisch durchzusehen. Manches kam ihm im Ton etwas hoch gegriffen vor. Aber seine Vorbilder, Hölderlin zum Beispiel, hatten auch nicht mit Pathos gespart. Vielleicht konnte er später einen kleinen Gedichtband herausgeben, so wie Schirachs’s „Lied der Getreuen“.
Lutz hatte schon eine ganz schöne Sammlung beisammen. Da gab es ein Gedicht „an die ferne Geliebte“ ( „Wenn in stillen Stunden / mich die Einsamkeit beschleicht, / und des Tages Hastgetriebe/ stillem Frieden weicht, / denk ich Dein!“ ), Es gab ein „Panzerlied“ ( „Deutsche Panzermänner fürchten / nicht Gefahr und nicht den Tod. / Frischer Mut und kühnes Wagen / zwingt am Ende jede Not!“ ), es gab eine Hymne „Der Sieg“ („ Wenn je die Göttin des Sieges mit Lorbeer / dem tapfersten Kämpfer die Stirne umwand, / wenn je das Schicksal, Gerechtigkeit übend, / Recht, Treue, Glauben und Ehre belohnt, / wenn je die Geschichte die eigenen B ahnen / in der Zeiten Wandel sinnvoll verfolgt, / dann muss, o mein Deutschland, der Sieg Dir gehören!“ ), und noch einiges mehr. Sicher würde ihm später auch noch einiges einfallen.
Im Übrigen trieb ihn ein Problem um, das er unbedingt noch lösen wollte. Wer weiß, wie es ihm erging, wenn er jetzt an die Front kam, ob er mit heilen Knochen davon kam, oder ob er vielleicht gar ins Gras beißen würde? Dann wäre das Leben vorbei, ohne dass er die Liebe richtig kennen gelernt hätte. Verliebt war er schon oft gewesen. Und der erste Kuss, den er damals bei seiner Tanzstundendame gewagt hatte, war auch eine wunderbare Sache gewesen. Aber das waren alles gewissermaßen nur Vorspiele. Das richtige „faire l’amour“ hatte er noch nicht geschafft. Die Chancen, dass ihm das in diesen kurzen Tagen gelingen würde, waren gering.
In Gedanken war er alle Möglichkeiten durchgegangen, und schließlich bei seiner Klavierlehrerin gelandet. Margarete Müller-Brandini war zwar mindestens doppelt so alt wie Lutz, aber sie war eine attraktive Frau und außerdem eine Künstlerin, unkonventionell, temperamentvoll mit einem Hauch des Südländischen, wie man schon am italienischen Teil ihres Namen erkennen konnte. Woher der Name Brandini stammte, wusste Lutz nicht. Die Dame lebte allein im Erdgeschoß eines alten Bürgerhauses. Das Klavier-Üben war für Lutz zwar immer eine Quälerei gewesen, aber die Klavierstunden waren umso interessanter. Da war der große Wohnraum, in dem der Flügel stand, der dunkelrote Perserteppich auf dem Parkettboden und die Sitzecke mit den vornehmen Sesseln und dem Ledersofa.
Lutz konnte sich an alles genau erinnern und beschloss, Frau Müller-Brandini einen Besuch abzustatten. So ganz wohl war ihm dabei nicht. Als er vor ihrer Tür stand und auf die Klingel drückte, hatte er doch etwas Herzklopfen. Aber dann war alles ganz einfach. Frau Müller-Brandini öffnete selbst und stutzte. „Aber das ist doch der Lutz Meinburg!“, rief sie dann aus. „Ein richtiger strammer Soldat! Komm herein!“
Aus dem Salon klangen Klaviertöne, die sich nach einer Cerny-Etüde anhörten. „Aber ich störe doch sicher, ich wollte Ihnen nur noch einmal Guten Tag sagen, bevor ich wieder weg muss“, sagte Lutz.
„Das ist lieb von dir, du musst mir erzählen, wie es Dir ergangen ist. Nur, jetzt habe ich gerade Unterricht. Komm doch noch einmal vorbei!“
„Aber gerne, wenn ich darf. Aber ich will ihnen keine Umstände machen.“
„Wie lang bist Du denn noch hier?“
„Der halbe Urlaub ist schon vorbei, nur noch acht Tage.“
„Na, du musst einmal kommen, wenn ich keinen Unterricht habe - am besten gegen Abend. wann hast Du denn Zeit?“
„Ich kann mich ganz nach Ihnen richten.“
„Also dann sagen wir, wie wäre es morgen Abend?“
„Gerne. Wann ist es Ihnen recht?“
„Sagen wir, so gegen sieben. Geht das?“
„Jawoll!“ Lutz, in heller Begeisterung, schlug gewohnheitsmäßig die Hacken zusammen und hätte beinahe „Heil Hitler!“ gebrüllt, schluckte es aber noch rechtzeitig hinunter. „Bis morgen. Auf Wiedersehen!“
Am nächsten Tag konnte Lutz es kaum erwarten, bis es Abend war und er wieder vor Frau Müllers Tür stand. Die Fenster waren nach Vorschrift verdunkelt, aber am Rand war doch ein schmaler Lichtsaum zu sehen. Also musste sie da sein. Er suchte in der Dunkelheit nach dem Klingelknopf und drückte zaghaft. Innen ging eine Tür und dann öffnete sich auch schon die Wohnungstür. Margarete, wie er sie im Stillen bei sich nannte, trug ein langes rotes Kleid, das bis an die Knöchel reichte, ein „Hauskleid“, wie man es damals nannte. Ihr Haar war nicht so streng zurückgekämmt wie sonst, sondern fiel auf die Schultern. Sie komplimentierte Lutz in den Salon. In der Sitzecke verströmte eine Stehlampe gedämpftes Licht und Lutz versank in einem der vornehmen Sessel.
„Magst Du einen Cognac?“, fragte Frau Müller. „Ich habe noch einen Rest für besondere Gelegenheiten.“
„Gern“, entgegnete Lutz. „Und es ehrt mich, dass ich eine besondere Gelegenheit bin.“ Lutz war froh, dass er einen lockeren Ton gefunden hatte, aber er stand immer noch unter Spannung.
„Nun erzähl’ mal!“ sagte Frau Müller und setzte sich ihm gegenüber.
Lutz berichtete von der Ausbildung, von der Garnisonsstadt und vom OB-Dorf. Schließlich ging ihm der Stoff aus und es entstand eine Pause.
„Und jetzt ziehst Du in den Krieg. Schon schlimm, was sie mit euch Jungen alles machen. Wie fühlst Du Dich?“
„Na ja, einesteils…..“, sagte Lutz, und stockte.
„Und andererseits? - Was bedrückt dich denn?“
„Na ja, man weiß ja nicht, ob man wiederkommt.“
„Ja, das ist furchtbar.“
„Aber das muss wohl so sein. Nur“, fuhr Lutz fort, „wenn es einen wirklich erwischt, dann war das Leben doch ziemlich kurz. Und das Wichtigste hat man versäumt.“
„Das Wichtigste?“
„Na ja, die Liebe zum Beispiel“
Margarete sah ihm lange in die Augen dann nahm sie ihre Brille ab, beugte sich vor und strich ihm über die Haare. „Armer Bub“, murmelte sie.
Lutz ergriff ihre Hand und drückte einen Kuss darauf. Er spürte, dass sie seine Wünsche verstanden hatte.
„Nebenan ist auch noch ein Zimmer“, sagte Margarete, fasste ihn bei der Hand und zog ihn hoch.
Diesen Satz und diesen Augenblick sah Lutz Meinburg noch genau vor sich, er würde ihn nie vergessen. So hatte er doch noch die Liebe kennen gelernt.
Lutz fuhr hoch aus seiner Träumerei, als der Zug langsamer wurde und schließlich die Bremsen kreischten. Alles rappelte sich auf, es entstand ein ungeheures Durcheinander, bis jeder seine Klamotten beisammen hatte und alle zum Ausgang drängten. Auf dem Bahnsteig war es bitter kalt und sie waren ziemlich durchgefroren, bis sie sich schließlich zur Frontleitstelle durchgefragt hatten.
6
Der Befehlsstand der III. schweren Tiger-Abteilung des Panzerregiments GD war in einem großen Schlossgut untergebracht. In der Schreibstube wurden sie vom Spieß empfangen.
„Aha, die Herren Fahnenjunker! Na, wir werden schon noch Soldaten aus euch machen!“, begrüßte er sie verheißungsvoll.
Was der Herr Hauptfeldwebel darunter verstand, sollten sie bald merken. Für ihn und die altgedienten Unteroffiziere waren die „jungen Hupfer“ eine willkommene Beute, um sich die Langeweile zu vertreiben. Manchen von ihnen sah man die Lust am Schikanieren richtig an. Harti regte sich darüber auf, aber Lutz beschwichtigte ihn: „Wart nur, wenn wir erst wirklich im Einsatz sind, dann ist das bald vergessen. Ich kann die alten Kommissköpfe ja eigentlich sogar verstehen. In einem halben Jahr, wenn wir von der Kriegsschule kommen und Leutnant sind, müssen sie vor uns stramm stehen. Das wissen sie genau und darüber ärgern sie sich jetzt schon.“
Aber abgesehen von solchen kleinen Ärgernissen waren die drei Fahnenjunker voll Eifer dabei. Sie waren auf verschiedene Panzerbesatzungen aufgeteilt worden und wurden nun in ihre Funktionen eingewiesen. Da hieß es üben, üben, üben. Jeder Handgriff musste sitzen, dass alles funktionierte war entscheidend für das Überleben. Die „Tiger“ - Panzer, mit denen sie hier zum ersten Mal zu tun hatten, waren weit imposanter als alles, was sie bisher gesehen hatten. 60 Tonnen schwer, 750 PS, wenn der Motor dumpf dröhnend ansprang, ging es einem richtig unter die Haut.
Abgesehen vom Drill an den Panzern war das Leben hier im Bereitstellungsraum natürlich viel lockerer als in der Garnison. Sie waren in Privatquartieren untergebracht, in Althof, einem kleinen Dorf bei Rastenburg. Die fünf Kameraden von Lutz’ Besatzung wohnten zusammen in einem Einfamilienhaus bei Frau Borkenhagen. Sie hatte ihren Quartiersgästen ein großes Zimmer frei gemacht, dort schliefen sie auf dem Boden. Nur der Kommandant, Feldwebel Heerwagen, konnte in einem Bett schlafen.
Frau Borkenhagen, deren Mann an der Westfront stand, sorgte sich rührend um die einquartierten Panzermänner. Es gab da auch noch ein hübsches junges Mädchen, das täglich die Milch ins Haus brachte. Frau Borkenhagen gab bereitwillig über sie Auskunft. Sie hieß Anneliese, war die Tochter des größten Bauern im Ort und ging in Rastenburg aufs Lyzeum. Die Kameraden kamen bald mit ihr ins Gespräch, nur Feldwebel Heerwagen brummte etwas von „grünem Gemüse“.
Norbert, der Funker, redete besonders eifrig, wenn Fräulein Anneliese da war, während Lutz sich nicht weiter anstrengte. Er fand Anneliese zwar sehr sympathisch, aber sie würden ja schon bald weiter ziehen und deshalb hatte es keinen Sinn, nähere Bekanntschaften zu schließen. Doch dann bemerkte Frau Borkenhagen zu Lutz, als sie einmal allein in der Küche waren, so nebenbei, dass Fräulein Anneliese sich besonders nach Lutz erkundigt habe und ihn offenbar sehr sympathisch fände. Das brachte dann bei Lutz doch gewisse Überlegungen in Gang.
Inzwischen waren es nur noch 3 Tage bis Heiligabend und es kam eine Art weihnachtlicher Vorfreude auf. Pläne wurden geschmiedet, wie man feiern wollte, zumal es hieß, dass es reichlich Marketenderware geben würde. Am Vormittag des Heiligabend kam Fräulein Anneliese vorbei und verkündete mit feierlicher Miene, dass ihre Mutter und sie sich freuen würden, wenn die ganze Besatzung am Weihnachtstag zum Kaffee und zum Abendessen zu ihnen kommen würde. Da hellte sich selbst Feldwebel Heerwagens verdrossene Miene auf. Zwar lag ihm nichts an „dem Weiberzeug“, aber umso mehr an gutem Essen. Er bedankte sich höflichst und versicherte, dass sie alle mit großem Vergnügen kommen würden.
So wurde das Weihnachtsfest doch noch zu einer schönen runden Sache. Bauer Soyke war bei der Marine und schwamm irgendwo auf der Ostsee herum, aber seine Frau, ihre Tochter Anneliese und die Cousine bemühten sich eifrig um ihre Gäste, die mit größtem Behagen die seltenen Leckerbissen genossen. Es wurde viel erzählt und viel gelacht, sogar gesungen. Für kurze Zeit war der Krieg fast vergessen.
Lutz redete ziemlich wenig, er war in Gedanken angestrengt damit beschäftigt, eine Lösung zu finden, wie er es anstellen könnte, mit Fräulein Anneliese einmal allein zu sein. Sie saßen sich an der großen Tafel schräg gegenüber und hatten verschiedentlich Blicke ausgetauscht und Lutz meinte sich sicher sein zu können, dass sie ihm wohl wollte.
Nach dem Abendessen ergab sich dann doch eine günstige Gelegenheit. Lutz hatte sich erboten, ihren Fahrer, den Obergefreiten Haberkorn, abzuholen, der noch an einem „Oberschnäpser“ - Abend hatte teilnehmen müssen. „Kommt keiner von euch mit?“, fragte er in die Runde. Aber niemand ging darauf ein, alle saßen so wohlig im Warmen und genossen ihren Wein.
Da rief Fräulein Anneliese: „Wenn ihre Kameraden Sie im Stich lassen, dann begleite ich Sie. Sonst verlaufen Sie sich vielleicht noch.“
So kam es, dass Lutz und Anneliese sich in der schönen kalten und sternenklaren Winternacht zu zweit auf den Weg machten. Es war wunderbar still, nur der Schnee knirschte unter ihren Füßen. Lutz betrachtete Anneliese von der Seite. Sie sah reizend aus in ihrem dunklen Pelzmantel. Auf dem Kopf trug sie ein niedliches Pelzbarett, das ihr sehr gut zu ihren blonden Locken stand. Ihr Gesicht war von der Kälte gerötet und Lutz dachte bei sich: „Sie ist wirklich schön!“
Sie plauderten über gleichgültige Dinge und Lutz überlegte krampfhaft wie sie sich etwas näher kommen könnten. Schließlich wagte er es, ihr seinen Arm anzubieten. Sie hängte sich bei ihm ein und er war so kühn, ihre Hand zu fassen und sie zaghaft zu drücken. Lutz spürte an ihrem sanften Gegendruck mehr, als alle Worte ausgedrückt hätten. Vielleicht könnte er sogar einen Kuss landen, dachte Lutz. Aber jedes Mal wenn er dazu ansetzte, schien sie es zu ahnen und wich geschickt aus. Kurz bevor sie dann Albert, den Fahrer, trafen, fasste sich Lutz doch noch ein Herz und sagte: „Das ist doch wunderschön, so ein Spaziergang durch die Winternacht - wollen wir das morgen Abend nicht noch einmal versuchen?“
„Ich weiß nicht“, meinte Anneliese, aber es klang nicht sehr abweisend.
„Ach bitte, geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß!“, bat Lutz. „Wer weiß, wie lang wir noch da sind. Heute wurde schon davon gemunkelt, dass wir bald verladen werden.“
„Aber an Sylvester sind sie doch sicher noch da?“
„Das ist leider gar nicht sicher. Also wie wär’s morgen Abend? Vielleicht um 8 Uhr an der großen Kreuzung?“
„Ich weiß nicht“, wiederholte Anneliese und fügte hinzu: „Na ja, ich werde sehen, dass ich kommen kann.“
Und sie kam wirklich am nächsten Abend. Lutz wartete an der Kreuzung und geriet in Hochstimmung, als er ihre schmale Gestalt in der hellen Winternacht auf sich zukommen sah. Diesmal waren sie schon etwas vertrauter und Lutz hatte sich natürlich eine Strategie zurechtgelegt.
„Arm in Arm im Mondlicht zu spazieren, das ist doch ausgesprochen romantisch, meinen Sie nicht?“
„Ja, es ist schön.“
„Aber zur Romantik passt es gar nicht, dass wir noch so förmlich per Sie miteinander reden. Wollen wir nicht Du zueinander sagen?“
„Ich weiß nicht…“
„Ich heiße Lutz“, fuhr er fort. „Und dass Du Anneliese heißt, weiß ich ja.“
„Aber Sie…“
„Nicht Sie! Du!“ verbesserte sie Lutz. „Und überhaupt, die Brüderschaft muss man natürlich bekräftigen. Das ist so üblich. Und wenn man nichts zu trinken hat, muss es mindesten mit einem Kuss besiegelt werden.“
„Aber das geht entschieden zu weit! So haben wir nicht gewettet“, widersprach Anneliese, aber es klang nicht sehr überzeugend.
Lutz nahm sie in die Arme und küsste sie. Sie wehrte sich zwar ein wenig, aber er fühlte an ihren Lippen, dass sie der Kuss ebenso ergriffen hatte wie ihn. Der Anfang war gemacht und Lutz hatte es nun nicht mehr so schwer, wenn er sich auch jeden Kuss einzeln holen musste. Der halbherzige Widerstand, den Anneliese seinen stürmischen Attacken entgegen setzte, ließ mehr und mehr nach und am Ende wurde er sogar mit ein paar Zugaben belohnt.
Die Zeit war wie im Flug vergangen, als sie feststellten, dass es bereits 11 Uhr war und höchste Zeit, Anneliese nachhause zu bringen. Sie verabredeten sich für den nächsten Tag und Lutz konnte lange nicht einschlafen, weil er sich schon den nächsten Abend ausmalte.
7
„Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende“, schrieb Lutz mit krakeliger Schrift in sein Notizbuch. Es diente ihm als eine Art Tagebuch und das Schreiben fiel ihm schwer, weil der Zug so rüttelte. Lutz verstreute gern Zitate. Er hatte durch seine Lesewut in den letzten Schuljahren einen ansehnlichen Vorrat davon angehäuft. Das Aranjuez aus dem Don Carlos-Zitat war in Lutzens Wirklichkeit das Dörfchen Althof und die schönen Tage lagen gerade 24 Stunden zurück.
Jetzt um diese Zeit hätte er sich mit Anneliese treffen wollen, aber daraus war nichts geworden. Am Morgen nach ihrem romantischen Spaziergang kam der Abmarschbefehl. Sie brauchten fast den ganzen Tag, um die Panzer zu verladen und nun rollten sie seit zwei Stunden in die Nacht hinein.
Den Neujahrsabend verbrachten sie in einem kleinen polnischen Dorf bei Praschnitz. Statt in Althof mit Anneliese zu feiern, schob Lutz in stockdunkler Nacht Wache. Ihre Panzer mussten Tag und Nacht bewacht werden, denn die Gegend wurde von Partisanen unsicher gemacht. Inzwischen war es bitter kalt geworden und Lutz war froh, als er nach seinen 2 Stunden Wache in die Bauernkate zurückkehren konnte, in der sie sich einquartiert hatten. Sie war zwar alles andere als einladend. Sie hausten dort mit der Bauersfamilie zusammen in dem einzigen großen Raum, in einem schrecklichen stinkenden Mief, der aber immerhin warm war. Alles war dreckig und abstoßend, wie es Lutz noch nie vorher erlebt hatte. Sie waren froh, wieder in ihrem Tiger zu sitzen, als es am nächsten Tag weiter nach Süden ging.
Wenige Tage später, am 12. Januar 1945, begann die große russische Offensive. Die Tiger-Abteilung stand bei Praschnitz und sollte zusammen mit den Panzergrenadieren vorrücken. Lutz war als Ladeschütze eingeteilt und konnte nicht sehen was draußen vor sich ging. Er hörte nur die Kommandos des Kommandanten und bediente in rasender Eile das Geschütz, sobald sie wieder einen Schuss abgefeuert hatten. Eine ungeheure Anspannung hielt ihn gefangen, zum Nachdenken hatte er keine Zeit.
Und dann krachte es furchtbar, sie wurden von einem irren Stoß durchgerüttelt und der Kommandant brüllte „Ausbooten!“ Lutz stieß seine Luke auf, rollte sich heraus und ließ sich auf den Boden fallen. Eine große weiße Pläne lag vor ihnen, und ein paar hundert Meter weiter blitzte immer wieder russisches Mündungsfeuer auf. Ihr Tiger war manövrierunfähig und sie krochen zurück. Lutz hatte ein paar Splitter am linken Arm mitbekommen, aber es war nicht weiter schlimm. Sie hofften dass ihr Panzer abgeschleppt und wieder instand gesetzt werden konnte. Das war am 18. Januar 1945, Lutz sollte das Datum nie vergessen, denn der 18. Januar war der Reichsgründungstag von 1871, das war bei Lutz seit der Schulzeit im Kopf hängen geblieben.
Ihr Tiger konnte tatsächlich später abgeschleppt und wieder instand gesetzt werden. 8 Tage später waren sie wieder im Einsatz. Nun fuhren sie nach Norden, denn die russische Übermacht drückte von Süden her immer stärker nach Ostpreußen herein. Sie kamen durch Dörfer und Städte, die bereits verlassen waren und deren Menschenleere niederdrückend wirkte.
Einmal, es war in der Nähe von Ortelsburg, kamen sie auf einen großen Gutshof, auf dem noch ein Hund bellte und Rinder blökten. Sie machten Halt in der Hoffnung, etwas Essbares zu ergattern. Vor dem Gutshaus hielt ein Pferdefuhrwerk, offenbar waren die Bewohner gerade im Aufbruch. Der Kommandant winkte Lutz mitzukommen. Sie gingen ins Haus und hörten aufgeregte Stimmen, denen sie nachgingen. In der großen Gutsküche saß eine alte Frau im Mantel auf einem Stuhl und stierte vor sich hin. Eine junge Frau stand vor ihr und redete auf sie ein. Die junge Frau richtete sich auf und blickte die Panzermänner hilfesuchend an.
„Sie müssen schnellstens weg hier!“, rief ihr Feldwebel Heerwagen zu. „Die Russen sind nur noch eine Stunde weit weg.“
„Wir wollen ja weg“, sagte die Dame, „aber meiner Mutter war es nicht gut und jetzt will sie bleiben.“
Lutz sah die junge Frau an und war beeindruckt. Sie war groß und blond und wirkte trotz der Umstände in ihrem Pelzmantel ausgesprochen elegant.
„Meine Mutter meint, es wird schon nicht so schlimm werden.“
„Nein, nein! Sie müssen weg!“, wiederholte der Kommandant. „Denken Sie an Nemmersdorf!“
„Ja, das ist furchtbar!“
In Nemmersdorf bei Gumbinnen hatten die sowjetischen Truppen im Oktober 1944 schrecklich gehaust. Zivilisten, darunter Kinder waren erschossen worden, Frauen wurden vergewaltigt.
„Mama komm, wir müssen los!“, die junge Frau beugte sich wieder zu ihrer Mutter und versuchte sie hochzuziehen. Ein kleiner weißer Foxterrier sprang kläffend an ihr hoch und wollte sie daran hindern.
„Der Hund“, rief die junge Frau, „was machen wir denn mit dem Hund, den können wir doch nicht auch noch mitnehmen!“
„Nein, nein“, sagte Feldwebel Heerwagen. „Der muss dableiben. Lassen Sie nur, wir versorgen ihn.“ Er griff das kläffende Bündel am Halsband und drückte den zappelnden Terrier Lutz in die Hand. „Meinburg, erledige das“, murmelte er.
Lutz war klar, was damit gemeint war. Er drückte den Hund an sich, ging hinaus auf den Hof und hinter die große Scheune. Er packte den Hund am Halsband und zog seine Pistole. Der Terrier strampelte wild und wollte sich losreißen. Lutz hielt ihn am gestreckten linken Arm, schob mit der anderen Hand den Sicherungshebel zurück und drückte ab. Der Schuss krachte los und der Hund flitzte davon. Er hatte sich losreißen können, bevor der Schuss losging. Lutz stand da und kam sich ziemlich blöd vor, aber es half nichts, er musste wieder vor ins Gutshaus, obwohl er sich schrecklich genierte. Aber die Frauen waren inzwischen auf das Fuhrwerk geklettert und fuhren gerade los.
Die Besatzung kletterte wieder in ihren Panzer, für sie war es auch höchste Zeit, weiter zu kommen. Lutz hing seinen Gedanken nach. Sie waren schon an vielen Flüchtlingstrecks vorüber gekommen, und es war einfach furchtbar zu sehen, wie sich die Menschen mühsam durch Kälte und Schnee kämpften, mit verzweifelten oder stumpfen Gesichtern. Man hätte gerne helfen wollen, aber konnte nicht. Die Szene, die sie eben erlebt hatten, hatte ihm noch einmal gezeigt, wie schrecklich es für die Menschen sein musste, alles stehen und liegen zu lassen, ihr Zuhause aufzugeben und ins Ungewisse zu ziehen. Er dachte an Anneliese Soyke. Es war noch keine 4 Wochen her, dass sie in ihrem schönen Hof Weihnachten gefeiert hatten. Womöglich war Anneliese jetzt auch schon mit einem Flüchtlingstreck unterwegs.
Feldwebel Heerwagen und seine Besatzung mussten mit ihrem Tiger C 33 immer wieder ins Gefecht. Man versuchte, die Russen aufzuhalten, und es gelang ihnen auch immer wieder, feindliche Panzer abzuschießen, aber immer neue T 34 und KW I - Sturmgeschütze rückten nach. Ein Wunder, dass sie selbst noch nicht abgeschossen wurden.
Aber das ließ dann nicht mehr lange auf sich warten. Ende Februar 1945 versuchten sie, den kleinen Ort Zinten zu halten. Am östlichen Ortsrand waren russische Panzer aufgetaucht. Die drei Tiger, die von der Kompanie noch übrig waren, fuhren durch den Ort. Sie mussten eine Brücke überqueren und einen Hügel hinauffahren, zwischen den Häusern, einer hinter dem anderen, wie auf dem Präsentierteller. Der C 33 fuhr an der Spitze, immer gewärtig, dass irgendwann die russischen Panzer auftauchen würden. Aber es blieb still, bis sie die Anhöhe erreicht hatten. Dann tauchte plötzlich rechts von ihnen ein russisches KW II - Sturmgeschütz auf und schwenkte sein riesiges Rohr auf sie zu.
Der Kommandant brüllte: „Ein Uhr - Panzergranate - Feuer!“, aber bevor noch der Richtschütze abdrücken konnte, gab es einen furchtbaren Donnerschlag und die Welt schien unterzugehen. Das 15 cm - Geschoss hatte ihren Tiger-Panzer voll in der Seite erwischt. Der Kommandant brüllte „Ausbooten!“, aber da waren sie schon alle in Bewegung, soweit sie konnten. Ein beißender Rauch schlug Lutz ins Gesicht, er stemmte seine Luke hoch, kroch nach draußen und ließ sich vom Panzer rollen. Vorne kroch Albert, der Fahrer, aus seiner Luke und zog sich am Geschützrohr hoch. Sein Gesicht war rot gesprenkelt von lauter kleinen Splittern. Aber am Schlimmsten hatte es Norbert Klee, den Funker, erwischt. Er hockte auf dem Rand seiner Luke, sein Gesicht war totenbleich und Lutz sah mit Entsetzen, wie aus seinem Bauch weiße Gedärme herausquollen. Der Kommandant und der Richtschütze waren heil davongekommen und gemeinsam hoben sie Norbert herunter und zerrten ihn ins nächste Haus. Hinter ihnen krachte es erneut und Flammen schlugen aus ihrem Tiger, er hatte einen zweiten Treffer abbekommen.
Am nächsten Tag begruben sie Norbert Klee. Irgendwie hatten sie es geschafft, ihn zum Tross zurück zu bringen aber da war er bereits tot. Zu dritt standen sie am Grab und schwiegen. Sie hatten Norbert alle gemocht, er war ein guter Kamerad gewesen, hilfsbereit, und stets zu einem Spaß aufgelegt.
„Jetzt hat es ihn auch erwischt!“, meinte der Richtschütze, Unteroffizier Kroneis. „Dabei hätte er sich vor dem Fronteinsatz drücken können.“
„Wieso?“
„Er war der Jüngste von 5 Söhnen und seine 4 älteren Brüder sind alle gefallen.“
Sie waren alle ziemlich niedergeschlagen. Ihr Panzer war weg, sie waren nun im „Infanterieeinsatz“, wie es im Kommissdeutsch hieß. Viel Zeit zum Nachdenken blieb allerdings nicht, es ging um’s Überleben und man war froh, wenn man wieder einen Tag heil überstanden hatte. Inzwischen war ihnen klar, dass sie in einem Kessel eingeschlossen waren, den die Russen immer enger zogen. Wie sollten sie jemals noch aus Ostpreußen herauskommen? Es gab noch den Ausweg übers Meer, aber diese Chance war äußerst gering.
Im Raum Heiligenbeil, am Frischen Haff, wo sie schließlich landeten, drängten sich neben den Soldaten noch Zehntausende von Flüchtlingen zusammen. Immerhin, der Rest ihrer Kompanie hielt noch zusammen und das war etwas, was einem noch Halt gab. Auf die Kameraden konnte man sich verlassen. Schließlich schafften sie es doch, im Hafen Rosenberg auf eine „Seeschlange“ zu kommen, die sie nach Pillau übersetzte.
Die Hafenmauer in Pillau war mit Parolen vollgeschmiert: „Sieg oder bolschewistisches Chaos!!“, aber darauf achtete niemand mehr. Auch Pillau war vollgestopft mit Menschen und zeitweise unter Beschuss. Lutz und seine Kameraden waren froh, als sie schließlich nach Osten an der See entlang in Marsch gesetzt wurden. Sie landeten in Nodems auf einem großen Gutshof und kamen dort wieder etwas zur Ruhe.
8
In Nodems traf Lutz Meinburg seinen Freund Hartmut von Tolk wieder. Seit Beginn der Kämpfe bei Praschnitz hatten sie sich nicht mehr gesehen. Jeder war in einem anderen Panzer gefahren, aber nun waren alle Panzer weg und was von ihrer stolzen Tiger-Abteilung und ihrer Kompanie noch übrig geblieben war, fand sich hier als Infanterist wieder. Lutz und Harti tauschten ihre Erlebnisse aus.
„Weißt Du wo Paschke abgeblieben ist?“, fragte Lutz.
„Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sein Panzer schon bei Praschnitz abgeschossen wurde. Es hieß, er sei verwundet worden. Aber wie schwer es ihn erwischt hat und ob er durchgekommen ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat er Glück gehabt und liegt jetzt irgendwo im Lazarett.“
Sie saßen in der großen Scheune, in der sie untergebracht waren, auf einem Strohballen, als plötzlich ihre Namen ausgerufen wurden. Sie sollten zum Chef kommen. Der Kompaniechef, Oberleutnant Leussing, eröffnete ihnen, sie hätten sich am nächsten Morgen um 10 Uhr auf dem Divisionsgefechtsstand in Palmnicken zu melden.
„Was sie von euch wollen, weiß ich auch nicht“, fügte der Chef hinzu. „Es sieht so aus, als wenn es alle Fahnenjunker betrifft.“
Frühzeitig am nächsten Morgen machten sich Lutz und Harti auf den Weg. Sie hatten sich genau erkundigt und herausgefunden, dass es am einfachsten war, am Strand am Meer entlang zu gehen, dann mussten sie nach 2 Stunden unweigerlich in Palmnicken landen. Es war Ende März und ein wunderschöner Frühlingstag. Die Sonne wärmte schon richtig. Das Meer war ruhig, die Wellen schlugen leise ans Land. Es war ein schöner, heller Sandstrand, an dem sie entlang gingen, links das Wasser, rechts die Dünen und über allem lag eine wunderbare Ruhe, die nur hie und da von einem Möwenschrei unterbrochen wurde.
„Man könnte meinen, man ist im Urlaub“, sagte Lutz.
„Das ist ja hier auch ein berühmtes Urlaubsland. Ich war mit meinen Eltern einmal hier, da muss ich zehn oder zwölf gewesen sein, so genau weiß ich das nicht mehr. Das Samland hier war berühmt, weil es so unberührt und nicht überlaufen war“, erzählte Harti. „Und dann natürlich gehört das hier zur Bernsteinküste. Wenn wir genau aufpassen, finden wir vielleicht ein paar Brocken.“
Eine ganze Weile gingen sie schweigend nebeneinander her und freuten sich an der Landschaft.
„Glaubst Du, dass wir hier noch einmal herauskommen?“, unterbrach Lutz die Stille.
„Vom Verstand her gesehen - ziemlich unwahrscheinlich. Das geht ja nur über die See. Und die paar Schiffe, die es noch gibt, wenn sie nicht auch noch torpediert werden - und dann nicht allein die Soldaten, auch noch die zigtausende von Flüchtlingen. Es sieht schon finster aus.“
„Aber das kann doch nicht das Ende sein“, entgegnete Lutz. „Es wäre so sinnlos.“
„Aber das ist es doch vielleicht schon lange. Wir wollen es bloß nicht wahrhaben.“
„Wenn es so wäre - warum dann überhaupt noch kämpfen?“, murmelte Lutz vor sich hin.
„Willst Du den Russen in die Hände fallen?“
„Ganz bestimmt nicht - eher bringe ich mich um.“
„Na, siehst Du. Also gibt es doch nur eins: Die Russen möglichst lange aufhalten, damit sich möglichst viele Flüchtlinge absetzen können, und dann weg von den Russen, schauen, dass wir nach dem Westen kommen, zu den Amerikanern oder den Engländern.“
„Meinst Du, dass man allein….“
„Aber natürlich nicht. Allein bist Du sofort verloren. Wir können nur froh sein, dass unser Haufen noch so zusammenhält.“
„Das stimmt“, pflichtete Lutz bei. „Es ist wirklich das einzige, wo man sich noch einigermaßen sicher fühlen kann. Ohne die Kameraden bist du verloren.“
„Und wenn wir es noch eine Weile hinausziehen können“, nahm Harti den Faden wieder auf, „geschieht vielleicht doch noch einmal ein Wunder.“
„Du meinst die Wunderwaffe, von der immer wieder geredet wird?“
„Ach Quatsch, das ist doch nur Propaganda! Nein, aber vielleicht überlegen es sich die Amerikaner und die Engländer doch und ziehen gemeinsam mit uns gegen die Sowjets. Und je länger wir den Iwan aufhalten, desto weiter rücken die Amerikaner vor.“
„Na ja, von Aufhalten kann ja eigentlich kaum mehr die Rede sein. Außerdem spürt man überall die Torschlusspanik. Jetzt ist man so lange durchgekommen, da sollte man am Schluss nicht noch eine verplettet bekommen.“
Den Rest des Weges gingen sie schweigend nebeneinander, jeder hing seinen Gedanken nach. Auf dem Divisionsgefechtsstand kamen sie mit einer kleinen Verspätung an. Auf dem Platz vor dem Gefechtsstand waren etwa 50 Soldaten angetreten, davor stand ein Offizier und hielt eine Rede. Lutz und Harti folgten einem Wink und stellten sich ohne Aufhebens ans Ende des Gliedes. Was sie hörten, waren Durchhalteparolen. Konkret: Königsberg musste um jeden Preis gehalten werden. Aber es klang nicht sehr überzeugend.
Anfang April fiel Königsberg. Die Reste des Panzerregiments GD wurden nach Pillau zurückbeordert. Die Stadt war der reinste Hexenkessel. Sie war vollgestopft mit Flüchtlingen und Soldaten und lag unter Artilleriebeschuss. Am Hafen spielten sich schreckliche Szenen ab, wenn einmal ein Marineprahm bei stürmischer See anlegte. Tausende wollten auf das Fährschiff, aber nur Hunderte hatten Platz.
Oberleutnant Leussing war es gelungen, sich mit dem Rest seiner Kompanie durchzuboxen und auf einen Prahm zu gelangen. Kaum waren sie an Bord, fuhr das Boot auch schon los, denn es sah nach Sturm aus und die Wellen gingen hoch. Sie hatten Glück und landeten ohne Zwischenfall auf der Halbinsel Hela.
In Hela saßen sie 2 Tage fest, kampierten auf der Straße im Hafen. Lutz und Harti konnten schließlich in Erfahrung bringen, wie es weitergehen sollte. Es hieß, bei Berlin stünden noch neue Tiger-Panzer ohne Besatzung, die sollten sie übernehmen. Und tatsächlich, am 3. Tag lief ein dänisches Frachtschiff ein, das Verwundete und Flüchtlinge aufnehmen sollte. Auch Oberleutnant Leussing und seine Kompanie kamen an Bord der „Esbjerg“, die inzwischen völlig überladen war. In der Nacht fuhr das Schiff los und gegen Morgen fuhren sie in einen Hafen ein. Keiner wusste genau, wo sie waren und niemand machte Anstalten, das Schiff zu verlassen. Nur die GD-Panzermänner wurden aufgefordert, sich in Bewegung zu setzen, offenbar hatte man nur wegen ihnen angelegt. Sie gingen an Land und die „Esbjerg“ stach wieder in See. Sie waren in Swinemünde.
9
Lutz Meinburg lag in einem Lazarettzug. Genau genommen waren es einfach nur Güterwagen, bei denen man den Boden mit Stroh bedeckt hatte. Darauf lagen die Verwundeten und halfen sich gegenseitig, so gut sie konnten. Der Zug war jetzt 2 Tage unterwegs. Das heißt, die meiste Zeit stand er, zwischenrein fuhr er dann wieder einmal, eine Stunde oder eine halbe. Immerhin, soweit sie es mitbekommen hatten, fuhr er nach Westen.
Lutz dachte noch einmal zurück, was in den letzten Tagen alles passiert war. Von Swinemünde aus hatte man sie mit der Eisenbahn weiter transportiert, aber nach 2 Stunden, kurz nach einem kleinen Bahnhof mit dem Namensschild „Pasewalk“, hielt der Zug an. Er könne nicht weiterfahren, sagte der Lokführer, da vorne seien die Russen.
Oberleutnant Leussing hatte zusammengetrommelt, was von seiner 11. Kompanie noch übrig war und dann hatten sie sich in Marsch gesetzt, Richtung Neubrandenburg. Das ging so zwei Tage lang über die Dörfer, bis sie hörten, dass in Neubrandenburg inzwischen bereits der Iwan sei. Kompaniechef Leussing hatte seine Leute in einem kleinen Wäldchen zusammengezogen, wo sie in Deckung waren. Nun war zu überlegen, In welcher Richtung sie weiterziehen sollten. Aber viel Zeit zum Überlegen war ihnen nicht geblieben, sie hörten plötzlich hinter sich die Motoren und das typische Quietschen und Kettenrasseln von russischen Panzern und Panzerspähwagen. Es gab nur noch die Möglichkeit, nach vorne durchzubrechen.
Vor ihnen lag ein Saatfeld und eine große, leicht ansteigende Wiesenfläche, dahinter ein Waldrand, der Schutz verhieß. In kleinen Gruppen versuchten sie, über die freie Pläne zu kommen. Als die ersten los liefen, ratterten auch schon die russischen MG’s los. Nun war klar, dass die Russen die freie Fläche voll einsehen und unter Feuer nehmen konnten. Trotzdem, es gab keine andere Möglichkeit, sie mussten hinüber. Einzeln rannten sie los und jeder wusste, dass er um sein Leben lief.
Lutz sprang mit keuchendem Atem immer 10 bis 20 Meter, dann warf er sich wieder hin. Schließlich waren es noch etwa 100 Meter bis zum rettenden Waldrand. Doch als er wieder aufsprang, spürte er einen Schlag im Rücken und stürzte zu Boden. Er versuchte wieder hoch kommen, aber knickte mit dem linken Bein ein. Das russische Feuer wurde stärker und Lutz fing verzweifelt an zu robben. Er hatte kein Gefühl mehr dafür, wie lange er da auf dem Boden kroch, aber schließlich war er doch am Waldrand zwischen den Bäumen. Lutz versuchte, sich aufzurichten. Auf dem rechten Fuß konnte er stehen, aber das linke Bein knickte wieder ein. Mühsam humpelte er weiter, jedenfalls war er jetzt erst einmal aus dem russischen Schussfeld heraus.
In dem Wald ging es jetzt einen steilen Hang hinunter. Lutz ließ sich einfach Meter für Meter hinunterrollen. Unten war eine Straße, daneben eine Bahnlinie und eine Art Bahnhofsgebäude. „Neddemin“ stand auf dem Ortsschild. Von den Kameraden war niemand zu sehen, sie waren wohl schon weiter. Hinter der Bahnlinie kam ein Fluss, aber weit und breit war keine Brücke zu sehen. Flussabwärts sah er ein paar Kameraden, die durch den Fluss schwammen. Hinter ihm war immer noch das russische Geschützfeuer zu hören. Lutz wusste nicht, wie tief der Fluss an dieser Stelle war, und ob man laufen konnte oder schwimmen musste. Er zog seine Tarnjacke und seine schwarze Uniformjacke aus, die Uniformjacke ließ er liegen, die Tarnjacke und seine Pistole hielt er über den Kopf und stieg ins Wasser. Das Wasser war eiskalt, aber das spürte er jetzt nicht.
Wie er hinübergekommen war, wusste er nicht mehr genau. Er erinnerte sich nur noch, dass er drüben auf der Uferwiese liegen blieb. Sein linkes Bein war inzwischen unförmig angeschwollen, er konnte es nicht mehr bewegen. „Jetzt hat es mich doch noch erwischt“, dachte Lutz. Weit und breit war niemand zu sehen. Lutz fühlte sich plötzlich erschöpft und bettete den Kopf auf seine Tarnjacke. Ihm wurde kalt, er wusste nicht, wie es weitergehen sollte. War das das Ende?
Da tauchten plötzlich hinter ihm zwei von seiner Kompanie auf, er kannte die Gesichter, aber nicht die Namen. Sie packten ihn unter den Armen und schleiften ihn mit sich weiter, bis sie zu ein paar Häusern kamen. Die beiden organisierten einen Handwagen und legten Lutz darauf. So zogen sie ihn mit sich fort, Lutz wusste nicht mehr wie lange, bis sie an eine Kreuzung kamen, wo noch andere Verwundete lagen. Eine Art Verwundetensammelstelle.
Lutz dachte später noch oft darüber nach, wie er die Namen der beiden Kameraden ausfindig machen könnte, die ihm das Leben gerettet hatten. Jetzt aber, in dem Lazarettzug, hatten sie andere Sorgen. Der Zug kam einfach nicht schnell genug vom Fleck und es konnte nur eine Frage von Stunden sein, bis die Russen ihn eingeholt hatten. Mit Hilfe des Landsers, der neben ihm lag, er hieß Franz und konnte sich wenigstens auf den Beinen bewegen, dafür war sein rechter Arm einbandagiert, hatte Lutz die verloren gegangene Zeitrechnung rekonstruieren können. So wusste er, heute war der 3. Mai 1945, sein 19. Geburtstag.
Durch die halb geöffnete Waggontür konnte man sehen, dass draußen die Sonne schien. Ein herrlicher Maimorgen. Aber drinnen sah es ziemlich düster aus. Lutz malte sich aus, wie es wäre, wenn sie in die Hände der Russen fielen. Mit Verwundeten würden die Sowjets wohl nicht viel Federlesens machen. Es hieß ja, auf den „Großdeutschland“-Ärmelstreifen sei ein Kopfgeld ausgesetzt. Aber selbst wenn man durchkam, 20 Jahre Sibirien waren wohl das mindeste. In russische Gefangenschaft wollte Lutz auf keinen Fall kommen. So holte er seine Pistole, eine Walther PPK, hervor und legte sie griffbereit.
Der Halt auf freier Strecke dauerte nun schon verdächtig lange. Die Spannung wuchs und mit ihr die Angst, verstärkt durch die Hilflosigkeit ihrer Lage. Franz versuchte heraus zu bekommen, was los war und spähte nach draußen. „Da hinten sind Russen“, berichtete er. „Und irgendetwas ist mit dem Waggon hinter uns los.“ Dann hörten sie ein Gerumpel und der Zug ruckte an.
„Die Wagen hinter uns haben sie abgekoppelt!“, berichtete Franz.
Lutz konnte sich so weit aufrichten, dass er durch den Türspalt sehen konnte. Er sah nun auch fremde Soldaten mit Maschinenpistolen im Anschlag den Zug entlang kommen. Sie trugen rote Bérets und Lutz schoss es durch den Kopf „Das müssen Kanadier sein!“ Jetzt war ihre Zughälfte im Westen angekommen! Lutz hätte vor Erleichterung am liebsten losgebrüllt.
Der Zug rollte nun gleichmäßig dahin und hielt schließlich auf einem großen Bahnhof. Sie wurden ausgeladen und in LKW’s verfrachtet.
Später hörten sie, dass „der Führer auf seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei, bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismus kämpfend, für Deutschland gefallen sei.“ Aber das hatte sie eigentlich merkwürdig kalt gelassen. Im Augenblick dachte jeder daran, die eigene Haut zu retten. Im Gegenteil, wenn Hitler tot war, konnte das nur bedeuten, dass nun der Krieg wirklich zu Ende war.
10
In der Pionierkaserne in Lübeck, die als Hilfslazarett eingerichtet war, fand sich Lutz Meinburg in einem zusammengewürfelten Haufen wieder, von seinen GD-Kameraden war keiner dabei. Was wohl aus Harti geworden war, ob er durchgekommen war bei Neubrandenburg?
Lutz musste im Bett liegen, sein Bein war eingeschient und er hatte noch Fieber. Aber er fühlte sich wohl, wie schon lange nicht mehr. Da waren richtige Krankenschwestern, die sie betreuten, und die Landser um ihn herum waren wieder ganz normal. Die einen klopften Sprüche, andere waren still. Allen aber war eine große Erleichterung anzumerken. Man musste keine Angst mehr haben, der Krieg war vorbei.
Wie es weiter gehen würde, war ungewiss, aber irgendwie würde es schon gehen. Das nächste Ziel war die Entlassung. Erst mussten sie gesund werden und dann kamen sie wohl in ein Gefangenenlager. Aber die Gefangenen musste man ja irgendwann nachhause schicken.





























