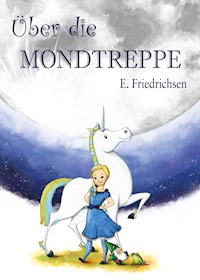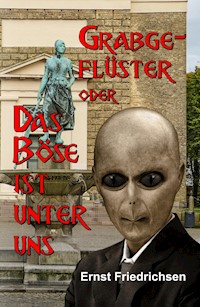4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei kurze Geschichten über das Leben, das Schicksal und ein paar Dinge, die damit zu tun haben. Der Autor wirft einen mehr oder weniger humorvollen Blick auf den Sinn des Lebens oder was man dafür halten mag. Der Leser wird auf eine schwankende Fahrt mitgenommen, zwischen Tragik und Komik pendelnd, die nicht nur auf der Nordsee, oberhalb der dort versenkten Kriegsüberbleibsel, nahe beieinanderliegen. Das Glück des Lebens scheint mitunter zum Greifen nah, liegt aber vielleicht auch schon hinter einem - wohl dem, der es bemerkt hat. So kann der Blick vom großen Ziel rasch auf die Kleinigkeiten das Alltags umschwenken und auf dem Höhepunkt des Glücks, eingebettet in eine liebende Familie, besteht das einzige Unglück dann vielleicht lediglich in einem missglückten Grillnachmittag - je nachdem, was danach noch vom Familienglück übrig ist. Geschichten zum Schmunzeln und über das eigene Leben Nachdenken. Lebe den Tag, will uns der Autor sagen, morgen könntest du vielleicht schon vor Deinem Schöpfer stehen - oder seinem Sohn, der deine Grillwurst futtert, während er sich ungehalten Schlick von den Füßen schabt, der … Na, wir wollen nicht zu viel verraten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ernst Friedrichsen
Drei Geschichten über Gott, Friesland und das Grillen
Copyright: © 2017 Ernst Friedrichsen
Lektorat: Erik Kinting – www.buchlektorat.net
Umschlaggestaltung & Satz: Erik Kinting
Titelgrafik: © Gabriele Rohde (fotolia.com)
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der Inhalt dieses Buches ist frei erfunden, Ähnlichkeiten mit Lebenden oder Verblichenen sind weder beabsichtigt noch herbeigeführt. Auch sind die Ereignisse nicht Gegenstand einer vorhandenen Gegenwart.
Sollten beabsichtigte Ähnlichkeiten auftreten, so sind auch diese zufällig.
Sollten zufällig beabsichtigte Ähnlichkeiten auftreten, so sind auch diese nicht beabsichtigter Zufall.
Sollten Ähnlichkeiten auftreten, die beabsichtigt zufällig sind, so ist es nicht beabsichtigter Zufall.
WARNUNG!
Dieses Buch dient der Kurzweil und ist nicht als Wurfgeschoss gedacht.
Man sollte es nicht im Bett lesen, es besteht die Gefahr des Nichteinschlafenkönnens.
Auch sollte man es nicht lesen, wenn man nach Helgoland möchte.
Unter Umständen sollte man es nicht alleine lesen.
Auch wird geraten, eine Hand freizuhalten – zum Umblättern.
Wer schwache Nerven hat, muss das Buch im Dunkeln lesen, bei Kerzenschein, das beruhigt.
Zur Beruhigung für Sehschwache: Wo keine Buchstaben zu sehen sind, da sind auch keine.
Wer es dennoch liest, tut dieses auf eigene Gefahr, für eventuelle Lachfalten wird keine Haftung übernommen.
Auch ist Angstschweiß nicht versichert.
9 Uhr ab Hamburg
Kapitel 1
13.06., 5.00 Uhr morgens
Nordfriesland an einem Montag. Es war der 13. Juni eines beliebigen Jahres, fünf Uhr morgens. Der Wecker von Heinrich-Jürgen Großmann läutete. Regen klopfte sachte an das Fenster, es windete in leichten Böen.
Heinrich-Jürgen war Landwirt und das mit Leidenschaft. Geboren 1952 durfte er als Erstgeborener den Hof übernehmen. Seine beiden Brüder hatten ohnehin keinen Sinn für die Landwirtschaft: Kühe stinken und machen abhängig, rauben die Freizeit, sonntags Melken ist ein Graus und so weiter. Ludwig-Leonhard hatte sich als Maurer einen kleinen Zweimannbetrieb aufgebaut, der lief ganz gut. Der jüngste Bruder, Ole – den Namen mochte Heinrich-Jürgen nicht und schmierte es seinen Eltern bei jeder Gelegenheit aufs Brot – war als Kfz-Händler mit Werkstatt auch gut beschäftigt.
Heinrich-Jürgen war 1,80 Meter groß und hatte einen leicht nach vorne geneigten Gang. Seine Arme hingen am Körper herunter und schlackerten ein wenig beim Gehen, das ließ seine Erscheinung etwas tumb wirken. »Er läuft wie ein Affe«, lästerte seine Frau, zwar liebevoll, aber für Außenstehende wirkte es durchaus herablassend.
Heinrich-Jürgen hatte sich von seinem Vater davon abraten lassen, bei der Energiewende mitzumachen, so fuhr der Zug mit den Windanlagen an ihm vorbei; auch die Stallungen wurden nicht mit Solarzellen bestückt. Die Schatten der Rotorblätter von Nachbars Anlagen zogen bei tief stehender Sonne über seinen Hof, als wollten sie ihn ermahnen: Wer zu spät kommt, dem fährt der Zug vor der Nase weg.
Die Rotorblätter durchschnitten die Luft mit einem leichten Dröhnen. Vögeln, die der Anlage zu nahe kamen, erging es auch nicht besser – was das Durchschneiden betriff, nicht das Dröhnen. So drehten die Mühlen das Geld in die Taschen seiner Nachbarn.
Sparsam, das war er, aber mit Geld umgehen? Na ja … Es war ihm lieber, wenn seine Frau sich darum kümmerte. Heinrich-Jürgens rechter Stiefel hatte sich mal einen Riss zugezogen. Er war wohl hinter der Ackerschiene hängengeblieben und noch bevor er es merkte, war der Stiefel aufgerissen. Wegwerfen wollte er das gute Stück nicht. Er hatte mit ihm schon eine Menge Mist durchgestanden und so manche Jauchepfütze durchwatet. So schnitt Heinrich-Jürgen, für ihn logisch, den Schaft ab und, damit es ein leichtes Hinein- und Hinausschlüpfen wurde, auch gleich die Hacke mit weg. Da der Rand seiner neuen Gummischuhe nicht versteift war, hingen die Seiten wie Hasenohren runter, was dazu führte, dass er gelegentlich ins Schnüffeln geriet. Das wurde von ihm mit einem Lachen zur Kenntnis genommen und mit den Worten »Ist nun mal so« kommentiert.
Der Schnüffel-Tüffel – damit konnte seine Isolde ihn so richtig zum Kochen bringen, das wusste sie genau. Besonders, wenn sie nicht ihren Willen bekam, konnte sie bösartig werden. Er hingegen konnte nicht aus der Haut fahren, sähe einfach blöde aus, und so kochte er dann innerlich und der Knecht musste als Blitzableiter herhalten.
Es war ihm eine Freude, den Klang des Weckers zu hören, nicht nur als Hörtest. Sein Herz hüpfte vor Freude, da er nun in den Stall konnte, denn da fühlte er sich wohl und sicher; der Stall war seine eigentliche Heimat. Da kam ihm seine Wortkargheit zugute, denn die Kühe stellten keine Fragen.
Seine Frau stand jeden Morgen mit ihm auf. Sie redeten nicht viel miteinander. Er ging melken, füttern und misten, den Trecker treten, wenn ihm danach war, und sie bereitete das Frühstück zu.
Während des gemeinsamen Frühstücks bemerkte sie, dass ihr Gatte mindestens eine Sorge, wenn nicht mehrere hatte, denn das Frühstücksei wurde mit brachialer Gewalt geköpft. Für gewöhnlich titschte er das Ei mit einem leichten Messerschlag an, um es dann komplett aus der Schale zu pellen, dabei lächelt er versunken, um es dann in einem Stück zu verspeisen.
Die Jahre ihrer Ehe hatten sie zu einem Gedanken zusammenwachsen lassen. Sie verstanden sich, ohne viele Worte zu machen, und genauso redeten sie oft aneinander vorbei.
63 Jahre war er nun alt – und kinderlos. Nicht dass er sich keine Mühe gegeben hätte. Mit Eifer hatte er sich bemüht und abgemüht, geradezu mit Begeisterung abgestrampelt, aber vergebens. In jungen Jahren war kaum eine Nacht ungeschwitzt vergangen. Über die Jahre wurden es dann weniger, bis die nächtliche Schwitzerei fast zum Erliegen gekommen war. Seine Isolde war ein Jahr jünger und hatte ihn bis zum Letzten gefordert, aber es war vergebens; auch sie hätte gerne Kinder gehabt.
Der Hof war seit Generationen Heimat der Familie, vom Vater auf den Sohn übergegangen. Heinrich-Jürgen sagte immer, mit Blick auf die Kinderlosigkeit: »Ich habe den Hof nicht von meinem Vater geschenkt bekommen, sondern von meinen Kindern geliehen.« Es war nun so, dass der Erbe fehlte. Das trübte die gesamte Stimmung auf dem Hof ein.
Auch hatte Heinrich-Jürgen einige Schafe, die er auf dem Deich laufen lassen durfte, die waren mehr Hobby, als dass sie für den Betrieb von Bedeutung gewesen wären. Kosteten eher, als dass ein Gewinn zu erwarten war. Seine Isolde wurde darum auch nicht müde, ihm in den Ohren zu liegen, er möge sich doch von den Tieren trennen. Aber er liebte seine Tiere, da er ihnen seine Nöte anvertrauen konnte. Dinge, die er nie mit Isolde bereden würde, konnte er bei ihnen loswerden – die konnten Geheimnisse für sich behalten.
Der Frühling war für Heinrich-Jürgen bisher zufriedenstellend, der erste Schnitt der Heuernte war unter Dach und Fach. Die Schafe und Kühe waren wohlauf. Die Schafe liefen auf dem Deich, das hatte auch einen praktischen Effekt, denn mit ihren kleinen Füßen festigen sie den Deich. Spaßvögel behaupteten, dass die Schafe bei Überschwemmung als Wischmopp dienen könnten.
Schafexperten tauschen sich schon mal aus und das auch gerne weltweit. In Australien gibt es wohl die größten Herden, also wurden nordfriesische Schafexperten geschickt, sich zu informieren, wie es gelingen kann, ohne Deiche Schafe zu halten. Die Nordmänner wunderten sich, dass keiner Platt verstand, die Australier hingegen, dass keiner Englisch sprach, und über die Gummistiefel, die in Grün oder Gelb in der Sonne leuchteten. Man plauderte lustig aneinander vorbei und hatte eine Menge Spaß. Ob die Ausis »Kommt mal wieder« oder »Bleibt lieber zu Hause« sagten, ist nicht bekannt, beim Abschied wurde jedenfalls reichlich gewunken. Auch etwas Verwertbares wurde nicht mitgebracht, da es an der sprachlichen Kompetenz mangelte, aber eine launige lang anhaltende Erinnerung war es dann doch.
Die Nordfriesen boten dem Blanken Hans jeden Tag die Stirn. In jahrelanger Müh ringen sie dem Meer das Land wieder ab, das sich die See bei jeder sich bietenden Gelegenheit holt. Sie werden nicht müde Lahnungen ins Watt zu bauen. Alle sechs Stunden kommt die See vorbei und schaut, ob diese Kerle noch da sind. Und die sind da, emsig und unermüdlich, unterstützt von zahllosen Urlaubern, die durchs Watt wandern. Die zeigen der See die Zähne, meist zitternd vor Kälte, wird behauptet. Eingeschüchtert zieht sich die See zurück. Wenn die See wütend wird, dann aber richtig. Die kommt dann nicht alleine. Sie bringt einen Freund mit: den Sturm. Manches Mal bringt er auch seinen großen Bruder mit, der auf den Namen Orkan hört. Wobei zu sagen ist: Der hört nicht, der ist zu hören. Gemeinsam toben sie sich aus und reißen alles mit, was nicht fest ist.
Aber die Menschen an der Küste – wettergegerbt, regenerprobt, sonnenverbrannt, sonniges Gemüt – spucken in die See, fluchen dem Wind entgegen, blinzeln in die Sonne und holen die Brötchen beim Bäcker. So auch Bauer Heinrich-Jürgen, der mit dem Südwester zum Bäcker stakste und sich, triefend vor Nässe und über das Wetter fluchend, einen Kaffee gönnte.
Montag, 9.30 Uhr
Zur Bäckerschen sagte er: »Bei dem Wetter jagt man ja keine Sau vor die Tür.«
»Dann bist du wohl ein Eber«, meinte diese schnippisch.
»Danke. Und dir habe ich mein Herz ausgeschüttet.«
»Ich werde deine Sorgen ins nächste Brötchen einbacken«, bot sie ihm an.
»Dass deine Zunge ein Eigenleben hat, macht mir keine Angst, aber wo andere ein Herz haben, hast du einen Eiszapfen. Das weiß doch jeder.«
»Ich bin nicht an der Küste geboren. Eure wettergegerbten Seelen versteht ohnehin nur ihr. Ihr trampelt im Watt rum und lockt auch noch Fremde mit, nur um im Matsch rum zu tapsen, Ihr pinkelt selbst bei Sturm gegen den Wind, nur damit auch jedem klar ist: Mit uns nicht. Also im Kaffee ist dein Regen auch drin oder soll ich den Regen ausgießen und du nimmst den Kaffee pur?«
»Backsche, du hast eine Seele, da würde selbst der Teufel zum Christentum wechseln.«
Er süffelte den Kaffee nach altem Brauch mit Schnaps, denn er selbst mitbringen musste, was seine Isolde allerdings nicht wissen durfte, denn bei Alkohol sah sie Rot.
Ein anderer vom Wetter gegerbter Bauer, Joachim Grimm, gesellte sich zu ihm.
Heinrich-Jürgen deutete auf die Herrin der Brötchen und meinte: »Die ist hier gut aufgehoben.«
»Wie meinst du denn das?«, fragte Joachim.
»Na, die Backsche auf dem Hof und die Schafe stehen Spalier zum Appell, eine Pfote an der Hutkrempe.«
Ein Dritter mit einer Tasse in der Hand stellte sich dazu. Es war Herbert Johansen, ein Ureinwohner der ganz alten Sorte, immer bester Laune.
»Na Johansen? Wieder Oberkante Unterlippe? Bei dir hat Kimme und Korn eine andere Bedeutung – wenn du zu viel Korn hast, liegst du auf der Kimme. Wenn du das Korn auf dem Feld reifen siehst, freut sich bei dir die Leber«, lästerte die Bäckereifachverkäuferin.
»Werd nur nicht frech. Wir Friesen sind früher auf. So was wie dich sind wir früher zur Arbeit geritten, nur nannten wir die Schindmähren.«
Sie ergriff ein Mandelhörnchen und drohte den dreien. »Passt auf, dass ich euch keine Schafskötel in den Kaffee rühr.«
»Mit dir, du garstiges Weib, möchte ich gerne mal Klabusterbeeren beißen«, lachte Johansen.
»Früher haben wir drollige Frauen im Deich vergraben, damit der besser hält. Ist leider aus der Mode gekommen«, mischte sich Heinrich-Jürgen ein. »Aber wir haben dich trotz deiner frechen, oder gerade wegen deiner frechen Schnauze gerne, ohne dich wären wir nicht hier«, ergänzte er.
Sie senkte die mandelbewehrte Faust.
Der alte Deichgraf Tönnsen, der steif und fest behauptete, dass er Klaus Störtebeker noch persönlich gekannt hat, traf ein. Wie alt der Tönnsen wirklich war, wusste in der Tat niemand genau, aber Zweifel waren angebracht. Der versuchte, wie jeden Tag, zu den dreien dazu zu stoßen, scheiterte aber wie immer an der Stufe vor der Tür. Die Stufe war ein Hindernis, für den alten Mann kaum zu überwinden. Er wohnte gleich neben dem Laden, war aber so schlecht zu Fuß, dass er 15 Minuten brauchte, von seiner Haustür bis zur Stufe am Bäckerladen.
Mit vereinten Kräften wurde er emporgehoben.
Er war Gebissträger. In der Regel trug er das Gebiss in der Hosentasche, da es ihm wegen schlechten Sitzes stets aus dem Mund fiel. Einst vergaß er es einzusetzen und setzte sich drauf, wobei das Unterteil zerbrach. Seit dem Tag pfiff er ein wenig beim Reden. In früheren Jahren kontrollierte er die Deiche auf Schäden. Das machte er auch heute noch, obwohl er schon längst in Rente war. Er machte sich jeden Tag auf den Weg zum Deich, gelangte aber nur bis zum Deichfuß. Aus einem Buchenzweig hatte er sich einen Gehstock geschnitzt, mit Mustern und Ornamenten, mit dessen Hilfe kam er gut zurecht. Einen Rollator hat er bislang vehement abgelehnt. »Ich bin doch nicht gehbehindert«, fluchte er dann, wenn einer damit anfing.
Er stand nun vor dem Tresen, erleichtert, es geschafft zu haben. »Fachst mir einen Faffee fit Fahne, drei Fück Fucker, Fittfe«, sagte Tönnsen, dabei hatte er eine Hand vorm Mund, da er Angst hatte, dass sich sein Gebiss alleine über die Torten hermachen könnte.
»Ich mach dir einen doppelten Schuss Milch rein, damit der Milchumsatz steigt.« Dabei sah die Backsche zu den Landwirten, denn die hatten sich in den letzten Tagen stark über die fallenden Milchpreise ausgelassen.
Da hatte sie einen Nerv getroffen und es ging hitzig zur Sache. Vorneweg Heinrich-Jürgen, denn er hatte noch vor geraumer Zeit investiert, in die Zukunft, denn der Markt gab es gerade her. Nun war die Nachfrage aus China weggebrochen und die Quotenregelung auch dahin. Eine Überproduktion hatte begonnen, die Handelseinschränkungen mit Russland waren auch zu spüren. Er musste derweil Klimmzüge am Brotkasten machen, das durfte aber keiner wissen. Und dass er einen Termin bei der Bank hatte, wegen einem kleinen Überbrückungskredit, sagte er auch keinem, denn die Blöße mochte er sich nicht geben.
Nun betrat der Pastor den Laden, um seine Brötchen abzuholen, wie jeden Tag. »Ach, da sind ja meine U-Boot-Christen«, lachte er.
»U-Boot was?«, fragte die Backsche und sah den Pastor verwundert an.
»Die«, dabei zeigte er auf die drei Bauern, »tauchen nur in der Kirche auf, wenn es was zu feiern gibt, U-Boot-Christen eben.« Heinrich-Jürgen sah den Pastor böse an. »Wir haben nun wirklich ernstere Sorgen, als in deine Kirche zu kommen!«
»Heinrich-Jürgen«, begann der heilige Mann mit sanfter Stimme, »ich kenne eure Besorgnis um die Milchpreise und die Sorge um eure Existenz, aber lasst nicht ab vom rechten Weg, der Herr ist mit euch. Vergesst das bitte nicht.«
»Ich hab es nicht bös gemeint, Paster. Ich bin nur sauer, weil die Lage so ernst ist und die Politik uns im Stich lässt.«
Für gewöhnlich regen Nordfriesen sich nicht auf, das liegt nicht in ihrer Natur, ist ihnen zuwider.
»Und wie ist es mit dem Export von eurer Milch?«, fragte der Pastor.
Herbert Johansen antwortete schon fast verzweifelt: »Wenn wir unsere Milch nach Afrika schicken, dann verarmen die Bauern da, deren Milchwirtschaft bricht dann zusammen und die kommen als Flüchtlinge zu uns, das ist genau die Politik, die wir seit Jahren betreiben. Auf der einen Seite Entwicklungsgelder zur Stärkung der Wirtschaft in den Entwicklungsländern und dann mit billiger Milch gegensteuern, unheimlich intelligent ist das nicht. Ein Absterben der Höfe wird beginnen und nur die, die genug entgegenzusetzen haben, werden überleben.«
Der Pastor würde lieber gehen, ihm wurde unbehaglich, aber er gab nicht auf, seine Schäfchen in die Kirche zu bekommen.
So sind die Nordfriesen: bekannt für ihr unbeirrtes Denken. Dazu nehmen sie eine bequeme Körperhaltung ein. Dazu bedarf es einer Schaufel oder Forke, ein Gatter tut es zur Not auch. Das wiederum ist eine Erfindung der Friesen wegen dem Denken: Sie nehmen eine leicht gebeugte Körperhaltung ein, das hilft beim Denken. Wenn jemand stört, so wird er vergattert, dafür das Gatter. Das hat sich in den Sprachgebrauch der gesamten Republik eingeschlichen. Beim Denken ist Störung unbedingt verboten. Wenn denn eine Lösung in Sicht ist, kommt der Zeigefinger nach oben und macht kleine bis große Kreise. Der Kopf folgt den Kreisen oder geht entgegengesetzt. Wenn es nicht passt, kommt ein deutliches »Ach, nööh!«, bei dem kurz der Kopf gehoben wird. Und der Denkvorgang wird wiederholt.
Ein Denkvorgang ist überliefert: Da ist ein Friese ins Watt gegangen um Muscheln zu suchen, Bewaffnet mit einer Forke und einem Eimer. Da muss ihm ein Gedanke gekommen sein. Welcher, ist nicht bekannt, muss aber wichtig gewesen sein. Er hat seine Forke in den Boden gerammt und seine Denkhaltung eingenommen. Nordfriesen, muss man wissen, kommen langsam aber mit Überzeugung. Da muss ihn die Lösung überkommen haben, aber auch die Flut – er ist ertrunken; der Zeigefinger war noch in der Luft, als man ihn aus dem Watt bergen konnte. Es war noch zu erahnen, dass er seine Kreise in die Luft geschrieben hatte. Nach der Stellung des Kopfes war es wohl ein Ach nööh. Auch als die Ebbe einsetzte, hat er seine Denkhaltung beibehalten, was für die Beharrlichkeit der Nordfriesen spricht. Er ist somit der erste bekundete Ach-nööh-Taucher. Ob er ein erneutes Denken begonnen hätte, lässt sich leider nicht mehr feststellen.
Auch gelingt es einem Nordfriesen durchaus auch mal Beamter zu werden. Dass es da beim Denken ein Problem gibt, liegt einzig daran, das er in seinem Büro keine Forke in den Boden rammen kann, denn die Körperhaltung ist sehr wichtig. Ein Gatter gibt es auch nicht, so legt er aus der Not den Kopf auf den Tisch und geht Kaffee trinken. Das erklärt die vielen Kopflosen in den Ämtern. Das hat nichts mit Büroschlaf zu tun, das ist ein reiner Denkprozess.
Einem Nordfriesen würde es auch nie in den Sinn kommen, sich etwas aus dem Kopf schlagen zu wollen, denn das tut weh. Den Kopf hat sich da auch noch keiner zerbrochen, so einen großen Nussknacker haben die Nordfriesen nämlich nicht.
Um tiefschürfend nachzudenken, geht man in den Keller.
Die Mathematik wurde in Nordfriesland späht eingeführt, abends um acht. Ein friesischer Rechner ermittelte, dass bei 12 Grog die Augen das Schielen beginnen, so würde man 24 Grog benötigen, um nach hinten sehen zu können. Nach dieser Theorie begann er mit dem Laborversuch, der in der Dorfkneipe aufgebaut wurde; anderen Orts nennt man das Selbstversuch. Es begann die Umsetzung: Bei 14 Grog lag sein Kopf auf dem Tisch – nicht dass er besoffen war, nein, das war nur zur Neuberechnung, wie er betonte. Das logische Denken ist den Friesen in die Wiege gelegt. So auch dem kleinen Max. Drei Jahre war der Knabe. Und Spross einer Friesenfamilie, der in einer Umgebung mit ausgeprägten Brüsten aufwuchs. Wenn ihm nach kuscheln war, so lag er weich und geschützt. Der kleine Max durfte irgendwann in den Kindergarten. Und ihm war nach kuscheln. Nach längerem Drängen erbarmte sich eine Kindergärtnerin und nahm den kleinen Mann auf ihren Schoß. Max schmiegte sich an ihre Brust.
Nach einer Weile des Kuschelns, sah Max die Frau an: »Hast du auch einen Busen?«, fragte er mit kindlich-unschuldigem Gemüt. Die Frau, leicht irritiert, antwortete wahrheitsgemäß: »Ja, jede Frau hat einen Busen.« Sie deutete mit der Hand auf ihren Oberkörper.
»Kannst du den morgen mitbringen?«, fragte Max.
Dieses Ansinnen war der Guten wohl zu dreist, die Eltern wurden einbestellt und mussten Fragen beantworten, die nur jemandem einfallen konnten, der keinen Sinn für kindliches Verlangen hat. Auch waren es für friesische Verhältnisse zu viele Worte.
Beerdigungen sind unangenehm, besonders für den Verstorbenen. Davon werden auch die Nordfriesen nicht verschont. Ein betontes Moin beim Einbuddeln ist eine gute Predigt. Ein lang gezogenes Moiiin heißt: Gut dass wir dich los sind. Wenn es während der Beerdigung regnet, spart man sich die Tränen.
Heinrich-Jürgen beschäftigte einen Knecht und eine Magd, die gute Dienste verrichteten. Die Mahlzeiten wurden auf dem Hof gemeinsam eingenommen. Dabei musste man nur auf eines achten: Sobald sich die Nasen berührten, war Vorsicht geboten und man musste drauf achten, dass einem keiner in die Lippen biss.
Auch ist beurkundet, dass ein Nordfriese Amerika entdeckte. »Dissen Ammer, Erika machste mitnehm« Diese Aussage ist niedergeschrieben worden, wie man sehen kann.
Montag, 10.15 Uhr
Die drei Einträchtigen standen nun beim Bäcker. Jeder war eine Weile mit seinen Gedanken auf Abwegen, nur um dem Pastor eins auszuwischen, denn Gedanken sind frei.
Der Schornsteinfeger August Lohmann betrat den Laden. »Machst du mir vier Brötchen mit Käse, Ei und Mettwurst?« Er sah zu den dreien und dann zum Pastor. »Musst du deinen Schäfchen nachlaufen?«
»Die drei da sind die schwarzen Schafe der Gemeinde, die sind auch geschoren, nicht kirchlich kompatibel, meinte der Pastor.
»Na, Tönnsen«, dabei klopfte Lohmann dem Alten auf den Rücken, sodass sich dessen Zähne über die Lippen schoben und nur mit einer Reflexbewegung aufgehalten werden konnten.
»Muft du mif so erschreckfen, if hatte fafst mein Gebif verforen.«
»Ich komme am Nachmittag bei dir den Schornstein fegen.« Mit einer Tasse Kaffee gesellte er sich zu den dreien. »Was meint ihr, treten die Briten aus Europa aus? Die haben ja heute Abend ihre Wahl.«
»Das wäre sehr dämlich, der Schaden für die Engländer dürfte größer sein als der Nutzen. Dass die das tun, kann ich mir nicht vorstellen«, meinte Herbert.
Joachim gab zu bedenken, dass die Schotten die Gelegenheit nutzen dürften und auch ein Referendum durch führen würden: »Es dürfte den Schoten nur zu recht sein, wenn die Engländer austreten, die werden ihre Möglichkeit erkennen und England ihrerseits den Rücken kehren, das würde den Briten das Herz brechen und dem Wahn, eine große Nation zu sein, ein Ende bereiten.«
Der Pastor meldete sich zu Wort: »Wenn die Nationalisten in Europa die Oberhand gewinnen, ist die Demokratie in Gefahr, der Weg von der Unabhängigkeit zur Diktatur ist nur kurz und zu verlockend, die Gefahr, dass bei einem Auseinanderbrechen der EU eine unkontrollierte Egomanen-Gesellschaft an die Macht kommen könnte, ist groß, diese Popolisten.«
»Heißt es nicht Populisten?«, unterbrach Herbert den Geistlichen.
»Bei mir sind das Popolisten, basta! Das sind die Marktschreier des Verderbens.«
Heinrich-Jürgen stellte seine Tasse ab. »Ich muss mich auf den Weg machen. Ich habe noch einen Anhänger auf der Koppel stehen«, erklärte er seinen Freunden. In Wirklichkeit hatte er aber ein Treffen mit dem Bankmenschen.
»Der war so schweigsam?«, fragte der Schornsteinfeger.
»Er hat wohl Geldsorgen. Seine Frau, so wird erzählt, lässt beim Kaufmann anschreiben«, sagte Joachim und hob dabei die Hände.
»So schlimm steht es um ihn?«, meinte der Pastor besorgt.
Der Pastor ging eilig hinter Heinrich-Jürgen her: »Heinrich, warte mal!«
Heinrich-Jürgen hörte nicht oder wollte nicht hören, ging in seinem ihm eigenen schlaksigen Stil weiter.
»Eh, nun warte doch!« Der Pastor wurde etwas energischer. Heinrich-Jürgen stoppte, ungehalten. »Was ist, Paster? Ich habs eilig!«