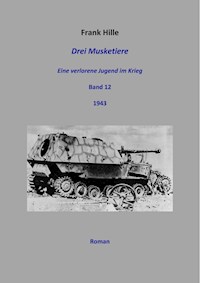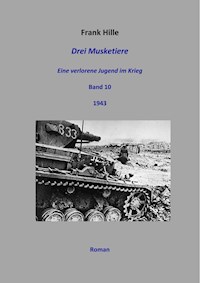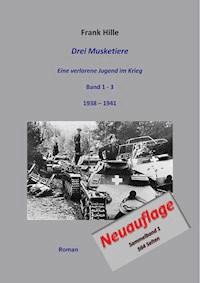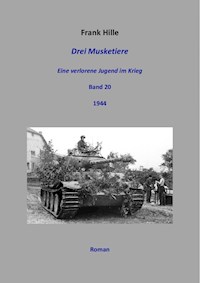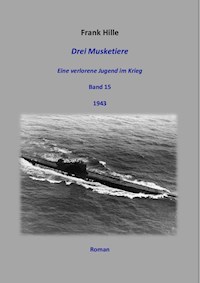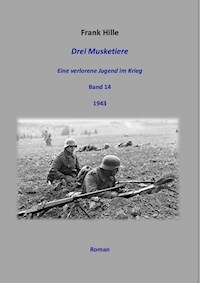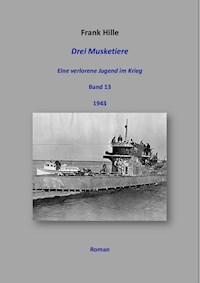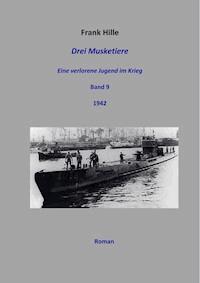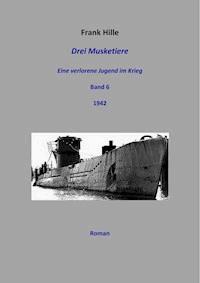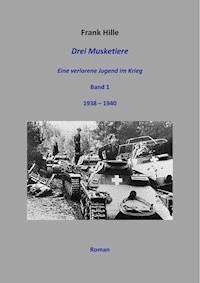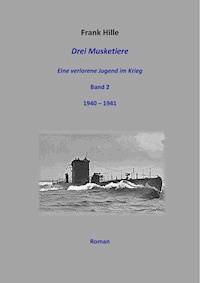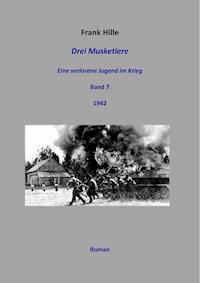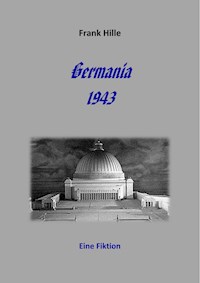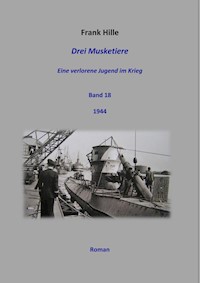
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zu Beginn des Jahres 1944 sind die deutschen Truppen von der Roten Armee schon weit in die Ukraine zurückgedrängt worden. Nunmehr zeigt sich die drückende materielle und personelle Überlegenheit der Sowjets mit aller Deutlichkeit. Dazu kommt, dass der Gegner aus den vielen bitteren Erfahrungen des Krieges gelernt und die richtigen Schlüsse für die Truppenführung gezogen hat. Es gibt kaum noch Unterschiede in der Qualität der strategischen und taktischen Planung der Operationen zu denen der deutschen Gegenseite. So gelingt es den Russen, bei Korsun einen Kessel zu bilden, in dem fast 60.000 deutsche Soldaten eingeschlossen sind. Günther Weber steckt mit seinen SS-Grenadieren auch darin fest. Unter hohen Verlusten können sich die Männer bis zu den weiter westlich liegenden deutschen Auffangstellungen durchschlagen. Fred Beyers Panzerverband operiert auch in dieser Gegend und sichert das Absetzen der Einheiten. Martin Haberkorn ist mit seinem Boot im Atlantik im Einsatz und erlebt aufs Neue die Grausamkeit des Seekrieges.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Drei Musketiere
Eine verlorene Jugend im Krieg
Band 18
1944
Copyright: © 2019 Frank Hille
Published by: epubli GmbH, Berlin
www. epubli.de
Martin Haberkorn, 17. Februar 1944, bei Grönland
Günther Weber, 17. Februar 1944, nach Lysjanka
Fred Beyer, 17. Februar 1944, vor Lysjanka
Martin Haberkorn, 17. Februar 1944, zur Biskaya
Günther Weber, 17. Februar 1944, Lysjanka
Martin Haberkorn, 17. Februar 1944, bei Grönland
Günther Weber, 17. Februar 1944, westlich von Lysjanka
Martin Haberkorn, 17. Februar 1944, zur Biskaya
Fred Beyer, 17. Februar 1944, Medvyn
Martin Haberkorn, 17. Februar 1944, zur Biskaya
Fred Beyer, 17. Februar 1944, Medvyn
Martin Haberkorn, 17. Februar 1944, zur Biskaya
Günther Weber, 18. Februar 1944, nach Lemberg
Martin Haberkorn, 18. Februar 1944, zur Biskaya
Fred Beyer, 19. Februar 1944, Kosjatyn
Günther Weber, 19. Februar 1944, östlich von Lemberg
Martin Haberkorn, 23. Februar 1944, Biskaya
Martin Haberkorn, 17. Februar 1944, bei Grönland
Es waren viele Faktoren gewesen, die den Angriff der deutschen U-Boote auf den Geleitzug in einer Katastrophe enden ließen. Wie erwartet, waren die Kolonnen der Frachter und die Begleitschiffe kurz vor Mitternacht bis auf 30 Kilometer Entfernung an die einen Sperrriegel bildenden Boote herangekommen. Zu dieser Zeit war dichter Nebel aufgezogen, es hatte zu regnen begonnen und der Seegang betrug Stärke 5. Obwohl zwei Geleitzugträger im Konvoi mitfuhren hatten diese schlechten Witterungsbedingungen den Einsatz der Flugzeuge verhindert und damit war die sonst schon weit vor dem Geleit operierende Luftsicherung nicht möglich gewesen. Ohnehin waren Nachteinsätze der Flieger gegenwärtig nur von Flughäfen an Land aus machbar, denn es fehlten noch die erforderlichen technischen Mittel um Starts und Landungen auch in der Dunkelheit auf den Trägern zu absolvieren, der hohe Seegang hätte aber auch dies ausgeschlossen, selbst wenn sie denn vorhanden gewesen wären. So gesehen schienen die Erfolgsaussichten der U-Boote gar nicht so schlecht zu sein, denn ob das Radar auf den Schiffen unter diesen widrigen Umständen richtig funktionieren würde war nicht sicher. Da der Konvoi aber unerwartet einige Male gezackt hatte und nicht zur vorausgesehenen Zeit auf den Speerriegel gestoßen war, hatten die Attacken der Boote erst gegen 5 Uhr früh auf das Geleit beginnen können. Die Sicht betrug kaum 400 Meter und die deutschen Kommandanten wussten, dass sie bei einem Überwasserangriff sehr gefährdet sein würden. Da die Morgendämmerung in dieser Jahreszeit gerade angebrochen war blieb noch etwas Zeit für überraschende Angriffe, und jetzt noch länger zu warten und bei dem dann ungünstigen Tageslicht anzugreifen erschien fast aussichtslos.
Als Auftakt des Gefechts wurde ein an Backbord des Konvois stehendes Boot von einem Zerstörer doch mit dem Radar geortet. Das Kriegsschiff war mit großer Fahrt auf das Boot zugelaufen und hatte dann in einer Entfernung von 500 Metern die Scheinwerfer an Bord voll aufgeblendet. Die Männer auf dem Turm waren von dem heranstürmenden Schiff auch wegen der schlechten Sicht vollkommen überrascht worden. Binnen weniger Sekunden hatte sich der Rumpf des Schiffes mit hoher Gewalt kurz vor dem Turm in den Bootskörper gebohrt. Sämtliche in dieser Lage einsetzbaren Geschütze des Zerstörers hatten das Feuer eröffnet und auf der Brücke des U-Bootes ein Blutbad angerichtet. Der Kommandant dort sah seinen Wachoffizier plötzlich von den großkalibrigen Geschossen geköpft in die Brückenwanne kippen, dann wurde er selbst von mehreren Kugeln in die Brust getroffen und getötet. Auch alle anderen Männer auf dem Turm fielen in dem Eisenhagel. Obwohl die Waffen weiterschossen drängten weiter Männer aus dem Inneren des Bootes nach oben, aber auch sie wurden gnadenlos zusammengeschossen. Der Zerstörer war dann auf große Fahrt zurückgegangen und bösartig knirschend hatte sich der Bug des Schiffes aus dem Bootkörper herausgezogen. Die Wucht des Aufpralls war so enorm gewesen, dass der Druckkörper des U-Bootes aufgerissen worden war und das Wasser durch ein großes Leck ungehindert in das Innere stürzen konnte. Es hatte nicht einmal 5 Minuten gedauert, dann war das Boot gesunken. Die Beschädigungen am Bug des Zerstörers waren vergleichsweise gering, es kam zwar viel Wasser über, aber das Schiff blieb schwimmfähig.
Ein zweites Boot hatte soeben zum Anlauf auf die äußere Steuerbordkolonne der Frachter angesetzt als es ebenfalls geortet wurde. Diesmal betrug die Entfernung zu der Fregatte ungefähr 1.000 Meter. Die Brückenbesatzung hatte das Kriegsschiff gesehen, war eingestiegen und das Boot mit Alarmtauchen unter Wasser gegangen. Der Kommandant hatte keine andere Wahl gehabt: wenn er oben geblieben wäre hätte man sie zusammengeschossen oder gerammt. Leuchtraketen abfeuernd war die Fregatte schnell an der Tauchstelle gewesen und hatte etliche Wasserbomben geworfen. Eine etwas dumpfer als sonst üblich dröhnende Detonation klang aus der Tiefe herauf, dann trieben schnell Leichen und Wrackteile auf. Ein drittes Boot hatte sich auch gerade noch mit Alarmtauchen seinem Verfolger entziehen können und durch eine sofortige Kursänderung unter Wasser noch einmal etwas Zeit gewonnen. Der Kommandant war schnell auf große Tiefe gegangen und eine Weile war der Kontakt zu dem Boot abgerissen. Dann wurde es in 220 Meter Tiefe langsam fahrend wieder aufgespürt, und da zwei Schiffe es jagten, hatte sich ein ganzer Wasserbombenteppich über ihm ausgebreitet. Die Schäden an Bord waren so schwerwiegend, dass sich der Kommandant zum Auftauchen entschloss, aber die Ventile der Anblasleitungen klemmten, so dass die Druckluft das Wasser nicht aus den Tauchzellen drücken konnte. In mehr als 300 Metern Tiefe wurde der Druckkörper dann zusammengepresst, die Spanten brachen, und durch ein großes Loch an der Steuerbordseite entwich die im Boot befindliche Luft extrem schnell und fauchend wie aus einem Hochofen. Egal wo sie sich im Boot aufhielten, die Männer wurden mit enormer Kraft davon mitgezogen und gegen die Wände, Böden, Maschinen, Aggregate geschleudert und getötet oder ertranken jämmerlich.
Haberkorns Horcher hatte die typischen Geräusche von Wasserbombenexplosionen deutlich hören können, und dann auch die Sinkgeräusche, als die Druckkörper der Boote in der Tiefe kollabierten. Mit versteinerter Miene hatte er das an seinen Kommandanten gemeldet. Innerhalb kurzer Zeit waren drei Boote vernichtet worden und auch wahrscheinlich alle Männer an Bord ums Leben gekommen: 150 Seeleute. Alle mit Hoffnungen und Wünschen für die Zukunft, einige schon mit Familien und Kindern, alle mit Eltern, Verwandten, Freunden. Haberkorn konnte jetzt nicht nur in sicherem Abstand mit dem Geleit mitlaufen lassen und sich so aus der Gefahrenzone heraushalten. Erstens würde er es seinen Männern nicht erklären können warum er gerade nach der Versenkung der Kameradenboote inaktiv geblieben wäre, und zweitens würde es in gut zwei Stunden zu dämmern beginnen und dann wäre ein Angriff wirklich aussichtslos. Haberkorn beschloss mit einem Anlauf alles auf eine Karte zu setzen und er konnte sich die Ausmaße des Konvois vorstellen, er würde viele Kilometer lang sein. Trotz des starken Geleitschutzes wäre es vielleicht möglich durch eine Lücke in der Sicherung durchzuschlüpfen und einen Fächer zu schießen. Er wusste auch ganz genau, dass sie nur diesen einen Versuch haben würden. Was von Vorteil sein könnte war der hohe Seegang, der das Boot gut verbergen könnte. Allerdings würde dies auch die Schussgenauigkeit der Torpedos beeinträchtigen, aber das musste er in Kauf nehmen. Da das Geleit in mehreren Kolonnen marschierte könnte selbst ein Fehlschuss auf einen Frachter dennoch in den inneren Marschsäulen ein Ziel finden. Haberkorn war mit dem I. WO und dem Obersteuermann auf dem Turm, das UZO war bereits auf die Zielsäule aufgesetzt worden. Die Nummer Eins saß im Turm vor dem Torpedovorhalterechner und wartete auf die Angaben des I. WO. Das Boot hatte leicht auf die Backbordkolonne zugedreht und lief mit hoher Fahrt auf diese zu. Haberkorn wollte sich noch die Option offenlassen, eventuell schnell abdrehen zu können, falls ein Kriegsschiff sie entdecken würde. Erst in der wirksamen Schussentfernung wollte er dann auf Null Grad gehen. Jetzt ging es darum ungesehen so nah als möglich heranzukommen. Das Boot stampfte und rollte durch den Seegang, aber auch auf den feindlichen Schiffen würde die Beobachtung des Meeres schwer sein. Haberkorn schaute angestrengt durch das Fernglas nach vorn, der Obersteuermann beobachtete die anderen Sektoren. Plötzlich stieg eine Leuchtrakete trotz der schon einbrechenden Morgendämmerung über dem Geleitzug auf.
„Haben die n Vogel“ rief der Obersteuermann verblüfft aus.
Dann erfolgte eine gewaltige Explosion, ein Tanker oder ein Munitionsfrachter war getroffen worden. Haberkorn sah jetzt die Silhouetten der außen laufenden Schiffe für ein paar Sekunden sehr hell, aber das hatte ihm zur Orientierung gereicht.
3.000 Meter.
Das getroffene Schiff brannte lichterloh, vermutlich also doch ein Tanker.
Eine zweite Detonation an der Steuerbordseite.
Wahrscheinlich war ein Boot in das Geleit eingedrungen.
Haberkorn wollte die Verwirrung beim Gegner nutzen.
„Anlauf beginnt, beide AK, Mündungsklappen öffnen!“
2.800 Meter.
„I. WO“ brüllte er „Zweierfächer auf den großen Frachter in 5 Grad, zwei Einzelschüsse auf die dahinter laufenden Fahrzeuge!“
Der Wachoffizier schaute durch das UZO und gab die Werte in den Turm weiter.
„Entfernung: 2.300 Meter. Lage links. Geschwindigkeit: 6 Knoten. Tiefe: 4 Meter.“
Der Maat im Turm stellte die Regler am Vorhalterechner ein, dann rief er nach oben:
„Eingestellt!“
Kurz darauf:
„Deckung!“
2.000 Meter.
„Feuererlaubnis“ rief Haberkorn.
Der I. WO verbesserte die Werte nochmals, dann rief er:
„Fächer Rohr 1 und 2: los!“
Nach einem Augenblick:
„Rohr 3: los! Rohr 4: los!“
„Auf 170 Grad gehen“ befahl Haberkorn.
Das Boot drehte ab, dann zeigte das Heck auf die Schiffsreihe.
„Rohr 5: los! Rohr 6: los.!“
„Alarm!“
Haberkorn stieg als letzter ein und setzte das Turmluk dicht.
„Auf 120 Meter gehen, 150 Grad!“
Mit halber E-Maschinenfahrt ging das Boot auf Tiefe. Der LI hatte es gut in der Hand. Es war still im Boot, nur leise Befehle waren zu hören. Der Obersteuermann lehnte am Kartentisch, er hatte jeweils eine Stoppuhr in jeder Hand.
„Peilung“ fragte Haberkorn leise, aber der Horcher winkte ab.
Die Sekunden tröpfelten weg, nichts geschah.
„Aufkommen!“
Das Boot war eingesteuert und lief vom Geleitzug ab. Haberkorn wusste aber, dass sie noch sehr nah an den Schiffen standen und mit den E-Maschinen nur langsam davon wegkamen. Unbewusst zählte er die Zeit mit. Die Torpedos waren aus ungefähr 1.800 Metern losgemacht worden, eine recht große Entfernung. Es wäre günstiger gewesen, aus kürzerer Distanz anzugreifen, aber die Lage hatte das nicht zugelassen. Die G7 liefen mit maximal 44 Knoten, ungefähr 70 Kilometern in der Stunde, fast 20 Metern in der Sekunde. Eigentlich müsste nach ungefähr 90 Sekunden klar sein, ob die Geschosse getroffen hatten oder nicht. In wenigen Augenblicken würden sie es wissen.
Günther Weber, 17. Februar 1944, nach Lysjanka
Bis zum Einbruch der Nacht des vorigen Tages hatten die SS-Grenadiere noch ihre Stellungen halten können, dann war in den frühen Morgenstunden der Rückzugsbefehl gekommen. Der Kessel war jetzt im östlichen Bereich nur noch ein schmaler Schlauch von knapp drei Kilometern Breite, und dieser Bereich war zum Friedhof für hunderte Soldaten und zum Schrottplatz für zerstörte Militärtechnik geworden. Es war vor allem das Bild der auf engem Raum liegenden Leichen, der gesprengten Geschütze, brennender LKW und einer total verwüsteten Landschaft, welches sich Weber einprägte. Irgendwie empfand er es als Vorschau auf kommende Zeiten, aber so würde es dann nicht mehr in Russland, sondern in Deutschland aussehen. Und vermutlich noch schlimmer, denn ein in die Enge getriebener Gegner, die sichere Niederlage vor Augen, würde selbst das eigene Land noch mit in den Abgrund reißen wollen. Die Wehrmacht und die anderen Truppengattungen waren angeschlagen, aber es war nicht so, dass sie zu schwach wären, um dem Gegner nichts mehr entgegensetzen zu können. Weber ging davon aus, dass sich der Widerstand sogar noch deutlich verhärten würde, je näher der Feind den Reichsgrenzen kommen würde. Momentan war aber ihre Aufgabe, jetzt noch das Schlupfloch aus dem Kessel zu erreichen, denn viel Zeit blieb nicht mehr, da der Kessel auch am westlichen Ende immer mehr zusammengedrückt wurde und kaum noch anderthalb Kilometer Breite aufwies. Dort drängten sich die demoralisierten deutschen Soldaten und hatten die Sowjets ihre Kräfte konzentriert. Alles, was hinter dieser Stelle lag, würde ihnen so wie so früher oder später in die Hände fallen.
Günther Weber stapfte mit seinen Männern kurz nach fünf Uhr auf die Ausbruchsstelle zu. Noch zirka 30 Grenadiere seiner Kompanie marschierten mit ihm mit. Überall im Gelände bewegten sich kleinere Trupps vorwärts. Es waren die Reste der Nachhut und im Gegensatz zu früher war der Gang der Soldaten nicht mehr aufrecht und selbstbewusst, sondern eher schlurfend, geduckt und mit auf den Boden gerichteten Blicken. Es schien so, als würden seelenlose Maschinen durch die Gegend ruckeln. Die meisten Männer führten nur noch Handfeuerwaffen mit sich, einige wenige schleppten Panzerfäuste. Für diese Waffen gab es keine Trageriemen, so dass die Soldaten sie am unteren Rohrende festhielten und schräg nach oben gerichtet auf ihren Schultern abstützten. Was den Optimismus der Männer sicher nicht erhöhte war der Marsch durch die Hinterlassenschaft der deutschen Divisionen. Man sah auch einige frisch aufgeschüttete Erdhügel, Massengräber, in denen die Toten eiligst verscharrt worden waren. Die Zeiten des Antretens der Einheit und des Salutschießens waren lange vorbei. Günther Weber erinnerte sich an die in seinen Augen feierliche Zeremonie nach ihrem ersten Einsatz im Polenfeldzug, bei dem einige Kameraden gefallen waren. Die Toten waren in noch offenen Särgen aufgebahrt worden, bis auf Lachmann, dem eine Kugel den halben Schädel weggerissen hatte. Dessen Sarg war bereits geschlossen und mit einer Reichskriegsflagge dekoriert worden. Der Kompaniechef hatte eine würdevolle Trauerrede gehalten, dann waren die Karabiner durchgeladen und dreimal abgefeuert worden. Heute war so etwas vollkommen unvorstellbar, denn es ging um die Rettung des eigenen nackten Lebens und es schmerzte Weber, dass sie ihre Toten ohne eine Geste des Abschieds zurücklassen mussten. In diesem Augenblick musste er darüber nachdenken, was eine Armee eigentlich so alles zu organisieren hatte. In den siegreichen Zeiten hatte sich hinter der Front eine regelrechte Armada von Verwaltungsdiensten etabliert, die heute zwar auch noch vorhanden war, aber durch die ständigen Auskämmungen stark geschrumpft war. Damals hatten diese Einheiten wie von deutschen Bürokraten geführte Organisationen funktioniert: an festen Regeln orientiert, keinen Deut bei ihren Entscheidungen und Handlungen davon abweichend, unnahbar, knochentrocken. Das hatte immerhin zur Folge, dass der Laden wie geschmiert lief. Das hatte auch die Bereitstellung von Särgen betroffen. Mit zunehmender Dauer des Krieges waren vor allem die Bestattungskompanien an ihre Grenzen gestoßen und die einst mit großem Aufwand angelegten Soldatenfriedhöfe Massengräbern gewichen. Der nächste Schritt war der gewesen, gefangen genommene Rotarmisten für das Verscharren der deutschen Gefallenen einzusetzen. Jetzt war weder das eine noch das andere möglich, die meisten der Toten bleiben unbestattet zurück.
Die Männer kamen relativ unbedrängt voran, nur ab und an schoss die russische Artillerie in diesen Bereich herein, denn die Sowjets wussten, dass eine allgemeine Flucht von dort eingesetzt hatte. Nach drei Stunden Marsch befahl Weber eine Pause. Die erschöpften, übermüdeten und ausgehungerten Soldaten suchten sich einen Platz zum Ausruhen. Keiner von ihnen sprach ein Wort, wer noch etwas in seinem Brotbeutel hatte aß es auf. Günther Weber hatte sich an einen ausgebrannten LKW gelehnt und rauchte. Er schaute sich seine Grenadiere an. Unter den Stahlhelmen sah er ausgemergelte und schmutzige Gesichter, schon von tiefen Falten durchzogene Wangen, dabei waren es noch junge Männer. Er würde ihnen jetzt noch 15 Minuten Pause gewähren, dann mussten sie weiter. Weber konnte auch nicht ausschließen, dass die Sowjets Kräfte an die Flanken des Restkessels dirigierten. Wenn sie auf feindliche Panzer stoßen würden wäre es vorbei, die wenigen Panzerfäuste konnten sie nicht retten. Also trieb er seine Leute etwas an, aber nicht übermäßig, denn vermutlich lag der schwierigste Teil des Weges noch vor ihnen, der Übergang über den kleinen Fluss. So wie er es einschätzte war das Durcheinander und Chaos schon so groß, dass die Bedingungen für einen geordneten Übergang über kleine Behelfsbrücken nicht geschaffen worden waren. Weber hatte einige Male Flüsse forcieren müssen, aber stets über Pontonbrücken oder in einem Boot. Kurz vor der Mittagszeit näherten sie sich der Ausbruchsstelle. Die Flanken dieses Bereiches wurden noch von Einheiten der deutschen Infanterie verteidigt, aber diese musste sich wegen der russischen Panzerangriffe immer weiter zurückziehen. An dieser Stelle hatte sich aber nochmals die Wirksamkeit der Panzerfäuste gezeigt, da etliche T 34 abgeschossen worden waren. Hier war das Bild noch schlimmer. Da der Schlauch kaum noch einen Kilometer breit war, und die Russen ständig mit der Artillerie auf diesen Bereich feuerten und trotz der Verluste noch Panzer vorschickten, waren hier hunderte deutsche Soldaten gefallen. Das Gelände war an vielen Stellen mit zertrümmerter Kriegstechnik gepflastert, dazwischen mit Leichen bedeckt. Über diesem schrecklichen Panorama zog eine dichte schwarze Qualmwolke hinweg, die den Männern den Atem nahm und ihnen Tränen in die Augen trieb. Weber ging mit seinen Männern noch ein Stück weiter, dann ließ er halten und nahm sie zusammen.
„Hört zu“ sagte er „wir werden jetzt gleich in ein riesengroßes Durcheinander kommen. Es hat keinen Sinn, auf Teufel komm raus zusammen zu bleiben, das wird sowie so nicht klappen. Seht euch die Massen an, die jetzt alle aus der Falle raus wollen. Also. Jeder wird sich ab hier auf eigene Faust durchschlagen, Treffpunkt ist Lsyjanka. Bildet höchstens kleine Gruppen. Und unterschätzt den Fluss nicht. Wartet lieber oder sucht euch halbwegs sichere Übergänge als ans andere Ufer zu schwimmen, ihr werdet es nicht schaffen, es ist Hochwasser. Vielleicht kommen unsere Truppen von draußen doch noch durch. Haltet die Ohren steif, wir haben schon ganz andere Probleme gemeistert.“
Weber ging los, zwei Männer waren bei ihm geblieben, Herbert Großmann und Dieter Kleber. Beide kannte er seit Beginn des Russlandfeldzuges. Großmann war kräftig, er hatte als Metzger gearbeitet. Kleber war ein zierlicherer Typ, er war direkt nach dem Abitur in die SS eingetreten. Obwohl er schmächtig wirkte war er einer der besten Handgranatenwerfer der Kompanie, er wandte eine etwas wundersam anmutende Technik an. Er warf die Granaten nicht wie die anderen mit nach vorn schnellendem Arm über den Schulterbereich sondern mehr aus Hüfthöhe. Das Ergebnis war frappierend, denn er erzielte große Weiten und eine hohe Treffgenauigkeit. Seine Ergebnisse kommentierte er immer gern, er war sehr gesprächig. Großmann war sein Gegenpart. Er wirkte wie ein Teddybär aber war dennoch sehr beweglich und schnell. Die drei Männer gingen hintereinander, keiner hatte Lust zum Reden. Mit ihnen marschierten hunderte Soldaten auf das Tor in die Freiheit zu, aber keiner wusste, wie lange sie es noch passieren konnten. Die in ihrem Rücken feuernde russische Artillerie trieb sie zusätzlich an. Die Einschläge schienen kein Muster zu haben, sie streuten willkürlich im Gelände und das vergrößerte die Panik noch mehr.
Nach weiteren vier Kilometern erreichten sie den Gniloi Tikisch.