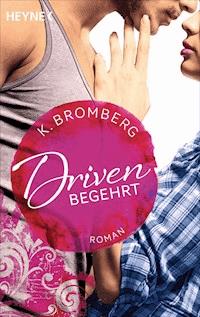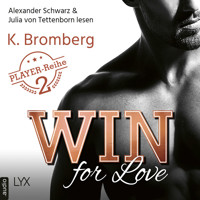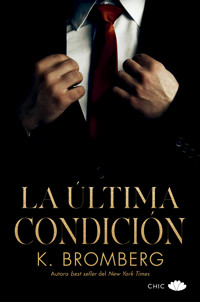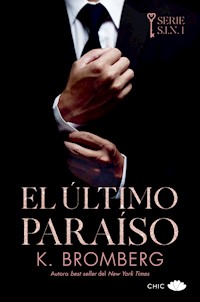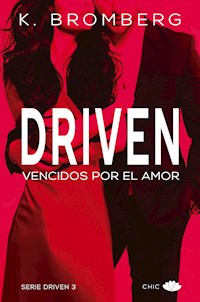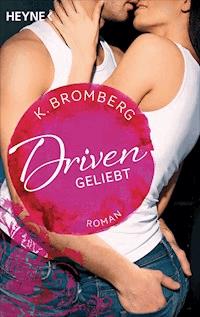
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Driven-Serie
- Sprache: Deutsch
Was wärst du bereit für jemanden zu geben, ohne den du nicht leben kannst?
Du lebst für den einen Moment, der dein Leben bestimmt. Wenn er gekommen ist, musst du all deine Ängste überwinden, gegen deine inneren Dämonen ankämpfen, das Gift aus deiner Seele verbannen – oder du verlierst alles, was dir lieb ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 683
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
K. BROMBERG
Driven
GELIEBT
Roman
Aus dem Amerikanischen von Kerstin Winter
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel Crashedbei JKB Publishing.
Taschenbucherstausgabe 04/2015
Copyright © 2013 K. Bromberg
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe
Random House GmbH
Redaktion: Anita Hirtreiter
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
unter Verwendung von shutterstock/g-stockstudio
Datenkonvertierung: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-14905-5
www.heyne.de
Für Mom und DadIhr habt mir beigebracht, dass es im Leben nicht so sehr darum geht, das Gewitter zu überstehen, sondern darum, im Regen zu tanzen. Und das tue ich endlich …
Flap, flap, flap.
Der dröhnende Schmerz in meinem Kopf spiegelt den Lärm, der auf meine Ohren losgeht.
Flap, flap, flap.
Um mich herum herrscht ein grelles Getöse, und trotzdem ist es unheimlich still – bis auf dieses seltsam schlagende Geräusch.
Was zum Henker ist das?
Und wie kann es so heiß sein, dass die Luft über dem Asphalt flirrt, wenn mir doch im Augenblick so verdammt kalt ist?
Was geht hier vor?
Etwas zu meiner Rechten erregt meine Aufmerksamkeit. Ich wende den Kopf – und bin fassungslos. Zerquetschtes Blech, geplatzte Reifen, zerfetzte Verkleidungen. Becks wird mich umbringen, weil ich die Kiste zu Schrott gefahren habe. Abgerissene Einzelteile sind quer über die ganze Bahn verteilt. Was zum Henker ist passiert?
Unbehagen prickelt am Ansatz meiner Wirbelsäule.
Mein Herzschlag beschleunigt sich.
Am Rand meines Bewusstseins regt sich Verwirrung. Ich schließe die Augen, um das Hämmern zurückzudrängen, das mit meinen Gedanken Schlagzeug spielt. Gedanken, die ich nicht wirklich fassen kann. Sie rinnen durch meinen Verstand wie Sand durch Finger.
Flap, flap, flap.
Ich mache die Augen wieder auf, um auszumachen, woher das Geräusch kommt. Vielleicht hilft es mir, den Schmerz zu ertragen …
… Man muss Spaß haben, um den Schmerz zu betäuben …
Die Worte sind ein Flüstern in meinem Bewusstsein, und ich schüttele den Kopf, um zu begreifen, was geschieht, als ich plötzlich den kleinen Jungen entdecke: dunkles Haar, das mal wieder geschnitten gehört, kleine Hände, die einen Hubschrauber aus Plastik halten, ein Spiderman-Pflaster um den Zeigefinger, der die Rotoren bewegt.
Spiderman. Batman. Superman. Ironman.
»Flap, flap, flap«, ahmt er leise das Geräusch nach.
Warum also klingt es so laut? Große grüne Augen blicken durch dichte Wimpern zu mir auf wie die Unschuld in Person. Sein Finger am Spielzeug verharrt, als sein Blick meinem begegnet und er den Kopf zur Seite neigt, um mich eingehend zu mustern.
»Hey, du«, sage ich. Die ohrenbetäubende Stille hallt durch den Raum zwischen uns wider.
Irgendwas stimmt nicht.
Absolut nicht.
Ich habe da so eine dumpfe Vorahnung.
Etwas Unbekanntes kommt mir in den Sinn.
Wieder bin ich verwirrt.
Seine großen grünen Augen vereinnahmen mich vollkommen.
Doch mein Unbehagen verschwindet, als ein leichtes Lächeln über seine Lippen huscht und in seiner schmutzigen Wange ein Grübchen erscheint.
»Ich darf nicht mit Fremden reden«, sagt er und streckt sich, um größer und erwachsener zu wirken.
»Das ist eine kluge Regel. Hat deine Mom dir das beigebracht?«
Warum kommt er mir so bekannt vor?
Er zuckt nonchalant die Achseln. Wieder mustert er mich von Kopf bis Fuß, ehe sein Blick zu meinem zurückkehrt. Dann scheint er etwas hinter mir zu sehen, aber aus irgendeinem Grund schaffe ich es nicht, mich von seinem Anblick zu lösen und mich umzudrehen. Nicht nur, dass er das niedlichste Kind ist, das ich je gesehen habe, nein, ich scheine vollkommen in seinem Bann zu stehen.
Er runzelt leicht die Stirn, als er herabschaut und an einem anderen Superheldenpflaster zupft, das über seinem Knie klebt.
Spiderman. Batman. Superman. Ironman.
Haltet verdammt noch mal die Klappe!, möchte ich die Dämonen in meinem Schädel anschreien. Sie haben kein Recht, hier zu sein – ich will nicht, dass sie den hübschen kleinen Jungen belästigen –, und doch rasen sie um ihn herum, als würden sie einander jagen. So wie mein Wagen eigentlich jetzt über die Rennstrecke jagen sollte. Warum also gehe ich nun auf diesen Jungen zu, obwohl ich mich eigentlich gegen Becketts Schimpftirade wappnen sollte, die ich, wie die Kiste aussieht, wohl auch verdiene?
Ich kann nicht widerstehen.
Langsam und mit behutsamen Bewegungen gehe ich auf ihn zu, wie ich es bei den Jungs im Haus tun würde.
Die Jungs.
Rylee.
Ich muss zu ihr.
Ich will nicht mehr allein sein.
Ich muss sie spüren.
Nun bin ich total verwirrt. Dennoch gehe ich einen weiteren Schritt durch dichten Nebel auf diesen unerwarteten Lichtstrahl zu.
Sei mein Funke.
»Du hast aber eine ziemlich böse Schramme da an deinem Knie.«
Er schnaubt und zieht die sommersprossige Nase kraus. Und auch wenn ich es kaum zugeben mag, ist es echt niedlich anzusehen, wie er versucht, mich herablassend anzublicken.
»Ach nee. Was du nicht sagst, Schlauberger!«
Und er lässt sich offensichtlich auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Frecher Bengel! Ganz nach meinem Geschmack. Ich unterdrücke ein Lachen, als er wieder über meine Schulter blickt. Ich will mich ebenfalls umdrehen, doch seine Frage hält mich auf. »Ist alles okay mit dir?«
Hä?
»Was meinst du damit?«
»Ob alles okay mit dir ist«, fragt er wieder. »Du siehst ziemlich fertig aus.«
»Wieso? Wie sehe ich denn aus?« Ich mache einen weiteren Schritt auf ihn zu. Meine schwer zu fassenden Gedanken in Kombination mit seinem besorgten Gesichtsausdruck machen mich langsam nervös.
»Na ja, total fertig eben«, flüstert er. Sein verpflasterter Finger dreht wieder die Rotoren – flap, flap, flap –, dann deutet er mit einer vagen Geste auf mich.
Furcht packt mich, und ich blicke an meinem Overall herab. Er ist unversehrt, doch ich klopfe mich vorsichtshalber ab. »Nein«, sage ich. »Mit mir ist alles okay, Kumpel, siehst du?« Erleichtert seufze ich. Der kleine Bengel hat mich ganz schön erschreckt.
»Nein, du stehst auf der Leitung«, erwidert er augenrollend und deutet hinter mich. »Das meine ich. Guck es dir doch an.«
Ich drehe mich um.
Und mein Herz setzt aus.
Flap.
Meine Kehle verschließt sich.
Flap.
Jeder Muskel erstarrt.
Flap.
Ich blinzele immer wieder in der Hoffnung, dass die Bilder vor mir verschwinden. Doch sie bleiben, brennen sich in mein Bewusstsein ein und sind selbst hinter geschlossenen Lidern noch zu sehen.
Spiderman. Batman. Superman. Ironman.
Fuck. Nein, nein, nein.
»Siehst du«, sagt seine engelhafte Stimme. »Das meinte ich.«
Nein. Nein. Nein. Nein.
Ich stoße den Atem aus, als hätte man mir eine Faust in den Bauch gerammt. Als ich schlucke, fühlt sich meine Kehle wie mit Sand gefüllt an.
Ich sehe es, das Chaos – es liegt direkt vor meinen Augen. Aber wie ist es möglich? Wie kann ich hier und dort sein?
Flap, flap, flap.
Ich versuche, mich zu bewegen. Hinzurennen. Die Leute auf mich aufmerksam zu machen, um ihnen zu sagen, dass ich hier bin – dass mir nichts passiert ist –, aber die Panik lähmt mich.
Nein! Ich bin nicht dort drüben. Ich bin hier. Mir geht es gut, und ich weiß, dass ich lebe, denn ich spüre ganz genau, wie mir der Atem stockt, als meine Füße endlich gehorchen und ich näher herantrete. Die Angst sitzt mir in den Gliedern, denn was ich sehe … kann nicht sein. Ist verdammt noch mal total unmöglich!
Spiderman. Batman. Superman. Ironman.
Das sanfte Surren der Säge, mit der die Rettungskräfte den Fahrerhelm mittig öffnen, holt mich in die Wirklichkeit zurück. Es fühlt sich an, als würde mein Kopf explodieren. Ich sinke vor Schmerz auf die Knie und hebe zitternd die Hände, um meinen Schädel zu halten. Ich muss den Kopf heben. Muss sehen, wer in meinem Wagen war. Aber ich kann nicht. Es tut zu verflucht weh.
Tut es weh, wenn man stirbt?
Ich zucke zusammen, als seine Hand sich auf meine Schulter legt. Aber sobald ich sie spüre, hört der Schmerz auf.
Herrgott! Ich weiß, ich muss hinsehen. Ich muss mir ansehen, wer im Wagen saß, obwohl ich längst die Wahrheit kenne. Zusammenhanglose Erinnerungsfetzen flirren durch meinen Verstand wie die Splitter des zerborstenen Spiegels in dieser verdammten Absteige neulich.
Wieder sitzt mir die Angst in den Gliedern. Ich kann’s nicht. Ich kann einfach nicht hinsehen. Sei nicht so ein Weichei, Donovan. Stattdessen blicke ich zu meiner Rechten in seine Augen, die der einzige Ruhepol in diesem Chaos zu sein scheinen. »Ist das …? Bin ich …?«, frage ich, und meine Worte bleiben mir in böser Vorahnung im Hals stecken.
Er sieht mich ernst an und schürzt die Lippen. Dann drückt er meine Schulter. »Was denkst du denn?«
Am liebsten würde ich die verdammte Antwort aus ihm herausschütteln, aber natürlich tue ich es nicht. Kann es nicht. Mit ihm an meiner Seite in diesem tosenden Chaos habe ich mich nie friedlicher gefühlt – und gleichzeitig nie mehr gefürchtet.
Ich reiße meinen Blick von seinem los, um die Szene vor mir zu betrachten. Ich fühle mich wie in einem Kaleidoskop schartiger Bilder, als ich das Gesicht – mein Gesicht! – auf der Bahre betrachte.
Mein Herz setzt einen Schlag aus. Klopft langsamer. Immer langsamer.
Spiderman.
Blasse Haut. Verquollene Augen. Schlaffe, bleiche Lippen.
Batman.
Verzweifelt ringe ich mit dem Tod, doch meine Seele klammert sich an das Hier und Jetzt.
Superman.
»Nein!«
Ich schreie, so laut ich kann, bis meine Stimme nichts mehr hergibt. Niemand sieht zu mir. Niemand hört mich. Niemand reagiert – weder mein Körper noch die Sanitäter.
Ironman.
Die Gestalt auf der Trage – meine Gestalt! – bäumt sich auf, als jemand auf mich klettert und mit Herzmassage beginnt. Jemand befestigt eine Manschette um meinen Hals. Zieht die Augenlider hoch, schaut in die Pupillen.
Flap.
Konzentrierte Gesichter. Besorgte Blicke. Routinehandgriffe.
Flap.
»Nein!«, schreie ich wieder. »Nein! Ich bin noch hier. Ich bin okay!«
Flap.
Tränen laufen. Unglaube breitet sich aus. Möglichkeiten schwinden. Ebenso wie die Hoffnung.
Mein Leben hängt am seidenen Faden.
Mein Blick ist fest auf die Hand gerichtet, die reglos von der Trage herabbaumelt. Ein dünner Faden Blut rinnt meinen Finger herab und bildet einen Tropfen, der herunterfällt, als der Sanitäter erneut mit Druck mein Herz zu animieren versucht. Ich konzentriere mich auf dieses Rinnsal Blut. Mein Gesicht zu betrachten bringe ich einfach nicht mehr übers Herz.
Ich kann es nicht ertragen. Kann nicht zusehen, wie das Leben aus mir heraussickert, während ich spüre, wie sich eisige Kälte in meiner Seele festzusetzen beginnt.
»Hilf mir«, wende ich mich an den kleinen Jungen, der mir so vertraut und dennoch fremd ist. »Bitte.« Mein Flehen ist nur ein Flüstern. »Ich bin noch nicht bereit zu …« Ich bringe den Satz nicht zu Ende. Wenn ich es täte, würde ich akzeptieren, was vor mir auf der Trage geschieht und seine Anwesenheit hier neben mir bedeutet.
»Nicht?«, fragt er. Ein einzelnes einfaches Wort, und doch die wichtigste Frage in meinem ganzen verfluchten Leben. Ich blicke ihn an, lasse mich in die Tiefen seiner großen grünen Augen ziehen, in denen ich Verständnis, Anerkennung und Akzeptanz entdecke, und so ungern ich von dem Gefühl der Heiterkeit lassen will, das seine Nähe mir verschafft, so ist die Frage, die er mir gestellt hat, doch so einfach zu beantworten wie nichts zuvor in meiner Existenz.
Aber wenn ich mich zu leben entscheide – wenn ich zurückkehre, um zu beweisen, dass ich diese verdammte Chance verdient habe –, dann muss ich diesen kleinen engelhaften Jungen und den Frieden, den er meiner gequälten Seele verschafft, zurücklassen.
»Werde ich dich je wiedersehen?« Keine Ahnung, woher die Frage kommt, aber sie ist gestellt, bevor ich mich daran hindern kann. Ich halte den Atem an, während ich auf die Antwort warte. Ich wünsche mir genauso sehr ein Ja wie ein Nein.
Er neigt den Kopf zur Seite und grinst. »Wenn die Karten es so wollen.«
Welche verfluchten Karten?, möchte ich ihn anschreien. Gottes? Die des Teufels? Meine? Was soll das? »Die Karten?«
»Ja«, erwidert er, schüttelt leicht den Kopf, blickt auf seinen kleinen Hubschrauber herab und dann wieder zu mir auf.
Flap, flap, flap.
Das Geräusch wird lauter und blendet den Lärm um mich herum aus, und doch höre ich noch, wie er Atem holt. Höre, wie mein Herz hämmert. Höre ihn leise seufzen, als er eine Hand auf meine Schulter legt.
Und dann sehe ich plötzlich den Helikopter – einen Rettungshubschrauber – auf dem Infield, der mit sich drehenden Rotoren auf mich wartet. Die Trage ruckt an und wird auf den Landeplatz zugeschoben.
»Willst du nicht mit?«, fragt er.
Ich schlucke hart, als ich mich zu ihm umschaue und nicke. »Doch …«, flüstere ich, denn die Angst vor dem Ungewissen schnürt mir die Kehle zu.
Spiderman. Batman. Superman. Ironman.
»Hey«, sagt er und schenkt mir ein leichtes Lächeln, als er mit dem Kinn hinter mich deutet. »Ich glaube, diesmal sind deine Superhelden wirklich gekommen.«
Ich wirbele herum. Zuerst kann ich es nicht sehen, da der Pilot mir den Rücken zuwendet und dabei hilft, meine Trage in den Hubschrauber zu laden, aber als er sich umdreht, auf den Pilotsitz springt und den Hebel packt, ist alles klar.
Mein Herzschlag setzt aus.
Und wieder ein.
Langsam entspanne ich mich.
Der Helm des Piloten ist rot. Mit schwarzen Linien.
Er trägt Spidermans Symbol.
Der kleine Junge in mir jubelt. Der Erwachsene sackt vor Erleichterung zusammen.
Ich drehe mich wieder um, um dem Jungen Lebewohl zu sagen, aber er ist fort. Woher wusste er von meinen Superhelden? Ich suche ihn, weil ich eine Antwort brauche, doch er ist und bleibt verschwunden.
Ich bin allein.
Allein bis auf den Trost derer, auf dessen Ankunft ich ein Leben lang gewartet habe.
Meine Entscheidung steht fest.
Die Superhelden sind endlich gekommen.
Mein ganzer Körper fühlt sich taub an. Ich kann mich nicht regen, kann nicht denken, kann meinen Blick nicht von dem entsetzlich zerquetschten Wagen auf der Rennstrecke abwenden. Wenn ich anderswo hinsehe, wird alles real werden. Und der Hubschrauber über meinem Kopf bringt tatsächlich den schwer verletzten Mann fort, den ich liebe.
Den Mann, den ich brauche.
Ich kann ihn doch nicht schon wieder verlieren.
Ich schließe die Augen, um zu lauschen, aber ich höre nichts. Nichts außer dem Pochen meines Herzschlags. Und in der Schwärze meiner geschlossenen Lider, die mein Herz genauso fühlt, ziehen Bilder vorbei. Max’ Gesicht, das zu Coltons wird, und Coltons, das zu Max’ wird. Erinnerungen, die die Hoffnung, an die ich mich klammere wie an einen Strohhalm, mit einer Stichflamme vernichten.
Ich renn dich, Ryles. Seine Stimme, so stark und zuversichtlich, erklingt in meinem Bewusstsein, nur um sich aufzulösen und glitzernd wie schillerndes Konfetti herabzusinken.
Ich krümme mich zusammen und versuche vergeblich, die Tränen, die mich zu ersticken drohen, versiegen zu lassen. Der Kummer drückt mich wie eine bleierne Last nieder.
Ich zwinge mich zu atmen und sage mir fest, dass die vergangenen zweiundzwanzig Minuten gar nicht stattgefunden haben. Dass der Wagen sich nicht überschlagen hat und durch die verqualmte Luft geflogen ist. Dass keine ernst dreinblickenden Rettungskräfte die Karosserie aufschneiden mussten, um Coltons reglose Gestalt herauszuholen.
Wir haben uns nicht lieben können. Der Gedanke zuckt durch mein Bewusstsein. Wir hatten keine Chance zu rennen, nachdem er mir endlich die Worte gesagt hatte, die ich hören musste – und die er sich endlich selbst eingestanden und zu fühlen erlaubt hatte.
Am liebsten würde ich die Zeit zurückdrehen zu dem Moment im Hotelzimmer, als wir Arm im Arm im Bett lagen und einander ganz nahe waren, doch der entsetzliche Anblick des zerdrückten Autos lässt es nicht zu. Zum zweiten Mal fressen sich die Bilder eines furchtbaren Unfalls so gnadenlos in meine Erinnerung, dass meine Hoffnung schwindet.
»Ry, mir geht es nicht allzu gut.« Es sind Max’ Worte, die in meinen Verstand sickern, aber es ist Coltons Stimme. Es ist Colton, der mir ankündigt, was geschehen wird. Was ich schon einmal in meinem Leben habe durchmachen müssen.
Oh Gott, bitte nicht. Bitte nicht.
Mein Herz zieht sich zusammen.
Bilder ziehen in Zeitlupe durch mein Bewusstsein.
»Rylee, konzentrier dich! Sieh mich an!« Wieder Max’ Worte. Ich sacke zusammen, mein Körper gibt einfach nach, doch starke Arme schließen sich um mich und schütteln mich einen Moment fest.
»Sieh mich an!« Nein, es ist nicht Max. Und auch nicht Colton. Sondern Becks. Ich strenge mich an, seinem Blick zu begegnen. Seine sonst so ruhigen klaren blauen Augen sind voller Angst, und in den Winkeln sehe ich Fältchen, die vorhin noch nicht dort waren. »Wir müssen ins Krankenhaus fahren, okay?« Seine Stimme ist sanft, aber streng. Er spricht mit mir wie zu einem Kind. Vielleicht glaubt er, auf diese Art verhindern zu können, dass ich in die Millionen Stücke zerfalle, in die meine Seele bereits zerborsten ist.
Meine Kehle fühlt sich an wie mit Sand gefüllt. Ich bringe kein Wort heraus, daher schüttelt er mich ein zweites Mal. In mir ist kein Gefühl mehr außer Angst. Ich nicke, rege mich aber darüber hinaus nicht. Es ist totenstill. Um uns herum sind Zehntausende Zuschauer, und dennoch spricht niemand. Alle Augen sind fixiert auf die Aufräummannschaft und die Überreste der kollidierten Autos.
Ich strenge mich an, spitze die Ohren, lausche auf ein Lebenszeichen, doch da ist nichts. Nur Schweigen.
Becks legt einen Arm um mich und stützt mich, als er mich aus dem Tower der Boxengasse die Treppe hinunterführt und auf die offene Tür eines Vans zudirigiert. Sanft schiebt er mich hinein, rutscht neben mich auf die Rückbank, drückt mir Tasche und Telefon in die Hände und schnallt uns beide an. »Los«, sagt er zum Fahrer.
Der Van macht einen Satz nach vorn und rüttelt mich durch. Ich schaue hinaus, als wir das Fahrerlager verlassen und uns der Durchfahrt nähern. Rennwagen liegen kreuz und quer über die Bahn verstreut. Wie bunte Grabsteine auf einem asphaltierten Friedhof.
»Crash, crash, burn …«, tönt der Liedtext aus den Lautsprechern und klingt unnatürlich laut in der Stille des Wageninneren. Langsam wird mir die Bedeutung der Worte bewusst.
»Macht das aus!«, schreie ich und balle die Hände zu Fäusten.
Gott, ich werde hysterisch!
»Zander«, flüstere ich. »Zander muss am Dienstag zum Zahnarzt. Ricky braucht neue Stollen. Aiden geht ab Donnerstag zur Therapie, aber Jax hat vergessen, den Termin einzutragen.« Ich sehe auf. Beckett sieht mich an. Aus den Augenwinkeln entdecke ich weitere Teammitglieder auf den Plätzen hinter uns, aber ich habe keine Ahnung, wie sie dorthin gekommen sind.
Ich muss alles organisieren.
»Beckett, ich brauche mein Telefon. Dane wird es vergessen, und Zander muss dringend zum Zahnarzt und Scooter …«
»Rylee«, sagt er ruhig, doch ich schüttele nur den Kopf.
»Nein!«, brülle ich. »Ich brauche mein Telefon!« Ich setze an, mich abzuschnallen, merke erst jetzt, dass ich mein Handy in der Hand habe, kann aber nicht mehr umschalten und versuche, über ihn zu krabbeln und nach dem Griff der Schiebetür zu greifen. Beckett schlingt mir den Arm um die Mitte, um zu verhindern, dass ich die Tür öffne.
Und nun verliere ich die Beherrschung.
»Lass mich los!« Ich wehre mich gegen ihn. Ich winde mich, bäume mich auf, aber er hält mich fest.
»Rylee«, sagt er wieder und klingt jetzt genauso deprimiert, wie ich mich fühle. Ich gebe auf und will wieder auf meinen Platz zurück, doch Beckett hält mich noch immer fest, und eine Weile ringen wir beide um Atem. Er nimmt meine Hand und drückt sie fest, aber ich habe einfach keine Kraft, die Geste zu erwidern.
Draußen zieht die Welt an uns vorbei, meine dagegen ist stehen geblieben. Ihr Antrieb liegt irgendwo auf einer Trage.
»Ich liebe ihn, Beckett«, flüstere ich schließlich.
»Ich weiß«, sagt er, atmet bebend aus und drückt seine Lippen auf meinen Scheitel. »Ich auch.«
»Ich darf ihn nicht verlieren.« Aus Angst, die Worte könnten real werden, wenn ich sie laut ausspreche, ist meine Stimme kaum hörbar.
»Ich auch nicht.«
Das wischende Geräusch der automatischen Türen am Eingang zur Notfallambulanz ist lähmend. Ich bleibe wie angewurzelt stehen.
Albtraumhafte Erinnerungen werden in mir geweckt, und das Reinweiß der Gänge hat alles andere als eine beruhigende Wirkung auf mich. Seltsamerweise ist es ausgerechnet die Diashow fluoreszierender Lichter an der Decke, die durch meinen Verstand zuckt – mein einzig möglicher Bildausschnitt, als man damals meine Trage im Laufschritt durch die Gänge schob, die Ärzte knappe Befehle im Medizinerjargon austauschten und meine Gedanken sinnlos umherschweiften, während ich um Max und um mein Kind bangte.
»Ry?« Becketts Stimme reißt mich aus der aufsteigenden Panik, die mir die Kehle zuschnürt. »Kannst du reingehen?«
Die Freundlichkeit in seiner Stimme ist Balsam für meine Seele. Am liebsten würde ich zu weinen beginnen. Tränen schnüren mir die Kehle zu und brennen in meinen Augen, doch sie fallen nicht.
Ich hole tief Luft und befehle meinen Füßen, sich zu bewegen. Beckett schlingt mir wieder einen Arm um die Taille, um mir bei den ersten Schritten zu helfen.
Das Gesicht des Arztes von damals taucht vor meinem inneren Auge auf. Souverän wirkte er, frei von Emotionen. Aber sein Blick bat um Vergebung. Ich weiß noch, wie ich die Augen schließen und für ewig ins Vergessen herabsinken wollte. Höre noch die leise Stimme, die »Es tut mir leid« sagt.
Nein! Nein, nein, nein. Nicht noch einmal. Ich will nicht hören, dass ich Colton verloren habe, obwohl wir uns doch gerade erst gefunden haben.
Ich lasse den Kopf hängen und starre zu Boden. Zähle die Laminatfliesen, über die ich gehe, während Beckett mich zum Wartebereich führt. Ich glaube, er redet mit mir. Oder mit einer Schwester? Ich bin nicht sicher, da ich alle Energie benötige, die Erinnerungen zurückzudrängen und die Verzweiflung abzuwehren, damit sich vielleicht, nur ganz vielleicht, ein Funken Hoffnung dazwischenzwängen kann.
Ich setze mich neben Beckett und starre auf das permanent surrende Telefon in meinen Händen. Zahllose SMS und Anrufe allein von Haddie, ich kann allerdings nicht einmal daran denken, sie zu beantworten, obwohl mir klar ist, dass sie vor Sorge umkommen muss. Aber ich habe nicht die Kraft dazu. Mir ist alles zu viel.
Ich höre das Quietschen von Sohlen, als andere hinter uns eintreten, doch ich konzentriere mich auf die Kinderbücher, die vor mir auf dem Tischchen liegen. Spiderman liegt da. Meine Gedanken schweifen automatisch wieder ab. Hatte Colton Angst? Wusste er, was auf ihn zukommen würde? Hat er instinktiv seine Superheldenlitanei angestimmt, von der er Zander erzählt hatte?
Allein der Gedanke bricht mir das Herz, aber die Tränen wollen noch immer nicht kommen.
Ich sehe Krankenhausschuhe in meinem Blickfeld. Jemand spricht Beckett an.
»Unser Spezialist muss wissen, wie genau der Unfall geschehen ist, sodass wir diese Umstände miteinbeziehen können. Wir haben versucht, das Filmmaterial zu sichten, aber ABC hat die Wiederholung gestoppt.« Nein, nein, nein! Der Schrei gellt durch meinen Verstand, doch ich bekomme kein Wort heraus. »Man hat mir gesagt, dass Sie uns am ehesten sagen können, wie es passiert ist.«
Beckett richtet sich neben mir gerade auf. Seine Stimme klingt so entsetzlich belegt, dass ich meine Finger in meine Oberschenkel bohre. Er setzt zum Reden an, räuspert sich, setzt neu an. »Er ist auf dem Dach in den Fangzaun geprallt, glaube ich. Moment bitte, ich versuche es zu visualisieren.« Er lässt den Kopf in seine Hände sinken, reibt sich die Schläfen und seufzt, während er sich sammelt. »Ja, so muss es gewesen sein. Der Wagen war umgekippt. Der Spoiler hat oben den Zaun gerammt, während die Nase am Boden schrammte. Mittig gegen die Betonbarriere. Der Wagen hat sich quasi um die Kapsel herum in seine Einzelteile zerlegt.«
Das kollektive Aufschreien der Menge … »Können Sie uns schon irgendwas sagen?«, fragt Beckett nun.
Das furchtbare Knirschen von Metall, das mit aller Kraft zerdrückt wird …
»Noch nicht. Wir haben gerade erst angefangen, den Gesamtzustand einzuschätzen.«
Der beißende Gestank von verbranntem Gummi auf öligem Asphalt …
Wieder quietschen Gummisohlen. Murmeln Stimmen. Beckett seufzt und reibt sich das Gesicht, dann legt er eine Hand auf meine, löst meine Finger, die sich noch immer in mein Bein krampfen, und umklammert meine Hand mit seiner.
Ein einziger Reifen, der über das Gras rollt und gegen die Barriere prallt …
Bitte gib mir ein Zeichen, flehe ich stumm. Irgendeins. Irgendwas. Ein winziger Hinweis, der mir sagt, dass es einen Hoffnungsschimmer gibt.
Das Klingeln von Telefonen hallt von den nüchtern gekachelten Wänden wider. Immer wieder. Wie das Piepen der lebenserhaltenden Maschinen, das bis in den Wartebereich dringt. Wann immer ein Piepton verstummt, scheint in mir etwas zu sterben.
Plötzlich höre ich, wie Beckett neben mir der Atem stockt, dann bricht auch schon ein ersticktes Schluchzen aus ihm heraus, und der Laut fegt wie ein Hurrikan über mich hinweg und zerfetzt das schwache Gespinst aus Glaube und Entschlossenheit, das mich bisher aufrecht gehalten hat. Doch sosehr er auch versucht, die Tränen zurückzuhalten – er hat keine Chance. Es bringt mich um, dass der Mann, der nach außen hin immer Stärke zeigt, nun vor Kummer zusammenbricht. Ich kneife die Augen zu und sage mir, dass ich jetzt für Beckett stark sein muss, aber ich höre nur allzu deutlich die Worte, die er gestern zu mir gesagt hat.
Voller Angst und Unglaube schüttele ich den Kopf. »Es tut mir so leid«, flüstere ich. »So unglaublich leid. Es ist alles meine Schuld.«
Beckett lässt einen Moment lang den Kopf hängen, dann wischt er sich mit den Handflächen das Gesicht ab. Und bei dieser Geste, die man bei einem Kind vermuten würde, das sich seiner Tränen schämt, zieht sich mein Herz umso stärker zusammen.
Ich gerate in Panik, als mir bewusst wird, dass Colton tatsächlich nur meinetwegen hier ist. Ich habe ihn weggestoßen, ihm mein Vertrauen verweigert, ihn ausgelaugt und erschöpft – und das einen Abend vor einem wichtigen Rennen. Wir konnte ich nur so dumm und stur sein? »Ich habe ihm das angetan.« Die Worte bringen mich um. Reißen mich innerlich auseinander.
Beckett hebt den Kopf. Seine Augen sind rot gerändert. »Was redest du da?«
»Alles, was gewesen ist …« Mir stockt der Atem, und ich muss abbrechen. »Ich habe die vergangenen Tage für Stress und Chaos gesorgt. Du selbst hast mir gesagt, wenn ich das täte, wäre ich persönlich verantwortlich …«
»Rylee …«
»Wir haben uns gestritten und gegenseitig fertiggemacht, und als wir uns versöhnt haben, waren wir die ganze Nacht auf, und ich habe ihn trotzdem in den Wagen gelassen und …«
»Rylee«, presst er scharf hervor, aber ich schüttele mit brennenden Augen den Kopf, »das war nicht deine Schuld!«
Ich zucke zusammen, als er seinen Arm um mich legt und mich zu sich zieht. Ich greife in seinen Feuerschutzoverall und halte mich an dem rauen Material fest.
»Es war ein Unfall. So was passiert manchmal. Es war nicht deine Schuld.« Seine Stimme bricht. Er hält mich noch immer fest, aber ich habe das Gefühl, keine Luft mehr zu kriegen.
Abrupt stehe ich auf. Ich muss mich bewegen. Unruhig beginne ich, auf und ab zu gehen. Ein kleiner Junge in der Ecke rutscht auf der Bank nach vorn, um sich einen Buntstift zu nehmen. Licht fängt sich auf seinen Schuhen, und etwas blitzt rot auf und zieht meinen Blick auf sich. Ich verenge die Augen und sehe genauer hin. Ein auf der Spitze stehendes Dreieck mit einem »S« in der Mitte.
Superman.
Der Name kommt mir in den Sinn, doch ich wende mich dem Fernseher zu, an dem jemand den Sender verstellt hat. Coltons Name wird genannt, und ich ziehe scharf die Luft ein. Obwohl ich mich fürchte hinzusehen, kann ich doch nicht anders.
Und plötzlich scheinen alle im Raum aufzustehen und sich kollektiv auf den Monitor zuzubewegen. Eine Menschenmenge in roten Schutzoveralls blickt angstvoll auf den Fernsehschirm. Der Sprecher erklärt, dass es einen Unfall gegeben hat, der für über eine Stunde das Rennen lahmgelegt hat, und der Monitor zeigt Bilder der dunklen Rauchwolke und voneinander abprallenden Wagen. Der Blickwinkel ist ein anderer als der unsere vorhin auf der Strecke, sodass wir nun mehr sehen können, aber als Coltons Wagen in die Kurve fährt, wird die Aufzeichnung angehalten. Alle Leute im Raum sacken erleichtert in sich zusammen, als uns klar wird, dass nicht gezeigt wird, wovor wir uns gefürchtet haben. Die Berichterstattung endet mit der Ankündigung des Sprechers, dass Colton Donovan gegenwärtig im Bayfront Hospital medizinisch versorgt werde.
Vor meinem inneren Auge sehe ich den schwer verletzten Colton auf der Trage. Dann Max angeschnallt auf dem Fahrersitz des zerschmetterten Autos. Die Erinnerungen fließen ineinander, und der Schmerz, der mich durchfährt, verschlägt mir den Atem.
Als ich mich umdrehe, sehe ich, wie die Westins den Warteraum betreten. Coltons würdevolle und herrische Mutter sieht blass und erschöpft aus. Ich habe einen Kloß im Hals, während ich den beiden entgegensehe. Andy stützt seine Frau und führt sie zu einem freien Platz, während Quinlan an der anderen Seite ihre Hand hält.
Beckett springt auf und umarmt erst Dorothea, dann Quinlan rasch, aber innig. Andy zieht Beckett ebenfalls in seine Arme und hält ihn fest, und es scheint, als würde er sich verzweifelt an den jüngeren Mann klammern. Ich höre ein ersticktes Schluchzen und möchte weinen.
Die Szene weckt in mir Erinnerungen an Max’ Beerdigung. Im Geiste sehe ich den schwarzen Sarg, auf dem ein kleiner rosafarbener steht, und die Unmengen an Rosen, die beide bedecken. Asche zu Asche, Staub zu Staub … Bitte nicht noch einmal! Umarmungen, die nicht trösten können, die noch mehr Salz in die Wunde streuen.
Wieder beginne ich, auf und ab zu gehen, und höre gemurmelte Fragen, ob man schon etwas wüsste, wann mit Neuigkeiten zu rechnen wäre, wie der Stand der Dinge sei. Gesichter, die ich bisher nur sorglos, heiter oder ruhig gekannt habe, sind nun von Angst und Sorgen gezeichnet. Vor Andy und Dorothea bleibe ich stehen.
Wir starren uns eine Weile nur an, bis Dorothea ihre zitternde Hand nach meiner ausstreckt. »Ich …«, beginne ich und schüttele den Kopf. »Ich weiß nicht, was … Es tut mir so leid.«
»Das wissen wir, Liebes«, sagt sie, erhebt sich und nimmt mich in ihre Arme. Wir umklammern uns, als wäre die andere der einzige Halt. »Das wissen wir.«
»Er ist stark«, sagt Andy und reibt mir den Rücken, um mich zu trösten. Aber die Tränen, das erstickte Schluchzen und die Tatsache, dass ich hier mit seinen Eltern stehe, machen das Geschehen so furchtbar real. Sollte ich jemals wirklich gedacht haben, dass dies alles nur ein böser Traum sei, so ist das nun vorbei.
Ich mache mich los und weiche zurück. Ich muss mich auf etwas anderes konzentrieren, um nicht die Nerven zu verlieren.
Doch was immer ich versuche – ich sehe immer nur Coltons Gesicht vor mir. Den Ausdruck absoluter Sicherheit, als er inmitten des Durcheinanders unmittelbar vor dem Rennen zu mir sah und mir seine Gefühle gestand. Wieder muss ich um Atem ringen, als der Schmerz in meiner Brust so heftig wird, dass ich keine Luft mehr bekomme.
Plötzlich ist mir, als hörte ich ein Flüstern in meinem Kopf, und aus unerfindlichen Gründen sehe ich mich zum Fernsehbildschirm um. Gerade wird ein Trailer für einen neuen Batman-Film gezeigt. Wieder schöpfe ich Hoffnung, als meine Gedanken nach Erinnerungen der vergangenen Stunde graben.
Der Spiderman-Comic auf dem Tisch. Die Superman-Schuhe des Jungen in der Ecke. Der Batman-Film. Drei von vier Superhelden. Natürlich tadelt mein Verstand mich, dass es sich nur um einen Zufall handelt – und keinen besonders außergewöhnlichen dazu –, aber ich weiß, was ich sehe. Ich brauche nur noch den vierten, dann weiß ich, dass Colton es schaffen wird.
Dann wird er zu mir zurückkommen.
Ich beginne mich im Wartebereich umzusehen, während mein Herz schneller zu schlagen beginnt. Doch bevor ich ein Zeichen entdecken kann, lenkt mich die Unruhe, die aus Richtung Flur zu hören ist, ab.
Ich erkenne die Stimme sofort.
Augenblicklich bin ich kurz davor zu explodieren.
Blonde Haare und lange Beine rauschen herein, und es ist mir egal, dass ihr Gesicht denselben Kummer ausdrückt, den ich empfinde. Meine Angst, meine Verzweiflung erwachen erneut mit aller Macht, und es ist, als würde etwas in mir zerreißen.
In wenigen Sekunden habe ich den Raum durchquert. Köpfe fahren auf, als ich unwillkürlich ein Knurren ausstoße. »Raus!«, kreische ich. Tawny sieht erschreckt auf. Ihr verdutzter Blick begegnet meinem, und ihre aufgespritzten Lippen bilden ein »O«. »Du intrigantes Miststück …«
Erschreckt stoße ich den Atem aus, als Beckett mich von hinten packt und mit einem Ruck gegen seine Brust zieht. »Lass mich los«, fauche ich und winde mich in seinen Armen. »Lass mich!«
»Hör auf, Rylee!«, presst er hervor. »Heb dir deine Kräfte für Colton auf, denn er wird sie brauchen, glaub mir das. Er wird alles von dir brauchen, was du ihm geben kannst.« Seine Worte überzeugen mich. Ich höre auf, mich gegen ihn zu wehren, und spüre seinen keuchenden Atem an meiner Wange. »Sie ist es nicht wert, okay?«
Ich weiß nicht, was ich sagen soll – und ich glaube auch kaum, dass ich einen vernünftigen Satz herausbekomme –, also nicke ich nur besiegt und blicke zu Boden, um weder Tawny selbst noch ihre makellosen Beine ansehen zu müssen.
»Sicher?«, fragt er, als er mich langsam und behutsam loslässt und vor mich tritt, damit ich ihm in die Augen sehe.
Ich beginne zu zittern und ringe um Atem, als ich meinen Blick hebe. Plötzlich fühle ich mich wie ein Biest, weil ich hier stehe und mich von ihm trösten lasse, obwohl er doch Colton genauso liebt und ebensolche Angst hat wie ich, also nicke ich. Er nickt ebenfalls und dreht sich so zu Tawny um, dass er mir die Sicht versperrt.
»Becks …«, sagt sie seufzend.
»Nein. Sag kein Wort!« Er spricht so leise, dass nur wir drei ihn hören können, obwohl ich spüre, dass viele Augenpaare auf uns gerichtet sind. Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie Andy sich zögernd erhebt. Beckett spricht weiter. »Ich lasse dich nur aus einem einzigen Grund hierbleiben. Wood wird jeden Freund brauchen, wenn …« Er verliert die Fassung, beruhigt sich wieder, setzt erneut an. »… wenn er diese Sache hier überstehen will, und das schließt dich ein, obwohl ich nach dem, was du mit ihm und Ry angestellt hast, sagen muss, dass der Begriff Freundschaft auf dich angewandt sehr weit gefasst ist.«
Becks’ Worte überraschen mich. Tawny gibt einen merkwürdigen Laut von sich, dann setzt Stille ein … bis sie zu weinen beginnt. Es ist ein leises, kummervolles Wimmern, das mich um meine mühsam aufrechterhaltene Selbstbeherrschung bringt.
Und ich raste erneut aus.
»Nein!«, schreie ich und versuche, Beckett aus dem Weg zu schieben, um auszuholen. »Du wirst nicht weinen! Du hast alles getan, um ihn zu manipulieren. Du hast kein Recht, um ihn zu weinen!« Wieder packt mich jemand von hinten, damit ich nicht zuschlagen kann, aber das ist mir egal. »Verschwinde!«, brülle ich mit brechender Stimme, als man mich wegzieht. Ich wehre mich verzweifelt gegen die Arme, die mich halten. »Nein! Lasst mich los!«
»Schsch.« Es ist Andy. Andys Stimme und Andys Arme, die mich zu halten und zu trösten versuchen. Doch während mein Herz rast und mein Körper vor Wut zittert, weiß ich, dass mich im Augenblick nur eins beruhigen kann. Ich muss zu Colton. Ich muss ihn sehen, ihn anfassen, mit ihm sprechen, damit ich diese schwierige Situation überstehen kann.
Aber das geht nicht.
Er ist irgendwo in der Nähe, mein rebellischer Bad Boy, der den kleinen, traumatisierten Jungen in sich nicht ziehen lassen kann. Der Mann, der gerade begonnen hatte, den Heilungsprozess zuzulassen, liegt zerschmettert auf dem OP-Tisch, und es bringt mich um, dass ich nichts tun kann. Dass ich ihn nicht trösten, nicht beruhigen, nicht wieder aufbauen kann, dass seine reglose Gestalt auf dieser Trage irgendwohin gebracht worden ist, wo Fremde sich um ihn kümmern und ihn versorgen. Fremde, die keine Ahnung haben, welche unsichtbaren Wunden sich unter der Oberfläche verbergen.
Dorotheas und Quinlans Hände greifen nach mir, berühren mich, versuchen mich zu beruhigen, aber ich will nicht. Ich will nur Colton.
Und dann dämmert mir die entsetzliche Wahrheit. Immer wenn Colton in meiner Nähe ist, kann ich ihn spüren, kann ich ein Prickeln, ein Summen in mir fühlen, doch im Augenblick fühle ich – nichts! Ich weiß genau, dass sein Körper in meiner Nähe sein muss, aber der Funke springt nicht über.
Sei mein Funke, Ry. Ich höre seine Stimme in meinem Kopf, spüre noch seinen Atem über meine Wange streichen, doch ich fühleihn nicht.
»Das kann ich nicht!«, brülle ich. »Ich kann nicht dein Funke sein, wenn ich deinen nicht spüre, also wag es ja nicht, mir hier einfach zu verlöschen!« Es kümmert mich nicht, dass ich in einem Raum voller Menschen stehe, und es kümmert mich auch nicht, dass Dorothea mich behutsam umdreht und in ihre Arme schließt, denn der einzige Mensch, der mich hören soll, kann es nicht. Mein ganzer Körper erstarrt vor Angst. Ich kralle meine Hände in Dorotheas Kostümjacke, klammere mich an sie und setze meine Klage fort. »Wag es ja nicht zu sterben, Colton! Ich brauche dich, verdammt noch mal!« Als ich abbreche, ist die Stille um mich herum ohrenbetäubend. »Ich brauche dich so sehr, dass ich hier und jetzt ohne dich sterbe!« Meine Stimme bricht wie mein Herz, und obwohl Dorotheas Arme, Quinlans Murmeln und Andys stille Entschlossenheit mir helfen, weiß ich nicht, wie ich mit alldem umgehen soll.
Ich mache mich los und sehe sie nacheinander an, dann taumele ich blind in den Flur. Ich weiß, dass ich einem Zusammenbruch nahe bin. Ich habe nicht einmal die Energie, mit Beckett zu streiten und meinen Hass auf Tawny neu zu beleben. Aber wenn ich Schuld daran habe, dass Colton hier ist, dann muss sie verdammt noch mal einen Teil dieser Schuld auf ihre Kappe nehmen.
Ich folge den Pfeilen zur Toilette und biege um eine Ecke. Plötzlich kann ich nicht mehr weiter. Ich stütze mich mit beiden Händen an der Wand ab, ringe um Luft und muss mich zwingen, einen Schritt nach dem anderen zu tun. Aber es ist schwer, da ich mich auf nichts anderes konzentrieren kann, als darauf, dass der Mann, den ich liebe, um sein Leben kämpft und ich nicht das Geringste unternehmen kann. Ich bin machtlos, hilflos, hoffnungslos.
Ich sterbe innerlich.
Meine tastenden Hände berühren den Türrahmen, und ich taumele in die nächste offene Kabine. Die Stille in der Toilette tut mir gut. Ich knöpfe meine Shorts auf, und als ich sie über die Hüften schieben will, entdecke ich den karierten Stoff meines Slips. Mein Körper will nachgeben, auf den kühlen Boden sinken und nichts mehr fühlen, und ich stütze mich rasch erneut an der Wand ab. Mein Atem beginnt zu rasen. Ich hyperventiliere, und mir wird schwindlig. Ich gerate in Panik.
Du kannst deinen Hintern darauf verwetten, dass das die einzige karierte Flagge ist, die ich unbedingt für mich beanspruchen will.
Die Erinnerung an seine vertraute Stimme durchdringt mich. Sie ist wie Kitt, der mich zusammenhält und davor bewahrt auseinanderzubrechen. Ich ringe um Luft, während ich mich an sein unglaubliches Grinsen und die jungenhaften funkelnden Augen erinnere, als er mich zum letzten Mal küsste. Unwillkürlich lege ich meine Finger auf die Lippen, um einen Kontakt herzustellen, doch die Ungewissheit, ob wir uns je wieder küssen werden, wiegt bleischwer in meinem Herzen.
»Rylee?«
Ich fahre heftig zusammen, als die Stimme erklingt. Nein! Ich will nicht zurück in die Wirklichkeit. Ich will in meiner Erinnerung schwelgen, die Wärme seiner Haut spüren, seinen Duft wahrnehmen.
»Rylee!«
Es klopft an der Tür der Kabine. »Hm-hm?«, bringe ich hervor.
»Ich bin’s – Quin.« Ihre Stimme ist leise und bebt. »Ry, bitte komm raus …«
Ich entriegele die Tür, und sie drückt sie auf. Ihr Gesicht ist verquollen, die Wimperntusche verschmiert, und ihre Augen blicken verzweifelt. Während sie mich noch betrachtet, beginnt sie plötzlich zu lachen, aber es klingt hysterisch, und die Laute, die von den Wänden der Toilette widerhallen, sind Verzweiflung und Angst pur. Sie deutet auf meine halb herabgezogene Shorts und den schwarz-weiß karierten Slip, und ihr schallendes Gelächter bildet einen unheimlichen Kontrast zu den Tränen, die ihr über die Wangen laufen.
Ich stimme in ihr Lachen ein – ich kann nicht anders. Die Tränen wollen noch immer nicht kommen, die Angst lässt nicht nach, und die Hoffnung schwindet rasant, als ich zu glucksen beginne. Es klingt so falsch. Alles ist einfach nur falsch und schrecklich, und von einem Augenblick zum anderen streckt Quinlan – die Frau, die mich zunächst verabscheut hat – ihre Arme nach mir aus, während ihr Lachen nahtlos in Schluchzen übergeht. Ihr ganzer Körper zieht sich zusammen, als die Trauer und die Angst sie überwältigen.
»Ich fürchte mich so sehr, Rylee«, ist alles, was sie hervorbringt, aber mehr muss sie auch nicht sagen, denn ich empfinde genauso. Ihre gebückte Haltung, der sie überwältigende Kummer und die Verzweiflung in ihrem Griff spiegeln meine eigene Furcht, also klammere ich mich mit aller Kraft an sie.
Ich halte sie, tröste sie und versuche, mich in meine berufliche Rolle als geduldige Therapeutin zu versetzen. Es ist immer so viel einfacher, einem anderen Menschen zu helfen als sich selbst.
Sie will sich von mir lösen, doch ich lasse sie nicht. Ich besitze nicht die nötige Kraft, mit ihr hinauszugehen und auf den Arzt zu warten, der jeden Moment die Familie informieren wird.
Schließlich ziehe ich meine Shorts hoch, mache sie zu und betrachte mich im Spiegel. Mein Verstand rast zurück zu einem zersplitterten, mit Blut bespritzten Rückspiegel, der das Sonnenlicht reflektiert, während Max neben mir gurgelnd um Atem ringt. Und dann erinnere ich mich plötzlich an einen schönen Moment mit einem Spiegel. An einen Moment der Leidenschaft, in dem Colton mir zeigte, wieso ich es war, die er wollte. Wieso er ausgerechnet mich gewählt hatte.
»Komm«, flüstert Quinlan und unterbricht meinen tranceartigen Zustand. Sie legt einen Arm um meine Taille. »Nicht, dass wir noch Neuigkeiten verpassen.«
Die Zeit zieht sich wie Gummi. Jede Minute dehnt sich zu einer Stunde aus, und jede der drei Stunden, die tatsächlich vergangen sind, erscheinen mir wie eine Ewigkeit. Jedes Mal, wenn die automatischen Schiebetüren sich öffnen, setzen wir uns in banger Erwartung auf, nur um anschließend wieder auf unseren Plätzen zusammenzusinken. Der Mülleimer quillt von leeren Styroporbechern über. Im Raum ist es stickig geworden, und die Teammitglieder haben längst ihre Overalls bis zur Hüfte abgestreift und die Ärmel um die Taille verknotet. Ständig klingeln die Handys, weil jemand den Stand der Dinge wissen will. Doch es gibt noch immer keine Neuigkeiten.
Beckett sitzt neben Andy. Dorothea zwischen Quinlan und Tawny. Es wird hauptsächlich geflüstert, und der laufende Fernseher bildet den Hintergrund zu meinen Gedanken. Ich sitze etwas abseits und bin froh, mich mit niemandem auseinandersetzen zu müssen – das Chaos in meinem Kopf nimmt mit jeder Minute schizophrenere Züge an.
Mein Magen brennt. Ich habe Hunger, aber der Gedanke an Essen verursacht mir Übelkeit. Mein Kopf tut weh, doch ich heiße das Hämmern willkommen, denn es ist wie ein Zähler, mit dem ich versuche, die Zeit zu beschleunigen – oder zu bremsen, je nachdem, was für Colton die bessere Lösung ist.
Eine Tür wird mit einem elektronischen Piepen geöffnet. Wieder quietschende Sohlen. Dieses Mal öffne ich nicht einmal die Augen.
»Es gibt Neues zu Mr. Donovan.«
Ich zucke heftig zusammen. Füße scharren, und Leute erheben sich, und prompt liegt eine starke Anspannung in der Luft.
Ich kann nicht aufstehen. Kann mich nicht regen. Ich habe solche Angst vor dem, was ich gleich hören könnte, dass ich wie versteinert dasitze. Ich bohre meine Nägel in meine bloßen Oberschenkel, als könne der Schmerz meine Erinnerungen verdrängen, und bete, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt.
Der Arzt räuspert sich, und ich hole tief Luft.
»Zwar laufen die Untersuchungen noch, aber von dem, was wir bisher haben sehen können, handelt es sich um eine Dezelerationsverletzung mit einer durch die Wucht des Aufpralls bewirkten Fraktur der inneren Organe. Wenn der Körper abrupt gestoppt wird, bewegen sich die Organe im Inneren durch die Massenträgheit weiter, und wie wir bisher beurteilen können …«
»Bitte keine Fachtermini«, flüstere ich. Der Mann hält in seiner Erklärung inne, und als ich meine Bitte wiederhole, wendet er sich mir zu.
»Wir alle hier machen uns große Sorgen«, fahre ich verlegen fort, »und ich schätze, ich kann für alle sprechen, wenn ich sage, dass dieser Medizinerjargon uns eine Höllenangst einjagt.« Er nickt freundlich, also spreche ich weiter. »Verstehen Sie mich nicht falsch, aber könnten Sie uns bitte in einfachen Worten erklären, was mit ihm ist?«
Er lächelt, doch seine Augen bleiben ernst. »Als Colton gegen die Wand prallte, kamen der Wagen und sein Körper zum Stehen, sein Gehirn prallte jedoch wiederum innen gegen den Schädel. Zum Glück trug er das HANS-System, was Schäden im Hals- und Schädelbereich reduziert, die Verletzung ist aber dennoch sehr ernst.«
Mein Herz rast, und mein Atem geht schwer, als mir sofort Millionen Konsequenzen durch den Kopf gehen.
»Wird er …?« Andy tritt näher und stellt die Frage, die wir uns alle stellen, ohne dass er sie zu Ende formulieren könnte. Schweigen legt sich über den Warteraum, und das nervöse Scharren der Füße hört auf. Es ist, als ob alle gleichzeitig die Luft anhalten.
»Mr. Westin, wie ich annehme?« Der Arzt streckt Andy die Hand hin. »Ich bin Dr. Irons. Ich will nicht um den heißen Brei herumreden. Das Herz Ihres Sohnes ist während des Transports zweimal stehen geblieben.«
Mir ist, als hätte mir jemand den Boden unter den Füßen weggezogen. Bitte verlass mich nicht. Bitte verlass mich nicht, flehe ich stumm und hoffe, dass meine Worte ihn irgendwie erreichen.
Andy streckt den Arm nach Dorothea aus und drückt ihre Hand.
»Nach einer Weile waren wir jedoch in der Lage, den Herzschlag zu regulieren, was ein gutes Zeichen ist, da wir befürchteten, die Wucht des Aufpralls hätte die Aorta zerrissen. Inzwischen wissen wir, dass es sich um ein subdurales Hämatom handelt.« Der Arzt sieht auf und schaut mich an, bevor er fortfährt: »Das bedeutet, dass es eine Hirnblutung gibt. Wir stehen hier also vor einem doppelten Problem: Einerseits besteht durch das Trauma eine Hirnschwellung, andererseits übt das austretende Blut weiteren Druck auf das Gehirn aus, da es nirgendwohin entweichen kann.« Dr. Irons blickt über die Menschenmenge im Warteraum. »Da er im Moment relativ stabil ist, bereiten wir ihn auf die OP vor. Es ist zwingend notwendig, dass wir den Schädel öffnen, damit der Druck entweichen kann und die Schwellung zurückgeht.«
Dorothea klammert sich an Andy, und die so offensichtliche Liebe zu ihrem Sohn zerreißt mich innerlich.
»Wie lang wird die OP dauern? Ist er bei Bewusstsein? Gibt es noch andere Verletzungen?« Zum ersten Mal meldet sich Beckett zu Wort.
Dr. Irons schluckt und legt die Finger vor seinem Körper aneinander. »Im Vergleich zu der Schädelverletzung sind die anderen relativ geringfügig. Er ist gegenwärtig nicht bei Bewusstsein und seit dem Unfall auch nicht wieder zu sich gekommen. Er befindet sich in dem für diese Verletzungen typischen komatösen Zustand, in dem er sporadisch unzusammenhängend zu sprechen beginnt und sich gegen uns wehrt. Weitere Prognosen können wir erst abgeben, wenn wir die Operation hinter uns haben.«
Beckett stößt geräuschvoll die Luft aus. Seine Schultern sacken nach vorn, und ich weiß nicht, ob es vor Erleichterung oder aus Resignation ist. Nichts von dem, was der Arzt gesagt hat, hat die bleischwere Last auf meiner Seele erträglicher gemacht. Quinlan tritt vor, nimmt Becks’ Hand und wirft einen Blick zu ihren Eltern, bevor sie die eine Frage stellt, deren Antwort wir alle fürchten. »Wenn die Schwellung nicht durch die OP gestoppt werden kann …« Sie bricht ab, und Beckett zieht sie in einer brüderlichen Geste an sich. »Was … was bedeutet das? Ich meine, wenn Sie von einer Hirnblutung sprechen, wie … wie sind dann die Prognosen?« Ihr stockt der Atem, und sie unterdrückt ein Schluchzen. »Wie stehen seine Chancen?«
Der Arzt seufzt. »Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das nicht mit gutem Gewissen sagen. Wir müssen erst sehen, welche Bereiche genau in Mitleidenschaft gezogen wurden.« Aus Andys Kehle kommt ein erstickter Laut. Dr. Irons legt ihm eine Hand auf die Schulter, bis Andy zu ihm aufsieht. »Wir tun, was wir können. Wir sind Fachleute auf diesem Gebiet, und Ihr Sohn könnte nicht besser versorgt sein. Bitte verstehen Sie, dass ich mich nicht deshalb nicht zu den Erfolgschancen äußere, weil ich keine sehe, sondern weil wir erst herausfinden müssen, womit genau wir es zu tun haben. Sobald ich Bescheid weiß, entwickeln wir eine Strategie und handeln danach.« Andy nickt und wischt sich mit dem Handrücken über die Augen, und Dr. Irons blickt über die vielen Menschen, die sich im Wartezimmer versammelt haben. »Er ist stark und war zum Zeitpunkt des Unfalls in hervorragender körperlicher Verfassung, und das sind die besten Voraussetzungen.Es ist offensichtlich, dass der junge Mann von vielen Menschen geliebt wird, und ich kann Ihnen versichern, dass ich dieses Wissen mit in den Operationssaal nehmen werde.« Mit einem letzten Lächeln wendet er sich um und verlässt den Raum.
Niemand sagt etwas. Es ist, als müssten alle das Gehörte erst einmal verarbeiten.
Schließlich beginnen sich alle wieder zu bewegen.
Doch ich kann das nicht.
Colton lebt. Er ist nicht tot wie Max. Er lebt.
Aber die dumpfe Erleichterung kann den scharfen Schmerz der Ungewissheit nicht verdrängen. Und noch weniger kann sie die Angst lindern, die tief in meiner Seele sitzt. Ich spüre die Klauen der Klaustrophobie über meine Haut tasten und atme stoßweise aus. Schweiß tritt auf meine Oberlippe und rinnt mir den Rücken herab. Mein Atem kommt flach.
Wieder tauchen Bilder vor meinem inneren Auge auf. Max wird zu Colton, Colton zu Max. Blut, das aus seinem Ohr rinnt. Aus dem Mundwinkel. In Sprenkeln an der Windschutzscheibe. Mein Name ein ersticktes Flüstern. Sein Flehen, das sich in mein Gedächtnis einbrennt, um mich nie wieder loszulassen.
Ich brauche frische Luft. Ich brauche dringend eine Pause von diesem niederdrückenden Raum, ich brauche Farbe und Leben und Lebendigkeit – irgendetwas anderes als sterile monochrome Fliesen und furchtbare Erinnerungen.
Ich stemme mich hoch und renne fast hinaus, ohne auf Becketts Ruf einzugehen. Blind taumele ich auf den Ausgang zu, denn nun verheißt das Geräusch der Schiebetüren Freiheit und eine Atempause von der Panik, die meine Hoffnungen zu ersticken versucht.
Du bringst mich dazu, wieder zu fühlen, Rylee …
Ich stolpere durch die Türen, als die Erinnerung mich wie ein Fausthieb in den Bauch trifft. Ich keuche auf. Der Schmerz geht mir durch und durch. Ich ringe um Luft, als ich verzweifelt nach etwas suche, an das ich mich klammern kann. Das meinen Glauben daran stärkt, dass Colton diese Operation übersteht. Dass er die Nacht übersteht. Und den kommenden Morgen.
Ich schüttele den Kopf, um die beängstigenden Gedanken loszuwerden, während ich hinaustrete … und das Chaos über mich hereinbricht. Mindestens hundert Kameras blitzen gleichzeitig, und das Aufbranden der Stimmen, die mir Fragen zurufen, trifft mich wie eine Welle, vor der ich zurücktaumele. Augenblicklich stehe ich mit dem Rücken an der Wand und werde von Reportern bedrängt, die mir ihre Mikrofone hinhalten und unaufhörlich Fotos machen.
»Stimmt es, dass Colton Donovan im Sterben liegt?«
Die Worte bleiben mir im Hals stecken.
»In welcher Beziehung stehen Sie zu Mr. Donovan?«
Zorn steigt in mir auf, aber sie lassen mir keine Zeit.
»Sind seine Eltern jetzt gerade bei ihm?«
Mein Mund öffnet und schließt sich, meine Hände ballen sich zu Fäusten, mein Glaube an die Menschheit fällt in sich zusammen. Ich weiß, dass ich völlig verängstigt aussehen muss, und ich fühle mich auch so. Ich hatte gefürchtet, dass ich drinnen einen klaustrophobischen Anfall erleiden würde, doch hier draußen drücken mir die Medien die Luft ab. Mein Atem kommt in kurzen Stößen. Der blaue Himmel über mir beginnt sich zu drehen, und mein Verstand driftet ab in eine warme Dunkelheit.
Bevor ich jedoch in die willkommene Ohnmacht sinken kann, schlingen starke Arme sich um mich und verhindern, dass ich zu Boden gehe. Ich sacke gegen Sammys breite Brust, und die Erinnerung an das letzte Mal, dass ich in die Arme eines Mannes gefallen bin, zuckt durch meinen Verstand mit bittersüßen Bildern von vergessenen Bieterkarten und klemmenden Schranktüren. Lebendige grüne Augen und ein arrogantes Grinsen.
Mein sorgloser Rebell.
Sammys Stimme dringt durch meinen vernebelten Geist. »Verschwindet«, knurrt er die Presse an, während er mich mit einem Arm um die Taille aufrecht hält. »Wir sagen Bescheid, sobald es etwas Neues gibt.« Wieder flammen zahllose Blitze auf.
Und wieder das Zischen der Schiebetür, aber dieses Mal bin ich froh darüber. Das Biest im Inneren ist besser zu bekämpfen als das dort draußen. Meine Atmung beruhigt sich wieder ein wenig, mein Herzschlag verlangsamt sich. Sammy drückt mich sanft auf einen Stuhl nieder, und als ich zu ihm aufsehe, blickt er mich streng an.
»Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht?«, faucht er mich an. »Die hätten dich doch bei lebendigem Leib aufgefressen.« Die heftige Reaktion des sonst so unerschütterlichen Bodyguards zeigt mir, wie dumm es wirklich von mir war, nach draußen zu gehen; ich habe mich noch nicht an das Ausmaß an Öffentlichkeit in Coltons Welt gewöhnt. Sammy hat draußen gestanden und dafür gesorgt, dass wir hier drinnen ohne Störung unter uns bleiben können, und als mir das klar wird, schäme ich mich plötzlich in Grund und Boden.
»Es tut mir leid«, sage ich leise. »Ich brauchte einfach nur frische Luft und wollte nicht … Es tut mir so leid.«
Sein Blick wird freundlicher. »Alles okay mit dir? Hast du schon was gegessen? Du bist gerade fast ohnmächtig geworden. Du solltest unbedingt etwas zu dir nehmen …«
»Danke, mir geht’s gut.« Langsam stehe ich wieder auf. Ich glaube, er ist überrascht, als ich plötzlich seine Hand nehme und sie drücke. »Und wie geht’s dir?«
Er zuckt nonchalant die Achseln, aber ich weiß, dass es nur Show ist. »Solange er wieder gesund wird, bin ich zufrieden.«
Er nickt mir zu, dann macht er kehrt, um wieder seinen Posten draußen einzunehmen. Ich schaue ihm nach und denke an die gnadenlosen Kommentare und Fragen der Presseleute draußen, während ich versuche, den Mut aufzubringen, in den Wartebereich zurückzukehren.
Für einen Moment schließe ich die Augen und versuche, mich wieder auf schöne Erinnerungen zu konzentrieren. Aus den Tiefen meiner Verzweiflung versuche ich den Klang seiner Stimme heraufzubeschwören, den Geschmack seines Kusses, ja sogar seine Sturheit und wilde Entschlossenheit – alles, um die Nähte meines Herzens, das Coltons Liebe wieder zusammengefügt hat, zu klammern und zu kräftigen.
Nicht unbedeutend. Du könntest niemals unbedeutend sein.
Die Worte geben mir Hoffnung. Ich hole tief Luft und bringe meine Füße dazu, sich zu bewegen und den langen Flur in Angriff zu nehmen. Ich gehe gerade an der Schwesternstation vorbei, als ich zwei Krankenschwestern, die mir den Rücken zukehren, Coltons Namen aussprechen höre. Sofort verlangsame ich mein Tempo; ich nehme jede noch so geringe Information, die ich kriegen kann. Denn natürlich will mein Verstand immer wieder zu grübeln beginnen, ob man uns in Bezug auf Coltons Zustand auch wirklich die Wahrheit gesagt hat.
Und was ich höre, kann ich kaum glauben
»Wer ist in OP eins bei Mr. Donovan?«
»Dr. Irons hat den Eingriff übernommen.«
»Oh, das ist gut. Wenn ich unter solchen Umständen operiert werden müsste, dann könnte ich mir definitiv niemand Besseren dafür wünschen als Ironman!«
Spiderman.
Ich keuche auf, und die Schwestern drehen sich zu mir um. Die größere der beiden kommt einen Schritt auf mich zu und sieht mich fragend an. »Können wir Ihnen helfen?«
Batman.
»Wie haben Sie Dr. Irons genannt?«
Superman.
Sie runzelt leicht die Stirn. »Sie meinen unseren Spitznamen für den Doktor?«
Ironman.
Ich kann nur nicken, denn meine Kehle ist plötzlich wie zugeschnürt. »Oh, wir nennen ihn hier nur Ironman, Liebes. Brauchen Sie etwas?«
Spiderman. Batman. Superman. Ironman.
Ich schüttele nur den Kopf und gehe ein paar weitere Schritte auf den Warteraum zu. Doch dann lehne ich mich an die Wand und rutsche daran zu Boden. Coltons geliebte Helden sind hier, und die Symbolkraft drückt mich schier nieder.
Ein Mantra aus der Kindheit ist zur Hoffnung eines Erwachsenen geworden.
Ich lege meine Stirn auf die angezogenen Knie und klammere mich an den Glauben, dass dieses kuriose Zusammentreffen mehr ist als nur das – ein Zusammentreffen nämlich. Immer wieder sage ich diese Namen auf, und ich bin sicher, dass diese Helden noch nie mit solch einer Ehrfurcht angerufen worden sind.
»Colton hat als kleiner Junge im Schlaf immer davon gemurmelt«, erklingt plötzlich Andys Stimme vor mir. Ich sehe erschreckt auf, als er sich neben mir herabgleiten lässt und sich seufzend auf den Boden setzt. Ich verlagere meine Position, damit ich ihn ansehen kann. Er sieht älter aus als noch heute Morgen, bevor das Rennen begann. Seine Augen blicken traurig, und er versucht zu lächeln, scheitert aber kläglich. Der Mann, der bisher nur so vor Energie strotzte, wirkt nun jeder Lebenskraft beraubt. »Ich habe das seit einer Ewigkeit nicht mehr gehört. Ich hatte es sogar ganz vergessen, bis ich dich es gerade sagen hörte.« Er lacht leise, tätschelt mein Knie und streckt die Beine aus.