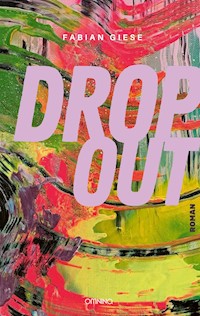
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Omnino Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ingmar war mal wer in der Provinz. Er hatte Geld, Familie, eine eigene Firma. Heute mit fast Mitte 50, hier in Berlin, hat er nichts mehr. Nicht mal eine Wohnung oder Lust aufs Leben. Doch sein Hippie-Freund Tobi träufelt ihm nach und nach Kraft und Zuversicht ein. Oder auch mal MDMA. Ein mysteriöser Anruf schickt die beiden mit Tobis französischem Wagenburg-Buddy Pierre auf einen absurden Roadtrip quer durch Europa – Tobis seit Jahren verschollener Vater, ein kauziger Wissenschaftler, steckt in der Klemme. Für Ingmar scheint eine andere Zeit anzubrechen. Er stellt sich sogar seiner egomanen Vergangenheit, die sein eigenes Schicksal und das vieler anderer gegen die Wand fuhr. Aber seine Schmerzen im Bauch werden immer heftiger, Blut husten kann auf Dauer einfach nicht gesund sein... In Dropout lässt Fabian Giese die Vater-Sohn-Beziehungen der drei Protagonisten aufeinanderprallen. Aber auch gegenwartspolitische Themen wie toxische Männlichkeit, Rassismus und Turbokapitalismus verwebt er mit dichter und direkter Sprache zu einer turbulenten Erzählung, die immer wieder die Grenzen zwischen Realität, Traum und Trip verschwimmen lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Dropout
Für Alessia
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Lektorat / Korrektorat: Ralf Diesel
Grafisches Gesamtkonzept, Titelgestaltung, Satz und Layout: fototypo.de
ISBN: 978-3-95894-244-8 (Print) / 978-3-95894-245-5 (E-Book)
© Copyright: Omnino Verlag, Berlin / 2023
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 1
Alle Viere von sich gestreckt lag er da. Wie ein Schneeengel, der aufgegeben hat, weiter mit den Flügeln zu schlagen. Leerer Blick.
„Wenn es doch Schnee wäre“, dachte er sich, „dann könnte ich einfach meine Augen zumachen. Einschlafen.“
Aber es war einfach nur Dreck, der von unten an ihn ransuppte. Dreck und Staub des Hochsommermolochs, dessen parasitärer Bewohner er war. Dreck und Staub, den der kurze, aber heftige Gewitterschauer in graue, miefende Matsche verwandelt hatte.
„Von wegen Sommerregen duftet immer so frisch“, grummelte er vor sich hin.
Der modrige, leicht beißende Gestank zog sogar ihm merklich in die Nase. Und das, obwohl er mittlerweile mehr als abgehärtet war, was unangenehme Gerüche betraf. In der U-Bahn wechselten wegen ihm die Menschen angeekelt das Abteil, ihre Blicke beschämt zu Boden oder aus dem Fenster raus gerichtet. Verübeln konnte er es ihnen nicht. Hätte er früher nicht anders gemacht. Aber dieser Fakt änderte nichts daran, dass es einfach wehtat – auch wenn er sich das nicht eingestehen wollte. Seine Klamotten umschlackten ihn, sonst immer völlig verkrustet und seit Wochen nicht gewaschen, jetzt komplett durchnässt. Sie zogen ihn nochmal mehr zu Boden. So wie das von ihm runtertriefende Wasser einer brackigen Brühe entsprach und dabei eine ungewollte Teilreinigung vollzogen wurde, hatte er das Gefühl, dass seine gesamte Rückseite die doppelte Menge an zivilisatorischer Ursuppe gierig einsog. Er war ein dreckiger unbedeutender Tropfen im ursprünglichsten aller Kreisläufe – von Staub zu Scheiße zu Staub zu Scheiße zu Staub und immer so weiter.
Der Dreck war über die Monate zum Panzer geworden. Versuche, ihn abzulegen, waren zwecklos. Das Gewicht drückte erbarmungslos auf die Schultern. Bucklig kam er mittlerweile daher. Und dabei war er vor drei Wochen gerade erst 52 geworden. Dem Klischee nach für Männer eigentlich das beste Alter. Etabliert, abgesichert, erfolgreich, faltiger als in den Zwanzigern, aber immer noch attraktiv genug, um bei Weihnachtsfeiern Werkstudentinnen und bei Messebesuchen Hostessen abzugreifen.
Er war am Ende. Sein Leben ein sinnloses Dahinsiechen. Früher hatte er sich in seinem Hochmut Unsterblichkeit gewünscht. Heute wäre er froh, sterblicher zu sein. Seine Welt: ein emotionaler Kühlschrank.
„Kann bitte jemand die Tür zumachen, damit endlich das Licht ausgeht?“
Er blinzelte hektisch. Ein Tick, der vor geraumer Zeit über Nacht gekommen war. Abrupte und unkoordinierte Verschlusszeiten für abertausende triste Bilder, die sich Tag für Tag auf seiner Netzhaut einbrannten. Er selbst hatte keine Lust, in diesem Museum der Retrospektive umherzuwandeln. Was so viele in dieser Stadt auf ihrem yuppieesken Selbstfindungstrip verzweifelt versuchten, gelang ihm tatsächlich problemlos: im Augenblick zu leben. Also, nicht wirklich leben. Eher dahinvegetieren. Aber das, was hinter ihm lag, und noch viel mehr das, was folgen sollte, spielte für ihn keine Rolle mehr. Gedanken an die Vergangenheit verursachten Schmerz (die Phase der Selbstkasteiung hatte er hinter sich), also hatte er sich selbst so konditioniert, Erinnerungen an die gute alte Zeit innerhalb von Sekundenbruchteilen verpuffen zu lassen. Nun war er schon an dem Punkt des Vergessens angelangt. Blasse Nebelschwaden hingen irgendwo da hinten in den Wirrungen seines nur noch an vereinzelten Stellen behaarten Kopfes, traurige Büschel verfilzter Haare hingen herab wie Trauerweiden. Aber auch diese wattigen Episoden seines alten Ichs würden bald restlos verschwunden sein. Und wie gesagt, noch extremer war er mit allem Zukünftigen. Wenn er nur an das Wort Zukunft dachte, musste er verbittert auflachen, was meist in röchelnd-rasseligem Husten resultierte.
„Wie dumm sind die Leute da draußen eigentlich alle? Denken, dass alles, dem sie Zukunft voranstellen, höher, schneller, geiler bedeutet? Zukunftsvision, Zukunftsforscher, zukunftsweisend … immer nur Fortschritt, anhäufen, mehr, mehr, mehr. Keiner bleibt auf der Strecke. Und wenn doch, hat er’s nicht anders verdient. Schwach oder dumm oder faul oder einfach nur Pech oder alles davon.“
Diese ethisch-philosophisch angehauchten Abhandlungen konnten ihn ewig beschäftigen. Ab und an wuchsen sie zu Streitgesprächen aus, er duellierte sich mit sich selbst, brabbelte und plapperte unentwegt vor sich hin, schob die Ärmel seines Sweatshirts mit den ausgeleierten Bündchen hektisch über die Ellenbogen. Nach zwei Sekunden das gleiche Spiel, weil sie wieder runtergerutscht waren. Rote Striemen auf den Unterarmen – immer dieses Kratzen mit seinen ungeschnittenen, schorfig-rauen Fingernägeln. Dabei hüpfte er eine nur ihm bekannte Choreographie, die mit zunehmender Diskussionsintensität immer wilder wurde. Jedes Mal, wenn es zu solchen Ausbrüchen an sehr belebten Ecken, wie dem Alexanderplatz oder dem Hermannplatz, kam, bildete sich um ihn herum eine ovale Freifläche, unsichtbar abgekordelt zu den dutzenden Passanten, die um seinen Dunstkreis herumflossen, die Köpfe schüttelnd, die Augen verdrehend. Das war kein Kunstprojekt, das aufrütteln sollte. Das war ein Theaterstück in unzähligen Akten, das das Leben geschrieben hatte – mit Blut, Schweiß, Tränen, Speichel, Sperma. Das Publikum war ihm eigentlich egal. Es störte ihn aber, dass niemand außer ihm Position bezog, sich auf eine Seite schlug, mit einstieg in den verbalen Schlagabtausch. Hier ging es um was! Hier wurden gerade die tatsächlichen Grundfesten unseres Daseins auseinandergenommen! Wie konnte das allen so scheißegal sein?! Alles dumme Lämmer, die allem und jedem hinterhertrotten, was nur im Ansatz Status, Anerkennung, Befriedigung, Ablenkung versprach. So, so lange war er einer von ihnen gewesen, aber das lag jetzt hinter ihm. Diese Ignoranz brachte ihn auf die Palme, trieb den Puls in die Höhe. Die Adern an seiner Schläfe traten pochend hervor, Schweißperlen rannen die Stirn herunter, brannten in den eh schon stark geröteten, trockenen Augen.
Für das Ende dieser brachialen Performances gab es eigentlich nur zwei Szenarien: Entweder sank er irgendwann komplett erschöpft in sich zusammen und schlief komatös ein. Oder die netten Herrschaften in Blau kamen vorbei, verwiesen ihn des Platzes, redeten auf ihn ein, packten ihn letztendlich unwirsch, sodass die Knochen knackten, und warfen ihn ohne Umschweife in eine karge Zelle, in der es nicht mehr gab als eine dünne Plastikmatte und kaltes Licht. Ein Loch im Boden fürs Nötigste. Blutige Knöchel waren nach jedem dieser Aufenthalte normal. Der Schorf hatte gar keine Chance, zu aschfahler Haut heranzureifen. Ein ums andere Mal landete er krachend auf den weißen Kacheln. So schnell, wie die wässrig roten, kryptischen Krakeleien an der Wand nach seiner Freilassung abgewischt wurden, so schnell geriet er jedes Mal in Vergessenheit bei den Beamten vor Ort. Nach ihm wurde der nächste Verrückte abgeliefert, die Zellentür hätte gut eine Drehtür sein können. Empathie: Fehlanzeige. Bürokratische Wahrung der öffentlichen Ordnung. Da war kein Platz für Einzelschicksale, die solche Verhaltensweisen eventuell hätten erklären können. Nach Stechuhr und Regel 35b Absatz schieß-mich-tot wurde verfahren. Völlig egal, ob es sinnvoll war. Hauptsache Kollege Bürstenschnitt konnte einen Haken dahinter machen, die x-te Beschwerde, das x-te Vergehen in seiner Akte vermerken, um dann beruhigten Gewissens zum Abendbrot mit Bierwurst und Spreewaldgürkchen zu fahren.
Der Regen und die Wolkenwand, die kurzzeitig apokalyptisch anmutete, hatten sich verzogen. Das unschuldig strahlende Blau bot ihm eine Leinwand, auf der seine verdreckten Finger Endlosschleifen zogen. Aber nichts blieb hängen. Er malte weiter, abwesend, dennoch irgendwie fasziniert von der Weite in seinem Blickfeld. Plötzlich tauchte eine ausgestreckte Hand vor seinen Augen auf. An der Hand hing ein Typ, den er kannte. Dieses schlitzohrige Grinsen war einzigartiger als sein Fingerabdruck: Tobi – ein, wenn man Ingmar fragte, auf Pilztrip hängengebliebener Mittvierziger, der durch die Parks Berlins schwebend göttliche Liebe „spreadete“ und Anglizismen jenseits von Gut und Böse verwendete, weil er sich vor zehn Jahren mal für ein paar Wochen in einer hawaiianischen Kommune verlustiert hatte und ihn die Vibes seitdem nicht mehr losließen. An und für sich war er aber ein dufter Typ.
„Ey, Ingo! Was machst du für weirden Stuff hier? Das nenn’ ich mal ’nen Schlamm-assel“, hechelte Tobi ihm entgegen, krakelig lachend.
Tobi hatte ein Faible für Wortspiele, für die sich 99 Prozent seiner Mitmenschen schämen würden. Außerdem konnte Tobi es sich einfach nicht in seine in esoterischen Sphären verlustierende Birne packen, dass er Ingmar hieß. Nicht Ingo. Aber was bedeutete das schon, eigentlich war’s völlig egal. Ingmar oder Ingo. Beides Kacknamen. Zu Anfang hatte er noch versucht, ihm Eselsbrücken zu schaffen:
„Na: Ingmar. So wie Ingmar Bergman.“
„Ah, war das nicht der, der schon sieben Mal aufm Mount Everest war und – so funny! – Bergmann heißt?“
„Nein, das ist ein ziemlich berühmter … ach, ist doch auch latte. Vergiss es!“
Trotzdem hatte er Tobi irgendwie ins Herz geschlossen. Oder eben in das, was die letzten Jahre des Selbsthasses übriggelassen hatten. Tobi war ein aufrechter Kerl. Vielleicht nicht mehr der Hellste. Aber grundehrlich. Er log tatsächlich nie. Dem hatte er abgeschworen. Einfach so. Damals, als er zum zweiten Mal nackt auf LSD durch den Grunewald tanzte und alteingesessene Seniorinnen in Allwetterjacken bei ihrem samstäglichen Nordic-Walking-Stammtisch die Schamesröte in die gebotoxten Gesichter trieb. Zum einen, weil er schrecklich schief Schlager aus den späten Fünfzigern trällerte. Zum anderen, weil sein Gemächt tatsächlich eben jenen Namen verdient hatte und selbst Poolboy Pedro aus Guadalajara, der im vergangenen Sommer bei Claudia und ihren Mädels reihum gegangen war, nicht hätte mithalten können. Das Gemächt baumelte, während Tobi taumelte. Und in den kindischen Untiefen seines innersten Ichs blickte er in einen Spiegel, in dem ein mit pinker Dauerwelle aufgehübschtes Krokodil zu ihm meinte, dass lügen ja sowas von bourgeois sei und er deshalb doch bitte zukünftig davon abrücken solle. Tobi und das Krokodil gaben sich ein High Five und damit war ‚der Deal done‘. So hatte ihm Tobi eines nasskalten Novemberabends davon vorgeschwärmt. Für Ingmar war es die einzige Konstante, die in seinem Leben übriggeblieben war: Tobi, der immer die Wahrheit sagte. Ein letzter kleiner Strohhalm auf dem sonst restlos niedergemähten Feld, auf dem einst die prächtigsten Illusionen blühten. Und genau deshalb konnte Ingmar diesem bärtigem Waldschrat (so bezeichnete er ihn still und heimlich für sich) nicht im Geringsten böse sein, als er ihn eben aus der fahrigen Himmelspinselei ge-eyt hatte.
Tobi zuttelte eine schon ziemlich vergilbte Einkaufsplastiktüte aus der Seitentasche seines Sommerparkas, faltete sie säuberlich auf, als wäre es ein edler Flokati, und platzierte dann seinen Hintern darauf, um nicht wie Ingmar die Schlacke des unbegrasten Parkgrunds in die Kimme gepresst zu bekommen. Natürlich im Schneidersitz. Ingmar richtete sich schwer ächzend auf. Seine Sitzhaltung glich einem Sack Mehl, den man achtlos in die Ecke gepfeffert hatte. Und bei jeder Bewegung des Oberkörpers dieser dumpfe Schmerz im Brustkorb, weit ausstrahlend, ohne dass er das genaue Zentrum ausmachen konnte. Tobi streckte ihm ein erstaunlich kühles Sterni hin.
„Seine verdammt hässliche Jutetasche hat also auch positive Seiten“, dachte sich Ingmar. „Hoffentlich verstecken sich da noch mehr von der Sorte …“
Sie prosteten sich zu, ein erster tiefer Schluck, es prickelte nicht im Bauchnabel, aber die Kehle runter. Da erst merkte Ingmar, wie lange er wohl nichts mehr getrunken hatte. Der Wunsch nach Flüssigkeit lag gleichauf mit dem Wunsch nach Alkohol. Er musste sich zusammenreißen, die Flasche nicht mit wenigen großen Schlucken zu leeren. Auch Tobi waren Ingmars gierige Augen nicht entgangen.
„Sachte, sachte, Dude. Ohne bewussten Genuss sind wir doch nix anderes als asselige Kellerasseln, right?“
Zur Veranschaulichung ließ er einen Käfer mit schimmerndem Panzer vom Boden auf seine Finger krabbeln und betrachtete ihn anschließend aus nächster Nähe.
„Findest du nicht auch, dass allein schon diese Gedanken Fluch und Segen zugleich sind? Also dass wir Menschen die einfach so haben, gar nicht ohne können, unser Hirn ständig rotiert und alles mit einem Sinn versehen will? … Ingo? Ingo! Listen to me!“
Wenn ihm jemand nicht zuhörte, konnte Tobi echt schnell salzig werden. Dann schnaubte er affektiert, was seiner Echauffiertheit eher komödiantischen Charakter verlieh, als dass es beim Gegenüber für erhöhte Aufmerksamkeit sorgte. So war es auch der Hauch eines süffisanten Grinsens, den Tobi auf Ingmars Gesicht erhaschte.
„Ey, du bist echt ‘n ass! Bier einheimsen, aber keine Manieren hier mit deinem Buddy. Du bist mir einer …“, raunzte Tobi.
„Ja ja ja, komm mal runter“, brummte ihm Ingmar entgegen. „Ist nicht so mein Tag. Hab’ scheiße geschlafen. Und kacken war ich seit zwei Tagen nicht mehr. Backsteine im Bauch.“
Er zog seinen Pulli hoch, um wohl zu zeigen, dass dem auch so war. Tobi sah nichts außer einen ausgemergelten Rumpf mit Schmerbauchansatz.
„Äh, ok, sorry. Wenn ich das gewusst hätte. Will dich ja nicht nerven. Dachte nur, dass du vielleicht ein bisschen …“
„Komm, lass gut sein, passt schon“, fiel Ingmar ihm ins Wort.
Er wusste, wenn sich hier einer entschuldigen musste, dann er. Einen Freund wie Tobi hatte er eigentlich gar nicht verdient. War er tatsächlich so was wie ein Freund? Konnte nicht sein. Mit ihm würde sich doch keiner ernsthaft abgeben wollen. Er war ein Stück Abfall, nicht mehr, nicht weniger. Ausgekotzt vom Erfolgsroulette, den ganzen Einsatz auf die falsche Zahl gesetzt. Und schon fuhr Ingmar eine weitere Runde in der Selbstmitleidsachterbahn, hoch und runter, immer schneller, Looping nach Looping, im Magen rumorte es kräftig, Säure stieg ihm in die Speiseröhre. Er spülte die Übelkeit zackig mit Bier runter. Der letzte Schluck schmeckte fahl. Das Prickeln war weg, welch’ Analogie auf sein Leben, sinnierte er in sich rein. Seine dürren Knochen schlotterten.
„Du, ich würde jetzt mal wieder lossteppen. Irgendwelche plans hab’ ich für heute Abend noch keine gemacht. Willste dich mit mir treiben lassen?“
Dabei machte er wellenartige Bewegungen mit seinen zu den Seiten ausgestreckten Armen, wiegte den Kopf hin und her und setzte einen Hundeblick sondergleichen auf – aber eher à la dahergelaufener Mischling im letzten Lebensabschnitt und nicht als kindchenschematisch für Entzückung sorgender Vorzeigewelpe.
„Ich würde auch erst mal in mein Crib gehen, um mir was hinter die Kauleiste zu heften. Hab’ zu viel gekocht, und bevor ich’s rausschmeißen muss. Komm schon, gib dir einen Ruck“, Tobi versetzte ihm einen fast liebevollen Schulterschubser.
„Oooh maaan, okeee … bevor du noch ewig rumnervst!“
Es war ihr kleines, nur ihnen bekanntes Ritual, und obwohl es so offensichtlich war, spielten sie beide ihre Rollen nach all diesen Monaten weiterhin sehr überzeugend. Ingmar, der sich nur nach ewiger Bettelei überreden ließ, mitzukommen, und sich dabei nichts sehnlicher wünschte, um nicht allein zu sein. Tobi, der ein feines Gespür hatte, sich über Ingmars Verhalten maßlos hätte aufregen können, es aber unterließ, da ihm bewusst war, welche Ankerfunktion er für Ingmar hatte. Im echten Leben, also in dem Leben, in dem bei Ingmar alles nach Plan gelaufen war und er dabei schön geschmeidig in der Spur lief, hätten sie sich never ever kennengelernt. Da war sich Tobi sicher. Ihre Bubbles hätten sich voneinander abgestoßen, für einen kurzen Augenblick wären die Hüllen vielleicht aneinander gerieben worden, ohne dabei den anderen überhaupt wahrzunehmen. Und dann dachte das Schicksal sich: So, den Ingmar schnapp’ ich mir mal, zeig dem, was ’ne Harke ist. Große Nadel, schützende Bubble ade. In Stein gemeißelte Gewissheiten und kristallklare Träume, die zerbröckelten und zerplatzten.
Tobi schnappte sich Ingmars Hand, zog ihn hoch, klopfte auf dessen T-Shirt rum, was aber nicht wirklich half. Nass und dreckig war es nach wie vor. Den alten Bundeswehrrucksack über die Schulter geworfen, schlurfte Ingmar, nur nach außen hin missmutig dreinblickend, aber innerlich himmelhoch jauchzend, diesem liebenswerten Hippie-Klischee hinterher. Die nassen Socken in den zerschlissenen Adidas-Tretern waren kein Vergnügen. Das Resultat nach einem guten Kilometer: Blasen auf den Blasen, die auf den Narben der vorangegangenen Blasen munter vor sich hin schmerzten. Früher genoss er im Freundeskreis einen Ruf als passionierter Wanderer. Wenn jemand auf der Suche nach herausfordernden und unbekannten Trekking-Touren in den Dolomiten oder im gerölligen Gebirge Teneriffas war, dann rief man Ingmar an, der ausführlichst Auskunft gab und gerne auf seinen Blog verwies. Laeuftbeimir.de. Die Besucherzahlen hatten sich in Grenzen gehalten. Wahrscheinlich lag es am Umlaut, der bei der Eingabe der URL insbesondere legasthenische Wanderer völlig überforderte. Oder der zu große kompetitive Charakter seiner Auffassung von Wandern. Es ging nämlich vor allem darum, immer schneller zu sein als die anderen, die Tour noch länger und kraftraubender zu machen, als Sieger aus dem Ganzen hervorzugehen – die Schönheit der Natur spielte zum Beispiel nur noch eine untergeordnete Rolle. Das war was für Frauen.
Seit sein Leben eine 180-Grad-Wende absolviert und ihm dabei den ausgestreckten Mittelfinger in die Harnröhre gerammt hatte, hasste er es zu laufen, vom Wandern ganz zu schweigen. Das war halt echt so ein Ding für Reiche. Wandern. Sinnbefreites Rumlatschen, weil man es sich leisten konnte. Schon mal einen Goldminenarbeiter aus Mali dabei erwischt, der sich an seinem freien Tag des Monats die Walkingstöcke schnappte und mit einer flotten Melodie auf den Lippen losstiefelte? Wohl kaum. Mit all diesem Groll im Kopf, mit diesem zunehmend klaren Blick auf die Verhältnisse in seinem Kiez, dieser Stadt, dem Land, den drumherum befindlichen Ländern, den anderen Kontinenten verbitterte Ingmar immer weiter. Wir sind alle gefickt – und wir werden andauernd weiter gefickt. Und niemand scheint ein Problem damit zu haben. Alles eine große Maskerade. Er schnaubte und trottete und schnaubte.
„Wie lang denn noch, Tobi?“
„Wir haben es gleich, wirklich!“
„Aber das letzte Mal sind wir doch da vorne links rum und mussten dann noch 20 Minuten auf den geklauten Bikes radeln?!“
„Jahaaa. Aber ich musste da weg, die haben Ärger gemacht. Ich sag’ dir, find mal ’nen neuen Stellplatz zurzeit. Und da jammern alle, der Wohnungsmarkt sei so terrible. Mimimi! Da bleibt mir die Spucke im Hals stecken beim Lachen, eh eh eh …“
Tobi besaß, seit er aus Hawaii zurückgekommen war, einen uralten Schaustellerwagen, den er sich beim Genuss hunderter Joints Schritt für Schritt zum feuchten Traum aller Aussteiger um- und ausgebaut hatte. Wagenburgen in ganz Europa hatte er im vergangenen Jahrzehnt sein Zuhause genannt. Und doch zog es ihn immer wieder nach Berlin zurück.
„Ingo, da ist der Spirit ein anderer. Ich kann’s nicht erklären. Selbst wenn sie mir die Reifen zerstechen oder die Gasflasche mopsen, nehm’ ich das als Zeichen der appreciation. Was sich liebt, das neckt sich, was! Pahaha!“
Ingmar schüttelte bei Tobis Ausführungen seiner Liebe zu Berlin immer nur ungläubig den Kopf. Er würde sich wünschen, aus diesem Drecksloch endlich verschwinden zu können. Für immer. Wahrscheinlich war Tobi heimlich Masochist, davon war Ingmar nach nicht allzu langer Zeit überzeugt. Dabei fußte Tobis Verhalten und Einstellung zum Miteinander auf einer ganz anderen Prämisse: Kill them with kindness. Wie viele Drogen musste man sich reinfahren, um dieser Welt, in der nur galt ‚fressen oder gefressen werden’, immer noch mit Optimismus entgegentreten zu können? Das war Ingmar ein Rätsel. Als er mal wieder stockbesoffen in einer U-Bahn Station rumgelegen war, hatte er sich sogar gedacht: Ist Tobi vielleicht der wiederauferstandene Jesus? Von den Erzählungen her könnte es passen, Frisur ist die gleiche, und da im Himmel hat er wahrscheinlich noch ’nen Dreier mit Martin Luther King und Mutter Theresa gehabt, Ghandi hat zugeschaut, wie die beiden die Olle richtig durchgebumst haben und hat sich dabei einen runtergeholt, perverses Schwein!
So kam es, dass er an jenem Abend irgendwann wild randalierend „Tobi, du sexgeiler Jesusfreak!“ in Dauerschleife brüllte. Auch dieser Abend endete in Sicherungsverwahrung.
„Ich hab’ aber mal wieder Glück gehabt. Mein Kumpel hier, der Pierre, hat mir noch ’nen Platz klar gemacht.“
Tobi zog einen Bauzaun zur Seite, gab Ingmar mit einer zackigen Kopfbewegung zu verstehen, durch die kleine Öffnung zu steigen. Mit dem Gesicht streifte Ingmar erstmal volle Breitseite einen Dornenbusch. Das Gestrüpp war so dicht, dass er bei der aufkommenden Dämmerung nicht ausmachen konnte, wo es hier langgehen sollte. Er ließ Tobi wieder den Vortritt. Nach wenigen Minuten und diversen Wurzelstolperern waren sie endlich da. Inmitten des urwaldartigen Großstadtgrüns tat sich ein kleiner Platz auf, nicht größer als zehn mal zehn Meter, schätzte Ingmar. Die Lichterketten an Tobis Wagen funkelten, ließen die Szenerie unwirklich erscheinen.
„Wie zur Hölle hat er denn diesen Koloss hierhin bekommen?! Eigentlich auch egal, solange er diese göttliche Couch noch hat“, dachte sich Ingmar.
Rechterhand an Tobis Heimstatt anschließend, leicht schräg, stand ein mit psychedelischem Graffito verzierter Wohnwagen. Das musste wohl der von diesem Pierre sein.
„Ach ja, da wohnt Pierre. Also, welcome again, Ingo! Meine Bude ist deine Bude, weißte ja.“
Ingmar ließ sich erschöpft auf einen der ausgeblichenen Liegestühle fallen, pellte die Schuhe von den aufgeweichten Füßen. Während er so ins Nichts glotzte, den Mund halb offen, sprang Tobi von A nach B, verschwand hinter C, um nach kleinem Umweg über D – und ah, was vergessen bei B! – in Windeseile ein Lagerfeuer zu entfachen. Es britzelte und bratzelte, die Füße fast ein wenig zu nah an den Flammen, nahm die Verkrampfung in Ingmars Gliedern langsam ab. Er taute auf, fühlte sich schlecht, heute bislang so mundfaul gewesen zu sein.
„Sag mal, Tobi, hast du vorhin nicht irgendwas von Essen gesagt? Tobi?“
Er drehte den Kopf nach hinten, Tobi war schon wieder weggesprungen. Da knarzte das Fenster, hinter dem sich die Einbauküche im Wagen verbarg, auf. Ein Bart lugte hervor:
„Ich hab‘ hier so ein leckeres Curry. Mmmh! Geile Linsen gefunden letztens. Ordentlich Ingwer drin. Und nochmal aufgewärmt, entwickelt das erst so richtig sein volles Potential!“
Ingmar musste lachen. In den wenigen unbeschwerten Momente, die er ab und an noch hatte, war Tobi anwesend. Tobi hielt all die Versprechen ein, die Alkohol nie einlösen konnte. Und trotzdem soufflierte ihm jeder einzelne Schluck, das ultimative Heilmittel für jedes seiner Probleme zu sein. Der einzige Haken daran: Jedem Schluck musste ein weiterer folgen, der den vorhergegangenen vergessen machte und den nächsten mit Engelschören ankündigte.
„Ist da Zitronengras drin? Ich hasse Zitronengras! Schmeckt wie Spülmittel!“
„Ne, Mann! Das gibt’s beim Vietnamesen und Thai. Aber die Inder haben damit nix am Hut.“
Endlich wieder was Warmes, endlich wieder was, das nicht nach Pappe schmeckte. Es schmeckte, sogar richtig gut. Seine Geschmacksknospen wussten nicht, wie ihnen geschah. Sein Magen krümmte sich. Er aß viel zu schnell, schaufelte, vergaß fast das Atmen zwischen den Bissen, wollte sich in der Schüssel suhlen. Auch wenn er mal ein Verständnis dafür besessen hatte, was zu Tisch angemessen war und was nicht – jetzt leckte er die Schüssel aus. Das wohlige Grunzen nahm Tobi als Kompliment. Sie hingen in den ausgeleierten Liegestühlen, die Hände auf den Bäuchen, die Blicke gen Nachthimmel. Mitten in der Stadt war natürlich, dank kolossaler Lichtverschmutzung, nichts mit endlosem Sternenhimmel. So etwas wie Zufriedenheit hing dennoch in der Luft. Sie schwiegen sich an und sagten damit alles, was es in dem Moment zu sagen gab. Selbst der talentierteste und einfühlsamste Dichter hätte nicht ausdrücken können, was sich hier gerade abspielte. Zwei Gestalten – unterschiedlich bis in die letzte Zelle und dennoch so eng verbunden. Unter Millionen von Individuen waren sie ineinandergelaufen. Jeder von ihnen eine der Gestalten, die vom Gros der Menschen entweder nicht gesehen wurden oder denen man in weitem Bogen aus dem Weg ging. Traurige Wurmfortsätze der Gesellschaft, die nicht wirklich eine ‚Funktion‘ im kapitalistischen Sinne hatten, aber auch nicht eben mal auf die Schnelle entfernt werden konnten. Abstumpfung durch wiederholte Konfrontation führte dazu, dass die meisten Großstädter gut damit leben konnten. Gehörte halt dazu wie der Afterwork-Drink auf der Dachterrasse vom Soho House. Der eine gewinnt, der andere verliert. Nächstenliebe, Fürsorge, Solidarität waren nur angesagt, wenn man sie reichweitenfördernd auf Instagram oder LinkedIn verwursten konnte. Soziale Medien.
Tobi ruhte gerade seine Augen aus, da sprach Ingmar heute zum ersten Mal, ohne davor etwas gefragt worden zu sein:
„Danke, Mann. Auch wenn das Fleisch gefehlt hat. Ich hab’ schon Schlechteres gegessen.“
Aus Ingmars Mund war das ein Kompliment par excellence. Weil es einfach keine positiven Ereignisse mehr in seinem Leben gab, hatte er verlernt, etwas Schönes wertzuschätzen und es gegenüber einem Mitmenschen auch entsprechend zu äußern. Er war zum harten Knochen mutiert, ständig am Knurren, aber zu kraftlos, um tatsächlich zuzubeißen.
„Das war mein pleasure, echt ey“, retournierte Tobi unaufgeregt, so unfassbar nonchalant, dass damit im Handumdrehen der Schlusspunkt hinter das Dankesprozedere gesetzt war.
Tobi wusste ganz genau, wie viel Überwindung es Ingmar gekostet hatte, sich für seine Verhältnisse so weit aus dem Fenster zu lehnen. Er hatte es sich bewusst zur Aufgabe gemacht, diesen verschrobenen Klotz Schritt für Schritt wieder dazu zu bekommen, die Dinge beim Namen zu nennen und Gefühle zuzulassen. Tobi bezeichnete solche Regungen als Seelenatmer, ohne die man irgendwann zu ersticken drohte. Auch wenn Ingmars Herz, rein biologisch betrachtet, nach wie vor schlug – Leben konnte man das nicht nennen. Ingmar war Menschenhülle, leere Taschen, leerer Blick. Das Curry hatte ihn ein Stückchen zum Licht gezogen. Auf so vielen Ebenen hatte es seinen dauerhaft betäubten Appetit angeregt.
„Und dieser Pierre … was macht der so?“
So etwas wie Eifersucht schwang in Ingmars Frage mit. Tobi überhörte die Färbung. Emotionen, die mit Besitzansprüchen – insbesondere auf Mitmenschen – verknüpft waren, hatte er wie das Lügen aus seinem Habitus gestrichen. Das kostete nur unendlich Kraft, die er viel lieber für seine kosmischen Ausflüge nutzte. Ganz hoch fliegen, ohne den Ausstoß von Kohlendioxid. Das konnte Tobi ziemlich gut.
„Yo, der Pierre ist ein Guter. Tänzer isser, so mit ganz viel Ausdruck! Wie der sich verbiegen kann, das musst du mal sehen! Schon irgendwie Ballett, aber noch viel abgedrehter. Ich war da mal bei einer seiner Performances. Das war in ‘ner alten Schlachterei. Der Geruch von Kadavern hing da noch in der Luft. Die ganze Truppe hatte Schuluniform an, mit so Schrubbern bewaffnet haben die die Fliesen da bearbeitet. Mit Blut beschmierte Tiermasken hatten die auf ihren Köpfen, so weird. Na ja, schwer zu erklären, hätteste dabei sein müssen. Meins war’s nicht, aber vielleicht war ich auch zu druff, um es zu verstehen.“
„Druff sein“, dachte sich Ingmar. „Das wär’s jetzt …“
In dem Moment fing Tobi an, einen Joint zu rollen. Vielleicht gab es ja doch so was wie einen Gott. Trotzdem war er die meiste Zeit ein elendiger Wichser. Immer mal wieder so kleine Brotkrumen von Glückseligkeit hinwerfen und einen dann aber sofort im Anschluss wieder mit dem Gesicht ins Urinal drücken. Ingmar kannte diese Aufs und Abs nur zu gut.
„Aus Cannes kommt der Pierre. Reiche Family, Parfüm-Produzenten. Aber er stand neben Frauen auch auf Männer, wollte in den Ballettunterricht, als er vier war, hatte keinen Bock, das Imperium zu noch mehr Kohle zu führen. Mit Anfang 20 machte er die Fliege. Packte zwei Koffer, hatte es eh nie so mit materialistischem Krimskrams, und düste in seinem alten Citroën gen Norden. Letzte Amtshandlung in seinem Elternhaus: Er kackte seinem Vater auf den Schreibtisch, in den Haufen steckte er noch ‘ne Karte, auf der geschrieben stand: ‚Merci pour rien!‘“
„Haha, scheint ein witziger Kerl zu sein, dieser Pierre!“
Ingmar hechelte mehr, als dass er lachte. Endlich reichte ihm Tobi die glühende Lunte rüber, dieser süßlich-würzige Duft … mmmh! Er wollte sich wirklich zügeln, aber er zog und zog. Seine Lunge füllte sich, er hielt für ein paar Sekunden die Luft an, um die Wirkung zu verstärken. Dann ließ er den dichten Rauch nach und nach entweichen. Und noch ein Zug. Früher hatte er nichts als Verachtung für Kiffer übrig. Nutzloses Abhängen, faul, nix gebacken bekommen. Wenn er sein Kind dabei erwischt hätte, dann aber Gnade ihm Gott. Natürlich soll man seine Kinder nicht schlagen. Aber irgendwo ist dann auch mal eine Grenze erreicht. Mittlerweile war das Kiffen mit Abstand das Harmloseste, was er drogentechnisch seinem Körper zuführte. Raubbau an Leib und Seele.
Plötzlich rumpelte es ganz fürchterlich in Pierres Wohnwagen. Es bollerte, es ratschte, Keramik zersprang. Ein tosender Wirbelsturm auf kleinstem Raum. Hatte der Wohnwagen gerade einen kleinen Satz gemacht?! So schnell es ihre sanfte Benebelung zuließ, schreckten Ingmar und Tobi auf, sahen sich an, drehten sich um.
„Hä, Tobi, du hast doch gemeint, Pierre ist die Tage gar nicht in Berlin? Was zur Hölle?!“
„Äh, ja, keine Ahnung! Boah, ich krieg’ die creeps! Das ist bestimmt so ein evil spirit. Der Geist von seinem Dad, der ihn jetzt gefunden hat und heimsucht!“
„Sag mal, hackt’s bei dir? Bist du auf Harry Potter hängengeblieben?“, blökte Ingmar zurück.
Dann ertönte ein tiefes Grunzen, ganz und gar unmenschlich, immer wieder unterbrochen durch schmatzendes, stakkatoartiges Atmen, und dann noch diese spitzen Schreie, die ihnen durch Mark und Bein fuhren. In dem Augenblick erkannte Tobi auch in Ingmars Augen pures Entsetzen, das ihm mitteilen sollte: ‚Ich nehm’ alles zurück. Du hast Recht. Das ist ein Geist oder Monster oder was auch immer!‘ Über die Lippen brachte Ingmar keinen Ton mehr, das Kreischen steckte in der Magengrube fest, seine Muskeln erstarrten, an wegrennen war nicht zu denken. Der Lärm türmte sich auf, multiplizierte sich, jeden Moment musste es doch die Tür und die Fenster aus den Angeln fetzen! Da sprang Tobi auf, pfefferte den Joint-Stummel ins Feuer, die linke Hand zur Faust geballt, die Sehnen im Unterarm zuckten nervös.
„Ich geh’ da jetzt rein, I don’t care!“
Ingmar starrte Tobi ungläubig mit weit aufgerissenen Augen an.
„Hast du sie noch alle?“
„Is‘ mir egal! Wenn ich sterbe, dann bei so was Abgefahrenem wie ‘nem Kampf mit einem Untoten!“
Fast schon heroisch blickte Tobi auf den Wohnwagen. Für das perfekte Filmplakat fehlte nur noch die Windmaschine, die seiner Haares- und Bartpracht die passende Dynamik verliehen hätte. Er griff einen der Holzscheite, der nur an einer Seite angekokelt war, und stapfte entschlossen los. Ingmars Augen folgten ihm, alles andere von Ingmar blieb im Liegestuhl zurück. Breitbeinig vor der Tür stehend, atmete Tobi nochmal tief durch, im Wagen tobte es unermüdlich weiter. Dann öffnete er mit einem Ruck zackig die Tür, sprang gebückt ins Dunkel. Die Tür fiel wieder ins Schloss. Von einem Augenblick zum anderen war es mucksmäuschenstill. In der Ferne wummerten Bässe. Ingmar beobachtete, wie die Büsche sich andächtig von einer zur anderen Seite wiegten. Es hatte fast schon hypnotisierende Wirkung. Da zerstachen spitze Schreie die Nachtluft. Aber zu denen des Monstrums waren ganz eindeutig die von Tobi dazugekommen. Zwei Augenblinzler später knallte die Tür auf, Tobi flog rücklings aus dem Wagen, landete auf dem Hosenboden und robbte ein paar Meter weiter zurück, den Blick nicht ablassend von dem schwarzen Nichts, das aus dem Innern quoll. Ingmar hatte sich mittlerweile hinter seinem Liegestuhl verschanzt, lugte bibbernd über den Rand. Aber es war kein zähnefletschender Dämon, der ins Licht trat, sondern eine zierliche Frau, lange braune Haare, die wild in alle Richtungen abstanden, blutunterlaufene, verheulte Augen. Ihre Schultern hingen kraftlos runter. Unendliche Wut und Verzweiflung drang aus jeder ihrer Poren. Das konnte selbst der sonst so abgestumpfte Ingmar sofort erkennen.
„Rebecca?!“, entfuhr es Tobi. „Ich mein’ … was soll der shit?“
Tobi kannte diese Furie im XS-Format? Die Fragezeichen über Ingmars Kopf nahmen exponentiell zu. Rebecca zuckte beiläufig mit den Schultern, als wäre ihr gerade aus Unachtsamkeit die Milch übergekocht – dabei hatte sie Pierres Hab und Gut zerstört. Alles kurz und klein geschlagen. Sie brach in hysterisches Lachen aus, dabei fingen die Tränen wieder zu kullern an.
„Welchen Film fährt die denn?“, brachte Ingmar leicht stotternd in Richtung Tobi raus.
Sein Mund war ganz trocken und pelzig. Tobi nahm nicht wahr, dass Ingmar eben etwas gesagt hatte. Gebannt starrte er Rebecca an, die auf die Knie fiel, sich vornüber warf, den Kopf in den Dreck drückte. Ihre Arme griffen nach Tobis ausgestreckten Beinen.
„Ich will doch nur dich! Du bist mein Ein und Alles! Mein Leben! Wann glaubst du mir endlich?“
Sie flehte verzweifelt vor sich hin, ihr Oberkörper bebte. Sie war kurz davor, sich an ihrer eigenen Spucke zu verschlucken. Der Rotz lief ihr aus den Nasenlöchern. Wenn Ingmar sonst unter Menschen war – sprich mindestens eine weitere Person in seiner direkten Nähe –, gewann er ausnahmslos den Preis für die bemitleidenswerteste Figur. Hier war es tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Rebecca lag aktuell sogar um Haaresbreite vorne. Tobi rührte sich weiterhin nicht, schüttelte aber unaufhörlich den Kopf. So hatte Ingmar ihn noch nie erlebt: Sprachlos. Eigentlich hatte er doch immer eine Antwort parat, selbst in den aus-weglosesten Situationen.
„Sag was! Ich hab’ das alles nur für dich getan! Kannst du das nicht sehen? Du darfst mich niemals verlassen … niemals! Hörst du das? Schwör es mir! ... Komm, mach schon.“ Rebecca keifte und kreischte.
Tobi spürte, wie sich ihre Fingernägel in seine Schienbeine krallten. Der Schmerz sorgte dafür, dass er aus seiner Schockstarre erwachte. Er schüttelte sich und packte beherzt ihre Handgelenke. Ganz nah zog er sie zu sich heran, ihre Gesichter nur wenige Zentimeter voneinander entfernt.
„Jetzt hör mal gut zu“, Tobi sprach bedacht, die Stimme so ruhig es ging, obwohl in ihm ein Vulkan brodelte, „ich bin durch mit dir. Was denkst du denn, wer du bist? Du hast mich bis an den Abgrund getrieben, gnadenlos. Und als ich nicht mehr konnte, es langweilig für dich wurde, hast du dir Pierre gekrallt. Eine so zarte Seele, ein Pflänzchen! Einzeln hast du ihm die Wurzeln ausgerissen! Und jetzt, wo er das Weite gesucht hat, kommst du wieder angekrochen?“
Ingmar fiel auf, dass Tobi bei dieser wirklich substanziellen Ansage völlig vergaß, seine Anglizismen einzustreuen.
„Du bist echt ein Blutegel, der jedem die Lebensenergie aussaugt. Verdammt hübsch, aber so verdammt rücksichtslos. Komm endlich damit klar: Es ist vorbei!“
Innerhalb weniger Sekunden hatte er sich in Rage geredet, sein Kopf puterrot angelaufen. So sehr er sich vorgenommen hatte, Ruhe zu bewahren, Gelassenheit und Coolness auszustrahlen, nicht auf die psychologischen Kriegsspielchen reinzufallen – es klappte einfach nicht. Zu tief war Rebecca vorgedrungen mit ihren messerscharfen Attacken. Die Wunden waren nie wirklich verheilt, das spürte Tobi jetzt deutlich. Eine dünne Kruste hatte sich zwar gebildet, die Besserung verhieß. Aber jetzt, wo Re- becca einmal kurz drübergeratscht war, klaffte jede dieser Wunden wieder auf. Es triefte und tropfte, Tobi war wieder mittendrin in diesem emotionalen Martyrium, es schnürte ihm die Kehle zu. Er wusste aus ihrer gemeinsamen Zeit, dass Anbrüllen genauso wenig half wie beschwichtigendes, verständnisvolles Auf-sie-Einreden. Wenn er sagte: „Ich liebe dich nicht mehr!”, kam bei ihr an: „Ich liebe dich!” Jedes Wort, das ihre so mühsam aufgebaute heile Welt ins Wanken hätte bringen können, wurde konsequent ausgeblendet, zensiert, gestrichen, fand den Weg nicht von ihrem Ohr ins Hirn. Auch das hatte er auf die harte Tour lernen müssen. Zu Beginn war er dermaßen naiv gewesen: Er dachte tatsächlich, er könne mit dem richtigen Mischungsverhältnis von Liebe, Vernunft und Verständnis (all das, was sie nie hatte!) für die Kehrtwende in ihrem Leben sorgen. Be-feuert durch sein esoterisches Grundverständnis des Seins und des Miteinanders, begab er sich damit blauäugig in die Höhle der ausgehungerten Löwin. Und wurde letztendlich zerfleischt, wie er sich nach monatelangem Kampf eingestehen musste. Ihrer alten Maschen hatte sie sich wohl noch immer nicht entledigt, denn jetzt sah sie ihn mit ihren großen braunen Augen an, den Blick leicht unterwürfig von unten nach oben gerichtet, als ob kein Wässerchen sie trüben könnte. Die Unschuld vom Lande. Ja, vom Lande kam sie ursprünglich, aber unschuldig?!
Durchtriebenes Stück, bollerte es Tobi durch den Kopf.
Mit der linken Hand versuchte Rebecca Tobis Wange zu streicheln. Sie wusste zu gut: Durch körperliche Nähe standen ihre Chancen besser, zu ihm durchzudringen. Sie schniefte, stille Tränen rannen ihr Gesicht herunter, Haarsträhnen blieben auf ihrer Wange kleben. Tobi konnte es nicht mehr ernst nehmen, er glaubte keine Sekunde dieser Show. Es tat ihm fast schon leid, dass er so dachte und fühlte. Aber ihre Beziehung, die ihn Kraft, Lebenslust und Vertrauen gekostet hatte, war in Retrospektive vor allem eines: ein Gär-Topf für ernüchterte Kaltherzigkeit. Er hatte keine Gefühle mehr für sie. Da war nur diese blanke Wut auf sie und das, was sie ihm angetan hatte. Und auf sich selbst, dass er es mit sich hatte anstellen lassen.
„Aber du weißt doch, das mit Pierre, das war nix Ernstes! Das war niemals so wie das, was uns verbunden hat! Wir waren besonders, einmalig … wir sind es immer noch.“ Rebecca setzte ab, atmete tief und bedeutungsschwanger ein. „Und das hab’ ich jetzt endlich begriffen. Ich war so dumm, hätte dich nie verlassen dürfen. Aber das passiert kein zweites Mal!“
Was für sie ein romantischer Liebesschwur war, klang in seinen Ohren nach einer offen ausgesprochenen Drohung. Ihm klappte die Kinnlade runter, weil ihm einfach nichts mehr einfiel, was er da noch hätte erwidern können oder sollen. Es glich ein wenig einer Diskussion mit alu-behüteten Klimawandel-Leugnern: Unlängst bewiesene Fakten wurden abgetan, somit entzog man dem ganzen Austausch die gemeinsame, verbindende Grundlage, zudem wurde verkürzt, über-emotionalisiert, verdreht und ununterbrochen persönlich verletzend angegriffen. Wenn Tobi und Rebecca beide dasselbe Lagerfeuer betrachteten, hätte Tobi gesagt: „Das ist aber ein schönes Lagerfeuer“, worauf Rebecca entgegnet hätte: „Was faselst du da? Das ist unser Brunnen, ein Quell eisigen Wassers! Trottel!“
Aus Ingmars Sicht fehlte eigentlich nur das Popcorn, es war wie Kino. Großes Kino. Herzschmerz, Verrat, Betrug, vielleicht aber doch noch das große Happy End? Alles hier direkt vor seinen Augen, nur wenige Meter zwischen ihm und den Protagonisten, fast konnte er die Hitze ihrer bebenden Körper spüren. Ingmar erinnerte sich dunkel daran, dass Tobi ihm mal von einer Rebecca erzählt hatte. Bipolar, scheiß Kindheit, keine wirkliche Familie – ein paar Fetzen waren hängengeblieben. Das große Ganze, die Zusammenhänge und die Chronologie ihrer Beziehung konnte er aber nicht mehr abrufen. Der Alkohol war schon ein gründlicher Löscher. Und nicht Durstlöscher. Ingmar starrte auf die Szenerie wie früher auf seinen 75-Zoll-Plasma-TV, den er schreinartig in seiner Männerhöhle (so hieß sein Hobbyraum!) gegenüber der schwarzen Ledercouch platziert hatte. Endlich fielen Ingmar Tobis kurze, zu ihm rüberschielende Blicke auf, gleichzeitig zog er die Mundwinkel zurück. Zum Glück hatte Ingmar gerade einen hellen Moment. Er verstand und wusste die Zeichen zu lesen: ‚Hilf mir! Ich komm’ hier alleine nicht raus. Mach was! Irgendwas!‘ Von sich selbst überrascht, fasste er sich ohne langes Hadern ein Herz und sprang kraftvoll hervor aus der Deckung seines Liegestuhls. Tatsächlich blieb es beim Wunsch: Aus dem kraftvollen Sprung wurde nichts, er fiel wie ein nasser Sack nach vorne auf seine Knie, mit den Handgelenken konnte er gerade noch gegensteuern und unterbinden, dass sein Gesicht den Boden küsste. Elegant und Respekt einflößend war anders. Und gerade jetzt wäre es doch wichtig gewesen, als Instanz, als zu fürchtende Autorität rüberzukommen. Wie sollte er es sonst schaffen, Tobi aus den Fängen dieser durchgeknallten Hexe zu befreien?
Damals, als er noch Chef gewesen war … eigenes Unternehmen, zwölf Angestellte, persönliche Sekretärin, alles Drum und Dran. Wenn er da nur die Augenbrauen nach oben zog, sind sie alle gesprungen. ‚Was ist, Chef? Kann ich was tun, Chef? Hab’ ich was verbockt, Chef?‘ Ja, damals, das war echt eine andere Nummer. Blickte er jetzt in den Spiegel, sah er nur den buckligen Zwillingsbruder seines alten Ichs, den man von klein an in den Keller gesperrt hatte, weil er so hässlich war. Abstoßend.
„Reiß dich zusammen! Du schaffst das! Du kannst Tobi nicht hängen lassen“, Ingmar hielt sich selbst einen kleinen Pep-Talk, der Wirkung zeigte. Angetrieben vom Adrenalin, das sein Körper nun endlich stark zeitverzögert ausstieß, raffte er sich auf und räusperte sich drohgebärdig.
Rebecca, die seinen Kniefall in ihrer Hysterie und To-bi-Fixiertheit gar nicht bemerkt hatte, drehte den Kopf zur Seite und schien erst jetzt wahrzunehmen, dass da noch jemand anderes war. In ihren Augen eine Mischung von Verwirrung und Scham. Ingmar sah es genau.
„Das ist meine Chance“, dachte sich Ingmar.
Er trat auf die beiden zu, nahm aber ausschließlich Rebecca mit grimmiger Mimik ins Visier, stemmte dabei die Hände in die speckigen Hüften.
„Jetzt ist hier aber mal Schluss! Du hast doch den Schuss nicht gehört! Alles kurz und klein schlagen und dann Tobi meucheln wollen? Wir sind hier nicht bei GZSZ!“
Ha! GZSZ – das war sein großes guilty pleasure. Jeden Abend 19:40 Uhr, Montag bis Freitag, saßen er und seine Tochter pünktlichst vor der Glotze. Ihr Ritual für so viele Jahre. „Ob sie es noch immer schaut, mitfiebert, mitleidet?“, fragte er sich. Er wusste es nicht. Das erboste Schnauben von Rebecca holte ihn zurück.
„Was ist dein verdammtes Problem, Alter?!“, rotzte sie zurück. Das Zeitfenster, in dem sie kurzzeitig verwirrt war, hatte sich wieder geschlossen.
Ohne darauf zu antworten, packte er sie am Kragen und zog sie hoch, schleuderte sie zur Seite, weg von Tobi.
„Ingo, sag ma‘ …“, mehr kam nicht von Tobi, so überrascht war er von Ingmars Kraftakt.
Dann ein gellender Schrei, Ingmar schnellte herum, und da sah er Rebecca mit einer spitz zulaufenden, mindestens 20 Zentimeter langen Glasscherbe bewaffnet auf sie zuhechten. Ingmars Reaktionszeit war ein Witz. Schon glitt sie an ihm vorbei, mit weit nach oben gerissenem Arm war sie kurz davor, auf Tobis Brust einzustechen. Der überforderte Ingmar sah vor dem inneren Auge bereits in alle Richtungen spritzende Blutfontänen. Aber da rollte Tobi blitzschnell zur Seite, griff mit der rechten Hand ihr Handgelenk, schlug mit der linken irgendwohin in ihrer Unterarmregion, sodass er in Sekundenbruchteilen die Kraft ihres Angriffs neutralisierte und sie von sich stoßen konnte. Er hatte es weder Ingmar noch Rebecca jemals erzählt, all die Geschichten, als er noch ein harter Hund war, Anfang 20, Bürstenschnitt, breiter Nacken. Im Krav Maga zählte er in seinem Kampfsport-Gym zu den Besten und Erbarmungslosesten. Kumpel, die bei Sparringkämpfen aus seiner Sicht viel zu früh aufgaben, hatten damals nichts als verächtliche Blicke von ihm geerntet. Das Gute bei Krav Maga für Tobi: Es war wie Radfahren. Einmal gelernt, wusste sein Körper noch immer, was er blitzschnell zu tun hatte. Da war kein Nachdenken nötig. In solchen Situationen halfen nur Reflexe, die ihren Ursprung in aber-tausenden Wiederholungen hatten.
Ingmar hatte gerade erst den Schock dieser Glasscherben-Attacke verkraftet, da läutete Rebecca die nächste Runde ein. Sie realisierte, dass sie Tobi unterlegen war und ihn nicht ernsthaft verletzen konnte – zumindest nicht körperlich. Der Hebel “Ich bring dich um, damit keine andere dich haben kann” führte sie nicht zum Erfolg, also umschalten auf “Ich zwing dich, auf meine Forderungen einzugehen”. Mit weit aufgerissenen Augen presste sie die Glasscherbe an die eigene Halsschlagader. Die scharfen Kanten hatten sich bereits in ihre Handinnenfläche gedrückt, dunkelrotes Blut floss ihren Unterarm hinunter.
„Ich bring’ mich um! Und das ist alles nur deine Schuld! Du hast mich auf dem Gewissen!“, brach es aus ihr heraus.
Rotz und Tränen und Spucke schossen in Richtung Tobi. Jetzt war endgültig der Punkt erreicht, an dem selbst dem sonst so Love-and-peacigen-ich-hab-für-alles-Verständnis-Hippy Tobi die Hutschnur platzte.
„Ok, jetzt ist es offiziell: Du bist echt verrückt. Mach, was du willst! Aber erpressen lass ich mich echt nicht. Weißte was, ich ruf jetzt die Bullen.“ Er zog sein Handy aus der Jamaica-beflaggten Bauchtasche und wählte schon drauf los.
Warum auch immer genau jetzt – aber in dem Augenblick schrillten bei Rebecca sämtliche Alarmglocken und diese gaben ihr zu verstehen: Lass es, du hast verloren, den kriegste nicht mehr.
„Ja, hallo? Äh, hier ist Tobi Schwendinger. Also, ich hab’ hier jemanden, der ist völlig durchge- …“ Rebeccas Hand auf seiner, mit der er sich das Handy ans Ohr hielt. Er merkte sofort: Der Wahnsinn war entfleucht, er verstand, was sie sagte, ohne dass sie einen Laut von sich geben musste. Er legte auf, ließ das Handy fallen, sie nahmen sich in den Arm. Wahrscheinlich das allerletzte Mal.
Kapitel 2
Ingmar fühlte sich wie gerädert. Also, nicht so wie sonst eh schon jeden Morgen der letzten 28 Monate und 13 Tage. (Er führte Buch: Es gab das Leben v. K. und das n. K. – vor der Katastrophe und nach der Katastrophe.) An diese mittlerweile alltägliche matte Dauererschöpfung hatte er sich zwangsläufig gewöhnt. Die Tage flossen auf gleichbleibend deprimierendem, höhepunktlosem Level ineinander. Der Mensch – ein Gewohnheitstier. An diesem Morgen war es aber anders. Obwohl er über zehn Stunden geschlafen haben musste – die Sonne brannte schon fast senkrecht auf Tobis Wagen, einzelne Strahlen drangen durch das gekippte Fenster über der Couch ins Innere, kitzelten ihn in der Nase –, machte es den Anschein, er hätte nicht mehr als ein fünfzehnminütiges Powernap abgehalten. Sein Körper ächzte, kraftlos, steif wie ein Brett. Das Herzrasen der letzten Nacht klang noch immer in seinem Brustkorb nach.
„Good Morning, sunshine“, trällerte es aus dem vorderen Bereich des Wohnwagens.
Tobi zog energisch den Vorhang zur Seite, der die ‚Chill-Lounge‘ von der Küche trennte. Die Mundwinkel gen Ohren gezogen, streckte er Ingmar eine große Tasse entgegen. Der Duft von frisch aufgebrühtem Kaffee war einfach unschlagbar! Früher hatte Ingmar ihn nie bewusst wahrgenommen. Es war selbstverständlich gewesen – wie so vieles, was er mittlerweile vermisste. Er nahm sie in beide Hände, sog den Duft tief ein, was in verschleimtem Morgenhusten endete.
„So, wie du ihn am liebsten magst – eineinhalb Teelöffel Zucker“, Tobi grinste zufrieden. „Die meisten meinen, weil ich fast immer stoned bin, kann ich nix mehr remembern. Pah!“
Er tippte mit dem Zeigefinger wiederholt an seine Stirn:
„Wenn die wüssten, was da drin alles gesaved ist. Staunen würden die!“
Zwischenzeitlich hatte er sich auf die Kante der Couch gepflanzt, für Ingmars Empfinden ein klein wenig zu nah. In Zeitlupe zog er seine Beine näher an sich heran. Körperliche Nähe, egal ob freundschaftlich oder sexuell, gab es für ihn nicht mehr. Wie jemand anderes roch, sich anfühlte – er hätte es beim besten Willen nicht beschreiben können. Tobi behandelte ihn unvoreingenommen, wie es zwischen zwei Menschen eigentlich normal sein sollte, aber für Ingmar war es befremdlich … wie für den Straßenköter, den man geschlagen und getreten hatte, der für Ewigkeiten im Tierheim dahindarbte und dem irgendwann der liebevolle Neubesitzer die Hand hinstreckte. Genauso duckte sich Ingmar durchs Leben.
„Listen, Ingo“, setzte Tobi an, „ich bin dir echt was schuldig. Kein’ Plan, wie ich ohne dich da gestern rausgekommen wäre aus dem Schlamassel. Ich war ohne Scheiß wie gelähmt.“
„Ach, komm, hör auf. Das hätte doch jeder gemacht. Ehrensache.“
Ingmar hatte schon immer Probleme, ehrlichen, von Herzen kommenden Dank anzunehmen. Da fühlte er sich automatisch unwohl in seiner Haut. Er wusste einfach nicht, wie er damit umgehen sollte. Schnell ablenken:
„Aber sag mal, was ist jetzt mit Rebecca? Ich mein’, dieses Ding mit euch. Unkompliziert sieht anders aus. Wo ist sie überhaupt hin letzte Nacht?“
„Nachdem du pennen gegangen bist, haben wir echt noch lange geredet. Das war irgendwie der einzige richtig deepe Talk, den wir jemals hatten. Crazy! Am Ende waren wir uns einig, dass es für sie an der Zeit ist, ihre Sachen zu packen. Sie muss sich selbst finden. Und ich glaube daran, dass sie das schafft. So ein starker Geist, der so viele Hürden schon übersprungen hat. Wenn du wüsstest, was sie schon alles durchgemacht hat! Jetzt heißt es aber für sie: Attack your inner demons!“
Attack your inner demons … wo sollte er da anfangen, fragte sich Ingmar. Vor solch einem Angriff müsste zunächst der Schritt erfolgen, sich diesen Dämonen auch stellen zu wollen. Ingmar rannte vor ihnen weg, unentwegt. So langsam merkte er, dass ihm die Luft ausging. Noch biss er jedoch die Zähne zusammen, obwohl er den fauligen Atem seiner Vergangenheit im Nacken spürte.
„Was meinste, wohin sie geht?“, fragte Ingmar fast schon väterlich besorgt. „Die hat doch niemanden mehr … verlorene Seele …“, murmelte er weiter.
„Alles juti, musst dir keine Sorgen machen! Hab’ ihr ‘ne Adresse gegeben. Ich kenne da ein paar Leute, unten im Allgäu. Haben einen großen Bauernhof, alles bio, organic. Der Rudi ist so eine Art Schamane. Was denkste, wer mir damals vorgeschlagen hat, nach Hawaii abzuhauen? Er hat bei mir das Licht angeknipst! Davor hab’ ich im Dunkeln gehaust.“
Ingmar musste die Stirn runzeln. Tobis Überzeugungen konnte er noch immer nicht ernst nehmen.
„Hab’ ihr noch heimlich ein paar Moneten in die Jackentasche gesteckt, damit sie auch safe in Rudis Oase ankommt. Sie muss weg vom Schmerz, weg von Verlockungen und Ablenkungen … hab’ ich wirklich alles gegeben, Ingo?“
Ingmar schluckte, denn ihm war bewusst, dass er für sich diese Frage nur mit Nein beantworten konnte.
„Mehr als das, Tobi. Wirklich. Typen wie dich gibt’s nicht so oft. Rebecca kann sich glücklich schätzen, du kleiner Weltretter!“
Sie lachten beide auf, seine feuchten Augen bemerkte Tobi, zu Ingmars Erleichterung, nicht. Sie lagen da auf der Couch, Kaffee schlürfend, frei – als ob es die Welt außerhalb des Wohnwagens nicht gäbe. Wie zwei Schwuchteln, über Gefühle und so einen Scheiß labern. So hätte Ingmar vor nicht allzu langer Zeit noch gedacht.
„Jetzt aber mal schnell geduscht, draußen wartet die Gartendusche auf dich. Ist kalt, macht dich aber fresh! Und dann rin in die Klamotten, wir haben Großes vor! Ah, ‘ne Stulle hab’ ich dir noch geschmiert, steht draußen auf dem Tischchen bei den Liegestühlen.“
Dann griff Tobi links neben das Sofa und präsentierte Ingmar strahlend einen Packen frisch duftender Kleidung.
„Vielleicht nicht so dein Style, aber da gewöhnste dich dran.“
Eine gute Stunde später standen sie an. Die Schlange war ok für einen Samstagnachmittag, Tobi hatte schon viel Schlimmeres hier erlebt. Das Sisyphos war einer seiner Lieblingsclubs in der Stadt. Ein bisschen hippyesk, kleinere und mittlere Floors, man konnte auch mal draußen am Teich chillen. Das Publikum war relaxed, die Türpolitik nicht ganz so faschistisch wie an manch anderem Ort des berühmt-berüchtigten Berliner Nachtlebens. Tobi war nach richtig Feiern zumute, loslassen. Das war so viel mehr, als sich nur stupide zuzudröhnen, er zelebrierte diese kitzelnde Vorfreude, bevor endlich zum spirituellen Tanz gebeten wurde. Gründe gab es heute ausreichend: Er hatte Rebecca auf den Pfad zum Licht geschickt, Ingmar hatte es sich verdient, endlich mal wieder aus tiefstem Herzen zu lächeln. Und Tobi wollte einfach nur tanzen, fließen, springen, wirbeln. Ingmar war skeptisch gewesen, ließ sich aber irgendwann vom Enthusiasmus anstecken und von den drei Jägermeistern überreden, die sie sich bei Tobi zum Aufwärmen gegönnt hatten. So standen sie, alle halbe Minute ein paar Schritte nach vorne. Sie konnten inzwischen die Türsteherin sehen. Je näher die Gäste ihr kamen, desto stiller wurden sie, desto mehr Abgebrühtheit und Club-Expertise wollten sie ausstrahlen. Dem geschulten Blick der Allmachtsperson am Einlass entging nichts. Hängenden Hauptes mussten immer mal wieder kleine Grüppchen nach links abbiegen, zurück zur Tram-Station.
„Für euch ist das heute hier nichts. Sorry, tut mir leid.“
Eiskalt. Worte, die man nach einer Stunde Anstehen nicht hören wollte.
„Na, toll“, dachte sich Ingmar. „Wir beide katapultieren hier den Altersdurchschnitt in unbekannte Höhen und cool bin ich erst recht nicht. Ein Würstchen bin ich und am Arsch!“
Er hatte jedoch die Rechnung ohne Tobi gemacht. Der war nämlich ein bunter Hund, hatte Homies in ganz Berlin, von allen gemocht. Tobi log nie, auf den konnte man zählen. Das wussten Hinz und Kunz. Und das kam ihm immer wieder zugute. Tobi und die Türsteherin begrüßten sich mit Küsschen links, Küsschen rechts und: Sie lächelte!
„Ey, lang nicht mehr gesehen!“
„Wie geht’s denn?“
„Ja, super! Selbst?“
„Kann nicht klagen, alles dufte! Das ist übrigens Ingo, guter Freund von mir!“
Ingmar wollte schon ansetzen, Tobi zu verbessern, aber dann war es ihm bereits wieder egal.
Scheiß drauf, bin ich halt Ingo, dachte er sich.
„Ihr kennt den Drill.“
Sie streckte ihnen eine Rolle mit minikleinen Stickern hin. Tobi zückte sein Handy und klebte mit flinken Fingern die Kameras auf beiden Seiten ab. Ingmar zuckte beschämt mit den Schultern und flüsterte, sodass die beiden es fast nicht hören konnten:
„Ich besitze kein Handy …“
Als sie in den Innenhof traten, verstand Ingmar die Welt nicht mehr. Die Sonne züngelte unverhohlen am Himmel, kein Wölkchen, viele der jungen Hüpfer in kurzen (sehr kurzen!) Hosen, die Typen teilweise ohne T-Shirt, schwitzig, happy, aufgedreht … es war, verdammt nochmal, Samstagnachmittag! In welchem Film war er hier?! In der Disko feiern, war doch was, was man Freitag- oder Samstagnacht tat! Ein Mädel mit regenbogenbunten Haaren und merkwürdig krakeligen Tatöwierungen an beiden Armen, den Beinen und sonst noch wo, warf ihm eine Plastikblumenkette über und grinste frech, bevor sie mit ihrer Truppe in einem langen, verrauchten Gang zu seiner Linken verschwand. Ingmar spürte urplötzlich ein warmes Kribbeln, er wollte gleich hinterher. Als er gerade kehrt machen wollte, packte ihn jemand am T-Shirt-Kragen und hielt ihn vehement zurück.
„Na na na, Ingo. Chill dich! Wir sind gerade erst angekommen“, tadelte ihn Tobi.
Wie ein trotziges Kind erwiderte Ingmar:
„Ja, aber hast du das nicht gesehen? Wie die mich angeschaut hat? Die will bestimmt mehr! Ich muss da hinter- …“
Tobi lachte los. Es war aber kein Auslachen, es war eher jenes liebevolle Lachen, das Eltern von sich geben, wenn ihr Kind mit voller Überzeugung etwas gesagt hat, was keinen Sinn ergab – aber nur, weil es der halbe Meter in seiner unerschütterlichen Naivität nicht besser wusste. Er nahm Ingmar in den Schwitzkasten.
„Ingo, Ingo, Ingo … du einiges noch zu lernen hast“, seine Yoda-Imitation war ausbaufähig. „Wir holen uns jetzt erstmal ‘nen Drink und dann fliegen wir los!“
Um an die Bar zu kommen, mussten sie sich zwischen unzähligen verschwitzten, wunderschönen Körpern durch-drücken. Ingmar war sprachlos. In welcher absurden Parallelwelt war er hier gelandet? Der Bass trieb die Menge unermüdlich an. Bumm Bumm Bumm Wämms! Die Musik drehte sich im Kreis, eine Melodie nahm er nicht wahr. Laut war es vor allem. Immer wieder bratzten ihm breitflächige Synthesizerklänge frontal ins Gesicht. Ebbe und Flut in kürzesten Abständen. Jedes Mal, wenn sich die Musik hin zu einem dieser kleinen Höhepunkte schob, fingen die Frauen und Männer zu pfeifen, kreischen und johlen an. Die Arme wurden gen Decke gereckt.
Er musste sich an der Bar festkrallen. Das war irgendwie alles zu viel. Was war das? Und fand er es schrecklich? Oder doch schön? Die feuchte Luft in diesem überfüllten Raum sorgte jetzt auch bei Ingmar für übermäßigen Schweißfluss. Tobi sah hingegen wie das blühende Leben aus, so zumindest Ingmars Eindruck. Er wäre der perfekte Posterboy für die 68er-Bewegung gewesen. Als Ingmar ihn so betrachtete, wie er lässig und unaffektiert an der Theke lehnte, fiel ihm auf, dass es eben nicht in erster Linie sein Äußeres war, das ihn so einzigartig erscheinen ließ. Die Haare lang, ein paar verfilzte Dreads im gelockten Wirrwarr, der Bart noch länger, die Klamotten kunterbunt (aber alles natürlich nur ökologisch-wertvolle Produkte oder Second Hand), an den Handgelenken und um den Hals baumelten Kettchen und Armbänder aus aller Herren Länder. Das war kein Look von der Stange, aber auch keiner, der die Fashionistas auf der Straße zum Umdrehen bewegte. Nein, Tobi hatte tatsächlich so etwas wie eine Aura. Eine Aura, die ihn strahlen ließ. Menschen, die sich auf ihn einließen, bemerkten schnell, dass Tobi dieses gewisse Etwas hatte. Und er hatte es, weil er es nicht erzwang, es nicht unbedingt haben wollte, nichts damit bezweckte, mit sich selbst im Reinen war. So sprudelte das Charisma ganz von selbst.
Ingmar verspürte eine Spur von Neid. Wie Tobi aus all den Druffis herausstach, wie er mit dem Barkeeper flachste, die beiden sich lachend gegenseitig an den Schultern packten. Das war immer sein großer Wunsch gewesen: Eine charismatische Persönlichkeit wollte er sein, nach der sich der ganze Raum umdrehte, sobald er ihn betrat. Wirtschaftlicher Erfolg schön und gut. Da hatte er sich nichts vorzuwerfen. Performt hat er wie ein junger Gott, gnadenlos, immer mit dem richtigen Riecher, wann es an der Zeit war, Risiko zu gehen. Bis auf dieses eine Mal eben. Aber jenes schillernde Antlitz, das manch andere Macher (Reinhold Würth! Steve Jobs! Elon Musk! ... Groß denken! The sky is NOT the limit!) auf Magazincover und in Talkshow-Sessel brachte, besaß er nicht. Irgendwann hatte er sich auch eingestehen müssen, dass dies etwas war, das man nicht erlernen konnte. Was er über all die Jahre an Kohle in Personality-Coaches gepumpt hatte! Bei den massiven Beträgen, die er denen gezahlt hatte, war es kein Wunder, dass sie ihm mit ihren zurückgegelten Schmalzlocken hinterhergekrochen kamen. Wahrhaftigkeit ließ sich nicht kaufen, täuschen konnte er nur bis zu einem bestimmten Grad. Das war Fakt.
Tobi streckte ihm eine Wasserflasche hin:
„Jetzt geht die Luzi ab, Digger!“
Wasser? Stilles Wasser?! War das sein Ernst? Damit sollten sie jetzt gebührend feiern und einen draufmachen? Er roch an der Flasche. Nee, war auch kein klarer Schnaps. Ingmars offensichtliches Stirnrunzeln brachte Tobi zum Lachen:
„Komm mit …!“
Er hakte Ingmar unter und zog ihn mit. Er ging quer über den Innenhof, überall saßen und lagen die zerfeierten Gestalten, nahmen sich eine Auszeit, folgten durch ihre Sonnenbrillen den vereinzelten Wattebällchen am Himmel.
„Ey, cooler Style“, rief ihm einer zu, der im Schneidersitz auf einer der terrassenförmig angeordneten Holzbänke saß, über ihm baumelten Lichterketten, deren bunte Gehäuse ausgeblichen waren.
Will der mich verarschen, dachte sich Ingmar. Zuerst blickte er an sich runter, dann dem Typen ins Gesicht. Cool sollte das sein? Eine weite Pluderhose aus taubengrauem Leinen, das Hemd kurzärmlig, ein pastellfarbenes Muster à la 60er-Jahre-Wohnstubentapete, an den Füßen ausgelatschte weiße Reebok-Tennisschuhe. Wie ein Clown sah er aus, ein sehr bemitleidenswerter! Mehr aber auch nicht. Der Typ war wohl anderer Meinung: Sein Lächeln hätte nicht echter sein können. Von Grund auf ehrlich gemeint.
„Danke …“, erwiderte Ingmar verschüchtert.
Sie glitten weiter durch die Grüppchen schöner Menschen.
„Äh, Tobi, ich muss aber gar nicht pissen!“
„Ist egal, komm jetzt!“
Tobi zog ihn in eine der Kabinen, schloss ab. Die Wände von unten bis oben vollgetaggt, Aufkleber en masse, Kloschüssel ohne Klobrille, die Luft uringeschwängert.
„Hier, halt mal.“
Zack – und Ingmar hatte beide Wasserflaschen in der Hand. Aus der Innentasche seines Portemonnaies zog Tobi ein kleines Plastiktütchen, darin kleine weiße Kristalle.
„Was ist denn das?“, fragte Ingmar neugierig.
Auf seinem Leidensweg hatte er schon so einiges probiert, um die Wucht des Lebens abzudämpfen. Heroin hatte er schon unzählige Male geraucht (das Spritzending hatte er noch nicht gewagt, davor hatte er (noch) Bammel), Crystal Meth hatte er auch schon mal probiert, das war vielleicht abgegangen! Dass er echt mal als Junkie enden sollte: Wer hätte das gedacht! Karma war nach wie vor ein Schlitzohr.
„Mdeeee ist das, Ingo! Also MDMA … das lässt dich schweben, ich sag’s dir! Du wirst die Welt vor lauter Liebe zerquetschen wollen!“
Hibbelig wie ein kleines Kind sprang er von einem Bein aufs andere. Er bröselte kleine Mengen in beide Flaschen.
„Das sollte für den Anfang enough sein. Kein Alkohol mehr heute, das verträgt sich nicht so. Und wunder dich nicht, wenn ich dich immer mal wieder zum Pissen schicke.“
„Hä, das merk ich doch selber, wenn ich muss?“
„Ne, du hast da nicht so den Harndrang, du musst dich dann richtig zwingen. Aber alles easy, das wird zauberhaft!“
Tobi prostete Ingmar auf dem Weg zurück ins Getümmel zu, nahm einen tiefen Schluck. Ingmar tat es ihm gleich. Bah! Bitter war das! Aber was soll’s. Solange es ordentlich knallt. Gleich noch einen Schluck hinterher. Sie gingen durch den langen verrauchten Gang, in dem vorhin das Blumenkettenmädel verschwunden war. Die Intensität der Musik nahm zu, dieses Mal sphärische, hypnotisierende Sounds, minimalistisch eingesetzt über gedämpften, aber unermüdlich nach vorne preschenden Bässen. Sie bogen um ein paar Ecken, die matt schwarz gepinselten Wände schluckten das Licht, nahmen der Umgebung das Profil. Dann standen sie mitten auf dem Floor, viel größer als der erste war der, auf mehrere Betonpfeiler prallten die Strobo-skopblitze, die vom DJ-Pult heranschossen. Im Nebel zappelten dutzende schwarze Schatten, Tageslicht drang keines in diesen Raum, dessen Ecken Ingmar beim besten Willen nicht ausmachen konnte. Während er noch versuchte, sich zurechtzufinden, hatte Tobi schon die Augen geschlossen und wiegte sich mit baumelnden Armen sanft zur Musik. Nach und nach zog Tobis Körper immer größere Kreise. Wie Fische in einem riesigen Schwarm kamen sich die Tanzenden zu keinem Augenblick in die Quere. Sie glitten aneinander entlang. Jeder für sich und doch gleichzeitig ein einziger pulsierender Organismus.
„Und ich? Was mach’ ich jetzt?“, fragte sich Ingmar.
Scooter war das höchste der Techno-Gefühle, was bei ihm ab und an zu später Stunde bei Grillparties und Weihnachtsfeiern gelaufen war.
Kein Schimmer, wie ich mich da bewegen soll. Da kann ich mich nur zum Trottel machen, schwitzte es in seinem Hirn.
Er wollte schon kehrtmachen. Weg, raus an dem kleinen Teich, Tobi sein Ding machen lassen. Da zwinkerte ihm durch die Nebelschwaden das Blumenkettenmädel zu, sie streckte ihm den Arm entgegen, gab ihm zu verstehen: ‚Komm! Trau dich.’. Sie fing an zu hüpfen, warf die Hände in die Luft, den Kopf in den Nacken. Tänzerisch anspruchsvoll sah das nicht aus, rhythmisch, nun ja… aber sie hatte Spaß, und was für einen!





























