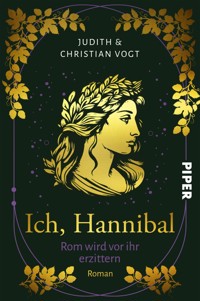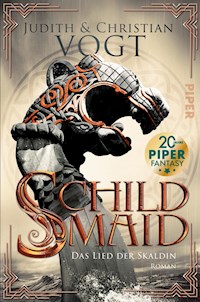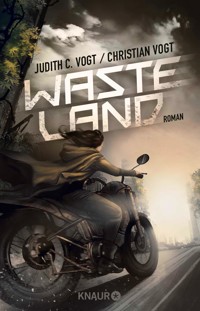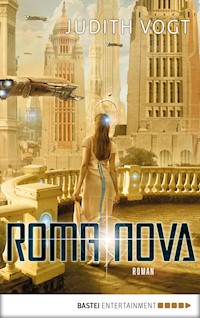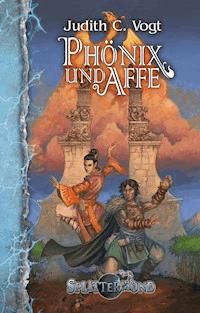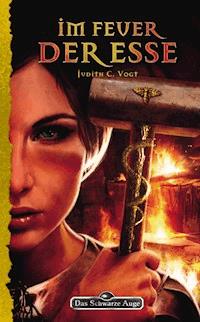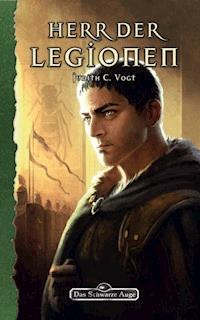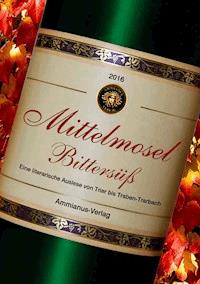Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
Die Wildermark - vom Krieg zerbrochen, von falschen Hoffnungen getäuscht, ist dies kein gutes Land, um allein auf die Walz zu gehen. Dennoch macht sich die junge Schmiedegesellin Zita aus Zweimühlen auf, um ihr Handwerk zu vervollkommnen. Gejagt von den niemals ruhenden Geistern ihrer Vergangenheit gilt es, inmitten plündernder Orkbanden und intriganter Kriegsfürsten zu bestehen. Als zudem verdorbene Klingen aus Sternenstahl auftauchen, welche drohen, die Seelen ihrer Opfer für immer in die Niederhöllen zu zerren, schließt sich Zita dem Schwertgesellen Ulfberth an. Sie stellen sich einem grausamen Feind, um das ohnehin gebeutelte Land vor einem weiteren Fluch zu bewahren; einem Fluch, der den Krieg in der Wildermark nie enden ließe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Biografie
Judith Vogtwurde 1981 in der Nordeifel geboren. In einem 100-Seelen-Dorf, das wenig Beschäftigung für Jugendliche bot, begann sie Rollenspiel mit siebzehn Jahren und tauchte ab in das Lesen und Schreiben von Fantasy. Ihrer Leidenschaft für Bücher treu, arbeitete sie als ausgebildete Buchhändlerin.
In ihrer Freizeit interessiert sie sich – neben Rollenspiel – vor allen Dingen für alte Zeiten und alte Geschichten, für Kelten, Frühmittelalter, Reenactment, Schwertkampf, aber auch für Natur und Ökologie und natürlich fürs Schmiedehandwerk.
Judith Vogt lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Aachen.Im Schatten der Esseist ihr erster Roman.
www.jcvogt.de
Titel
Judith C. Vogt
Im Schatten der Esse
Ein Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Impressum
Ulisses Spiele Band 11069PDFTitelbild:Arndt Drechsler Aventurienkarte: Ralph HlawatschLektorat: Catherine Beck Buchgestaltung: Ralf Berszuck E-Book-Gestaltung: Michael MingersCopyright ©2012 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems. DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN und DEREsind eingetragene Marken. Alle Rechte von Ulisses Spiele GmbH vorbehalten.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt.
Danksagung
Für Hawlogh – den Weggefährten vieler Abenteuer
Dank gebührt: … an vorderster Stelle dem, den ich am wenigsten kenne: Uli Lindner – vielen Dank für Zweimühlen und eine großartige Zeit! … meiner weltbesten Kriegsfürstengruppe: die Herren von eigenen Gnaden Lydia, Marc und Christian, die Berater Dietmar und Tobias. Danke für die Tasse. … der unermüdlichen Korrekturleserin Alex für all die nützlichen Korinthen und Erbsen, für die Hilfe bei der Erstellung des Glossars und für dein Urteil als Nicht-DSA-Fritte. … Marc für ebenso fleißiges Korrekturlesen, für bissige und nette Kommentare, für dein Urteil als DSA-Fritte und natürlich für Tronde (und die Rede)! … Ines für die ausführliche Meinung. … Jannis für seine spontane Hilfe bei den Schmiedeszenen und für viele nützliche Infos, die ich, wenn schon nicht beim Schreiben, vielleicht irgendwann beim Schmieden gebrauchen kann. … Anna und Stefan fürs nie die Hoffnung aufgeben. … meinen Kindern dafür, dass sie mich manchmal haben arbeiten lassen. … Christian – ein Detailauszug muss reichen: Danke für nächtelanges Storybasteln, für Faltenausbügeln, geduldiges Loben und Nörgeln, für die Schmiede in der Garage und Abenteuerliches im realen Leben und in Aventurien!
Abschied von Zweimühlen
Abschiede pflegen die schlechte Gewohnheit, sich so lang hinzuziehen, dass es ist, als sterbe man einen sehr langsamen Tod. Mein Abschied begann an einem Morgen, an dem die Dämmerung den Himmel entzweischnitt wie eine Schere. Die eine Hälfte war rosarot, wie verwässertes Blut, das aus dem Schnitt perlte, die andere Hälfte grau und kalt und fahl. Im Innenhof von Nardos Schmiede stehend sah ich hinauf, und es war, als sei der Himmel mein Spiegel. Eine Hälfte meines Herzens fühlte sich grau und taub an in meiner Brust – wie ein Stein und so, als würde ihr nichts etwas bedeuten. Die andere Hälfte vergoss Herzblut und Tränen bei dem Gedanken, fortzugehen.
Ich hatte mein Bündel bereits geschultert, als Saria, Nardos Frau und erste Gesellin, mit dem kleinen Gondrik auf dem Arm aus dem Wohnhaus kam, beide noch verschlafen und sich die Augen reibend. Undankbar sah ich sie an. Mussten sie es mir noch schwerer machen? Nardo stand doch schon unbeholfen an meiner Seite und trat von einem schwerfälligen Fuß auf den anderen – und ich hörte zu allem Überfluss sich nähernde Fußtritte.
Nardo legte mir die schwielige Hand auf die Schulter, deren Fingernägel, ebenso wie meine, schwarze Ränder hatten, die sich nie wieder würden abwaschen lassen. Ich versuchte, ihn anzulächeln, aber der Morgen war so grau und kalt und traurig, ich konnte es gar nicht richtig. Mein Meister Hawlogh bren Anchas kam durchs Tor, der neue Baron von Zweimühlen. Es ist eine lange Geschichte, wie es kam, dass der Meisterschmied eines halbnackten Barbarenvolkes aus dem Norden Baron unserer Stadt in Darpatien wurde, und ich weiß nicht, ob ich sie richtig erzählen würde. Jedoch so ist es. Er ist unser Baron und mein Lehrmeister. Also, Nardo ist auch mein Lehrmeister, als Baron hat man ja noch andere Dinge zu tun, als Kindern wie mir beizubringen wie man Nägel schmiedet. Aber anders als Nardo Gänsekiel, der liebenswürdige, schwergliedrige, schnaufende Hufschmied, hat Baron Hawlogh eine Kunstfertigkeit, die sicherlich die aller Schmiede in der Wildermark übertrifft, außer vielleicht die der Zwerge in Zwerch. Und er kennt Geheimnisse – Geheimnisse von Feuer und Stahl und Hammerschlägen und alten Versen und Gesängen, die die Zaubereien seines Volkes in die Waffen hineinschmieden.
Der Baron trat durch den Innenhof zu uns und sagte leise, in der Stille der Morgendämmerung: »Du wirst ihr doch wohl nicht den Segen geben, Nardo, sie ist mein Lehrling.« Dann sah er mich an, und etwas Weiches spielte um seine Lippen. »Gewesen. Du bist mein Lehrling gewesen. Jetzt bist du eine verdammt gute Gesellin. Eine bessere jedenfalls«, er erhob die Stimme ein wenig, weil Reto nun auf den Hof trat, »als Reto, dieser faule Hund, der keinen graden Nagel in die Wand schlägt.«
Reto verzog das Gesicht, als hätte er zu viel Ampfer gegessen, lachte dann aber und zwinkerte mir zu.
Hawlogh trat vor mich, so nah, dass ich unter seinem offenen Mantel auf seiner bloßen Brust die blauen Tätowierungen erkennen konnte, deren Linien sich schlängelten und überkreuzten und viele von uns abergläubischen Zweimühlenern so beunruhigten. Mich beunruhigten die blauen Hautbilder nicht mehr. Vertraut war mir das Spiel der Muskeln geworden, das sie wie lebendig erscheinen ließ, während der Arm mit dem Hammer seine präzisen Schläge ausgeführt hatte.
Er legte seine Hände auf meine Schultern und sah mir in die Augen, so lange, dass ich fühlte, wie mir das Herz in der Brust eng wurde.
»Zita, ich entlasse dich auf das, was wir im Norden Kralessa nennen. Wie deine Meister es schon getan haben, so sollst auch du jetzt auf Aves’ Spuren wandern, in Ingerimms Sinne lernen und von Natûru-Gons und Travias Segen begleitet sein und überall gerne empfangen werden. Lerne, was du kannst, gib weiter, was du weißt, und komme als Meisterin zu uns zurück! Wir werden jeden Tag nach dir Ausschau halten und dich vermissen.« Und damit drückte er mich heftig an sich, dass ich den Geruch seines Fellmantels in der Nase hatte und der Kloß in meinem Hals mich fast erstickte. Ich nickte und presste die Lippen zusammen.
Wie im Traum nahm ich wahr, dass Saria und Nardo mich umarmten, wie sie weinten und schnieften und sich schnäuzten. Der kleine Gondrik hing an meinem Hosenbein und wollte auf meinen Arm, aber ich wandte mich irgendwann einfach um und ging, während der Himmel über mir in Rot- und Rosatönen schier zerbarst. Irgendwo, weit im Westen, hing noch ein Hauch der kalten bleiernen Schwere. Als ich mich in diese Richtung wandte, erwachte die Stadt langsam zum Leben, und ich schritt eilig durch die Straßen und Gassen aus festgetretenem Staub und Schmutz, bis ich bei der Palisade am Wehrheimer Tor ankam.
»Jetzt gehst du also wirklich auf die Walz, Zita!«, sagte der lange Bogomil, der am Tor Wache stand, und machte sich gemächlich daran, es zu öffnen. So, wie er es anfing, sah es nach einer komplizierten und langwierigen Tätigkeit aus, und ich trat unruhig von einem Fuß auf den anderen.
»Hmm«, grummelte ich zur Antwort.
»Weißt du schon, wo’s hingeht?«
»Irgendwohin. Wo die Mark zu Ende ist. Nach Weiden vielleicht. Die Ritter dort wissen ein gutes Schwert bestimmt zu schätzen.« Diese Gedanken waren mir zwar gerade erst gekommen, kristallisierten sich jedoch sofort klar zu einem Entschluss heraus.
Bogomil nickte ernst. »Ich hab dein Gesellenstück im Tempel gesehen. Ein prachtvoller Andergaster, wirklich. Wer mit so was kämpfen kann, zahlt sicher einiges für ’nen zweiten von der Sorte.«
Hinter mir hörte ich Schritte. Kamen sie mir jetzt nachgelaufen, um mich noch mehr zu umarmen und mir ihre Tränen an Schultern und Wangen zu schmieren?
»Mach schon auf, Bogomil, sonst muss ich dem Baron sagen, dass Zweimühlen entweder ein kaputtes Tor hat oder seine Leute zu dumm sind, damit umzugehen!«, brummte ich den Langen an, der die Schultern hochzog und mich mit einem gespielt-ängstlichen Ausdruck ansah.
»Bloß nicht, bloß nicht. Wollte doch nur noch mal mit der besten Schmiedegesellin der Wildermark sprechen. Wer weiß, ob wir uns noch mal wiedersehen, Kleine. Man weiß ja nie, was das Leben hier so bringt. Vielleicht hebt Gallys eines Tages ab und stürzt auf uns runter, weißt du, wie diese Festung von dem Galotta.« Er kicherte, dann wurde sein Gesicht ernst, als wäre er sich nicht sicher, ob er etwas Lästerliches gesagt hatte, und er schlug hastig das Zeichen des Herrn Praios. »Also, alles Gute dir, und geh irgendwohin, wo es schön ist und die Leute Frieden haben. Dann lernst du mal, wie das so ist.«
Ich nickte und ging durch das Tor, das er mir nun endlich aufhielt. Auch ihm sagte ich kein Wort des Abschieds. Nach wenigen Schritten hörte ich jedoch ein »Warte, warte, nicht zumachen!«
Ich drehte mich nicht um, obwohl – oder weil – ich die Stimme erkannte. Einige weitere Schritte, und er hatte mich eingeholt.
Retos sommersprossiges Gesicht grinste mich an. Er war viel zu fröhlich und unbeschwert für diesen Morgen. Für dieses Land. Für meinen Geschmack.
»Zita, willst du gehen ohne einen Abschiedskuss?«, neckte er mich.
Ich runzelte die Stirn. »Warum sollte ich dir einen Kuss geben?«, fragte ich brüsk.
»Wem sonst? Komm, Zita, wir haben jahrelang zusammen gelernt. Du mehr, ich weniger, wie sie ja immer so nett behaupten. Du warst wie meine Schwester. Auch schon damals, bei Mutter Erlgunde. Gib mir einen schwesterlichen Kuss, dann kriegst du ein brüderliches Abschiedsgeschenk von mir.«
»Ich will keine Geschenke, ich habe schon genug zu tragen«, murmelte ich, aber er lehnte sich vor, spitzte die Lippen und schloss die Augen, und dabei sah er so herzzerreißend dumm aus, dass ich einfach lachen musste. Kurz entschlossen gab ich ihm einen winzigen Kuss auf die Wange.
»Hier, bezaubernde Zita, der alle Herzen zufliegen, mein Geschenk.«
Ich nahm es entgegen, es war in einen schmutzigen Lappen gewickelt – durch ihn hindurch spürte ich sofort, was es war. Ich nahm es heraus und fand meine Ahnung bestätigt. Es war eine Zange.
»Eine Zange. Danke.« Mit mäßiger Begeisterung schob ich sie in meinen Werkzeuggürtel zu meinen beiden anderen Zangen.
»Ich habe sie selber gemacht, was natürlich heißt, dass sie schlechter ist als deine«, feixte Reto. »Aber sie ist mit Liebe gemacht statt mit Verbissenheit. Also, jede Macke daran ist Kunst. Und es ist noch was Besonderes dran. Das sag ich dir nur, wenn du mir noch einen Kuss gibst.« Er grinste schelmisch. »Diesmal aber auf den Mund.«
Ich zuckte mit den Achseln und sah ihn verächtlich an. »Das denkst du dir wohl so. Aber ich mag Rätsel. Ich werde es einfach selbst herausfinden und mir den Kuss sparen.«
Empört sah er mich an. »Aber …«
»Kein Aber. Hol dir den Kuss von Mila ab oder von, wie heißt sie noch, Tsalinde.«
»Perainlinde«, murmelte er beleidigt. »Dann mach’s gut, und viel Spaß beim Rätseln, du Sturkopf! Ich werde dich vermissen.«
Ich ging ein paar Schritte auf dem ausgefahrenen Karrenweg. Dann wandte ich mich noch einmal um. Reto mit seinen ungekämmt-wirren Haaren stand da, und hinter ihm stand Zweimühlen, die Palisaden rosa vom Dämmerlicht behaucht, die Holzhütten und Fachwerkhäuser dahinter so seltsam verletzlich und schutzbedürftig zusammengedrängt, dass mir mein Herz so schwer war wie das ganze Bündel auf meinem Rücken.
»Ich dich auch«, sagte ich, und es fiel so ungewollt leise aus, dass ich es selbst kaum hörte.
Aber Reto hörte es, lächelte und nickte.
Ich höre Stimmen von drausen vor der Tür. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich bin, alles ist so verschwommen in meiner Erinnerung.
»Lass sie sich noch etwas ausruhen«, sagt Sarias Stimme. Ich merke, dass ich das nicht will, dass sich alles in mir dagegen sträubt. Untätig in der Dunkelheit sitzen. Die Tür geht auf, und Hawlogh steht im Türrahmen. Ich erkenne seine Silhouette an den wilden Zöpfen, die er am Hinterkopf zu einem unordentlichen Knäuel zusammengebunden hat. Er sagt ganz ruhig, obwohl ich so etwas wie Wut oder Aufgewühltheit in seiner Stimme hören kann: »Ich hab das Feuer angemacht. Zita, ich brauche deine Hilfe am Blasebalg.«
Ich stehe auf und gehe hinaus, über den Hof und in die Schmiede. Ich habe das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben, aber ich weiß nicht, was. Es riecht nach Kohle, nach Stahl und alter Hitze. Vielleicht auch nach einem Hauch Schweiß. Ich mag das und entspanne mich etwas.
Hawlogh steht neben mir, und wir zögern beide, bevor wir die Schmiede betreten. Werkzeuge liegen auf dem Boden, der schwere Tisch ist in der Mitte entzwei. Ich sehe sofort, dass Hämmer und einige fertig geschmiedete Messer fehlen. Reto steht schon an der Esse, weder er noch der Baron scheinen die Unordnung zu beachten.
Wir sehen uns alle an, und es kommt mir vor, als hätte ich etwas im Hals, was ich nicht runterschlucken kann. Hawlogh scheint nach Atem zu ringen, bevor er sagt: »Also, los, Lehrlinge, an die Arbeit!«
Meine erste Nacht unter freiem Himmel verlief zum Glück ereignislos. Ich träumte von Feuer und heißen Kohlen und erwachte sehr früh, zu der Stunde, zu der sich der Himmel langsam aufzuhellen beginnt, aber die Nacht noch einmal besonders kalt und unbarmherzig wird, und der Tau sich wie eine nasse Hülle um mich zu legen begann. Ich verkroch mich in meinen Wolldecken, wurde mir aber rasch bewusst, dass die Wärme meines eigenen zitternden Körpers nicht ausreichen würde, um diesen Herbstmorgen wesentlich gemütlicher zu gestalten. Also rollte ich zittrig und mit klammen, steifen Gliedern meine Habe wieder zu einem Bündel zusammen, das ich mir auf den Rücken schnallte. Meine Füße waren eiskalt in den Lederschuhen, und alles an meinem Körper fühlte sich feucht an und schien meine Bewegungen zu hindern. Trotzdem schlug ich direkt einen schnellen Schritt an und versuchte mich warm zu laufen, bis die Sonne aufgegangen war. Als jedoch die herbstlich goldenen Strahlen der Sonne einmal über die Hügelkuppen gekrochen waren, brach ein warmer Traviatag an, an dem mir noch zu warm werden sollte in meinen wollenen Hosen und mit all meinem Gepäck und Werkzeug. Ich befand mich immer noch in der Baronie Zweimühlen, und die friedliche Einöde, die einst die Kornkammer des Reichs gewesen war, umgab mich nach allen Seiten. Doch wenn ich wirklich die Wildermark verlassen wollte, so lag dahinter, in allen Richtungen auf viele Meilen, ein unberechenbares Land, in dem einem so ziemlich alles passieren konnte.
Ich gelangte zur Reichsstraße, der großen gepflasterten Schneise, die von West nach Ost durch die Wildermark schnitt. Einst eine viel befahrene Straße, war sie nun an vielen Stellen beschädigt und vernachlässigt. Unschlüssig stand ich am grasüberwucherten Straßenrand. Der Sommer hatte sein Werk getan und die Straße sicher an beiden Seiten noch um einen halben Schritt überwuchert. Ich fragte mich, wie schnell es wohl gehen würde, bis sich der Leib Sumus wieder über ihr geschlossen hatte.
Vielleicht würde es tatsächlich geschehen. Viel Wasser war den Darpat hinuntergeflossen und viel war gekämpft und geredet worden – manche wagten schon, vom Frieden zu sprechen, von der Kaiserin, vom Reich. Ich schüttelte insgeheim den Kopf. So nah am Schwarzen Tobrien – was konnte da noch alles geschehen?
Sollte ich der Reichsstraße gen Efferd folgen? Sie würde mich bis Wehrheim führen, aber von Wehrheim hatte ich nur gehört, dass es schrecklich zerstört worden war und von Geistern und Dämonen und diesen blutrünstigen Kor-Anhängern heimgesucht wurde. Und rundherum erstreckte sich auf Meilen und Meilen das Mythraelsfeld, auf dem die wütenden Geister derer, die dort beim Weltenbrand erschlagen wurden, jeden Dummen auffraßen oder in ihr Reich hinabzogen oder wer weiß schon was …
Es war ein seltsames Gefühl, fort von zu Hause zu sein. Einfach den Füßen zu folgen. Ich pflückte die letzten Brombeeren am Wegesrand und aß ein paar Scheiben Brot. Ich hatte sehr viel Zeit, über sinnlose Dinge nachzudenken, mich ewig dahinfließenden Gedanken hinzugeben. Von ferne sah ich einen Schäfer mit seiner Herde, gelblich-weiße Schafe mit schwarzen Gesichtern. Er hatte wohl immer Zeit, seinen Gedanken nachzuhängen – machte das aus Schäfern nicht sicherlich die größten Denker der Welt?
Meine Gedanken drehten sich immer wieder um meinen Weg. Gen Firun, einfach auf Karrenwegen durch die Wildermark? Oder bis auf Sichtweite an Wehrheim heran und es dann schleunigst Richtung Firun hin umgehen? Wo würde ich einen Meister finden, der mich aufnehmen würde, zumindest über den Winter? Was würde er von meinen Fähigkeiten halten? Vielleicht wäre er der Ansicht, dass ich nicht das Richtige gelernt habe, zu viele Dinge, die kein Mensch bezahlen kann, zu wenig Hufeisen und Pflugscharren.
Gegen Abend erschöpften sich meine Gedanken nurmehr darin, gequält meine Schritte bis tausend zu zählen und danach wieder bei eins anzufangen. Meine Füße brannten, aufgescheuerte Blasen schmerzten, mein Rücken tat mir weh, und ich hatte Hunger. Ich hatte noch etwas Brot im Gepäck, scheute mich aber, erneut ein durchfrorenes Nachtlager am Wegesrand aufzuschlagen. Tatsächlich zahlte sich meine Verbissenheit, für die mich Reto gestern früh noch geneckt hatte, aus, und ich sah zwischen dem Gesträuch, etwas abseits der Straße, ein Herdfeuer durch die Spalten in den Fensterläden eines Gehöfts schimmern. Als ich näher kam, hörte ich wildes Hundegebell. Nervös griff ich an meinen Gürtel und packte den Griff meines Schmiedehammers. Ein Schmiedehammer ist nicht so groß, wie die meisten Menschen denken, aber ich konnte ihn sehr präzise führen, egal, ob auf einem Werkstück am Amboss oder auf einen Hundekopf. Im Dunkeln vor mir hörte ich ein Hecheln, das sich vom Gebell abgesetzt hatte und sich mir rasch näherte. Ich löste den Schmiedehammer aus seiner Schlaufe und presste die Lippen zusammen.
Bei Travia, das war nicht sehr gastfreundlich, die Hunde auf einen Wanderer loszulassen!
Als ich schon triefende Lefzen und weiße Zähne im dämmerfinsteren Gesträuch vor mir aufblitzen sah, schallte mit einem Mal ein gellender Pfiff durch die Nacht.
»Answin! Zurück! Bei Fuß!«, brüllte eine kräftige Frauenstimme, und mit einem Winseln, als wäre er am Halsband zurückgerissen worden, gehorchte Answin.
Zitternd und schweißnass wagte ich mich nun weiter vor, nahm einen Pfad zwischen zwei überhängenden Weiden, die alles um mich her tief verschatteten, und zuckte schon beim leisen Warnruf eines Vogels zusammen.
Dahinter jedoch öffnete sich der Weg auf ein kleines Geviert, das von einigen Bäumen, einer Scheune und einem niedrig kauernden Bauernhaus umstanden war. Dort stand eine Frau mit einer Laterne aus Pergament, um sie drei Hunde – einer sich wild gebärdend, nur Lefzen, Fänge, gierige Augen und struppiges schwarzes Fell, die anderen beiden diszipliniert, ein grauhaariges langbeiniges Tier mit Schnauzbart und ein jüngerer Hund, der sich bereits zu den Füßen seiner Herrin zusammengerollt hatte. Die Frau war hager und wirkte streng, die Haare verborgen unter einer Haube, die hohen Wangenknochen traten unter einer dünn und alt wirkenden Haut scharf hervor. Mein Atem hatte sich noch nicht von der Angst erholt, die der Hund mir eingeflößt hatte, und so stieß ich stockend und fast schon demütig hervor: »Travia … Travia mit euch, ich bin auf der Walz und … ähm, gehofft, bei Travia …«
»Du möchtest auf Travias Gesetze verweisen, nehme ich an, Kind«, sagte die Frau streng, als hätte ich sie damit beleidigt. Was ich vielleicht hatte. »Ich weiß, dass ich einen Handwerker auf der Walz freundlich aufnehmen soll, so wollen es Travia und Ingerimm.«
Und Natûru-Gon,fügte ich in Gedanken hinzu.
»Du kannst im Kuhstall schlafen, das ist dort drüben. Ich bringe dir Suppe und einen Schluck Bier, und morgen beschlägst du mir mein Pferd neu.« Sie wandte sich ab, darpatische Gastfreundschaft hatte einem wildermärkischen Pragmatismus Platz gemacht. »Answin, Hal, Rohaja, kommt mit!« Zwei Hunde trotteten hinter ihrer Herrin her, Answin knurrte immer noch wild und ließ mich nur widerstrebend zurück.
Ich musste mich vom heimelig durch die Fenster scheinenden Herdfeuer abwenden und die Tür zum dunklen Kuhstall öffnen. Ich hatte Glück: Das Wetter war gut gewesen und die meisten Tiere noch auf der Weide, also schlug mir zwar im ersten Moment ein sehr unangenehmer Geruch entgegen, es erwies sich dann aber als nicht so schlimm wie befürchtet – und immerhin verbreiteten die wenigen Mutterkühe mit ihren Kälbern eine wohlige Wärme, sodass ich meine Decken auf einem Flecken sauberen Strohs ausbreitete und auf die versprochene Suppe wartete.
Dabei erinnerte ich mich an etwas, da muss ich sehr klein gewesen sein.
Ich werfe sicherlich einiges durcheinander, aber ich befinde mich in einer kleinen Baracke nahe der Palisadenmauer. Ich habe einen Hundewelpen bei mir, aber er ist kränklich, und ich bin zu klein, um mich richtig um ihn zu kümmern. Er hat sich jetzt schon länger nicht mehr bewegt, und ich stupse ihn immer wieder mit dem Finger an. Ich weiß, dass ich an dabei ein Frauengesicht denke, an das ich mich heute nicht mehr erinnere. Es ist wächsern und kalt, das weiß ich noch, und ich befürchte, dass auch der kleine Hund wie das Gesicht die Augen nicht mehr aufschlagen wird. Aber noch ist er warm, und ich lege meine Wange an seinen weichen Bauch und fühle das schwache Zittern des Lebens in ihm.
Während ich die Suppe aß und auch die ganze Nacht hindurch, wechselnd zwischen Wachen und Schlaf, fragte ich mich, was mit dem Welpen geschah. Starb er? War es meine Schuld? Hatte ich nicht genug zu fressen für ihn? War er ohne seine Mutter nicht fähig gewesen zu überleben? Ich hatte es überlebt, den Hunger und die Krankheit, die meine Mutter dahingerafft hatten.
Hatte ich den kleinen Hund begraben? Oder war er gar nicht gestorben, hatte er überlebt und war mir irgendwann davongelaufen? Ich durchkämmte mein Gedächtnis nach weiteren Bildern von ihm, doch ich wurde nicht fündig, und auch in meinen Träumen tauchte nur das Gefühl auf, wie es war, meine Wange an seinen weichen zitternden Bauch zu drücken.
Answin, Hal und Rohaja. Was für eigenartige Hundenamen. Doch sie passten zu dieser hageren, strengen Frau, die mit diesen Namen vielleicht etwas Ordnung in ihr Leben brachte.
Einsame Wanderung
Die Frau beschäftigte mich noch bis in den Nachmittag hinein. Die abendliche Suppe, die morgendliche Grütze und das Brot zu Mittag war mit einiger Arbeit abzugelten. Dafür musste ich auf ihrem brüchigen Strohdach eine undichte Stelle stopfen, ihre nervöse, hagere Mähre neu beschlagen, ein Türscharnier ausbessern, das Holzgestell ihres Pflugs richten und den Schlitten mit neuen Eisenkufen für den Winter ausstatten. Danach wurde ich langsam ärgerlich, denn es brachte mich nicht weiter auf meiner Reise, aber ich bemühte mich, mein Bestes zu tun und freundlich zu der Alten und ihrem störrischen, schweigsamen Knecht zu sein. Eine junge, aber bereits ergraute Magd steckte mir noch einen halben Laib Brot und ein Stück Käse zu, bevor ich weiter meines Wegs ging. Die Sonne sank bereits wieder, als ich auf die Reichsstraße traf und ihr noch ein Stück nach Westen folgte. Irgendwo hier endete Zweimühlen, und die Baronie Königsweber begann, aber wo, konnte ich nicht genau sagen. Alte Grenzsteine waren überwuchert, und niemand hielt Wache an den Grenzen. Bald wandte sich ein recht gut befahren aussehender Weg nach Norden.
Eigentlich muss ich schon recht nahe an Wehrheim dran sein,dachte ich.Es ist auf jeden Fall hinter Königsweber.So beschloss ich, mich Wehrheim nicht weiter zu nähern, sondern dem Karrenpfad zu folgen, der sich buckelig über Grassoden und Baumwurzeln dahinschlängelte. Dabei versuchte ich, mir ins Gedächtnis zu rufen, auf wessen Gebiet ich mich wohl befand. Der Weg war, wie alle Wege bislang, verlassen. Nur Vögel zwitscherten, ab und an huschten eine Maus oder ein Kaninchen am Wegesrand vor mir davon. Ein Falke rüttelte über einer offenen Stelle im Gelände. Anders als auf der Reichsstraße fühlte ich mich nun etwas verlassen und irgendwie bedrückt von all der Einsamkeit um mich herum. Und was, wenn ich jetzt auf feindlichem Gebiet war? Auf dem Gebiet von Räuberbanden oder Söldnerfürsten, denen Travias Gebote nichts galten und auch nicht das Gesetz vom freien Geleit der wandernden Handwerksgesellen? Was war, wenn sie nun aus dem Wald stürzten und mich beraubten, mir mein Werkzeug wegnahmen und die Handvoll Taler in dem Beutel, den ich um den Hals und unter dem Hemd verborgen trug? Energisch schüttelte ich den Kopf, fasste den Wanderstab, den ich mir aus einem Haselgebüsch geschnitten hatte, fester und versuchte, mutig auszuschreiten. Die Pause, während der ich die Gerätschaften der Bäuerin gerichtet hatte, hatte immerhin meinen Blasen und wunden Füßen wohlgetan, der späte Herbst war golden und rot, und es gab sicherlich keinen Grund, sich Sorgen zu machen. War ich hier nicht auf dem Gebiet des Rabenmunds? Der war ein Ritter, nach allem, was ich wusste, der Enkel des großen Kaisers Answin, über den hier so viele Geschichten erzählt wurden. Er, so hieß es, hätte sicherlich nicht all dieses Elend über sein Heimatland Darpatien kommen lassen. Und manche sagten gar, es sei dem Hause Gareth ganz recht gewesen, dass dies Land hier verheert worden sei – war es doch die Wiege des sogenannten Thronräubers Answin und sollte hiermit lernen, keine weiteren Umstürzler mehr hervorzubringen. Aber ich wusste nicht, ob das stimmte. Die Kaiserin war freundlich und sehr anmutig gewesen, als sie Zweimühlen besucht hatte. Und Darpatien lag nun einmal an der Trollpforte, und direkt dahinter war ja schließlich das finstere Dämonenreich mit den Toten, die bei Tage herumwandeln und den fliegenden Festungen und all diesen Sachen. Mich schauderte bei dem Gedanken, dass die Reichsstraße, der ich gestern noch so arglos in die Gegenrichtung gefolgt war, direkt dort hineinführte, mitten in den Schlund der Dämonen und Untoten und dieser entsetzlichen Schrecknisse. Mir wurde wieder etwas bang ums Herz. Zu Hause, da hatte ich das natürlich auch alles gewusst, aber es erschien mir unmittelbarer, als ich so allein auf der Straße unterwegs war.
Als nächstes wird der Barde beigesetzt. Seine lustigen Lieder gefielen den Kriegsfürsten immer besser, doch zu seiner Beerdigung spielt Hildelind eines seiner traurigen Lieder über den Krieg und über die Menschen, die so viel verloren haben. Sie stockt irgendwann und kann nicht weitersingen, ihre Stimme ist voller Tränen. Da singt nur ihre Drehleier das Lied zu Ende, summend und quietschend und dröhnend und leicht misstönend, weil es ein altes und verstimmtes Instrument ist.
Auf dem Boronsanger sind viele, viele frische Hügel, und die Totengräber haben noch viel Arbeit vor sich. Ich stehe etwas abseits und schaue mich um. Ich will nicht hier stehen und traurig sein. Ich will zurück in die Stadt, in die Schmiede, ich wollte den Griff des Messers tordieren, aber nun ist er zu kurz geworden, und ich muss sehen, was ich daraus mache. Wie kriege ich das wieder ausgebügelt? Reto sieht zu mir rüber, wie ich von einem Fuß auf den anderen trete, und runzelt die Stirn. Fragt er sich, was ich grade denke? Es werden noch einige Leute beerdigt, und fast die ganze Stadt ist hier, um ihnen die letzte Ehre zu erweisen. Die Gardisten heben ihre Waffen, als Midgardia in ihr Grab gelegt wird, die große und schwere Frau wirkt in dem weißen Tuch fast kindlich. Ich seufze und wende mich ab, gehe unbemerkt vom Boronsanger zurück in die Stadt.
In der Schmiede angekommen, betrachte ich stirnrunzelnd den Messergriff. Ich könnte die Klinge verkürzen, die noch unfertig ist, ein flaches, unbearbeitetes Stück Eisen, und aus einem Teil davon noch ein Stück Griff heraushauen. Aber diesen mittleren Teil zu bearbeiten, wird schwierig. Ich könnte versuchen, die Torsion rückgängig zu machen; könnte den Griff wieder erhitzen und in die andere Richtung drehen. Aber dann verdreht es sich wahrscheinlich noch mehr. Irgendwann kommt auch Reto wieder rein. Er wirft einen Blick darauf und sagt: »Mach einfach ein Kindermesser draus. Ist genau richtig für Kinderhände. So, wie die Zeiten aussehen, kannst du die Klinge auch gleich richtig groß und scharf ausschmieden, dann können sie sich beim nächsten Überfall wehren.« Er macht zustechende Bewegungen mit dem rechten Arm, und ich verziehe unwillig den Mund.
Ich will etwas sagen, ich will sagen, dass sie nicht mehr alle über diesen Überfall reden sollen. Dass sie nicht um jeden Toten so viel Aufhebens machen sollen, ständig weinen sie alle überall, und dieses Gerenne zum Boronsanger nimmt kein Ende, und jeder hat etwas dazu zu sagen, statt endlich seine ingerimmverdammte Arbeit wieder aufzunehmen – die Dächer zu reparieren, die Palisade instandzusetzen und weiterzumachen. Aber ich sage es nicht. Nicht, weil ich glaube, dass es Reto verletzen würde, sondern, weil ich es einfach satt bin, weitere Worte zu verschwenden.
Ich habe natürlich kein Kindermesser daraus gemacht. Ich habe Stunden dafür gebraucht, den Griff wieder zu einem schönen, geraden Stück Eisen auszuarbeiten, es länger und dünner auszuschmieden und dann noch einmal ordentlich zu tordieren, sodass der Griff eine lange, gedrehte Schlaufe ergab, die gut in der Hand lag. Reto machte es sich eben immer zu einfach. Das ist der Grund, weswegen er ewig Hufschmied bleiben wird und in Nardo Gänsekiels Fußstapfen Pflugscharren und Nägel schmieden wird.
Ich hingegen wollte neue Geheimnisse entdecken, Waffen schmieden, die der Kaiserin selbst gefallen würden. Ich lächelte vor mich hin. Die Weidener Ritter würden Schwerter brauchen und Lanzen, vielleicht auch Streitkolben. Und die meisten Menschen wussten auch immer ein schönes Messer zu schätzen, keine Waffe, sondern einfach ein schönes Messer, um einen Apfel zu zerteilen oder ein Seil durchzuschneiden. Ich dachte an die Schlangenmusterung, die sich ergab, wenn man ein Messer aus zweierlei Stahl eine Weile in Essig legte. Das würde den Weidener Rittern gefallen, und sie würden mir eine Unterkunft und ein gutes Leben dafür gewähren. Und vielleicht würde ich danach ein Empfehlungsschreiben erhalten und könnte damit nach Gareth zu Meister Thorn Eisinger, dem Heldenschmied, gehen, dem größten Schmiedemeister der Menschen…
Langsam brach die Dämmerung herein, und als ich die ausgebrannten Ruinen eines Bauernhofs inmitten brachliegender Felder ausmachte, wurde mir klar, dass diese Nacht kein warmer Kuhstall, Suppe und Bier auf mich warteten. Ich seufzte und beschloss, mir mein Lager in den Ruinen einzurichten. Wenigstens vor Wind und Regen würde ich dort einigermaßen geschützt sein.
Aber vielleicht sind dort Menschen gestorben.
Es war, während ich mir die Ruinen so ansah, sogar sehr wahrscheinlich, dass dort Menschen gestorben waren. Die schwere Eichentür hing eingeknickt in den Angeln, alles, was vom Mobiliar nicht im Laufe der Zeit geplündert worden war, war zerstört, zerhauen und umgestoßen. Die Knochen eines Rindes lagen ineinander gefallen neben dem Brunnen im Innenhof, Gras wuchs durch die Augenhöhlen des blankgepickten Schädels. Ich erschauerte und suchte mir einen Platz im Heuschober, der zwar fast komplett niedergebrannt war, wo es aber am unwahrscheinlichsten war, dass dort noch die ruhelosen Geister der Toten wandelten.
Die Nacht wurde kurz und unruhig. Immer wieder glaubte ich, Geräusche zu hören, und schreckte auf. Hörte ich das Rind nicht mit den Knochen klappern und schaurig muhen? Kroch nicht etwas unten im Brunnen herum? Ich hatte Durst und mein Wasserschlauch war fast leer, doch ich traute mich nicht, Wasser aus dem schwarz gähnenden Brunnen hinaufzuziehen. Kratzten nicht dort unten Fingernägel an den Steinen?
Sie haben sie sicher dort hinuntergestoßen. Sie haben gelacht und die Kinder hineingeworfen und die Magd … Und sie sind nie wieder hinausgekommen, sondern unten jämmerlich verhungert.
Nein, hier konnte ich nicht weiterschlafen! Unglaublich müde, aber in noch größerem Maße verängstigt, packte ich mein Zeug zusammen und rannte fort, wieder zum Karrenpfad, dem ich in der mondsilbernen Dunkelheit nur stolpernd folgen konnte.
Schon gegen Mittag war ich so müde, dass ich mich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Glücklicherweise fand ich einen Bachlauf, der munter dahinplätscherte und den der Weg auf einigen modernden Bohlen überquerte. Ich setzte mich ans Ufer, trank und füllte den Wasserschlauch, aß ein paar Scheiben Brot mit einem harten Käse, der so intensiv schmeckte, dass sich mein Mund zusammenzog. Dann legte ich den Kopf gegen den Stamm einer Erle und hörte das Wasser murmeln und den Baum über mir rauschend antworten. Ich dämmerte in der Mittagssonne dahin und fiel schließlich in einen tiefen Schlummer.
Ich erwachte von einem seltsamen Gefühl. Es war kein Geräusch und auch keine Berührung, aber es war, als könnte ich spüren, dass sich etwas in meiner Nähe fast lautlos bewegte. Ich riss die Augen auf und rang nach Atem, als ich sah, dass jemand vor mir, genau zwischen meinen Oberschenkeln einen Speer in die Erde gerammt hatte. Ich schrie, robbte zurück gegen den Stamm und sprang dort auf die Füße.
Hinter dem Speer stand ein grinsender Mann, lehnte sich lässig auf den Schaft und musterte mich von Kopf bis Fuß. Ich riss meinen Hammer aus der Gürtelschlaufe und hob ihn drohend.
»Ich bin Schmied! Ich hau dir auf den Kopf, bevor du den Speer wieder raus hast!«, kreischte ich, aber das Zittern meiner Arme macht meine Drohgebärde zunichte.
Der Mann lachte. Er hatte wilde Bartstoppeln, manche kürzer, manche länger, fettige Haare bis zum Kinn und bäuerliche Tracht am Leib. Seine Augen blitzten heimtückisch, als er den Speer lässig hinauszog, ohne dass ich die Gelegenheit nutzte, ihm auf den Kopf zu hauen. Ich verfluchte meine Zimperlichkeit.
»Schmied!«, lachte er höhnisch. »’N kleines Mädchen bist du! Bevor du mit dem Hämmerchen heran bist, hab ich dich aufgespießt!«
»Was willst du von mir? Ich habe kein Geld«, stammelte ich eilig. »Ich bin auf der Walz und gehe mit Aves’ und Travias Geleit!«
»Da bist du in der falschen Gegend, wenn du dich auf Travia verlässt. Hättste nach Rommilys gehen müssen, hierzulande gibt’s Leute, die würden sogar Travia schänden, wenn sie die Gelegenheit dazu hätten«, höhnte er.
Ich rang nach Atem – solch eine lästerliche und unverhohlene Drohung musste ich erst einmal schlucken.
»Aber der alte Trim ist nicht so. Das bin ich«, erläuterte er, als er meinen verwirrten Blick sah. »Der alte Trim will nur, was Phex will. All dein Geld. Keiner geht ohne Heller aus dem Haus, meine ich, und wenn du doch so dumm warst, wirst du mir was anderes geben müssen. Ich nehme auch körperliche Gefälligkeiten.« Er zwinkerte, und ich hatte das Bedürfnis, mich zu übergeben. Auf ihn.
Mit zitternden Fingern griff ich in mein Hemd. Er riss die Augen auf, als rechnete er schon damit, dass ich seinen Vorschlag nun in die Tat umsetzen und mich entkleiden würde. Stattdessen zog ich den kleinen Beutel heraus, streifte ihn über den Kopf und warf ihn ihm zu. Es klimperte nur sehr bescheiden darin. Er hob ihn auf, öffnete ihn und schnüffelte am Inhalt.
»Kupfer!«, knurrte er. »Bin enttäuscht. Schlecht bezahlt werden Handwerker heutzutage.«
In diesem Moment ergriff etwas anderes von mir Besitz, als hätte es länger geschlafen als der Rest meines Körpers und wäre erst jetzt mit einem Ruck erwacht. Ich sprang vor, packte den Hammerstiel so fest, dass meine Muskeln aufbegehrten, und zog ihn Trim über den Kopf. Mit einem dumpfenKlocktraf ich seine Schläfe. Er torkelte und gab einen wütenden Laut von sich. Ich schlug noch einmal zu, bückte mich nach meinem Bündel, setzte über den Bach und war schon fünf Schritt weiter, als Trim, meinen Geldbeutel unter sich begrabend, auf dem Boden aufkam. Mit rasendem Herzen rannte ich weiter. Hatte er Leute bei sich, die aus dem Gebüsch ihre Speere oder Pfeile auf mich zielten? Hatte ich ihn getötet? Ich rang nach Luft, rannte, so schnell ich konnte, und schlug mich einfach blindlings zwischen den Bäumen hindurch in den Wald.
Wir stehen alle in einer Reihe. Die dicke Schneiderin und ihre blonde Tochter. Der rothaarige Alvin, der zu klein für sein Alter ist. Der Bäcker, noch mit Mehl in den Haaren, und der alte Finsel, der kaum noch grade stehen kann. Insgesamt drei Reihen stehen auf dem Marktplatz, wie krumme und schiefe Perlen auf einer Kette, keiner steht richtig grade. Nicht so wie die Gardisten, die Hauptmann Tronde auf Vordermann gebracht hat. Tronde tritt auf den Platz, flankiert von Eirene und dem fetten Ron, die beide bei ihm in hoher Gunst stehen, weil sie aufrechte Leute sind und nicht so faul wie die anderen. Die Stimme des Hauptmanns schallt über den ganzen Platz. Jeder soll sich eine Holzwaffe greifen. Es gibt drei Körbe: einen mit Kolben und Keulen, einen mit längeren und einen mit kurzen Stöcken. Ich greife mir einen hölzernen Kolben, weil er einem Hammer am ähnlichsten ist und wiege ihn in der Hand.
Wir bilden jetzt also die Bürgerwehr, schärft uns Tronde ein. Er ist ein kleiner, irgendwie altersloser Mann, mit silbergrauem militärisch gestutztem Haar, der seine Plattenrüstung wahrscheinlich auch im Schlaf trägt. Wir sollen uns paarweise aufteilen und Übungskämpfe beginnen. Ron, Eirene und er werden herumgehen und einschätzen, wie unsere Fähigkeiten an der Waffe so aussehen.
Für uns ist diese Übung beschämend, aber ich glaube, Tronde schämt sich noch mehr. Mit wütend gerunzelter Stirn und schmal gekniffenen Lippen baut er sich danach wieder vor uns auf.
»Bürger von Zweimühlen, das ist erbärmlich! Orkmist! Kor würde blutige Tränen weinen, wenn er dies sehen würde! Mutter Erlgundes Waisenkinder könnten euch ohne ein Kind Verlust überrennen. Ich verstehe nicht, wie ihr euch ständig von irgendwem in den verdammten Arsch treten lasst und nicht mal drüber nachdenkt, euch zu wehren! Das ändert sich jetzt. Ihr kriegt eure gottverdammten Bauernknochen hoch und lernt endlich, euch zu wehren, bei Kor und Rondra! Ihr seid freie Menschen, und wenn ihr das bleiben wollt, lernt ihr, euch eurer Haut zu erwehren! Und wenn ihr euch alle Glieder brecht, bis es so weit ist!« Er wollte uns eigentlich einmal in der Woche antreten lassen, aber jetzt müssen wir zwei Nachmittage dafür opfern. Wir hauen uns die Finger und Arme blau, wir schlagen uns Beulen in den Kopf. Hübsche Mädchen brechen sich die Fingernägel ab, dicke Frauen kreischen auf, wenn sie getroffen werden, alte Männer fallen nach hinten um und brauchen jemanden, der sie aufhebt. Aber irgendwann wird es besser. Irgendwann treffen wir einander seltener. Irgendwann werden die Bewegungen vertrauter, wir entlocken dem Hauptmann auch einmal ein knappes, aufmunterndes Nicken und dem fetten Ron ein Schulterklopfen.
Wir veranstalten Wettkämpfe im Bogenschießen und Fechten, im Speerwerfen, im Ringen. Es macht nicht allen Spaß, aber wer nicht kommt, kriegt zu Hause Besuch von der Garde. Ich gehe hin, obwohl ich weiß, dass ich nie ein Kämpfer werde. Ich bin zu zaghaft, ich entschuldige mich, wenn ich gewinne, und bin immer froh, wenn ich wieder in der Schmiede stehe, aber ich merke, dass wir nun nicht mehr so wehrlos sind. Dass nicht mehr jeder sein Spiel mit uns treiben kann.
Als es Abend wurde, stolperte ich immer noch durch Farnkraut und Brombeerbüsche, unter Kiefern und kühlen, rotbelaubten Buchen hindurch. Ich schnaufte und keuchte und traute mich immer noch nicht, anzuhalten. Irgendwann fielen die Schatten unter den Bäumen herab wie ein Vorhang und tauchten die Welt um mich in Dämmerlicht. Mit einem Mal erkaltete der Schweiß auf meiner Haut und ließ mich frieren. Ich hielt an und schlang die Arme um mich. Dabei merkte ich erst, dass ich den Hammer immer noch in der schweißnassen Hand hielt. Ich vermochte meine Finger kaum zu öffnen, so sehr hatten sich meine Muskeln und Sehnen verkrampft. Mein Unterarm schmerzte.
Als ich den Hammer wieder in seine Schlaufe am Gürtel steckte, sah ich mich um. Wald.
Ich war wie besinnungslos in den Wald gelaufen. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war, wo die Straße lag. Ich wusste nicht einmal, in welche Richtung ich gelaufen war. Mein Herz hörte auf mit seinem hastigen Getrappel und begann stattdessen einen schweren, langsamen Takt. In diesem Moment erklang über mir ein Trommelwirbel auf dem herbstlich gelichteten Blätterdach der Bäume. Es begann zu regnen. Das goldene Herbstwetter war vergangen, dicke Wolken hatten die Praiosscheibe verdunkelt und ihre Schleusen geöffnet. Ich suchte nach einem Unterstand, aber mehr als eine auch im späten Travia noch dicht belaubte Buche ließ sich nicht finden. Ich setzte mich auf eine armdicke Wurzel und wartete darauf, dass der Regen all das Blattwerk durchdringen und mich aufspüren würde – was unweigerlich geschah. Ich hüllte mich in Mantel und Decke und zog mir die Kapuze tief in die Stirn. Tropf, tropf, tropf. Langsam wanderte das Wasser an der Kapuze herab, sammelte sich auf dem dicken Wollstoff zu einem Rinnsal und bildete, nur fingerbreit vor meiner Nase, einen kleinen Wasserfall. Ich seufzte. Wenigstens konnte ich recht sicher sein, dass Trim, wenn er noch am Leben war, nicht weiter meiner Spur folgen würde. Ich musterte meinen Hammer. Ich hatte mit der stumpfen Seite zugeschlagen, was nicht unbedingt ein Garant für sein Überleben bedeutete. Es war kein Blut daran. Andererseits, wäre es so schade, wenn er nun mit eingeschlagenem Schädel dort am Bach liegen und krepieren würde? Einer weniger, der die Straßen unsicher macht. Ich zog die Nase hoch und merkte, dass ich mich immer noch wacklig und unsicher fühlte.
Tot oder nicht, er besaß nun so oder so meinen Geldbeutel. Jetzt war ich völlig auf die Gunst Travias angewiesen und darauf, dass die Menschen noch ihre Gebote achteten … Es schien mir, im Regen, in der Dämmerung, nass und verfroren, unwahrscheinlich, dass ich noch irgendwo freundliche Aufnahme finden würde. Vermutlich würde ich bei Einbruch des Winters erfrieren oder vorher verhungern. Ich zog die Decke so weit hoch, dass sie die Kapuze berührte und den Wasserfall durch ihre Falten zur Erde leitete und versuchte, im Sitzen zu schlafen. Es fiel mir nicht so leicht wie noch am Nachmittag, als ich am Bach eingenickt war, doch irgendwann schläferte mich das Tröpfeln, das auch noch stetig weiterging, als der Regen schon geendet hatte, ein.
Saria sieht mich im Traum an. Sie ist glücklich, das weiß ich. Es ist nicht schwierig, glücklich zu sein, sollte man denken, wenn man sie kennt. Manchmal glaube ich, wenn ich merke, dass ich einfach nicht glücklich sein kann, dass mir vielleicht die Götter nicht die Fähigkeit dazu gegeben haben. Ich bin auch nicht unglücklich, es ist nicht so, dass ich morgens aufwache und traurig bin oder verzweifelt. Aber ich wache auf und fühle mich … gleichgültig irgendwie. Vielleicht bin ich schon so zur Welt gekommen und kann einfach nicht anders. Ein bisschen fühle ich mich, wenn ich Saria sehe, um etwas betrogen, was ich nie hatte.
Saria jedenfalls ist sehr glücklich und sehr schwanger. Sie trägt ein weißes Hochzeitskleid, ja, ein richtiges, weißes, langes Kleid, und einen Ährenkranz im Haar, und sie ist so schön, wie ich noch nie jemanden gesehen habe. Das Kleid muss ein Vermögen gekostet haben, aber sie winkt ab und sagt, dass es ein altes ist und sie es geschenkt bekommen hat und nur umnähen musste, damit ihr dicker Bauch hineinpasst. Sie hat halt Glück.
Plötzlich spielt Hildelind wieder zum Tanz auf, ihre Drehleier eiert und dudelt, aber alle stampfen und klatschen und springen herum wie Kinder, und Saria packt plötzlich meine Hände und zieht mich zwischen all die Tanzenden. Ich tanze mit und lächle, weil ich weiß, dass sie sich dann freut. Und sie freut sich wirklich, sie tanzt wie eine Wilde, obwohl ihr Bauch bedrohlich wackelt. Dann kommt Nardo, der, obwohl er ein wenig dick und plump ist, sehr stattlich aussieht, mit einer dunklen Tunika und einem Hut auf dem Kopf mit einer langen, festlichen Fasanenfeder daran. Er schwenkt mich herum, und seine Wangen sind ganz rot.
»Jetzt hab ich meine eigene Gesellin geheiratet!«, lacht er zwischen zwei Hopsern. »Fehlt nur noch, dass der Reto dich den ganzen heiratswilligen Gardisten wegschnappt.«
Ich winke ab. Weder Reto noch irgendein heiratswilliger Gardist wird mich kriegen. Zum Heiraten muss man glücklich sein. Und ich weiß zum Glück nicht, wie das geht.
Ich irrte nun schon tagelang durch die Wildnis und fühlte mich langsam wie ein hungriges, mageres Tier. Vor zwei Tagen war ich irgendwann aus dem Unterholz herausgestolpert, der Wald hatte sich aufgetan und einige blanke, windgepeitschte Hügel offenbart. Ich erklomm einen davon, um einen Überblick über das Land zu erhalten, vielleicht Felder zu finden, einen Bauernhof – wenn ich viel Glück hatte, sogar einen Weiler. Aber nichts dergleichen. Auf einem weiteren Hügel ragten zwischen dem hüfthohen gelben Gras weiße Steine auf, blank und ohne Moos, in einem Kreis wie ein offenes Maul voller scharfer Zähne. In der Mitte war ein steinerner Quader, wie ein Altar. Ich fürchtete mich vor dem Steinkreis und rannte wieder hinunter in den Wald. Es regnete nun häufiger, und ich begann, abends ein Feuer zu entzünden, aber es war mühselige Arbeit mit Feuerstein und Stahl, denn das meiste, was ich fand, war bereits feucht, und kleine, herbstduftende Pilze breiteten sich auf dem Totholz aus.
Also grub ich mir abends Mulden ins weiche Laub und deckte mich mit Blättern und Tannenreisig zu, weil ich keine Wärme und keinen Schlaf finden konnte. Brot und Käse waren zur Neige gegangen, und ich lebte nun von späten Brombeeren, einigen leicht matschigen Holzäpfeln und den wenigen Pilzen, die ich sicher als essbar erkennen konnte. Auf kurz oder lang würde ich jagen gehen müssen. Ich hatte eine kleine Pfanne dabei, um etwas zuzubereiten, aber ich hatte niemals zuvor ein Tier jagen müssen und war mir sicher, dass mich der ganze Wald hoffnungslos auslachen würde, wenn ich es versuchte. Mein Magen knurrte missmutig, aber ich bemühte mich, an etwas anderes zu denken.
Das Moos auf den Bäumen – ich wusste, dass es immer in einer bestimmten Himmelsrichtung wuchs, konnte mich aber nicht erinnern, in welcher. Ich hoffte, dass ich, wenn ich zumindest immer so ging, dass das Moos zu meiner rechten Seite lag, nicht im Kreis lief und irgendwann wieder aus dem Wald herausfinden würde. Manche Bäume waren aber auch über und über mit Moos bedeckt, andere gar nicht, sodass ich manchmal schier verzweifelte. Auch Praios verdeckte sein richtungsweisendes Antlitz mit immer neuen Wolken, und ich ging einfach immer weiter, Moos zu meiner Rechten.
Am fünften Tag stieß ich auf einen Bachlauf. Mein erster Impuls war, den Bach zu queren und in die Richtung weiterzulaufen, die ich eingeschlagen hatte, doch dann verharrte ich nachdenklich. Ich konnte dem Bach folgen, vielleicht würde er auf einen größeren Fluss treffen, an dem sogar eine Siedlung läge. So oder so konnte ein Bach niemals im Kreis herumführen, das war sicher. Irgendwohin würde er fließen. Ich tastete an meinem Gürtel herum. Hatte ich noch irgendetwas, das ich entbehren konnte, um Aves’ Segen zu erbitten? Retos Zange? Ich schüttelte den Kopf und nahm letztlich ein winziges Messer, eine kleine, dreieckige Klinge mit lederumwickeltem Griff, das zwischen den Lagen des Gürtels versteckt war. Man konnte ja nie wissen.
Ich hielt es in der Hand und betrachtete es. Immerhin war es hübsch. Ich ließ es in den Bach fallen, es glänzte unten zwischen den Kieseln und den Flechten der Algen. »Aves, hilf mir auf meinem Weg! Wenn ich nicht bald irgendwo ankomme, sterbe ich beim ersten Schnee oder verhungere.« Meine Stimme, tagelang nicht benutzt, war heiser in meinen Ohren. Ich fühlte jetzt auch ein Kratzen im Hals, Vorbote einer Erkältung.
Es war still unter den Bäumen. Irgendwo hörte ich das heisereKrahkraheiner Krähe, dann das Zwitschern einer Amsel. Dann wieder Stille. Blätterrauschen und das Plätschern des Bachs. War mein Opfer angenommen? Ich seufzte und folgte nun dem Bachlauf, auf dem schmalen Pfad eines Wildwechsels.
Gegen Abend, ich hatte den Wildwechsel verlassen müssen, um am Bach zu bleiben, und kam nur mehr langsam voran, hörte ich Stimmen. Mein Herz schlug schneller vor Freude und Erleichterung, doch verhielt ich meine Schritte, als Trim mit seinen fettigen Haaren und seinem gierigen Blick vor meinem geistigen Auge auftauchte. Ich vermochte mich im Wald nicht sehr leise fortzubewegen, versuchte es nun aber, so gut es eben ging. Eine Elster keckerte, als würde sie meine Bemühungen wahnsinnig witzig finden, und flog davon. Frustriert sah ich ihr nach und ballte die Fäuste.
Einige hundert Schritt weiter, konnte ich aus dem Unterholz heraus eine Gruppe Menschen erkennen. Sie hatten am Bach ein Lager aufgeschlagen, eine Zeltplane als Regendach aufgespannt und ein Feuer entzündet. Ich schob mich auf den Knien noch etwas näher heran und sah, dass es größtenteils Männer waren und einige merkwürdige Gestalten, gedrungen und dunkel, die ich auf die Entfernung nicht zuordnen konnte. Mein Herz schlug hart und langsam. Waren das nun wieder Männer, die Travia am liebsten schänden würden, oder wie hatte Trim das ausgedrückt? Würde ich noch als Mann durchgehen, wenn ich die Kapuze auf dem Kopf behielte? Mit meinen Halsschmerzen wäre meine Stimme vielleicht auch tief und rau … Ich würde sie nur nach dem Weg fragen und dann rasch sehen, dass ich fortkam. Aber warum lagerten sie hier draußen? War es eine Räuberbande? Gesetzlose, die in den Wäldern hausten? Ich musste noch näher kriechen, um herauszubekommen, ob sie Waffen dabei hatten, und wenn ja, welcher Art sie waren. Handbreit um Handbreit schob ich mich vorwärts. Das Farnkraut ging langsam in Dorngesträuch über, Heckenrosen und Brombeeren, und ich biss die Zähne zusammen, als sie mir Hände und Gesicht zerschrammten.
Ich hörte die Elster wieder lachen und runzelte die Stirn. Verdammter Vogel, würde mich nun auch noch verraten … Es dauerte jedoch nur ein Dutzend Herzschläge, bis ich begriff, dass ihr Keckern diesmal nicht mir gegolten hatte, sondern mich hätte warnen können. Eine Hand legte sich hart auf meine Schulter und ließ mich zusammenfahren. Ich schreckte, immer noch auf den Knien, herum und sah auf Augenhöhe in das bärtige Gesicht eines Mannes, der sich ebenfalls auf den Knien befand und eindringlich einen Finger an die Lippen presste.
»Schhhht!«, zischte mir mein Gegenüber zu. Ich zog den Kopf ein, mein Herz flatterte wie ein Vogel im Käfig meiner Brust. Ich kam mir dumm vor, wusste aber nicht, warum, und über mir keckerte die Elster hämisch vor sich hin. Der Mann bedeutete mir, ihm zu folgen, und kroch langsam auf allen vieren durch die Schneise, die ich ins Unterholz gegraben hatte, zurück. Ich warf noch einen Blick auf das Lager am Flussufer, hörte eine leicht über die anderen erhobene Stimme, konnte aber keine Worte verstehen. Auf meiner Unterlippe kauend beschloss ich schließlich, dem Mann zu folgen. Einer war harmloser als ein Dutzend. Nach einigen Metern richtete er sich auf und schlich gebückt weiter, verließ schließlich das Bachufer und begab sich in einen dunklen Tannenwald, in dem die Zweige beinahe den Boden berührten. Am harzigen Stamm einer großen Tanne hielt er an.
»Da hast du noch mal Glück gehabt, Bursche«, sagte er leise, und ich gratulierte mir innerlich zu meiner Entscheidung, die Kapuze so tief ins Gesicht zu ziehen.
Ich brummte etwas Fragendes und musterte ihn. Er war kein großer Mann, breit gebaut und mit wuchernden schwarzen Haaren auf dem Kopf und im Gesicht, buschigen Augenbrauen, und darunter, wie zwei dunkle Kohlen, blitzten seine Augen. Als er mit einer Hand in die Richtung des Lagers deutete, sah ich, dass auch sein Handrücken dicht behaart war.
»Das da«, sagte er mit einer Stimme, aus der ich heraushören konnte, dass er nicht so alt war, wie sein dichter Bart ihn erscheinen ließ, »ist eine Räuberbande. Wenn ich mich nicht irre, gehören sie zu Sharkush.« Erwartungsvoll sah er mich an. Ich zuckte mit den Schultern und versuchte erneut, fragend zu brummen.
»Bist du stumm oder dämlich?«, knurrte er. »Sharkush – der Orkhäuptling! Du musst doch von ihm gehört haben!«
»Klar«, murmelte ich in den Tiefen meiner Kapuze, obwohl ich den Namen nie gehört hatte. Orks. Ich hatte gehört, dass sich Orks in der Wildermark herumtreiben sollten, aber ebenso wie Goblins, Harpyien und Trollzacker gehörten sie für mich eher ins Reich der Gerüchte und Ammenmärchen. Die Bande am Bachufer hatte größtenteils aus Menschen bestanden, allerdings erinnerte ich mich noch deutlich der dunklen, muskelbepackten Gestalten, die ich nicht hatte einordnen können.
Während ich noch grübelte, streckte mein bärtiger Begleiter rasch seinen Arm vor und stieß mir die Kapuze vom Kopf. Mit einem wütenden Schnauben griff ich wieder danach, aber es war schon zu spät. Strähnen meines kinnlangen rotblonden Haares hatten sich hervorgestohlen, und sicherlich hatte er auch einen Blick auf meine Gesichtszüge werfen können. Er grinste breit, und dabei entdeckte ich, was er zu verbergen suchte – große, gelbliche Zähne – die unteren Eckzähne waren wie die Fangzähne bei einem Tier hervorgewachsen und gaben seinem Gesicht einen bestialischen Ausdruck.
Ich unterdrückte einen Schrei. Das hier musste auch ein Ork sein!
»Bist ein Mädchen, was?«, grinste mein Gegenüber.
»Und du bist ein Ork!«, schrie ich und drehte mich auf dem Absatz um, um davonzustürzen.
Er packte mich an der Schulter, wie vorhin im Gebüsch, und zerrte mich zurück. »Dumme Göre! Sie werden dich hören – sie haben dich wahrscheinlich schon gehört! Wir sollten jetzt von hier verschwinden, sonst kommen sie hinter uns her!«
Er ließ mich los und bückte sich unter den ausladenden Ästen der Tanne hindurch. Schnellen Schrittes entfernte er sich, seine Tritte waren kaum zu hören auf dem weichen Nadelteppich.
Unschlüssig verharrte ich. Waren da nicht Geräusche? Rufe, Fußtritte? Und konnte ich nicht beinahe schon fühlen, wie die Läuse durch mein Haar krochen, in dem sich Blätter und Nadeln verfilzt hatten? Wo immer dieser Ork hinging, vielleicht war es dort besser, als im Wald zu verhungern. Ich lief ihm nach, kämpfte gegen das Tannengehölz und brach schließlich fast neben ihm aus dem Wäldchen heraus auf einen ausgetretenen Pfad, breit genug für zwei Menschen nebeneinander.
Hier war ein Pfad. Ich hätte es wirklich verdient, im Wald zu verhungern, ausgelacht von einer Elster, die wahrscheinlich genau gewusst hatte, dass keine zwanzig Schritt weiter ein Weg zwischen den verdammten Bäumen hindurchführte.
»Warte! Wohin gehst du, wenn du nicht zu diesem Orkhäuptling gehörst? Wohin führt dieser Weg?«
Er sah mich verächtlich an. »Ihr seid alle gleich. Kaum merkt ihr, dass ich nicht einfach ein hässlicher Mann bin, da verdächtigt ihr mich auch schon, mit Sharkush im Bunde zu sein oder gleich mit dem Aikar im Orkland! Glaube ich, nur weil du ein Mensch bist, dass du Galotta dienst, der ja wohl auch ein Mensch war?«
Ich zog den Kopf zwischen die Schultern. »Ich habe noch nie einen Orken gesehen«, grummelte ich. »Was erwartest du, dass ich mich freue?«
»Ich bin ein Halbork«, verbesserte er mich grimmig, während er dem Weg schon beinahe im Laufschritt folgte. Es dämmerte bereits, ich hatte in der Wildnis deutlich gemerkt, dass die Tage immer kürzer geworden waren. »Mein Vater war ein Ork, meine Mutter eine Menschenfrau. Sie gab mir den schönen Namen Alrik.«
Ich kicherte, irgendwie erleichtert. Ein Halbork, der Alrik hieß.
»Ich wusste nicht, dass sich Orks in Menschenfrauen verlieben.«Obwohl, schoss es mir durch den Kopf,man es nicht verübeln kann, wenn die Frauen dort so scheußlich aussehen wie die Männer.
»Oh, ich glaube nicht, dass Travia oder Rahja bei so einer Verbindung mit im Spiel sind. Meine Mutter hatte jedenfalls nie liebenswürdige Dinge über meinen Vater zu sagen. Aber Blut ist halt Blut, was, und es fließt recht deutlich in meinen Adern.« Er blickte mich prüfend von der Seite an.
Ich keuchte ganz schön, denn ich war den ganzen Tag gelaufen und hatte wenig gefrühstückt.
»Du bist Handwerker, Menschenfrau«, stellte er mit einem Blick auf meinen Gürtel fest. »Dieser Weg führt zu dem Dorf, in dem ich wohne. Einem Menschendorf«, betonte er.
Wir liefen eine Weile nebeneinander. Es war still um uns, roch streng nach versteckten Wildschweinen und Pilzen, und der Weg wurde so schlammig, dass meine Schuhe beinahe stecken blieben.
»Ich verüble dir dein Misstrauen nicht. Du wirst aber noch froh sein, dass ich dich gefunden habe.«
Alrik und Eirik
Travia war wieder mit mir. Aves hatte das geopferte Messer angenommen und mir den richtigen Weg gewiesen. Nun gut, er hätte mir auch einfach den Pfad zeigen können, aber dann hätte ich vielleicht den haarigen Alrik nicht getroffen.
Er hatte mich zu einem kleinen Weiler gebracht, einem von einer niedrigen und leicht baufälligen Holzpalisade gesäumten Flecken im Wald namens Langbruch. Der Peraineschrein auf dem Dorfplatz sollte den wenigen Feldern, die man dem Wald hatte abringen können, Segen schenken. Ansonsten lebte man von der Köhlerei und vom Torfstechen im nahen Moor. Außerdem gab es nahe der Stelle, wo mein Bach, über steile Felsen fallend, in einen kleinen Fluss mündete, eine Mühle – und eine Schmiede. Ich hatte sofort den Rauch gesehen, der aus dem Windloch abzog, und innerlich vor Neugierde geglüht wie ein Werkstück in der Esse.
Eirik hieß der Schmied, und die Gesetze von Ingerimm und Travia galten ihm noch etwas – und so war ich nun bei ihm untergekommen, als seine Gesellin. Mittlerweile hatte ich mich im eisigen Fluss gewaschen, mir die Haare ausgekämmt, mir ein heißes Bier gegen die Erkältung einverleibt und saß gemütlich in seiner Stube. Er war ein hagerer Mann mit grauen Strähnen im Haar und lebte allein. Seine Frau, so sagte er, war nun fast ein Jahr tot, und seine Kinder schon alle fortgegangen. Seine Stube war ein einziger Saustall, und als er mich aufforderte, als Beginn meiner Gesellentätigkeit seine Stube zu fegen, fügte ich mich seufzend in mein Schicksal. Er wusste noch nicht, welche Fähigkeiten ich aus Zweimühlen mitgebracht hatte, sonst würde er mich nicht fegen lassen. Ich konnte ihm sicher noch einiges beibringen.
Du bist eine überhebliche Närrin. Nicht du bist hier der Meister, sondern er.Ich presste die Lippen zusammen und machte mich an die Arbeit.Travia und Ingerimm sei Dank, dass sie mich Demut lehren, dachte ich grimmig, während ich fegte und schrubbte.
»Was hast du eigentlich gelernt bei deinem Meister? War er auch so ein Taugenichts?«, fuhr mich Eirik an, und ich starrte auf seine Fußspitzen.
Zorn wallte in mir auf, ich versuchte nun schon seit Stunden, ihn niederzukämpfen, doch ich wusste, dass er sich früher oder später seinen Weg bahnen würde. Eher früher. Ich holte tief Luft, doch ich hatte den Kampf schon verloren. »Ich kann so nicht arbeiten!«, schnauzte ich zurück. »Was soll das für ein Stahl sein, hast du ihn selbst ausgebuddelt? Der taugt einfach nichts!«
»Dutaugst einfach nichts! Was denkst du, dass ich hier das Geld habe, um für mein Prinzesschen von einem Gesellen den besten Zwergenstahl zu beschaffen?«
Ich pfefferte meine Zange auf den Boden und ärgerte mich sogleich über mich selbst. Die Zange war aus gutem, bruchfestem Stahl hergestellt, nicht dieses Zeug, das im Feuer sofort wegbrannte oder beim Schleifen abbrach.
»Es ist falsch verhüttet, oder es ist irgendein Zeug drin, das nicht reingehört! Wer macht das, die Köhler draußen im Wald? Daraus kannst du noch Kessel gießen oder Pfannen, aber es ist zu spröde für alles andere!«, Ich warf einen frustrierten Blick auf die Gussform eines Kessels auf einem Regal an der linken Wand. Ich wollte schmieden, keine Haushaltsgegenstände gießen!
Der Halbork Alrik hörte auf, die Blasebälger zu bedienen, an denen er keuchend gearbeitet hatte, um die Glut heiß zu halten. Er lehnte sich neben die große, gemauerte Esse an die Wand und runzelte die Stirn, auf der der Schweiß perlte.
Eirik seufzte auf und warf mit seiner Zange mein halbverbranntes Werkstück in den Wassereimer, wo es zischend erkaltete. Ob es dabei Risse bekam oder nicht, war nun auch egal, es war ohnehin ruiniert.
Dann sprach er ruhiger, als hätte das Wasser auch sein Gemüt abgekühlt. »Du wirst nicht überall das beste Material zur Verfügung haben. Das ist wohl deine erste Lektion: Du darfst nicht wählerisch sein. Versuch, das Beste draus zu machen!« Er trat an eine Werkbank und stützte sich mit den Händen darauf. »Ich weiß, es ist fast schon Gusseisen. Schlecht, um was anderes als Pfannen draus zu machen. Man muss es sehr heiß machen, um es überhaupt schmieden zu können, und dann brennt es einem weg, wenn man Pech hat. Oder nicht aufpasst, so wie du!« Er griff in einen Korb, der auf dem Tisch stand und holte einen schwarzen Klumpen hervor. »Sie finden das Erz unterm Gras, nördlich vom Moor. Wenn sie es verhüttet haben, holen sie diese Dinger heraus.« Er warf mir den Klumpen lässig zu, und ich fing ihn weniger lässig auf.
»Luppe«, sagte ich und wog den schwarzen, harten, porös-schwammigen Klumpen in den Händen.
»Jawohl. So viel weißt du also doch. Damit du dich ein bisschen mit dem Eisen vertraut machen kannst, stell mir jetzt erst mal einen schönen Barren daraus her.«
Alrik stöhnte auf. Die Luppe musste noch mehrmals bis zur Weißglut erhitzt werden, damit Schlacke und Zunder herausgepresst wurden und nur noch das Eisen übrig blieb. Für ihn hieß das, dass sein Tag daraus bestehen würde, für mich den Blasebalg zu betätigen.
»Melde dich bei mir, wenn du fertig bist. Ich bin bei Rosswin einen trinken. Ach ja, falls es nicht genug Material ergibt: Bedien dich, der Korb ist voll mit Eisenschwamm.«