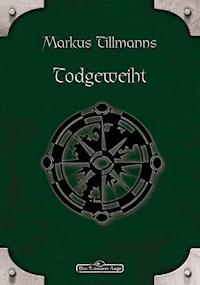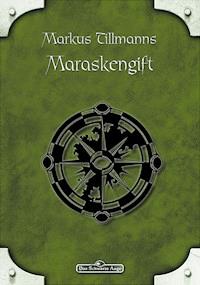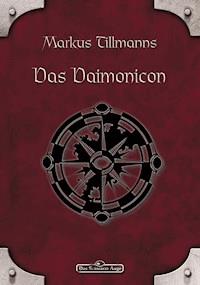
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ulisses Medien und Spiel Distribution GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Schwarze Auge
- Sprache: Deutsch
In dem abgeschiedenen Dorf Schindmeringen geschieht ein grausamer Doppelmord. Der junge Magier Fenndrick, der in dem kleinen Ort sein Erbe angetreten hat, wird in die Aufklärung der Bluttat hineingezogen. Handelt es sich gar um das Vermächtnis seines Onkels, des Schwarzmagiers Mocurion? Und welches düstere Geheimnis wird von den Dorfbewohnern gehütet?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Tillmanns
Das Daimonicon
Ein Roman in der Welt von Das Schwarze Auge©
Originalausgabe
Impressum
Ulisses SpieleBand 69
Kartenentwurf: Ralf Hlawatsch E-Book-Gestaltung: Nadine Hoffmann
Copyright © 2014 by Ulisses Spiele GmbH, Waldems.DAS SCHWARZE AUGE, AVENTURIEN, DERE,MYRANOR, RIESLAND, THARUN und UTHURIA sind eingetragene Marken der Significant GbR.
Titel und Inhalte dieses Werkes sind urheberrechtlich geschützt.
Der Nachdruck, auch auszugsweise, die Bearbeitung, Verarbeitung, Verbreitung und Vervielfältigung des Werkes in jedweder Form, insbesondere die Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder ähnlichem Weg, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Ulisses Spiele GmbH, Waldems, gestattet.
Print-ISBN 3-453-86163-9
Alrik gewidmet,
Prolog
Schwüle Hitze hielt das kleine Arbeitszimmer Romero Jacobellas in unbarmherzigem Griff. Der Wind war zum Erliegen gekommen und die Luft dumpf vor Feuchtigkeit. Der schwarzhaarige Mann, auf dessen Haupt sich die ersten grauen Strähnen zeigten, strich sich nachdenklich über den gepflegten Schnurrbart. Bereits zum dritten Mal überflog er das Pergament mit den kaum lesbaren Notizen, welches Jesidero ihm hinterlegt hatte. Eine wahrlich obskure Angelegenheit, welche zu regeln ihm der Rat da aufgetragen hatte!
Draußen auf der Plaza herrschte geschäftiges Treiben; der vielstimmige Lärm einer südländischen Hafenstadt drang durchs offene Fenster herein. Doch Romero nahm die allgegenwärtige Geräuschkulisse ebenso wenig wahr wie den immer gleichen Duft nach frischem Maisbrot. Seine Schreibstube, die er sich mit Jesidero teilte, war verwinkelt und eng und wurde durch das kleine Fenster nur spärlich erhellt. Auch hatte sich mit den Jahren hier ein muffiger Geruch nach alten Akten und speckigen Ledereinbänden festgesetzt, den keine Macht der Welt mehr hinausbekommen konnte.
Romeros Tisch bog sich unter den Bergen von Pergamenten; halb unter ihnen begraben lagen nun Jesideros Notizen. Es hatte einen Todesfall gegeben. Todesursache ungeklärt. Das war nichts Ungewöhnliches in Chorhop. Todesfälle, die klar waren, mochten bei dreiundneunzigjährigen Mütterchen auftreten. In allen anderen Fällen fragte man besser nicht nach. Romero übte seine Arbeit für den Rat der Stadt nun schon seit vielen Jahren aus, und das stets zur Zufriedenheit der Zeforikas, welche in Chorhop Macht und Einfluss besaßen. Diese Zufriedenheit stützte sich zu einem guten Teil auf den Umstand, dass er niemals Fragen stellte. Neugierige Leute fanden sich in großer Zahl in den Galeeren des Stadtstaates wieder ... oder wachten eines Morgens einfach nicht mehr auf. In einem solchen Fall musste eine Urkunde angefertigt werden. Und das war Romeros Aufgabe.
Romero nahm ein leeres Blatt Pergament. Er tupfte die Schreibfeder in das Tintenfässchen und notierte Todestag und -stunde des Verstorbenen. In die Zeilen darunter übertrug er einige persönliche Daten, soweit Jesideros verschmierte Angaben überhaupt zu entziffern waren. Wenn er ein Wort nicht lesen konnte, trug er nach Gutdünken ein anderes ein.
Unter »Todesursache« schrieb er »Vergiftung durch Verzehr verdorbener Speisen«. Das war immer gut. Der Tote war Magier gewesen. Die großen Magiergilden stellten zuweilen unangenehme Fragen, wenn einer der ihren starb. »Vergiftung durch Verzehr verdorbener Speisen« klang da einfach besser als »Todesursache: unbekannt«. Romero kicherte in sich hinein. Schließlich stand dort ja nicht geschrieben, wer die Speisen verdorben hatte. Und das ging den Schreiber auch gar nichts an. So viel hatte Romero gelernt: Niemandem zur Last fallen. Keine Fragen stellen. Nicht auffallen. Das war die beste Garantie für ein langes Leben.
Wenn man in den weiß getünchten Palazzi vorstellig wurde, dann immer nur als ein überaus treuer Lakai. Vielleicht würde ja dann eines Tages doch ein wenig von dem Glanz der Palazzi auf den kleinen Schreiber abstrahlen ...
Der Tote komme vermutlich aus dem Mittelreich, hatte sein Kollege geschrieben. Das hieß, Romero würde die Urkunde nach Havena schicken. Sollten sie dort sehen, ob es irgendeinen Anverwandten gab, der sich dafür interessierte. Er rollte das Pergament zusammen und siegelte es. Fertig. Romero Jacobella war mit sich zufrieden. So ging die Urkunde auf Reisen und wurde zum Auslöser jener denkwürdigen Ereignisse, von denen die folgende Geschichte erzählen soll.
Ein Kutscher in Schwarz
Polter Plötzbogen hatte in seinem immerhin 55 Sommer währenden Leben schon einiges zu sehen bekommen. Die blassblauen Augen, die tief in den von Furchen umsäumten Höhlen lagen, hatten keineswegs nur die Äcker rund um Schindmeringen erblickt oder die sanft geschwungenen Hügel mit dem gräulichen Turm auf einer der Kuppen, die Weizen- und Rübenfelder, den Röbbewald, der das Land wie ein grünes Tuch bedeckte, und die ausgetretenen Lehmpfade, die alles miteinander verbanden: die Äcker mit dem Dorf, das Dorf mit dem Turm, den Turm mit dem Wald ... Oder den Wald mit dem Turm, den Turm mit dem Dorf, das Dorf mit den Äckern? Wer mochte das schon wissen?
Polter Plötzbogen wusste es nicht, genauso wenig wie er wusste, was das eigentümliche Schauspiel zu bedeuten hatte, das er seit geraumer Zeit von der Bank vor seinem Haus aus beobachtete.
Er rümpfte die Nase. Ja, in all den Jahren, die ins Land gezogen waren, hatte er sich so manches Mal auf den beschwerlichen Weg bis Gondheim gemacht, hatte auch Welbershofen und Schlonz besucht und einmal gar das stattliche Honingen von fern gesehen. Nein, einen so weit gereisten Mann wie Polter Plötzbogen sollte man gewiss nicht mit einem der Bauerntölpel verwechseln, die sonst in Schindmeringen wohnten und nichts weiter taten, als tagein, tagaus ihre Äcker zu bestellen, die den König einen netten Mann sein ließen (denn dass er ein solcher war, daran bestand für die Schindmeringer kein Zweifel), kaum einmal auch nur die Nachbarorte besuchten und ansonsten ihr Dorf für den Nabel der Welt hielten. Polter bezweifelte stark, dass Schindmeringen tatsächlich in Sumus Nabel lag, denn ein solcher würde gewiss schon beim ersten herbstlichen Regenguss voller Wasser laufen und hätte somit das Dorf samt Vieh und Bauern jämmerlich ersaufen lassen. Nein, der Nabel der Welt, da war sich Polter sicher, musste ein stiller, fast kreisrunder See sein. Schindmeringen hatte nichts von alledem. Es mangelte am See oder auch nur einem kleinen Weiher; die Hügelkuppen firunwärts des Dorfes waren alles andere als kreisrund angeordnet, und die Bauern und ihr Vieh waren mit allen möglichen Dingen beschäftigt und schienen nicht im Traum daran zu denken, hier zu ertrinken. Und selbst wenn einer der ihren dies eines Tages beabsichtigen sollte, so müsste er schon den Kopf in den Badezuber stecken, denn wie bereits erwähnt, nannte Schindmeringen nicht mal einen kleinen Weiher sein Eigen.
Und eben dieser Polter Plötzbogen, dem man so leicht nichts vormachen konnte, kratzte sich nun nachdenklich am Kopf. Seine kurzen, kräftigen Finger zerteilten das graubraune Haar mit einem deutlich hörbaren schabenden Geräusch, während sein Blick starr auf das Geschehen auf dem Dorfplatz gerichtet war.
Das war nicht einfach nur ein Fuhrwerk, das war ja ein regelrechter Planwagen! Die riesige Leinenplane, die das Innere des Wagens vor allzu neugierigen Blikken verbarg, beschäftigte Polters Phantasie. Doch dann lenkte ihn das Gebaren des Kutschers, der so gar nicht zu dem Gefährt passen wollte, von seinen Gedanken ab. Der hagere, sehnige Gesell trug einen kostbaren schwarz-samtenen Mantel und lederne schwarze Beinkleider. Gegen das Dunkel seiner Kleidung hoben sich die funkelnden Ringe an seinen Fingern ab, die bei jeder heftigen Bewegung der Hände einen vorwitzigen Sonnenstrahl fanden, der bereit war, dem Gold den rechten Glanz zu verleihen. Auf dem Kopf des Fremden saß ein Dreispitz von tiefstem Schwarz, wie ihn die Admiräle der kaiserlichen Flotte zu tragen pflegten, die Polter bislang jedoch nie zu Gesicht bekommen hatte. Der Hut stand dem Kutscher nicht schlecht; er warf einen dunklen Schatten auf sein Gesicht, in dem nur hin und wieder ein Blitzen der Augen zu sehen war. Und in diesem Moment schienen es Zornesblitze zu sein, die der düstere Kutscher von sich schleuderte, und seine Stimme bebte vor Wut, während er mit den goldberingten Fingern gestikulierte.
Es müsse doch möglich sein, in diesem Nest ein anständiges Paar kräftiger Hände zu finden, herrschte er sein Gegenüber an, die dickliche Magd Losane. Polter musste unwillkürlich schmunzeln, als er sah, wie das gute Kind mit dem roten Schopf nun auch noch rote Wangen bekam, weil es nicht wusste, welcher Benimm in Gegenwart eines so feinen – und noch dazu so wütenden Herrn – angemessen wäre. Anstelle einer Antwort rückte die Magd ihre Haube zurecht. Ihre Rechte verfing sich dabei in den unter der Haube hervorlugenden Locken, an denen sie unruhig herumnestelte. Schließlich stammelte sie: »Wenn ich dem Herrn doch sage, dass die Frau Gorfinde mich losgeschickt hat. Eben dem Pferd wegen.« Betreten blickte sie zu Boden, dann sah sie wieder auf, und in ihren Zügen spiegelte sich ein Lächeln der Erkenntnis.
»Aber wenn ich nach dem Pferd gesehen habe, was bestimmt nicht länger als den vierten Teil einer Stunde dauern mag, dann kann ich zurückkommen und Euch zu Diensten sein.« Polter konnte das Gesicht des Fremden zwar nicht gut erkennen, doch hätte er schwören können, dass dessen Augen in diesem Moment vor Gram in den Höhlen hin und her rollten. Lediglich die Hände des Mannes verharrten für den Augenblick gänzlich in ungewohnt erscheinender Ruhe. Dann bog sich sein Oberkörper zurück – später schwor Polter seinen Zuhörern im Fetten Eber Stein und Bein, dass der Fremde in diesem Augenblick ein ganzes Buch voller Worte mit dem Atem eingesogen haben müsse, denn als sein Oberkörper wie die gespannte Sehne eines Bogens wieder nach vorne schoss, sprudelte es nur so aus ihm hervor: »Du einfältiges Kind, was glaubst du, wer ich bin, dass ich hier den vierten Teil einer Stunde auf dich warte? Was glaubst du, wer du bist, wenn du dein schnödes Pferd mir vorziehst, was glaubst du, wer das Pferd ist, wenn du um seinetwillen den Herrn warten lässt, was bildest du dir ...«
Polter hörte nicht mehr hin. Die letzten Worte waren von einem viel sagenden Fingerzeig in Richtung Planwagen begleitet worden, der augenblicklich wieder Polters Neugier erweckte.
Was mochte im Wagen erst für ein feiner Herr stecken, wenn schon der Kutscher so herausgeputzt war? Und was mochte den Herrn bewogen haben, die Reise gänzlich abgeschirmt in diesem Wagen anzutreten, dessen Inneres ja kaum ein Lichtstrahl mehr erreichen konnte? Betreffs Polter Plötzbogens Welterfahrenheit wurden bereits einige Worte verloren, und so mag es den Leser nicht wundern, dass er in diesem Augenblick kurz entschlossen vortrat, um Losanes Leiden ein Ende zu bereiten. »Der Herr möge mit mir vorlieb nehmen. Ich verfüge über ein kräftiges Paar Hände. Genau das, was Ihr braucht.« Wie zur Bestätigung hielt Polter seine beiden Hände vor die Brust. Und mochten Polters ganzer Stolz auch seine Reisen sein, so sprachen seine Hände doch eine andere Sprache. Tiefe Furchen und dicke Schwielen erzählten wortlos die Geschichte von einem Leben, das sich hauptsächlich zwischen der Stange eines Pfluges und dem Stiel einer Sense zugetragen hatte. Das ist zwar zugegebenermaßen eine stark vereinfachte Sicht, doch wenn Hände erzählen, sollte man sich über die Einseitigkeit des Blickwinkels nicht beschweren. Der Fremde jedenfalls tat es nicht, wie überhaupt seinen Zügen keinerlei Regung zu entnehmen war. Während in Polter nunmehr ein Gefühl der Unsicherheit aufkeimte, ging ein Ruck durch die Gestalt des Hageren. Er machte auf dem Absatz kehrt, ging zum Kutschbock zurück und erwiderte mit heiserer Stimme: »Meinethalben. Nehmt Ihr Euch der Sache an. Ihr habt doch vernommen, worum es geht?« Polter, der die Auseinandersetzung des Fremden mit Losane im Gegensatz zu uns vom ersten Wort an verfolgt hatte, antwortete wahrheitsgemäß: »Ja ... Herr.« Derweil er den Wagen zur Hälfte umrundete, musterte er den Fremden, der ihm nun den Rücken zudrehte, voll unverhohlener Neugier: eine Gestalt von vielleicht einem Schritt und vier Spann, die der Hut jedoch erheblich größer erscheinen ließ. Der Hinterkopf zeigte kurzes, gepflegtes schwarzes Haar, die Hände waren kalkweiß und knochig. Polter, für den die blässliche Haut des Fremden so gar nicht zu dessen Profession zu passen schien, dachte sich, dass dieser wohl meist Handschuhe trage. Ein Mensch, der als Kutscher durch die Lande reist, müsste andere Hände haben, stellte er bei sich fest und ergriff mit den eigenen, sonnengebräunten Pranken den rückwärtigen Teil des Wagens, um sich mit einem Ruck nach oben zu ziehen.
»Was, zum Namenlosen, macht Ihr denn da?« Die Stimme des Kutschers klang völlig entgeistert, sodass Polter erschrocken innehielt, bis er schließlich mit all der ihm eigenen Unschuld antwortete: »Ich nehme auf dem Wagen Platz, Herr.« Der Fremde hatte sich Polter auf zwei Schritt genähert und herrschte ihn an:
»Was fällt Euch ein, den Herrn stören zu wollen? Euer Platz ist auf dem Kutschbock.« Sein Tonfall ließ keinen Zweifel daran, dass Polter und allen seinen Anverwandten und Bekannten zeit ihres Lebens kein anderer Platz zustehen dürfe.
Und so warf Polter noch einen sehnsüchtigen Blick auf das dunkle Tuch, mit dem das Wageninnere zur rückwärtigen Seite hin verhängt war (ob er noch einen raschen Blick riskieren sollte?), seufzte dann aber und sprang vom Wagen, um auf der anderen Seite beim Kutschbock wieder aufzusteigen.
Er ließ sich neben dem düsteren Kutscher nieder und versuchte wenigstens von diesem einen erhellenden Blick zu erhaschen, doch der Fremde hatte sich den eigentümlichen Hut noch tiefer ins Gesicht gezogen und den Blick abgewendet. »Heja!«, brüllte er und schwang mit ungelenker Bewegung die Peitsche. Die Pferde, zwei prächtige Tralloper Riesen, schienen kurz zu überlegen, was die eigentümlichen Bewegungen des dunkel gewandeten Gesellen ihnen sagen wollten, und setzten sich dann eher widerstrebend in Bewegung.
Der Wagen rumpelte über den Marktplatz von Schindmeringen hinweg, und es waren nicht wenige Augenpaare, die ihm folgten. »Was mag das für ein unheimlicher Mensch sein, der dort die Peitsche schwingt?«, fragte der alte Jossek, der wohl schon fast 80 Jahre zählte und sich in Anbetracht seines langen Lebens durchaus auf ein vergleichbares Ereignis zurückbesinnen konnte, über das er aber wegen der schlimmen Folgen, die es gezeitigt hatte, lieber kein Wort verlor.
»Und was er erst für ein geheimnisvolles Gefährt lenkt! Was mag sich nur unter den Tüchern verborgen halten?«, fragte die Wirtin des Fetten Ebers zurück, deren pralles Mieder bewies, dass in ihrem Wirtshaus nicht nur der Eber fett war. Alle aber, der alte Jossek, die runde Wirtin, die Magd Losane und die anderen Dörfler, die wegen des ungewöhnlichen Ereignisses ihr Tagewerk unterbrochen hatten und herbeigeeilt waren, alle fragten sie sich, was, beim Namenlosen, den guten Polter nur bewogen haben mochte, neben dem Fremden auf dem Kutschbock Platz zu nehmen. »Das macht das viele Herumtreiben in seiner Jugend«, wusste der alte Jossek beizusteuern, »so etwas ist nicht gut für einen ehrlichen Menschen. Man entwickelt die merkwürdigsten Ideen dabei.«
Den weiteren Verlauf des Gesprächs vernahmen auch Polters neugierig gespitzte Ohren nicht mehr, denn nun rumpelte der Wagen vorbei an der Häuserzeile, die zur einen Seite den Rand des Dorfplatzes und zur anderen Seite bereits den Rand des Dorfes begründete. Die Kutsche rollte unter heftigem Schaukeln einen Lehmpfad entlang, der sich in mehreren geschwungenen Bögen den Hügel im Norden des Dorfes hinaufwand. Polters Hände krallten sich am Bock fest; zum Glück drückte ihn die Steigung, die der Wagen erklomm, gegen das Brett des Wagenaufbaus, sodass das harte Holz in seinem Rücken ihm die Illusion von sicherem Halt vermittelte.
Mit zunehmender Höhe gewann man einen immer besseren Überblick über die Umgebung Schindmeringens. Die zwei Dutzend Holzhäuser lagen eingebettet in eine seicht gewellte Ackerlandschaft, deren bereits abgeerntete Erdfurchen mit den braunen Stoppeln gelegentlich von einer saftigen, grünen Viehweide unterbrochen wurden. Die großen, schmiedeeisernen Glokken der Bornländer Bunten, die mit stoischer Ruhe den Boden abgrasten, konnte man bis hier hinauf hören. Von fern konnte Polter auch noch einen der Jungen – Elgard, Gero oder Yann, das ließ sich bei dieser Entfernung nicht mit Gewissheit sagen – dabei beobachten, wie er ein Dutzend braunweiß gescheckte Hausschweine in den Röbbewald trieb, wo es unzählige schmackhafte Eicheln zu fressen gab. Doch selbst der ferne Wald schien an diesem Tag dem Rauschen seiner Blätter Einhalt zu gebieten und erwartungsvoll hin zu dem Gefährt zu sehen, das sich den seit langer Zeit nicht mehr benutzten Pfad hinaufquälte.
Polter schüttelte diese Gedanken ab und blickte über die beiden Tralloper hinweg zur Hügelkuppe, auf der sich dunkel und drohend der Turm erhob. Er hatte keinen Moment daran gezweifelt, dass er das Ziel ihrer Fahrt sein würde. Der schwarze Kutscher, das unheimliche Gefährt und der Turm, von dem es hieß, dass ein Fluch auf ihm läge, das alles schien untrennbar miteinander verbunden – wie die Aussaat nach einem langen Winter und die Ernte des darauf folgenden Herbstes. Polter glaubte nicht daran, dass der Turm tatsächlich verflucht sei, das waren bloß Geschichten, mit denen man die Bauerntölpel unten im Dorf in Angst versetzen konnte, aber nicht einen Mann mit seiner Lebenserfahrung! Andererseits hatte er nie einen Fuß in den Turm gesetzt, denn schließlich hatte er all seine Lebenserfahrung nicht erworben, indem er Warnungen leichtfertig in den Wind schlug. Nein, derlei Ammenmärchen zu glauben war eine Sache; sich allgemein ein wenig in Acht zu nehmen, um das eine Leben, das man nur hatte, nicht unnötig zu gefährden, war eine ganz andere!
Es mochte um die zehn Jahre zurückliegen, dass sich einige Burschen und Mädel des Dorfes in den Kopf gesetzt hatten, des Nachts hier heraufzuschleichen. Getrieben von der törichten Idee, den eigenen Mut vor den Gefährten durch das Erklettern der Außenmauern des grauen Turmes unter Beweis zu stellen, hatten sie sich in verschwörerischer Runde am Fuß des unheimlichen Bauwerks getroffen. Die Dunkelheit war bereits hereingebrochen, und der Mond hatte auf dem Gestein geschimmert, das vom Regen des vergangenen Tages noch nass gewesen war. Doch unter den Augen der Gefährten den Gang zurück zum Dorf anzutreten, das war den Abenteuerlustigen schlimmer erschienen als alles, was der verfluchte Turm ihnen hätte antun können. Und so hatte die kleine Bärja, die sich mit lauter Stimme und eisernem Willen bereits vor längerem zur Anführerin der Gruppe aufgeschwungen hatte, den Anfang gemacht. In die Ritzen des Mauerwerks hatte sie die geschickten Finger geschoben und sich Schritt um Schritt mit zusammengebissenen Zähnen nach oben gezogen. Bis, ja bis sie auf einer Höhe von fünf Schritt trotz kräftigen Griffs an einem nassen, bemoosten Stein abgeglitten war. Zuerst war ihr Oberkörper nach hinten weggekippt; fast hatte es so ausgesehen, als hätte er dort in der Luft stehen bleiben wollen. Doch dann war ihr Körper wie ein Stein nach unten gesackt und vor den Füßen der entsetzten Kameraden dumpf aufgeprallt. Die Kinder waren zurück ins Dorf gerannt, und binnen einer halben Stunde hatte jeder Bewohner Schindmeringens gewusst, was geschehen war. Der alte Jossek, der sich ein wenig aufs Heilen verstand, hatte wenig für das Mädchen tun können und mit steinerner Miene verkündet, dass seine Tage gezählt seien. Den anderen Kindern aber hatte er eingeschärft, sich niemals mehr in der Nähe des Turmes blicken zu lassen, »denn dort oben treibt sich ein anständiger Mensch nicht herum!« Wie ein Wunder war es den Schindmeringern vorgekommen, als Bärja sich sechs Wochen darauf von ihrem Krankenbett erhoben und allen Voraussagen zum Trotz sämtliche Verletzungen des Sturzes überstanden hatte. Doch die Warnung des alten Jossek war den Kindern – und nicht nur ihnen – bis auf den heutigen Tag im Gedächtnis geblieben.
Polter verscheuchte mit einer unwirschen Geste die alten Geschichten aus seinem Kopf und wandte sich wieder dem Weg zu, der vor ihnen lag: Das letzte Stück war das steilste, und die beiden Tralloper Riesen schienen trotz ihrer gewaltigen Muskeln, die sich deutlich und eindrucksvoll unter dem schweißnassen Fell abzeichneten, Mühe zu haben, den Planwagen die Anhöhe hinaufzuziehen.
Polter mutmaßte, dass sich unter der Wagenplane Dinge von ganz gehörigem Gewicht befinden müssten, denn anders wusste er sich nicht zu erklären, warum sich der Wagen angesichts der beiden kräftigen Zugtiere nun kaum mehr vom Fleck bewegte. Der dunkle Kutscher neben ihm schwang die Peitsche immer heftiger. Von wachsender Ungeduld getrieben, rief er in herrischem Ton unablässig »Heja!« und wieder »Heja!« Polter dachte sich im Stillen, dass dieser Mann wohl alles Mögliche sein mochte, aber ganz gewiss kein Kutscher.
Polter war in der Tat ein Mensch, dem man nichts vormachen konnte. Er merkte sogleich, wenn jemand ihn narren wollte. Jedoch wusste er nicht um jene Dinge, die sogar dem Kutscher einstweilen verborgen blieben. Und so müssen wir trennen zwischen dem Geheimnis, das den seltsamen Kutscher umgab, und den Geheimnissen, die sich auch ihm erst viel zu spät offenbaren sollten.
Polter Plötzbogen vermochte diese Dinge nicht zu trennen, und so verwechselte er die erste Ahnung heraufkommenden Unheils, die er verspürte, einstweilen mit einer Magenverstimmung.
Hoch hinaus
Fenndrick Herkenschlau wuchtete mit einem gleichermaßen von Leid und Erleichterung geprägten Seufzer den schweren Eichentisch herüber. Leid, weil es gewiss nicht zu seinen Gewohnheiten gehörte, schwere körperliche Arbeiten zu verrichten, und Erleichterung, weil es nun endlich das letzte Möbelstück war, dessen Gewicht er stemmen musste. Schwer ließ er sich auf einen seiner Stühle fallen und genoss es für einige Augenblicke, einfach nur dazusitzen und nichts zu tun. Dann beugte er sich vor und griff nach dem Beutel, den er zwischen all dem Mobiliar abgelegt hatte. Er nestelte ungeschickt daran herum, bis sich das Tuch endlich löste und den Blick freigab auf den kostbaren Inhalt: den guten Honinger Zwieback, die Dauerwurst und den in Zuckerguss gehüllten Apfel, den er sich bis zum Schluss aufbewahren würde. Wie hatte doch Magister Eboreus stets gesagt? »Wer arbeitet, darf auch essen. Wer viel arbeitet, darf viel essen, und wer viel und schwer arbeitet, darf viel und lecker essen.« Wenn man allerdings bedachte, welche kümmerlichen Portionen der Magister sich selbst zumutete, so lag der Verdacht nahe, dass er von seiner eigenen Arbeit eine ausgesprochen geringe Meinung hatte.
Fenndrick seufzte erneut. Der Magister ... Er hatte für jede Gelegenheit ein passendes Sprichwort auf den Lippen; stets wusste er die Dinge mit wenigen Worten in die göttergewollte Ordnung einzufügen. Eine Nachbarin hatte zum dritten Mal hintereinander eine Totgeburt? »Nun, ein kranker Baum bringt gesunde Früchte nicht hervor.« Der Winter erwies sich in diesem Jahr als beängstigend lang und streng? Kein Grund zur Sorge, denn »die schlimmsten Prüfungen ziehen den größten Lohn nach sich«. Vermutlich hatte der Magister den größten Teil seiner sechzig Lebensjahre damit verbracht, die Sprichwörterkunde zu erforschen. Besonders interessante magische Forschungen hatte Fenndrick bei ihm jedenfalls nie beobachtet. Vor sieben Jahren, als »Magicus Eboreus«, wie er sich nannte, den damals zwölfjährigen Fenndrick bei sich aufgenommen hatte, um ihn die hohe Kunst der arkanen Weisheiten zu lehren, hatte der junge Herkenschlau zu sich gesagt: »Fein, nun weist mich der Magister in die Macht der Magie ein. In einem Mond werde ich dem großen Leowin, der mich stets ärgert, einen Flammenstrahl ins Hinterteil brennen. In zwei Monden zaubere ich die kostbarsten Speisen herbei, welche die Welt je gesehen hat, und in drei Monden erschaffe ich mir ein geflügeltes Pferd.« Nun, all diese Hoffnungen waren in den darauffolgenden Jahren bitter enttäuscht worden. Nicht nur, dass die Ausbildung sieben volle Jahre in Anspruch genommen hatte, nein, zu allem Übel hatte der Magister von Flammenlanzen und geflügelten Pferden gar nichts wissen wollen und den Jungen stattdessen gelehrt, die gottgewollte Ordnung in Ehren zu halten und durch die Möglichkeiten der Magica Clarobservantia, der Hellsichtsmagie, frühzeitig eine Gefährdung dieser Ordnung zu erkennen. Und selbst das hatte Fenndrick sich nach den ersten Erläuterungen des Alten noch viel aufregender vorgestellt. In die Zukunft blicken zu können, heute schon zu wissen, welche Aufgabe ihm der Magister morgen stellen würde, oder markttags bereits zu sehen, welche Mannschaft praiostags das Immanspiel gewänne, das waren für den Zwölfjährigen wahrhaft erstrebenswerte Ziele gewesen. Stattdessen hatte er alte, unleserlich gewordene Göttersagen und Mythen mittels Magie entziffern dürfen ...
Nein, er tat dem Magister Unrecht, wenn er sich so beschwerte, dachte Fenndrick. Eboreus hatte sich schließlich stets um sein Wohlergehen gesorgt und es ihm nie am Nötigsten fehlen lassen. Und all seine guten Ratschläge waren so manches Mal durchaus von Nutzen gewesen. Der Magister lebte eben in seiner eigenen, aufgeräumten Welt. So wie er die Magie in Kategorien zu unterscheiden wusste, so wusste er auch die Alveranier und ihre Mythen in Ordnungen einzuteilen, und so führte er schließlich auch seinen Haushalt. Stets stand die Weinflasche am selben Fleck, von dem sie nur einmal in der Woche hervorgeholt wurde, und das stets nur für den Genuss eines einzigen Glases. Denn, so wusste Eboreus mit einem strengen Blick unter buschigen weißen Brauen zu berichten: »Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und wir täten dem Herrn Praios einen schlechten Dienst erweisen, wenn wir an seinem Wochentag, der uns und den Zwölfen zum Gefallen ein Festtag sein soll, ein Laster begründen würden.« So wie die Weinflasche ihren Platz im Haushalt des Magisters hatte, so fand man auch seine Hausschuhe, seine Bettlektüre, sein Pfeifchen und all die anderen Utensilien seines geordneten Lebens stets am selben Fleck. Und erst der Magister selbst: kein weißes Haar, das nicht sorgsam gekämmt gewesen wäre, kein Fleck auf seinem Morgenmantel, kein unschöner Geruch, der je seinen leichten Duft nach Flieder getrübt hätte. Ein ganzes Leben in praiosgefälliger Ordnung. Kurz: Es war nicht mehr zum Aushalten gewesen!
Und so hatte Fenndrick dem lieben Magister schließlich in aller Vorsicht, um ihn nicht zu verletzen, zu verstehen gegeben, dass er ihm, der ihm wie ein Vater ans Herz gewachsen sei, zwar zutiefst dankbar für alles Gelernte sei, doch dass er, Fenndrick, sich seine Zukunft angefüllt mit Studien vorstelle, die ein wenig ... nun, eben ein wenig aufregender und abwechslungsreicher wären als das wohlbehütete Leben bei seinem Magister in Honingen. Darauf hatte der Magister ihn lange über seine Studienbrille hinweg angesehen; seiner Miene war keine Regung zu entnehmen gewesen. Schließlich hatte er erwidert, dass es das gute Recht eines jeden jungen Menschen sei, einmal in die Welt hinauszuziehen und sich die Hörner abzustoßen, und dass auch gar er selbst vor längerer Zeit ein ähnliches Bedürfnis verspürt habe; bei diesen Worten hatte ein nachdenkliches Schmunzeln sein Gesicht umwölkt. Dann war seine Miene wieder ernst geworden, und er hatte Fenndrick ermahnt, auf sich Acht zu geben, und – mehr zu sich selbst als zu seinem Schüler – die Bemerkung fallen lassen, er hoffe nur, dass der Junge nicht nach seinem Onkel käme ...
Fenndrick, der sich inzwischen Brot und Wurst einverleibt hatte, biss nun herzhaft in den Apfel und genoss den süßen Geschmack des Zuckergusses, der sich in seinem Mund ausbreitete.
Ja ... Onkel Mocurion, lange Zeit der einzige noch lebende Anverwandte, war so ganz anders als sein Magister gewesen. Der gute Onkel war ebenfalls Magier, Schwarzmagier jedoch, Vertreter der linken Hand, wie der Magister ihn einzuordnen gelehrt hatte. Mocurion mochte tatsächlich nur wenige Jahre jünger sein als Eboreus, doch war sein Haar noch zur Gänze von tief schimmerndem Schwarz. Selbst bei hellstem Licht schienen einige Partien seines Gesichts in geheimnisvollem Schatten zu liegen, sodass er auf eine wahrhaft magische Weise anziehend und abschreckend zugleich gewirkt hatte.
Der gute Onkel hatte sich bei seinen seltenen Besuchen stets liebevoll um seinen einzigen Neffen gekümmert. Seine Rede war nicht voll von Ermahnungen und Ratschlägen wie die des Magisters gewesen, sondern hatte stets leise und doch eindringlich von mysteriösen Dingen berichtet – Forschungen, die Grenzen überwanden und in unbekanntes Terrain führten ...
Und so klar und nützlich die Äußerungen des Magisters gewesen waren, so unverständlich und doch fesselnd waren die Dinge gewesen, über die Mocurion gesprochen hatte. »Du glaubst, du kennst einen Menschen vermittels der Magica Clarobservantia«, hatte der Onkel einmal gesagt, »doch gibt es Dinge, die dem magischen Objectus selbst ein Geheimnis sind und die zu ergründen ihm und nicht minder dir auf diesem Wege verwehrt bleiben. Doch Geheimnisse sollten gelüftet werden, auch und wenn vieles das Licht scheut, weil es im Dunkel des Unbekannten die eigene Hässlichkeit verbirgt.« Unter Fenndricks bohrenden Fragen, was dies denn für Dinge seien, von denen das gute Onkelchen rede, hatte der Magier nur vage Andeutungen gemacht, die jedoch genügt hatten, den Jungen das Fürchten zu lehren. Wann immer aber der Schüler ein Zeichen der Furcht gezeigt hatte, hatte das gute Onkelchen seine Ausführungen beendet und mit einem aufmunternden Lächeln hinzugefügt, dass dies nun wahrlich kein Grund zum Verzweifeln sei, weil ein so aufgeweckter Bursche wie Fenndrick gewiss damit fertig werden würde. Dann war er dem Jungen in wüster Zärtlichkeit durch das Haar gefahren und hatte ihn fest an sich gedrückt.
Und nun war das gute Onkelchen tot.
Fenndrick konnte es selbst noch nicht so recht fassen. Geschlagene fünf Jahre war es her, dass er den Onkel zuletzt gesehen hatte; dieser war damals, wie so oft, im Streit von Magister Eboreus geschieden.
Der Streit indes war endgültig gewesen. Eboreus hatte Mocurion »für alle Zeiten« untersagt, noch einmal einen Fuß über seine Schwelle zu setzen, und der Onkel war dann auch tatsächlich zornsprühend davongerauscht und hatte sich nie wieder blicken lassen. Nur an der Straßenbiegung war er noch einmal stehen geblieben und hatte Fenndrick mit einem traurigen Lächeln zugewunken – zum letzten Abschied, wie dieser später erst begriff. In Fenndricks Phantasie aber war der Onkel nach wie vor gegenwärtig gewesen. Immer, wenn der Magister ihm eine schier unlösbare Aufgabe erteilt hatte, hatte das gute Onkelchen an seiner Seite gestanden und ihm Mut zugesprochen; wenn der Magister ihn allzu streng ermahnt hatte, war das Onkelchen aufgetaucht und hatte ihn aufgemuntert. Und stets, wenn er sich gefragt hatte, wohin die langweiligen Unterweisungen des Magisters noch führen sollten, war das Onkelchen vor seinem inneren Auge erschienen – und er hatte es gewusst! Genau so hatte er werden wollen, ganz gewiss! Ein Forscher, der den Dingen auf den Grund ging, der unnahbar und doch herzlich war, der düster wirkte und dennoch Zuversicht spendete, den weder der Tod noch alle Dämonen der Niederhöllen schrecken konnten. Und je mehr der Magister sich bemüht hatte, Fenndrick ein unfehlbares Vorbild zu sein, umso stärker hatte sich sein Zögling zu der Lasterhaftigkeit des Onkels hingezogen gefühlt, der mit einem verschmitzten Lächeln noch jede Regel des Magisters gebrochen hatte.
Fenndrick erinnerte sich noch lebhaft an einen Vortrag des Magisters über ein Leben in Anstand nach den Geboten der Frau Travia. Der Onkel hatte die ganze Zeit über bereits unverschämt gegrinst, und schließlich, als Eboreus geendet hatte, hatte er nach dessen Praiostagsheiligtum – der Weinflasche – gegriffen, sie in einem Zug fast zur Hälfte geleert und Tröpfchen sprühend verkündet, er halte es lieber mit der göttlichen Rahja, denn wer wolle schon ernsthaft behaupten, die zwölf mal zwölf Regeln des anständigen Benimms könnten es mit der Göttlichkeit von Wein, Weib und Gesang aufnehmen? Der Magister hatte darauf nur ernst dreingeblickt und gesagt: »Junge, geh ins Bett!« Später dann hatte Fenndrick sich wimmernd die Decke über den Kopf gezogen, weil er mit angehört hatte, wie die beiden Menschen, die er am meisten liebte, sich gegenseitig angeschrien hatten. »Du erziehst den Jungen nicht, du dressierst ihn«, hatte das Onkelchen ausgerufen.
Aber auch der gute Magister war voll der Vorwürfe gewesen, doch vermochte Fenndrick sich an diese kaum mehr zu erinnern. Eboreus hatte irgendetwas von »schlechtem Vorbild« oder dergleichen geredet, was erneut den Widerspruch des Onkelchens erregt hatte. Schließlich hatte der Magister geschrien, er habe sich immerhin um den Jungen gekümmert, als seine Eltern gestorben seien, im Gegensatz zu dessen einzigem Verwandten, der bis heute alle Verantwortung scheue. Darauf war es sehr still geworden im Haus, und Fenndrick hatte schon befürchtet, dass sie sich nun gegenseitig erwürgt hätten. Doch am Morgen darauf war alles wie immer gewesen, wenn Mocurion zu Besuch kam: Das Onkelchen hatte beim Frühstück seine lästerlichen Scherze gemacht, um den Neffen zum Lachen zu bringen, nur gelegentlich unterbrochen von den Ermahnungen des Magisters, dem es zuweilen zu weit ging.
Und nun war das Onkelchen tot.
Eine schlichte Urkunde war vor anderthalb Wochen von einem Boten zum Haus des Magisters gebracht worden. Eboreus hatte das Dokument mit steinerner Miene gelesen und ihn dann mit einem traurigen Blick unter seinen dicken weißen Brauen angesehen; Fenndrick fragte sich bis heute, ob der Magister tatsächlich des Onkelchens wegen Trauer gezeigt hatte oder eher um seinetwillen, weil er gewusst hatte, wie viel ihm Mocurion bedeutet hatte. Schließlich hatte der Magister mit belegter Stimme zu sprechen begonnen und Fenndrick auf den Inhalt des Dokuments vorbereitet. Schließlich hatte er es ihm überreicht und recht verloren gewirkt, während Fenndricks entsetzter Blick über die knappen Zeilen geflogen war, in denen in aller Kürze geschrieben stand, dass der Onkel auf einer Reise in irgendeinem Land des Südens, das Fenndrick nicht kannte, das Opfer verdorbener Speisen geworden sei, dass man seinen Leichnam auf dem nahe gelegenen Boronanger beigelegt habe und seinen nächsten Verwandten hiermit über den sicherlich äußerst beklagenswerten Vorfall in Kenntnis setze. Gezeichnet ... irgendein unaussprechlicher Südländer.
Fenndrick konnte es noch immer nicht fassen. Sein Onkel Mocurion, der mächtige und Furcht einflößende Schwarzmagier, gestorben an schimmeligem Brot oder dergleichen? All seine Träume wegen eines einzigen lächerlichen Pergaments zerstoben, zerplatzt, zunichte?
Zwei Tage lang war der junge Zauberer nicht ansprechbar gewesen, dann aber hatte er einen Entschluss gefasst. Er hatte all seinen Mut zusammengenommen, war zu seinem Magister in die Stube getreten und hatte ihm eben jene denkwürdigen Worte über Zukunftspläne und aufregendere Forschung dargelegt. Weiter hatte er den Magister in Kenntnis gesetzt, dass er nun gedenke, den sagenumwobenen Turm, den das Onkelchen bewohnt hatte und von dem es des öfteren aufregende Geschichten zu erzählen gewusst hatte, als einziger durch Urkunde berechtigter Erbe in Besitz zu nehmen und so das Andenken Mocurions in guter Erinnerung zu halten. Dass er beabsichtige, die Studien des Onkels – worum es sich auch immer gehandelt haben möge – zu einem erfolgreichen Ende zu führen, hatte er verschwiegen, denn das hätte dem lieben Magister gewiss nicht gefallen. Daher wollte Fenndrick ihm diese unbedeutende Einzelheit auch erst dann berichten, wenn er sein Ziel erreicht hätte, denn im Glanz des erzielten Erfolges würde Eboreus‘ Urteil über ihn gewiss nachsichtiger ausfallen ...
Fenndrick stopfte sich das letzte Apfelstück in den Mund und betrachtete die Möbel um sich herum. Gewiss würde er nicht umhinkommen, sie nun auch noch ins Haus zu tragen, aber seine schmerzenden Glieder waren ihm ein deutliches Zeichen, dieses Vorhaben vielleicht besser noch ein wenig hinauszuschieben. »Ich hätte diesen Bauerntrampel nicht so schnell mit dem Wagen fortschicken sollen«, murmelte er, »so einfältig das Landvolk auch sein mag, so kräftig weiß es zuzupacken, und das ist eine Eigenschaft, die mir eher abkommt.« Andererseits, hätte er den Mann mit der Holzfällerstatur mehr tun lassen, als die Möbel in Empfang zu nehmen, die er ihm aus dem Wagen entgegen geschoben hatte, so hätte der Bauer unweigerlich einen Blick ins Wageninnere geworfen, und genau das hatte Fenndrick unter allen Umständen vermeiden wollen. Und den guten Mann die Möbel in den Turm tragen lassen? Nein, das wäre ihm aufs Höchste unpassend erschienen. Ein Schwarzmagier wurde nicht mehr von der Aura des Geheimnisvollen umgeben, wenn er Leute in sein privates Heiligtum führte. Der Bauer hatte für die zwei Silbertaler, die er erhalten hatte, genug getan, wenn er den Wagen noch zurück nach Gondheim fuhr.
Fenndrick schüttelte sich unwillkürlich: Die Ortsnamen dieser zwölfgötterverlassenen Dörfer waren ihm bereits auf dem Hinweg unangenehm aufgefallen. Schindmeringen ... ein Name, der nach geschundenen Pferden klang!
Wenn er eines Tages zu Ruhm gelangen sollte (und dass dies der Fall sein würde, daran bestand für Fenndrick kein Zweifel), dann wollte er den Ort seiner Herkunft mit Stolz angeben. Sorgen bereitete ihm indes, dass berühmte Leute stets aus Havena, Gareth oder dem verrufenen Al‘Anfa zu kommen schienen. Jedenfalls war ihm noch nie eine Geschichte zu Ohren gekommen, in der es hieß: »Seht her, ich bin Xandria, die mächtigste Magierin aller Zeiten, und ich stamme aus Schlonz.« Nein, wenn er eines Tages zu Ruhm gelangt sein sollte, so würde er Honingen, den Ort, an dem er die letzten Jahre bei Magister Eboreus verbracht hatte, oder besser noch, Havena, seine Geburtsstadt, im Namen führen. Auch mit seinem Namen werde er bis dahin einiges machen müssen, dachte er, Fenndrick Herkenschlau mochte für einen geldgierigen Händler langen, ein Furcht erregender Schwarzmagier aber müsste eher Fenndri... Fenndrakon ... Fenndrakon von Havena oder so ähnlich heißen. Er malte sich aus, wie er sich unter diesem Namen den Dörflern vorstellte, und gluckste unwillkürlich voller Vorfreude auf ihre in Ehrfurcht erstarrenden Gesichter. Ob ihnen die kleine Vorstellung des Kutschers gefallen hat, fragte er sich. Nun, einen Zweck hatte das hochnäsige und herrische Gebaren gewiss erfüllt: Jeder im Dorf würde sich das Maul darüber zerreißen, dass ein Herr den Turm in Beschlag genommen habe, der so fein sei, dass schon sein Kutscher sich aufführe wie andernorts Edle und Barone.
Fenndrick kicherte leise in sich hinein. Wie leicht das Landvolk doch zu beeindrucken war! Diesen Auftritt hatte er sich lange überlegt, und nach dem Menschenauflauf zu urteilen, der sich im Dorf gebildet hatte, hatte sein »Kutscher« die volle Wirkung erzielt. Er überlegte kurz, ob er mit den Mitteln der Clarobservantia versuchen sollte, die Gespräche der Dörfler in Erfahrung zu bringen. Doch dann besann er sich der Worte des Magisters: »Die Clarobservantia dient der Abwendung von Gefahr und der Forschung. Neugiernasen mögen weiter durch Schlüssellöcher gucken.« Widerstrebend gestand Fenndrick sich ein, dass ein derartiges magisches Belauschen wohl dem nichtmagischen Lauschen lediglich im Grad der Perfektion voraus war, nicht aber in der Frage von Ehre und Gewissen.
Mit einem Ruck erhob er sich. Solange er nichts unternähme, dachte er, würden diese Möbel wohl kaum von selbst ins Innere des Turmes gelangen; also musste er sich wohl oder übel demnächst darum kümmern.
Zuvor aber brannte er darauf, endlich das Innere des Turmes zu erkunden! Des Onkelchens geheimstes Refugium stand ihm offen und er verschwendete hier Gedanken an tumbes Bauernvolk! Entschlossen trat er auf die Eingangstür zu, die in dunklem Holz gehalten und mit Eisenverschlägen verstärkt war. Doch dann drehte er sich noch einmal um:
»Verzeiht, Herr Kutscher, fast hätte ich Euch vergessen«, sprach er laut, ergriff den dunklen Mantel und den Dreikant, den er zuvor abgelegt hatte, und öffnete die Tür ins Innere des Turms.
Während Fenndrick den ersten Schritt in seine neue Existenz wagte, polterte Polter Plötzbogen mit dem Wagen und den beiden Tralloper Riesen den Hügel hinab. Nun, da der Wagen leer und leicht war, holperte er noch heftiger über den ausgesprochen schlechten Pfad und schüttelte bei jeder Unebenheit seinen Kutscher kräftig durch. Doch Polter machte das nichts, er verstand sich allemal besser auf das Lenken von Fuhrwerken als dieser angebliche Kutscher. Der Kerl war ein rechter Sonderling gewesen, nicht nur, dass seine Gewandung und sein Auftreten Polter gleich ins Auge gesprungen waren, nein; auf der Hügelkuppe angekommen, hatte er ihn auch noch angewiesen, nur die Möbel in Empfang zu nehmen und bloß keinen Blick ins Innere des Wagens zu werfen. Und als ob dies allein nicht merkwürdig genug gewesen wäre, hatte er ihm schließlich aufgetragen, sich umzudrehen, damit der Herr ungestört von allzu neugierigen Augen den Wagen verlassen und sein neues Heim betreten könne.
Doch da ihm der düstere Kutscher für seine Dienste zwei Silbertaler in die Hand gedrückt hatte, hatte Polter es tunlichst unterlassen, dumme Zwischenfragen zu stellen, und stattdessen einfach die Ohren gespitzt, um wenigstens auf diese Weise etwas über den neuen Turmherrn in Erfahrung zu bringen.
Doch, bei allen Zwölfen, der feine Herr musste derart leise dem Wagen entstiegen und ins Innere seines Turmes entschwunden sein, dass Polter nicht den kleinsten Laut vernommen hatte, bis der Kutscher gesagt hatte, er könne sich nun wieder umdrehen. Er hatte ihn noch angewiesen, den Wagen nach Gondheim zu bringen, wo sein Besitzer ihn schon sehnlichst zurückerwarte, und ihn dann, ohne ein Wort des Abschieds, abfahren lassen. Polter zermarterte sich das Hirn, was das alles nur bedeuten mochte, doch selbst einem so weitgereisten Mann wie ihm war es schlechterdings unmöglich, sich einen Reim auf das Geschehene zu machen.
Über seiner Grübelei hatte der Wagen schließlich wieder den Fuß des Hügels erreicht und bog auf den Pfad zum Dorf ein. Bald war er am nahen Dorfrand angelangt und rollte auf die große Eiche in der Ortsmitte zu. Bei seiner Ankunft auf dem Dorfplatz schien noch immer (oder schon wieder?) ganz Schindmeringen versammelt zu sein.
»Herr Plötzbogen, was hat sich denn da im alten Turm zugetragen?«, rief ihm der kleine Yann sogleich entgegen.
»Wer war der wunderliche Mann?« – »Was verbarg sich in dem Wagen?« – »Seid Ihr nun der neue Kutscher?«, riefen andere dazwischen. Mit einem vernehmlichen Brrrr! brachte Polter die beiden riesigen Pferde zum Stehen. Er legte in aller Ruhe die Zügel nieder und lehnte sich gemütlich zurück – soweit es der Kutschbock eben zuließ. Dann legte er noch eine Pause ein, bis schließlich sogar der alte Jossek drängte: »Nun erzählt schon, Plötzbogen, so eigentümliche Fremde verschlägt es nicht alle Tage nach Schindmeringen. Da haben wir ein Recht zu erfahren, wer sich im Dorf herumtreibt.«
Nachdem sich Polter der Aufmerksamkeit aller gewiss war, erzählte er die ganze Geschichte von Anfang an. Wie er gesehen habe, dass die Magd Losane der Hilfe bedurfte, und wie er, um ihr die Schmach zu ersparen, auf den Kutschbock gestiegen war. Er erzählte davon, dass er dem unheimlichen Kutscher bei der Fahrt den Hügel hinauf durch gezielte Fragen so manches Geheimnis entlockt hatte. So zum Beispiel, dass der ganze Wagen mit Möbeln beladen sei und dass inmitten der Möbel ein feiner Herr sitze, der so vornehm sei wie andernorts noch nicht einmal Edle und Barone. Er berichtete weiter, wie er, oben angekommen, die Möbel in Empfang genommen hatte, die, wie von Geisterhand geschoben, ihm aus dem Innern des Wagens entgegengekommen waren. Danach war dem Wagen ein vornehm duftender Herr entstiegen, der, ganz in dunkle Gewänder gehüllt und ohne einen Laut zu verursachen, geistergleich ins dunkle Innere des Turms entschwebt war. Der Kutscher aber hatte ihn für seine Hilfe überreichlich entlohnt und ihn mit dem Segen der Zwölfe nach Gondheim geschickt, da er dort von seinen früheren Reisen her den zauberkräftigen Stellmacher kenne, der dieses magische Gefährt gebaut hatte. Ihm solle er nun mit dem besten Grüßen das Gefährt überbringen.
Als Polter geendet hatte, herrschte eine geradezu hörbare Stille, dann sprudelten die Fragen aus den Kindern nur so hervor. Die Erwachsenen standen derweil im Hintergrund, lauschten angespannt und dankten den Göttern dafür, dass sie ihnen Kinder geschenkt hatten, die dabei halfen, die eigene Neugier zu verbergen. Alles wollte die Dorfjugend wissen: Woher der Fremde stamme, was er hier wolle, ob ihm jetzt der Turm gehöre und wie er denn mit dem darauf liegenden Fluch fertig werden wolle.
Polter, der keineswegs beabsichtigte, seine Zuhörer zu belügen, sondern seine Geschichten lediglich ein wenig ... auszuschmücken pflegte, beantwortete die Fragen, so gut er eben konnte. Und weil er es eben nicht besonders gut konnte, wurde er der Fragerei bald überdrüssig und knurrte unwirsch, er müsse nun aufbrechen, da ihm sonst womöglich die Verzauberung in eine Kröte oder Schlimmeres drohe. Die Dörfler bekräftigten sogleich, dass sie ihn gewiss nicht hätten aufhalten wollen. Sie waren doch arg erschrocken, denn etwas noch Hässlicheres als eine Kröte vermochten sie sich kaum vorzustellen.
Also wurde Polter mit dem Segen der Zwölfe verabschiedet und der Wagen rollte zum Dorfausgang hinaus auf den ausgetretenen Lehmweg, der irgendwo, meilenweit entfernt, am schönen Gondheim vorbeiführte. Polter sog die frische Luft des kühlen Herbstnachmittags in tiefen Zügen ein. Er fühlte sich frisch und frei wie schon lange nicht mehr. Erinnerungen an seine alten, wagemutigen Reisen nach Schlonz und anderswo wurden in ihm wach, und so beschloss er, nicht sogleich nach Schindmeringen zurückzukehren, sondern all seine Verwandten und Bekannten in den Nachbarorten zu besuchen.
Vielleicht hätte jemand Polter sagen sollen, dass die aufregendsten Ereignisse der folgenden Zeit nicht in Gondheim, Schlonz und anderswo stattfinden würden, sondern eben in Schindmeringen ... Das Innere des Turmes war so dunkel, dass das trübe Herbstlicht die Türöffnung in ein sich hell abzeichnendes Rechteck verwandelte. Im Turm selbst schien sich das Licht hingegen schneller zu verlieren, als Fenndricks Augen etwas klar erkennen konnten. Fast schien es, als ob der Turm das Licht in sich aufsaugte, um es dann gierig zu verschlucken ...
Fenndrick machte einen unsicheren Schritt in das Dunkel.
Es roch muffig.
Vielleicht sollte er zurück zu seinen Sachen gehen, um das kleine Talglicht zu holen, das ihm der gute Magister eigens für die Reise zurechtgelegt hatte ... Während er noch unschlüssig in seinem Zuhause stand, nahm der Raum um ihn herum langsam klare Konturen an: Fenndricks Augen gewöhnten sich an das Dunkel.
Der Raum maß vielleicht 6 Schritt im Durchmesser und war damit nur unwesentlich kleiner als die Außenmaße des Turmes. »Nein«, murmelte Fenndrick, »mit diesem Mäuerchen lässt sich gewiss kein feindliches Heer aufhalten.« Doch andererseits kannte der junge Magicus nur einen einzigen Menschen, der ihm nicht wohlgesonnen war, und das war Leowin, der »Große«, der inzwischen zu Furcht einflößenden zwei Schritt Länge herangewachsen war. Aber der würde sicherlich nicht halb Albernia durchkämmen, nur um den schmächtigen Burschen zu finden, den er wohl mehr aus Langeweile denn aus wirklicher Feindschaft so gern gequält hatte. Nein, Leowin war in Honingen, und da sollte er auch bleiben; dieser Turm war nun einzig und allein das Refugium Fenndrakons von Havena, des Schwarzmagiers!
Fenndrick machte einen entschlossenen Schritt in die Richtung, in der durch einige Ritzen ein wenig Licht sickerte. Sein Fuß verfing sich in etwas Widerspenstigem, das ihm den schnellen Schritt nicht gönnte, sodass er augenblicklich ins Straucheln geriet und erst beim kühlen Mauerwerk wieder Halt fand. Er fluchte mehr aus Gewohnheit denn aus wirklichem Ärger heraus, derweil seine Hände bereits das Gesuchte ertasteten. Er versetzte ihm einen ordentlichen Stoß, und mit einem Krachen flogen die Fensterläden nach außen gegen das Mauerwerk.
Endlich strömte helles Licht herein – und blendete ihn augenblicklich. Es waren Fenster, richtige kleine Fenster, keine Schießscharten! Er freute sich, dass der Turm wohl offenkundig kein trutziges Bauwerk war, wie er es bei der Nähe zum Burgenland erwartet hatte, wo sich allerorten Wehranlagen und Kastelle erhoben, sondern vielmehr ein reiner Wohnturm, den das Onkelchen vielleicht gar eigens für sich hatte erbauen lassen.
Nun konnte er auch ein weiteres Fenster in der gegenüberliegenden Turmwand erkennen. Geschwind ging er darauf zu, machte dabei einen respektvollen Schritt über die Teppichkante hinweg, die ihn zuvor wohl genarrt hatte, und riss die Läden auf. Frische Luft strömte mit Praios‘ hellem Licht herein und vertrieb die abgestandene Luft.
Neugierig blickte Fenndrick sich um. Zu seiner Rechten kam eine schmale, eng an die Außenmauer gepresste Steintreppe vom oberen Stockwerken herunter und endete in einem geschwungenen Bogen neben der Eingangstür. Während diese praioswärts lag und die beiden Fenster gen Efferd und gen Rahja zeigten, war gegenüber der Tür ein mächtiger Kamin ins Mauerwerk eingelassen, der gewiss für behagliche Wärme sorgen würde.
Vor dem Kamin stand ein großer, mit dunkelgrünem Samt bezogener Ohrensessel mit einem ebenso grünsamtenen Fußhocker. Die Regale, die sorgsam in das Rund der Wände eingepasst waren, nahm Fenndrick nur mehr am Rande wahr, denn er näherte sich bereits mit einem Laut des Entzückens dem Sessel. Es gab doch nichts Schöneres als ein so gemütliches Möbelstück in der guten Stube! Mit einem »Ahhh!« ließ er sich hineinplumpsen. Einen Lidschlag später bereute er sein Tun bereits, da eine große Staubwolke bei der ersten Berührung des prächtigen Stücks aufgewirbelt war und ihn zur Gänze einnebelte. Fenndrick unterdrückte ein Husten und versuchte, sich durch wedelnde Handbewegungen wieder atembare Luft zuzuführen. Seine Hochstimmung hatte einen kleinen, aber deutlichen Dämpfer erhalten. Es sah ganz so aus, als ob sich sein persönlicher Fortschritt vorerst darin erschöpfte, dass es nun die Wohnung des lieben Onkelchens war, die er gründlich von den Spuren der Zeit befreien musste – und dass, nachdem ihm jahrelang das Abstauben der Möbel des guten Magisters ein solcher Gräuel gewesen war!
Etwas vorsichtiger legte er nun die Füße auf das samtig weiche Höckerchen, räkelte sich im Sessel zurecht und befand, dass der Onkel seinerzeit mit dem Kauf dieser grünen Gemütlichkeit eine ausgezeichnete Wahl getroffen habe.
Er ließ den Blick über den Kamin schweifen, hinauf zum Kaminsims. Der Sims war – von einer dicken Staubschicht und dem Lebenswerk einer Künstlerspinne einmal abgesehen – leer.
Dort stelle ich mein Gemälde hin, dachte Fenndrick zufrieden. Das Gemälde war ein Porträt seiner selbst, das der Magister ihm zum achtzehnten Tsatag geschenkt hatte. Es stellte unverwechselbar Fenndrick dar, jedoch hatte der Künstler es mit all jenen Details, die nicht unbedingt von elfengleicher Anmut waren, nicht so genau genommen und stattdessen dem Gesicht einen schaurig-schönen Ausdruck düsterer Würde verliehen. Das war vermutlich auch der Grund, aus dem Fenndrick es jedem Bild im Stil des Kusliker Realismus vorzog.
Er erhob sich und stand erstaunlich weich. Sein Blick glitt nach unten zu dem vermaledeiten Teppich. Das viereinhalb Rechtschritt messende Stück mochte einmal leuchtend bunte Farben gehabt haben. Mochte man es der grauen Schicht von Staub oder Satinavs jede Farbe ausbleichender Unerbittlichkeit zuschreiben: der ehrwürdige Beweis tulamidischer Webkunst erregte Fenndricks Missfallen. Die scheußliche graue Fußmatte werde er gleich als Erstes durch ein Stück von erlesenerer Qualität ersetzen, dachte er sich. So teuer konnte ein einfacher Tulamidenteppich ja schließlich nicht sein, befand er und stellte damit doch nur unter Beweis, dass die leidlich gute Beherrschung arkaner Grundmuster und die Beurteilung südländischer Webmuster zweierlei Paar Schuhe sind.