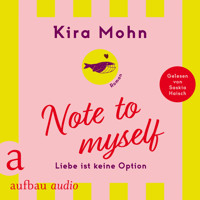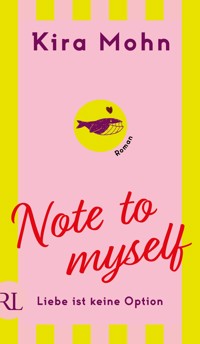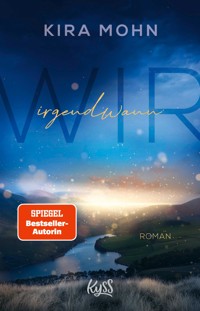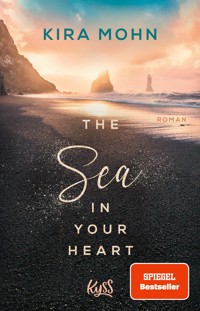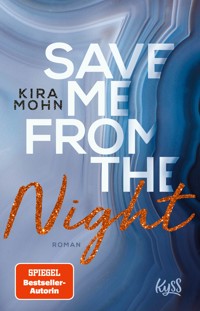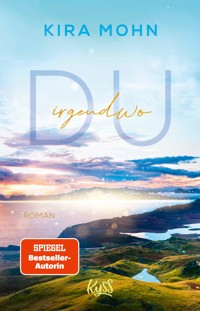
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schottland-Reihe
- Sprache: Deutsch
Hohe Berge, tiefe Wasser. Ein mitreißend emotionaler Liebesroman vor der wunderschönen Kulisse der schottischen Landschaft. Die neue Reihe von Spiegel-Bestseller-Autorin Kira Mohn. Du. In meinem Kopf. In meinem Herzen. Immer nur du. Lügen. Ein ganzes Leben voller Lügen. Victoria ist völlig schockiert, als sie mit neunzehn herausfindet, dass sie adoptiert wurde. Wie konnten ihre Eltern ihr das nur verschweigen? Und wer ist die Frau, die sie weggeben hat? Warum wollte sie sie nicht? Diese Fragen machen Vic verrückt, und wäre da nicht Jack, hätte sie bereits den Verstand verloren. Jack, ihr bester Freund, ihr Lieblingsmensch, ihr Fels in der Brandung. Sie braucht ihn jetzt mehr als je zuvor. Doch ein einziger Kuss ändert zwischen ihnen alles. Und nach einem gemeinsamen Roadtrip durch die Highlands auf der Suche nach Vics Mutter wird nichts mehr sein wie zuvor … Ein einzigartiges Serien-Konzept: Band 1 erzählt die Liebesgeschichte von Victoria, der Tochter, Band 2 die von Emmeline, der Mutter. Zwei romantische Liebesromane, eine herzzerreißende Mutter-Tochter-Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Kira Mohn
Du irgendwo
Roman
Über dieses Buch
Du. In meinem Kopf. In meinem Herzen. Immer nur du.
Lügen. Ein ganzes Leben voller Lügen. Victoria ist völlig schockiert, als sie mit neunzehn herausfindet, dass sie adoptiert wurde. Wie konnten ihre Eltern ihr das nur verschweigen? Und wer ist die Frau, die sie weggegeben hat? Warum wollte sie sie nicht? Diese Fragen machen Vic verrückt, und wäre da nicht Jack, hätte sie bereits den Verstand verloren. Jack, ihr bester Freund, ihr Lieblingsmensch, ihr Fels in der Brandung. Sie braucht ihn jetzt mehr denn je. Doch ein einziger Kuss ändert zwischen ihnen alles. Und nach einem gemeinsamen Roadtrip durch die Highlands auf der Suche nach Vics Mutter wird nichts mehr sein wie zuvor …
Hohe Berge, tiefe Wasser. Ein mitreißend emotionaler Liebesroman vor der wunderschönen Kulisse der schottischen Landschaft.
Vita
Kira Mohn hat schon die unterschiedlichsten Dinge in ihrem Leben getan. Sie gründete eine Musikfachzeitschrift, studierte Pädagogik, lebte eine Zeit lang in New York, veröffentlichte Bücher in Eigenregie unter dem Namen Kira Minttu und hob zusammen mit vier Freundinnen das Autorinnen-Label Ink Rebels aus der Taufe. Mit der Leuchtturm-Trilogie erschien sie erstmals bei KYSS, mit der Kanada-Reihe gelang ihr der Einstieg auf die Spiegel-Bestsellerliste. In ihren beiden neuen Büchern entführt Kira ihre Leser*innen nun in eins ihrer Lieblingsländer: Schottland. Es ist eine Dilogie mit einem einzigartigen Konzept: Band 1, «Du irgendwo», erzählt die Liebesgeschichte der 19-jährigen Victoria, Band 2, «Wir irgendwann», die ihrer Mutter. Außerdem wird die Reihe ergänzt durch eine Vorgeschichte, die unter dem Titel «Because It’s True – Ein einziges Versprechen» erschienen ist. Kira wohnt mit ihrer Familie in München, ist auf Instagram aktiv und tauscht sich dort gern mit Leser*innen aus.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Zitat auf Seite 111 und 120 aus dem Song «In My Life» von den Beatles; Melodie und Text von John Lennon, Paul McCartney
Redaktion Nadia Al Kureischi
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-01517-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Anna Tasca
Kapitel 1
In einer meiner frühesten Erinnerungen an meine Mutter stehen wir vor glitzerndem Wasser. Es ist warm, und ich erwidere das Lächeln meiner Mum, die mir gerade ein Eis gekauft hat. Ich brauche beide Hände, um die Waffel zu halten, und ich weiß sogar noch, dass es süß und fruchtig schmeckte und die Kälte meinen Mund zum Prickeln brachte.
«Nicht reinbeißen», hat Mum gerufen. «Victoria, nicht reinbeißen! Nur ablecken.»
Dann hat sie gelacht, wir alle haben gelacht. Ich glaube, Dad war auch dabei.
Es ist eine schöne Erinnerung.
Doch sie ist gelogen.
Eine früheste Erinnerung an meine Mutter gibt es überhaupt nicht.
Eigentlich habe ich nur mein Abschlusszeugnis heraussuchen wollen. Eine Sache von wenigen Minuten. Ich könnte jetzt schon wieder unten im Wohnzimmer sitzen und mit Mum frühstücken. Das tun wir jeden Morgen, es ist ein Ritual, das ich liebe, doch in diesem Moment fühlt der Gedanke daran sich absurd an. Weil ich ja offenbar noch nie mit meiner Mutter gefrühstückt habe.
Ich starre auf die Unterlagen, säuberlich abgeheftet in einem Ordner, auf dessen Etikett jemand Versicherungen/Bank geschrieben hat. Sie sind fast ganz hinten, diese Papiere, die mein ganzes Leben zu einer Lüge machen. Alice und George Buchanan sind nicht meine Eltern. Sie hätten auch ein anderes Baby erhalten können, und dann würde ich andere Leute Mum und Dad nennen. So beliebig. So austauschbar.
«Vic? Bis heute Abend, ich muss jetzt wirklich los!»
Die Stimme meines Vaters. Ich sehe ihn vor mir, wie er an der Treppe steht und vielleicht in diesem Moment nach seiner Tasche greift, während er ein wenig ungeduldig auf eine Antwort wartet. Er hat es eilig, eigentlich wollte er direkt weiter ins Büro, nachdem er Finny, den kleinen Bruder meines besten Freundes Jack, in den Kindergarten gebracht hatte – gut, dass das schon erledigt ist. Finny war bei uns gewesen, weil Jack einiges zu klären hatte, bei dem sein kleiner Bruder nicht dabei sein sollte, und es wäre ziemlich idiotisch, würde Finny jetzt stattdessen mitbekommen, was hier gleich los sein wird.
George hatte sein Portemonnaie vergessen. Dann hatte Mum ihn noch irgendetwas gefragt, und sie unterhielten sich gerade über das anstehende Wochenende, als ich nach oben ging, um dieses verdammte Abschlusszeugnis zu holen.
«Vic? Hast du mich gehört?»
Mit wackeligen Beinen stehe ich auf und bücke mich dabei nach dem Ordner. Versicherungen/Bank. Adoptionsunterlagen hätte man noch draufschreiben können, aber klar, haben sie nicht.
Nein, halt – wieso ist das klar?
Nichts an diesem ganzen Mist hier ist klar. Gar nichts.
Die Treppe führt vom ersten Stockwerk direkt ins Wohnzimmer, man kann von hier aus die Rückseite des Sofas sehen und die riesigen Panoramafenster, vor denen der Esstisch steht.
«Vic?» Fragend blickt mein Vater mir entgegen.
Meine Mutter hält die Teekanne noch in der Hand, als sie jetzt um die Küchentheke herumtritt und erst meinen Vater und dann mich ansieht. Einen kurzen Moment hält sie inne, dann geht sie langsam zum Esstisch und stellt die Kanne ab.
«Ist alles okay?», fragt sie, und ich wette, sie weiß es. Sie weiß, was ich da gerade in den Händen halte und dass ihr gleich alles um die Ohren fliegen wird.
Schritt für Schritt gehe ich die Stufen hinunter, bis ich zwischen meinen Eltern stehe, mein Vater vor dem Eingang zur Diele, meine Mutter noch immer neben dem Esstisch.
Meine Eltern. Zumindest auf dem Papier.
«Wieso habt ihr mir das nie gesagt?» Ich lasse den Ordner fallen, als wäre er plötzlich zu schwer geworden. Mit einem satten Klatschen landet er auf dem Parkett, noch immer aufgeschlagen, und sowohl Mum als auch Dad zucken zusammen. «Und wer sind wirklich meine Eltern?»
Stille senkt sich herab, in der mein Vater nur auf diesen verfluchten Ordner starrt und meine Mutter nach der Tischplatte tastet.
«Wieso habt ihr mir nie gesagt, dass ihr nicht meine richtigen Eltern seid?» Ich wundere mich, wie ruhig ich klinge. Als sei das hier ein völlig normales Gespräch. Wie man eben so redet, nachdem man herausgefunden hat, dass man sein gesamtes Leben lang belogen wurde.
«Vic», beginnt meine Mutter und tritt einige Schritte auf mich zu. Sie sollte jetzt besser nicht versuchen, mich zu umarmen, und als habe sie diese Botschaft in meinen Augen gelesen, bleibt sie wieder stehen. «Wir sind deine Eltern.»
«Hier steht etwas anderes.»
Sie legt eine Hand auf ihre Brust, und ich frage mich, ob ihr das Atmen in dieser Sekunde genauso schwerfällt wie mir. «Wir haben damals lange darüber diskutiert, wie wir mit der Situation umgehen wollen.» Jedes Wort kommt langsam und ein bisschen zitterig. «Glaub mir, wir haben es uns wirklich nicht leicht gemacht.»
Für einen Moment zögert sie, als müsse ich darauf jetzt irgendwie reagieren. Falls sie jedoch auf ein verständnisvolles Nicken meinerseits hofft, kann sie lange warten.
«Wir dachten, es sei besser so», sagt meine Mutter schließlich, und übrigens ist sie ja gar nicht meine Mutter, sie ist nur Alice.
«Ihr wolltet mir also niemals die Wahrheit sagen», erwidere ich mit viel zu dünner Stimme, deren Schwäche ich unmittelbar dadurch kompensiere, dass ich lauter werde. «Ihr habt einfach beschlossen, mich mein ganzes Leben lang anzulügen!»
«Victoria», schaltet sich mein Vater ein – George, sein Name ist George, «ich denke, wir sollten vernünftig darüber reden. Wir hatten unsere Gründe.»
«Ich rede vernünftig! Oder nicht? Was für Gründe sollen das bitte sein?»
«Es tut mir leid, das … ist jetzt unglücklich gelaufen.»
Im ersten Moment dachte ich, George habe sagen wollen, Es tut mir leid, dass du es so erfährst, und darauf hat mein Hirn mir unmittelbar eine Antwort zugespielt, aber Es tut mir leid, das ist jetzt unglücklich gelaufen? Ernsthaft? Unglücklich gelaufen? Tut mir leid, dass du’s rausgekriegt hast?
«Wir hätten mit dir darüber gesprochen», redet George weiter, «wenn die Umstände andere gewesen wären. Wenn … wenn die Chance bestanden hätte, dass du deine leibliche Mutter vielleicht mal kennenlernen könntest.»
«Sie ist also tot», erwidere ich gepresst. Gestorben. Vielleicht bei meiner Geburt, wie Jacks Mutter bei der Geburt von Finny. Alice und George wollten keine Schuld auf mich laden, ist es das? Nicht so wie Jacks Vater, der Finny schon sein ganzes Leben lang dafür verantwortlich macht, dass er seine Frau verloren hat.
«Nein, sie ist … sie ist nicht tot, aber …» Jetzt sieht mein Vater zu Mum, und die holt Luft.
«Deine leibliche Mutter hat sich damals gegen einen Kontakt entschieden, Vic.»
«Gegen einen Kontakt? Was heißt das?»
«Dass sie … dich nie kennenlernen wollte.»
Ich hasse den Tonfall, in dem sie das sagt. Sanft, mitfühlend, unsicher. Vielleicht will ich, dass sie schriller wird, lauter. Dann würde das, was in mir brodelt, endlich ein Ventil finden.
«Sie wollte nicht, dass du erfährst, wer sie ist, und sie wollte auch nicht wissen, wie … wie dein Leben verläuft.»
Diese Sätze bringen mich dazu, Halt am Treppengeländer zu suchen.
«Deshalb haben wir uns überlegt, also dein Vater und ich, dass du … Wir dachten …»
«Wir dachten, auf diese Art wäre es leichter für dich», springt mein Vater ihr zu Hilfe. «Deine leibliche Mutter wollte sich vollständig heraushalten, und wir entschieden daraufhin, dass es besser wäre, wenn sie gar keine Rolle in deinem Leben spielt.»
Sie wollte mit deinem Leben nichts zu tun haben. Meine Finger kribbeln, und ich balle sie zu Fäusten. Sie wollte nicht, dass du erfährst, wer sie ist.
«Ihr hättet es mir trotzdem sagen müssen.»
«Wir haben …», setzt mein Vater an.
«Ihr hättet es mir sagen müssen!», schreie ich und schiebe flüsternd hinterher: «Ich will sie kennenlernen.»
«Victoria», beginnt George gequält. «Das geht nicht. Das ist es, was wir dir die ganze Zeit zu sagen versuchen. Du kannst sie nicht treffen. Es war eine geschlossene Adoption. Nicht einmal wir haben deine leibliche Mutter kennengelernt.»
«Aber warum hat sie mich weggegeben?»
«Ich würde dir das wirklich gern beantworten, Vic … Sicher hatte sie ihre Gründe. Und es gibt bestimmt auch Gründe, warum wir nichts darüber wissen.»
Noch mehr Gründe. Sie alle haben Gründe, die sie nicht näher benennen. Wie einfach. Wie bequem.
«Du bist unser Kind, seit du ein kleines Baby warst, Vic. Unser Kind», sagt Alice jetzt. «Ich kann mir vorstellen, dass das alles ein Schock für dich ist, aber …»
«Gar nichts kannst du dir vorstellen, Alice», falle ich ihr ins Wort und bücke mich zum Ordner hinunter. Hastig reiße ich alle Unterlagen heraus, die mit dieser unsäglichen Geschichte in Verbindung stehen, dann drehe ich mich um und gehe so würdevoll, wie mir das eben möglich ist, zurück nach oben.
«Victoria!», ruft Dad mir hinterher. George. «Wir müssen das klären!»
«Ihr wolltet es die letzten neunzehn Jahre nicht klären, und jetzt will ich nicht», brülle ich zurück, schlage meine Zimmertür zu und fühle mich dabei, als sei ich zwölf. Und dann heule ich los, als sei ich drei.
Kapitel 2
Jack hält mich fest, oder er hält mich zusammen, gerade weiß ich das nicht so genau. Ich bin am Strand, meinte er vorhin am Telefon. Wenn Jack vom Strand spricht, meint er Ganavan Sands. Wir sind oft hier, um uns zu unterhalten oder einfach aufs Meer zu schauen. Heute stehen wir nur da, während der Wind an uns zerrt und sein T-Shirt meine Tränen aufsaugt.
Irgendwann, nachdem Jack meine wirr dahingestammelten Sätze zusammengesetzt hat, fragt er: «Wie hast du es herausgefunden?»
«Ich habe nach Zeugnissen gesucht», murmele ich gegen seine Brust.
So banal. So unspektakulär. Ich habe mein Abschlusszeugnis für meine Bewerbung für das Edinburgh College of Art gebraucht und die Praktikumsbescheinigung von Caleb Gordon, dem Steinmetz. Die habe ich aber nicht gleich gefunden, also habe ich in den anderen Ordnern gesucht. Hätte ich das nicht getan, würde ich jetzt bei Alice sitzen, bevor sie sich verabschiedet und zur Arbeit in die Bibliothek fährt. Und Dad … George wäre heute nicht zu Hause geblieben.
«Und was steht genau in diesen Unterlagen?»
«Nicht viel.» Ich wische mir eine klebrige Haarsträhne aus dem Gesicht. «Dass die Adoption abgewickelt werden darf. Und ich ab sofort Victoria Buchanan heiße und nicht mehr Victoria S-Punkt.»
«Victoria S-Punkt.»
Jacks Stimme ist anzuhören, dass er darüber jetzt genauso nachdenken muss wie ich. Wie lautete mein früherer Name? Victoria Smith? Victoria Stewart? Oder vielleicht Scott? Simpson? Und spielt das überhaupt eine Rolle? Es sind nur Buchstaben. Ohne Bedeutung. Ich höre Alice’ Stimme. Du bist unser Kind, Vic. Unser Kind.
«Sonst steht da nichts weiter?»
«Nein. Es war eine geschlossene Adoption. Das heißt, meine leibliche Mutter wollte verhindern, dass ich jemals vor ihrer Tür stehe und sie frage, warum sie mich einfach weggegeben hat.» Wut steigt in mir auf, nicht zum ersten Mal an diesem Vormittag, aber zum ersten Mal in diesem Zusammenhang.
Ich war etwas, das gestört hat. Etwas, das sie in ihrem Leben nicht haben wollte. Wie hat sie danach weitergemacht? Hat sie es vielleicht irgendwann einmal bereut? Hin und wieder? Hat sie sich zwischenzeitlich gewünscht, sie hätte mich nicht aus ihrem Leben entfernt? Und was für ein Leben ist das? Wie wohnt sie? Wie sieht sie aus? So wie ich? Braune Haare, braune Augen, mittelgroß oder eher klein? Nicht wie George, der fast zwei Meter misst, oder die hochgewachsene Alice. Sind meine leibliche Mutter und ich uns ähnlich, äußerlich? Innerlich sind wir es jedenfalls nicht, denn ich würde nie tun, was sie getan hat.
«Du kennst ihre Gründe nicht», sagt Jack in diesem Moment, als hätte er meine Gedanken verfolgt. «Du weißt nicht, was damals gewesen ist.»
«Nein, weiß ich nicht», murmele ich. «Aber ich will es wissen. Und ich will wissen …»
Ich breche mitten im Satz ab.
«Was willst du noch wissen?», hakt Jack nach.
«Wie es sich anfühlt, sie zu sehen. Ich will wissen, ob es doch eine Bedeutung hat.»
Du bist unser Kind, seit du ein kleines Baby warst, Vic. Unser Kind.
Das mag stimmen, aber etwa neun Monate lang war ich das Kind einer anderen. Hat sie mich da schon weghaben wollen? War es zu spät für eine Abtreibung?
Verflucht!
«Was ist?», fragt Jack.
Keine Ahnung, wie, aber er merkt immer, wenn sich irgendetwas in mir verändert. Und den Beweis dieser Gabe erbringt er jetzt einmal mehr, weil er sogar dann, wenn alles in Aufruhr ist, mitbekommt, dass ein Gedanke gerade noch ein wenig grausamer war als all die Gedanken zuvor.
«Ich könnte tot sein, weißt du?», flüstere ich. «Wenn sie mich weggemacht hätte.»
«Vic.» Jack tritt einen Schritt zurück und umfasst meine Arme. «Du weißt nicht, ob sie darüber überhaupt nachgedacht hat.»
«Das stimmt. Ich weiß gar nichts über sie. Nur dass sie mich anscheinend unerträglich fand.»
«Hey», sagt Jack sanft. Sein Blick brennt sich in meinen. «Das kannst du nicht wissen, okay? Bestimmt hatte sie ihre Gründe. Vielleicht ist es etwas, das du sogar irgendwie verstehen kannst. Vielleicht ist sie arm oder lebt auf der Straße, vielleicht wollte sie nur eine bessere Zukunft für dich …»
Jack redet noch weiter, doch die Worte treiben an mir vorbei. Schon wieder Gründe. Gründe, die ich nachvollziehen könnte – gibt es so etwas? Vielleicht hat sie ja meinen Vater gehasst und wollte durch mich nicht an ihn erinnert werden. Vielleicht … In mir zieht sich alles zusammen.
Ich muss es wissen. Ich muss unbedingt wissen, was damals gewesen ist, denn all das, was sich jetzt in meinem Kopf befindet, ist einfach zu viel.
«Vic?» Jack mustert mich mit seinem unverletzten Auge, halb verdeckt durch die dunklen Haare, die ihm in die Stirn fallen. Sein anderes Auge ist noch immer zugeschwollen – dafür trägt sein älterer Bruder Callan die Verantwortung. Er hat sich zwar entschuldigt, wie Jack mir gestern erzählte, aber jedes Mal, wenn ich mir vorstelle, wie Callan auf den schlafenden Jack losgeht, ist mir das völlig egal.
Mit einem leichten Kopfschütteln schiebe ich diesen Gedanken zur Seite. «Okay – was soll ich tun? Hast du irgendeine Idee? Wie bekomme ich mehr heraus?»
«Ich schätze mal, du willst jetzt nicht zu dir nach Hause fahren?»
Ich schüttele den Kopf.
«Gut, dann …», ein Seufzen, «… fahren wir eben zu mir.»
Kapitel 3
Jack wohnt mit seiner Familie in der Nähe des Hafens. Unter der Wohnung befindet sich das Merry Men, ein etwas heruntergekommener Pub, der seit Jahrzehnten den Rileys gehört. Jacks Urgroßvater hat ihn damals eröffnet – zu der Zeit ist er um einiges besser gelaufen.
Eigentlich bin ich eher ungern in Jacks Wohnung, seit sein Vater mal sturzbetrunken zu uns ins Zimmer gestolpert ist und mich angestarrt hat, als wäre ich eine Fremde. Dabei war das hier lange so etwas wie mein zweites Zuhause. Doch nachdem Jacks Mum gestorben ist, hat sich vieles verändert.
Als das damals mit seinem Vater passierte, hat Jack ihn am Arm gepackt und rausgeworfen. Es war kurz nach Finnys Geburt. Damals hat Jack ihn noch nicht überallhin mitgeschleppt. Das ist erst so, seit Finny etwa anderthalb Jahre alt ist, weil sich sonst keiner um ihn kümmert. Callan interessiert sich nicht besonders für seinen jüngsten Bruder, und Jacks Vater ignoriert ihn, soweit möglich. Seitdem habe ich oft gedacht, dass Jacks Familie wirklich kaputt ist, und war jedes Mal dankbar für meine Mum und meinen Dad – tja.
Ich folge Jack die Treppe hoch, und trotz allem, was heute geschehen ist, hoffe ich, dass sein Vater nicht zu Hause ist. Ich fühle mich dann einfach wohler. Sicherer. Jack sagt immer, sein Vater sei ein harmloser, alter Säufer, der im betrunkenen Zustand normalerweise nur schlafe, doch ich bekomme diesen irren Blick nicht mehr aus meinem Kopf, mit dem er mich damals angestarrt hat.
«War Fin heute Morgen eigentlich dabei, als du mit deinen Eltern geredet hast?», will Jack wissen, während er die Wohnungstür aufschließt.
«Nein, Dad hatte ihn schon in den Kindergarten gebracht. Also – George. Eigentlich wollte er danach zur Arbeit fahren, aber na ja. Du kannst dir ja denken, warum er bei Alice geblieben ist.»
Ich sehe Jack seine Erleichterung darüber an, dass die ganze Geschichte an seinem kleinen Bruder vorbeigegangen ist, und kann ihn verstehen. Finny hat mit seinen vier Jahren wirklich genug Mist erlebt.
In der Wohnung ist alles still. Trotzdem husche ich möglichst leise hinter Jack her, der mir über die Schulter hinweg einen Blick zuwirft.
«Es ist keiner da», sagt er und hat damit mal wieder in meinen Kopf hineingeschaut.
Verlegen erwidere ich sein etwas angespanntes Grinsen, als ich an ihm vorbei sein Zimmer betrete. In dem kleinen Raum gibt es gerade einmal ausreichend Platz für einen Kleiderschrank, einen Schreibtisch und ein Bett.
Ein anderes Ereignis der letzten Stunden schiebt sich plötzlich zurück in mein Bewusstsein, eins, von dem ich bis heute Morgen nicht gedacht hätte, dass es überhaupt nach hinten rutschen könnte.
Jack lässt sich ans Fußende des Bettes fallen und lehnt sich gegen die Wand, so wie meistens, wenn wir bei ihm sind.
Langsam setze ich mich ebenfalls, wie immer ans Kopfende.
Letzte Nacht habe ich kaum geschlafen, weil meine Gedanken sich immerfort um diesen einen Moment drehten, den Moment, in dem ich Jack gestern am Strand geküsst habe. Jack. Meinen besten Freund. Den Menschen, der mir am wichtigsten auf dieser Erde ist, aber eben eigentlich nur mein bester Freund.
Mittlerweile meine ich zu wissen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Er war so … verwundet. So verletzt, nicht nur körperlich. So fertig von allem, was in den letzten Tagen passiert ist. Die Sache mit Callan und sein unfähiger Vater und das Merry Men, um das er sich kümmert, Finny nicht zu vergessen – es schien alles zu viel, und ich wollte ihm so gerne helfen. Warum es mir wie eine gute Idee vorkam, ihn zu küssen, kann ich zwar nicht mehr beantworten, aber ich weiß noch sehr genau, dass es sich richtig angefühlt hat. Seine Lippen auf meinen zu spüren, nur ganz vorsichtig, weil Callan nicht nur Jacks Auge blau geschlagen hat, sondern unter seinen Fäusten auch Jacks Unterlippe aufgerissen ist. Es war ein wirklich, wirklich vorsichtiger Kuss, so behutsam, dass man sich fast fragen könnte, ob er überhaupt stattgefunden hat – wenn ich mich nicht ebenfalls noch daran erinnern würde, was dieser Kuss in mir ausgelöst hat.
Ich reibe mir die Stirn, als könne ich die Bilder dadurch löschen.
Es war ein seltsamer Moment. Ein paar Sekunden wie nicht von dieser Welt. Doch ich werde uns jetzt nicht in die unangenehme Situation bringen, darüber reden zu wollen. Zumal gerade ohnehin ein ganz anderes Thema im Raum steht.
«Also … was schlägst du vor?», frage ich.
Jack hat seinen Laptop vor sich auf den Schoß gestellt. «Hast du schon nach irgendetwas gesucht?»
Ich schüttele den Kopf.
«Okay, dann …» Er fängt an zu tippen. Sein unverletztes Auge scannt den Monitor. Mit einer Augenklappe würde er dank seiner etwas längeren, dunklen Haare wie ein Pirat aussehen. Ich mustere sein schmales, markantes Gesicht mit den hohen Wangenknochen und seinen Mund … die Unterlippe etwas voller als gewöhnlich …
Verwirrt sehe ich an ihm vorbei zum Fenster hinaus.
Ich weiß, dass Jack gut aussieht – ich bin ja nicht blind, und wir treffen uns fast täglich. Aber das hat nie eine Rolle gespielt. Oder? Ich meine, ich fand es immer nur lustig, wenn Freundinnen mich gefragt haben, ob ich nicht irgendetwas zwischen Jack und ihnen arrangieren könnte – es war lustig. Und ich war nie eifersüchtig.
Ich kann das Klicken der Tastatur hören, während ich darüber nachdenke, dass ich allerdings nie wirklich etwas in die Wege geleitet habe. Weil ich Jacks Vertrauen nicht ausnutzen würde – es steht mir nicht zu, ihn mit irgendjemanden zu verkuppeln, und die Freundinnen, die er trotzdem hatte, waren mir immer egal. Wir haben uns ja weiterhin gesehen, und das mit ihm und den anderen Frauen war nie etwas Ernstes.
Moment.
Das habe ich bisher noch nie gedacht. Dass es nie etwas Ernstes war. Warum sollte ich auch? Es spielt doch keine Rolle.
«Hier», sagt Jack, und ich zucke zusammen. «Du hast das Recht, etwas über deine Geburt und die Adoption zu erfahren, wenn du mindestens sechzehn bist. Vorher geht auch, aber dann müssen deine Eltern zustimmen. Deine Adoptiveltern, meine ich.»
«George hat gesagt, das ginge nicht.» Ich atme aus, als ich an das Gespräch von heute Morgen denke. Gespräch. Um es so nennen zu können, hätte ich wohl ein wenig leiser reden müssen. «Er hat das mit der geschlossenen Adoption erwähnt und dass es wohl Gründe gibt, warum sich das nicht zurückverfolgen lässt.»
«Hm.» Jack wendet sich wieder dem Laptop zu. «Hier steht, du hast das Recht auf eine Kopie des Adoptionsprotokolls und auf deine originale Geburtsurkunde. Und da müsste dann zumindest der Name deiner Mutter draufstehen. Und du könntest auch die Gerichtsakte beantragen.»
«Gerichtsakte.»
«Steht hier. Man kann einfach anrufen. Du musst denen nur deine Identität bestätigen, und dann kostet es noch fünfzehn Pfund, und sie schicken dir anscheinend alles zu.»
«Blöd nur, dass ich gar keine wirkliche Identität habe.»
«Vic.» Jack sieht auf. «Du kennst die Identität deiner leiblichen Mutter nicht. Aber deine schon.»
«Klar. Ich bin das Adoptivkind von Alice und George Buchanan. Ich habe lediglich keine Ahnung, wer meine wahren Eltern sind oder ob ich Geschwister habe oder ob die alle überhaupt noch leben und ob …» Meine Stimme versagt.
«Komm her.» Jack schiebt den Rechner zur Seite, als er jetzt zu mir rutscht und einen Arm um mich legt. Mein Kopf sinkt gegen seine Schulter, und eine Weile sitzen wir so da, während mein Herz viel zu schnell schlägt und ich mich nicht so recht entscheiden kann, warum es das tut. Weil ich sogar eine Waise sein könnte. Wäre doch immerhin möglich. Und weil wir hier gerade versuchen, etwas über meine leibliche Mutter herauszufinden. Die Frau, die mich zur Welt gebracht und dann sofort verlassen hat. Und weil wir so dicht nebeneinandersitzen.
Jack duftet nach Jack. Mit geschlossenen Augen könnte ich ihn jederzeit zwischen tausend anderen erkennen.
Ich richte mich auf. Das ist irgendwie … irritierend. Vielleicht werde ich mit Jack doch irgendwann über gestern Abend sprechen müssen.
Sein Arm liegt noch immer auf meinen Schultern. «Du bist Victoria Buchanan», sagt er in diesem Moment. «Adoptiert von George und Alice Buchanan. Du kennst dein ganzes bisheriges Leben, bis auf ein paar Monate direkt nach deiner Geburt, an die du dich aber sowieso nicht erinnerst. Ich mich an meine ersten Monate jedenfalls nicht. Und wir werden herausfinden, was genau vor deiner Geburt passiert ist, okay?»
«Okay.» Mit dem Kinn weise ich in Richtung Laptop. «Was steht da noch?»
Jacks Arm löst sich, als er den Rechner wieder zu sich zieht. «Dass in dem Adoptionsprotokoll die Umstände stehen, die zur Adoption geführt haben», sagt er. «Und dass du die Möglichkeit therapeutischer Unterstützung wahrnehmen kannst, wenn du möchtest.»
«Möchte ich aber nicht.»
«Kannst du dir ja noch überlegen», erwidert Jack diplomatisch. «Und dann gibt es noch die Gerichtsunterlagen.»
«Was steht da alles drin?»
«Eine Kopie der Geburtsurkunde, der Adoptionsantrag, eine Einverständniserklärung der leiblichen Mutter und so ein Bericht, der von einer unabhängigen Person verfasst sein muss – einem Anwalt oder so. Hier steht, in den Gerichtsunterlagen findet man letztlich mehr über die Adoptiveltern als über die leiblichen Eltern. Ist aber egal, du brauchst ja fürs Erste nur einen Namen und eine Adresse.»
Er hat recht. Ich brauche nur einen Namen und eine Adresse.
Oder?
Brauche ich das wirklich?
Blöde Frage. Die Alternative besteht darin, so zu tun, als hätte ich diese verfluchten Unterlagen nie entdeckt. Nie Alice und George vorgeworfen, dass sie mir die Wahrheit verschwiegen haben.
Ich ziehe die Knie an die Brust und umschlinge meine Beine.
«Hier steht außerdem, dass in den Gerichtsunterlagen auch der Name deines Vaters festgehalten wird, wenn es dazu Angaben gibt. In der Geburtsurkunde ist er nicht unbedingt eingetragen.»
Der Name meines Vaters.
Ich mustere Jacks Profil, während er sich weiter auf den Text konzentriert, und frage mich, ob ich tatsächlich die Namen meiner leiblichen Eltern herausfinden möchte. Ob ich sie wirklich suchen will. Gerade eben war ich mir noch sicher, doch jetzt, wo Jack mit konkreten ersten Schritten kommt, bin ich es nicht mehr.
«Vic?» Jack sieht mich an.
«Mhm?»
«Du könntest alles jederzeit und immer stoppen, das weißt du, oder?»
«Nicht wirklich. Ich meine … wenn ich wüsste, wo meine Mutter wohnt … wo vielleicht sogar beide wohnen, mein Vater und meine Mutter, dann bekäme ich das nie wieder aus meinem Kopf. Und dann muss ich da irgendwann hinfahren, ob ich will oder nicht. Und Dad … George hat gesagt … er meinte vorhin …»
«Was meinte er?», fragt Jack, als die Sekunden sich zu dehnen beginnen.
«Na ja, er hat eben gesagt, dass es Gründe gibt, weshalb er und Alice nichts über meine leibliche Mutter wüssten. Und wenn sie es nicht wissen, warum sollte man mir etwas über sie verraten?»
«Weil du mit deiner Mutter verwandt bist und George und Alice nicht», erwidert Jack.
«Aber sie hätten diese Informationen sicher bekommen. Vielleicht hätten sie es mir ja irgendwann erzählen wollen, und dann müssen sie doch wissen …»
Einmal mehr unterbreche ich mich, um den zersetzenden Gedanken niederzukämpfen, dass George und Alice nie vorhatten, es mir zu sagen. Dass sie mich lieber weiter und immer weiter belügen wollten und dass sie deshalb vielleicht gar nicht mehr nachgehakt haben.
«Wir rufen da an. Dann erfahren wir ja, welche Informationen es gibt und welche nicht», sagt Jack schlicht. «Da steht, es gibt ein Kontaktregister. Man kann entscheiden, ob man angeschrieben werden will oder nicht – immerhin könnte es sein, dass deine Eltern sich irgendwann später noch eingetragen haben, ohne dass George oder Alice davon wissen.»
Das Geräusch eines Schlüssels lässt mich aufhorchen. Genau wie ich hebt Jack den Kopf, als jemand gegen seine Tür klopft.
«Hi!» Callans Stimme. «Ich war beim Bäcker.»
«Okay», erwidert Jack. «Vic ist da.»
Ein paar Sekunden bleibt es still. «Falls ihr Hunger habt – jetzt gibt’s wieder Brot», sagt Callan schließlich. Unmittelbar darauf entfernen sich seine Schritte.
Mein Blick huscht zu Jacks blau geschlagenem Auge. Auch wenn Callan sich entschuldigt hat, ist es mir fürs Erste lieber, ihm nicht zu begegnen. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, hierherzukommen.
«Du kannst denen auch schreiben», sagt Jack in diesem Moment. «Dann hättest du noch ein bisschen Zeit, dir alles in Ruhe zu überlegen.»
«Meine Eltern sollen möglichst nichts davon erfahren. Alice und George, meine ich.» Herrgott. Muss ich das ab jetzt immer dazusagen? Alice und George?
«Wieso nicht?», will Jack wissen.
Auf diese Frage kann ich nur mit den Schultern zucken. «Wo ist diese Adoptionsstelle überhaupt?»
«In Edinburgh.»
Ausgerechnet. Da werde ich studieren. Also, wenn alles klappt, mein tägliches Mantra wirkt und die Kunsthochschule mich nimmt. In ein paar Monaten könnte ich einfach hinlaufen und persönlich nach dem Namen meiner leiblichen Mutter fragen. Hi, zufällig weiß ich nichts über die Frau, die mich zur Welt gebracht hat, wenn Sie mir da vielleicht bitte weiterhelfen könnten?
«Ich ruf lieber an», sage ich.
«Okay.» Jack nickt. «Wann?»
«Jetzt gleich.» Ich zerre mein Smartphone aus der Jackentasche und versuche dabei, Jacks überraschten Gesichtsausdruck nicht zu beachten. «Wahrscheinlich bekomme ich sowieso keine Informationen. Gibst du mir die Nummer?»
Jack dreht den Laptop so, dass die Adresse zu sehen ist. Hastig gebe ich die Telefonnummer ein, bevor ich es mir anders überlegen kann, und als ich plötzlich eine Frauenstimme in der Leitung höre, bin ich so nervös, dass ich kaum mitbekomme, was sie sagt.
«Ähm … guten Tag», beginne ich unsicher. «Mein Name ist Victoria Buchanan, und … also … ich wurde adoptiert und wüsste gern etwas über meine leibliche Mutter.»
«Wie genau kann ich Ihnen da weiterhelfen?», fragt die Frau. «Möchten Sie gern Ihre Gerichtsakten einsehen?»
«Ja, also … wenn das ginge?»
«Das sollte kein Problem sein. Dazu brauche ich nur Ihren Geburtsnamen, das Datum der Adoption und das Gericht, das sich mit der Adoption befasst hat.»
Es dauert einige Sekunden, bis ich feststelle, dass ich nichts davon beantworten kann. «Ich glaube, das weiß ich alles nicht.»
«Liegt Ihnen bereits Ihre Originalgeburtsurkunde vor?»
«Nein.»
«Dann müssen Sie die zuerst beantragen. Dazu müsste ich Sie mit einer Kollegin verbinden, einen Moment …»
Irgendein Popsong ertönt, und ich lasse das Handy sinken.
«Was ist?», fragt Jack. «Was hat sie gesagt?»
Ich schüttele nur den Kopf, weil bereits eine neue Stimme zu hören ist. «Guten Tag, mein Name ist Samantha Mitchell, wie kann ich Ihnen helfen?»
«Ich … also ich hätte gern meine Originalgeburtsurkunde – ich wurde adoptiert», füge ich schnell hinzu.
«Sicher, dann würde ich eine Kopie Ihres Ausweises benötigen. Sie können mir die per Post oder per Mail schicken oder auch faxen.»
«An welche Mailadresse?»
«Adoptions at …»
«Moment, ich brauche was zu schreiben!»
Jack springt auf, und Sekunden später notiere ich mir die Mailadresse auf dem Block, den Jack mir zusammen mit einem Kugelschreiber hingehalten hat.
«Können Sie mir die Urkunde direkt per Mail schicken?», frage ich.
«Nein, das ist leider nicht möglich. Ich kann Ihnen die Geburtsurkunde nur an die Adresse schicken, die auf Ihrem Ausweis steht.»
«Okay.» Dann werde in den nächsten Tagen eben ich die Post hereinholen. «Ich schicke Ihnen die Kopie jetzt gleich.»
«Sehr schön, ich freue mich, von Ihnen zu hören. Alles Gute.»
Die Worte der Frau hallen noch in meinem Kopf nach, während ich ein Foto meines Ausweises mache und anschließend mein Mailprogramm aufrufe. Alles Gute. Wieso denn alles Gute? Als wäre ich krank oder so. Aber irgendwie ist es ja auch ein krankhafter Zustand, adoptiert zu sein. Zumindest wenn man es so erfährt wie ich.
Augenblicke später lasse ich das Smartphone sinken und blicke zu Jack. «So», sage ich und lächle etwas bemüht. «Das war’s.»
«Ich glaube, es fängt jetzt erst an», erwidert Jack, dann lächelt auch er, vielleicht weil er die Welle der Angst, die mich in diesem Moment ergreift, spüren kann. «Aber es wird alles gut. Wir schaffen das, okay?»
Ich nicke. Mir ist schlecht.
Kapitel 4
Sinclair.
Ich hieß einmal Victoria Sinclair. Nur ganz kurz, nur für einige Wochen, bevor ich zu Victoria Buchanan wurde.
Der Brief mit der Geburtsurkunde befindet sich in meiner Schreibtischschublade, in der einzigen, die sich abschließen lässt. Vom Bett aus starre ich bereits seit dem Aufwachen diese Schublade an und denke über all die Fragen nach, die sich aufgrund ihres Inhalts neu aufgetan haben.
Victoria Sinclair ist die Person, die ich gewesen wäre, hätte meine Mutter mich damals behalten. Der Name fühlt sich fremd an. Ich bin Victoria Buchanan. Das klingt nach Familienausflügen und Kindergeburtstagen und nach einer Mutter, die ihrer Tochter abends vorgelesen hat.
Doch Victoria Sinclair – wer ist das? Es könnte eine Person sein, die Mathematik liebt und gern früh aufsteht. Eine, die schon seit einem Jahr studiert und sich nicht ewig mit dem Portfolio für die Bewerbung an der Kunsthochschule Zeit gelassen hat. Eine selbstbewusste Person, die vielleicht ein Pferd hat. Vielleicht studiert Victoria Sinclair Physik oder Medizin und könnte die Faszination, die ich für die Arbeit mit Steinen empfinde, weil ich immer und überall Figuren und Formen darin zu erkennen meine, nicht einmal im Ansatz nachvollziehen.
Niemand wird es je erfahren. Victoria Sinclair hat sich leider nach nur drei Monaten in Luft aufgelöst. Übrig geblieben ist Victoria Buchanan, genannt Vic.
Ob etwas von Victoria Sinclair zurückkehrt, sollte ich jemals meiner Mutter gegenüberstehen? Sie kennt Victoria Buchanan nicht.
An diesem Punkt meiner Überlegungen angekommen, schlage ich unwillig die Decke zurück und schwinge die Beine aus dem Bett. Ich bin genervt von mir selbst. Erstens weil ich nicht aufhören kann, über all das nachzudenken, und zweitens weil ich mich dabei dauernd in Sackgassen manövriere.
Ja, meine leibliche Mutter kennt Victoria Buchanan nicht.
Nur kennt sie leider auch Victoria Sinclair nicht. Victoria Sinclair ist niemand, nicht mehr als ein Hirngespinst.
Ganz davon abgesehen kenne ich umgekehrt meine Mutter nicht und werde sie auch nie kennenlernen, denn ihr Name steht im Gegensatz zu meinem nicht auf der Geburtsurkunde.
Ich suche mir Klamotten aus dem Schrank und öffne die Zimmertür, um ins Bad zu gehen.
Arme Victoria Sinclair. Es hat einfach nie jemand wissen wollen, was aus dir geworden wäre.
«Guten Morgen. Hast du gut geschlafen?», begrüßt Alice mich, als ich nach unten komme.
Sie sitzt mit einer Tasse Kaffee am Esstisch. Sie hat mir Tee gekocht, und der Duft des Kaffees vermischt sich mit meinem Earl Grey, als ich mir jetzt eine Tasse davon einschenke.
«Mhm», erwidere ich unverbindlich und setze mich zu ihr.
Wir haben dieses Ritual beibehalten, das schon so lange existiert, obwohl es sich in den letzten Tagen hölzern und unecht angefühlt hat, weil ich nun mal inzwischen weiß, dass das hier kein trautes morgendliches Zusammensein zwischen Mutter und Tochter ist.
Es mag ungerecht sein, so darauf herumzureiten, doch es gelingt mir einfach nicht, es so zu sehen wie früher.
Ich weiß, sie wartet darauf, dass ich endlich einlenke und wir noch einmal über alles sprechen. Natürlich wäre es wichtig, und ich will es ja auch. Nur habe ich keine Ahnung, was genau gesagt werden könnte, um diese Enttäuschung in mir aufzulösen – nein, Enttäuschung ist nicht das richtige Wort. Gibt es einen Begriff, der das Gefühl ausdrückt, wenn man entdeckt, dass das eigene Leben auf Lügen basiert? Totale Desillusionierung vielleicht. Ich bin ein Kaninchen, das jemand aus einem Hut gezogen hat und das sich jetzt fragt, wo genau es eigentlich herkommt.
«Hast du deine Zeugnisse inzwischen nachgereicht?», fragt Alice in die Stille hinein.
«Ja, hab ich.»
«Dann werden sie sich sicher bald bei dir melden.»
Sonnenstrahlen, die durchs Fenster fallen, verleihen dem Tisch an einigen Stellen einen honigfarbenen Schimmer. Ich schiebe meine Tasse ins Licht, und die blassrote Keramik leuchtet auf. Der Gedanke, dass vor einigen Tagen die Frage, ob das Edinburgh College mich nehmen wird, das Wichtigste in meinem Leben war, ist seltsam.
Mittlerweile fällt es mir leichter, Alice beim Vornamen zu nennen. Ich weiß, dass sie das trifft, doch ich kann es nicht ändern. Sie haben mich auch getroffen und dabei schlimmer verletzt.
Alice verändert ihre Sitzposition. «Vic …», beginnt sie, sucht nach Worten und umfasst schließlich ihre Kaffeetasse. «Können wir bitte …»
«Ich fahre heute zu Caleb», unterbreche ich sie und rücke meinen Stuhl wieder zurück.
Alice’ Mund steht noch ein paar Sekunden offen, dann atmet sie aus. «In Ordnung.»
Meinen Tee nehme ich mit, als ich zurück in mein Zimmer gehe. Ich wünschte, Alice würde nicht immer wieder versuchen, das Thema anzuschneiden, denn mittlerweile fühle ich mich grausam, weil ich sie jedes Mal ausbremse. In den letzten Monaten habe ich nach WG-Zimmern in Edinburgh gesucht, aber jetzt bin ich zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich auch davon überzeugt, dass eine eigene Wohnung unbestreitbare Vorteile hätte.
Ich stehe mit meinem Earl Grey am Fenster. Zwei Mädchen mit Schulranzen auf dem Rücken laufen an unserem Hoftor vorbei.
Es ist noch zu früh, um zu Caleb zu gehen. Vor einiger Zeit wollte er mir einen Schlüssel für die Werkstatt geben, aber das hat er wieder vergessen. Ich habe nie nachgefragt, denn der Laden ist von zehn Uhr morgens bis in den späten Abend hinein geöffnet, und seit meinem Praktikum kann ich kommen und gehen, wann ich will. Der Arbeitsplatz, den Caleb damals für mich eingerichtet hat, steht mir jederzeit zur Verfügung. Ich glaube, er hofft ein wenig darauf, das College werde mir absagen – Caleb gefiele es sehr viel besser, wenn ich eine Ausbildung als Steinmetzin bei ihm beginnen würde.
Das war bisher mein Plan B, und ich könnte es mir auch immer noch vorstellen. Sollte ich keinen Platz an der Kunsthochschule bekommen, würde ich mich jetzt allerdings auch in Oban nach einer eigenen Wohnung umsehen, um einen Ort zu haben, an dem ich ungestört über alles nachdenken kann.
Es ist verrückt – normalerweise gehören Alice und George zu den Menschen, an die ich mich wende, wenn ich mich völlig hilflos fühle, doch jetzt?
Ich greife zum Smartphone und tippe eine Nachricht ein.
Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Wenn Jack nicht gerade schläft oder arbeitet, reagiert er meistens sofort. Umgekehrt halte ich es genauso.
Ich greife nach meinem Autoschlüssel.
Jack hat zurückgeschrieben, er werde zum Strand kommen, sobald er Finny in den Kindergarten gebracht habe, doch als ich Ganavan Sands erreiche, ist er noch nicht da. Es ist menschenleer. Um diese Uhrzeit sind alle in ihren Büros, in der Schule oder noch im Bett.
Es ist fast halb neun, und die Sonne hatte bereits mehrere Stunden Zeit, den Horizont hinaufzuwandern. Das Meer breitet sich ruhig und schimmernd blau vor mir aus, nur müde lecken die Wellen am hellen Sand, als seien sie noch gar nicht richtig wach. Es weht ein leichter Wind, der einen schwachen Duft von Tang mit sich trägt; es riecht so, wie ich mich fühle, wenn ich auf den Ozean blicke. Gleichzeitig nach Freiheit und als sei ich hier zurückgelassen worden. In Edinburgh werde ich das vermissen.
Ich ziehe meine Jacke vor der Brust zusammen und schlendere über die steinerne Rampe zum Strand hinunter. Es gibt einiges, das ich vermissen werde, nicht nur den Duft des Meeres. Jack zum Beispiel. Unvorstellbar, ihn nicht mehr jeden Tag zu sehen – niemand steht mir näher als er. Nur mit Alice und George verbindet mich ähnlich viel.
In eine Familie wird man hineingeboren. Vielleicht denkt man manchmal, man hätte mit diesen Menschen gar nicht so viel zu tun, wäre man nicht zufällig miteinander verwandt, aber, ob man will oder nicht, es gibt da dieses Band, das wohl nur unter Schmerzen zerrissen werden kann. Kurz nach dem Tod seiner Mutter habe ich Jack vorgeschlagen, er solle einfach Finny nehmen und zu uns ziehen; weg von seinem Vater, der doch ständig immer nur betrunken war. Jack hat mich entgeistert angesehen und dann aufgelacht. Danach habe ich dieses Thema nie wieder angeschnitten und mich sogar ein wenig dafür geschämt, es überhaupt versucht zu haben. Denn ich habe es verstanden. Jacks Familie hat mit meiner eigenen wenig gemein, doch es ist nun mal seine Familie. Und auch wenn ich mir nicht habe vorstellen können, dass man einen Mann wie Mr Riley überhaupt lieben kann, so tut Jack wohl genau das, obwohl er aufgehört hat, ein Vater zu sein.
Und ich liebe Alice und George. Immer noch. Trotz allem. Zwei Menschen, die gar nicht meine wahren Eltern sind. Zwei Menschen, die mich lediglich bei sich aufgenommen haben, weil sie sich ein Kind wünschten. Irgendeins. Und ich kann nichts dagegen tun, nicht einmal ihre Lüge kann meine Liebe zu ihnen zerstören. Es tut nur furchtbar weh, wenn ich daran denke.
Was muss geschehen, damit die Verbindung zwischen Eltern und ihren Kindern wirklich zerstört wird? Wenn es nicht ausreicht, dass ein Mann seine Söhne überwiegend im Alkoholdunst wahrnimmt, und eine Frau ihrer Tochter nur vorspielt, sie sei ihre tatsächliche Mutter?
Wie also konnte meine leibliche Mutter das Band zwischen uns damals durchtrennen? Ist es leichter, wenn man einander noch gar nicht wirklich kennt? Andererseits war ich monatelang ein Teil von ihr. Bedeutet das nichts?
Offensichtlich.
Die Sohlen meiner Sneakers werden vom Salzwasser umspült, so nah laufe ich an der Brandungslinie, doch es ist mir egal, dass meine Füße mittlerweile feucht sind. Hätte ich daran gedacht, Badesachen mitzunehmen, würde ich weit ins Meer hineinwaten, um darin unterzutauchen, ungeachtet der kühlen Temperaturen. Eine Wiedergeburt. Nur müsste ich danach ja doch zurück in mein altes Leben, in dem gerade alles ein wenig verrutscht ist.
«Vic!»
Ich drehe mich um.
Vom Parkplatz winkt Jack mir zu. Er trägt keine Jacke, nur ein schwarzes Shirt zu schwarzen Jeans. Der Wind weht ihm die Haare ins Gesicht, das mittlerweile fast wieder normal aussieht. Die lila Verfärbung um sein Auge herum ist in den letzten Tagen erst zunehmend gelblicher geworden und dann zusammen mit der Schwellung verschwunden; die aufgeplatzte Unterlippe ist verheilt.
Während er auf mich zukommt, muss ich daran denken, dass ich vor wenigen Wochen auf eine mögliche Frage, wen ich in Edinburgh am meisten vermissen würde, Jack genannt hätte. Zu diesem Zeitpunkt wäre ich nicht auf die Idee gekommen, ich könne bereits viel früher etwas vermissen. Geborgenheit. Zugehörigkeit.
Eigentlich war ich der Meinung, in den letzten Jahren immer autonomer und selbstständiger geworden zu sein, bereit, auf eigenen Beinen zu stehen. Aber vielleicht fällt das leichter, wenn man weiß, wohin man zurückkehren kann, sollte etwas schiefgehen. Und jetzt? Möchte ich dringender von zu Hause ausziehen als jemals zuvor, und gleichzeitig wünschte ich, ich hätte es behalten dürfen, das Bild von meinem Zuhause.
«Hi», sagt Jack.
Er kommt vor mir zum Stehen, und ich schließe beide Arme um ihn. Ich umarme Jack immer zur Begrüßung und noch einmal, wenn wir uns voneinander verabschieden. Seit ich zurückdenken kann, gehört das einfach dazu – dass es mir zunehmend schwerfällt, ihn wieder loszulassen, muss er nicht wissen. Jack ist alles, was mir an Zuflucht geblieben ist, doch es erscheint mir unangemessen, mein Bedürfnis nach seiner Nähe zu offensichtlich werden zu lassen. Erstens hat er mit Finny, Callan und seinem Vater genug Menschen, um die er sich kümmern muss, und zweitens will ich nicht riskieren, noch einmal von meinen eigenen Gefühlen so überrollt zu werden wie an diesem einen Abend am Strand, an dem ich Jack geküsst habe. Sobald ich jedoch spüre, wie Jack meine Umarmung erwidert, kann ich das nicht mehr ausschließen, weshalb ich einen halben Schritt zurücktrete und mich dabei hin- und hergerissen fühle. Ihn jetzt anzusehen, bringt mich beinahe dazu zu wünschen, es hätte diesen einen Kuss nie gegeben.
Beinahe.
Er war zu perfekt, um ihn wirklich ganz aus meiner Erinnerung streichen zu wollen.
«Ist alles in Ordnung?», fragt Jack.
«Ja, ich musste nur mal raus. Es fällt mir schwer, zu Hause einfach weiterzumachen wie immer.»
Jack mustert mich einen Moment, dann schiebt er die Hände in die Hosentaschen und nickt in Richtung der Felsen weiter hinten. «Laufen wir ein Stück?»
«Okay.»
«Du musst ja nicht so weitermachen wie immer», sagt er, während wir über den Strand schlendern.
«Doch, irgendwie schon. Was soll ich denn sonst tun?»
«Rede mit Alice und George über das Ganze.»
«Dadurch verändert sich doch nichts.»
Während wir so nebeneinanderher gehen, passen sich unsere Schritte einander an.
«Ganz egal, was ich oder Alice oder George sagen oder auch tun, sie steht trotzdem immer zwischen uns, ihre Lüge. Ich würde so gern fühlen, dass es gar nicht so viel bedeutet, aber ich tu’s nicht, verstehst du? Ich sehe sie an und denke: Zufall. Reiner Zufall, dass ihr es geworden seid und nicht irgendjemand anders. Ja, sie haben sich um mich gekümmert, wie man sich um seine Tochter kümmern sollte, und ich liebe sie auch, aber …» Ich spreche nicht weiter.
«Was ist mit deiner leiblichen Mutter?», sagt Jack in die Hilflosigkeit hinein, die sich in mir aufzubauen beginnt und mir den Zugang zu jedem weiteren Wort abschneidet. «Du wolltest sie doch suchen. Vielleicht würde das etwas verändern.»
«Meine leibliche Mutter», murmele ich und starre auf meine Füße. Der hellgraue Stoff meiner Turnschuhe ist dunkel vor Nässe. «Sie wollte nicht, dass ich sie finde, Jack.» Sie wollte es so wenig, dass sie entsprechende Vorkehrungen getroffen hat. «Es gibt keinen Eintrag von ihr im Kontaktregister. Ihr Name steht nicht einmal auf meiner Geburtsurkunde.»
«Bleiben immer noch die Gerichtsakten.»
«Nein, verstehst du nicht? Sie wollte mich absolut und vollkommen aus ihrem Leben entfernen.»
Jack schweigt so lange, bis ich einen Blick zur Seite werfe.
«Die Frage ist doch – was willst du?» Er bleibt stehen. «Das eine ist das, was deine Mutter wollte. Aber was willst du, Vic? Wenn du sie finden willst, dann ist es dein Recht, sie zu finden. Ihre Entscheidung von damals ist nicht automatisch die richtige, nur weil sie sie zuerst getroffen hat – das, was du willst, hat genauso seine Berechtigung.»
Ich erwidere seinen ernsten Blick. «Was, wenn sie vor mir steht und mich … mich schrecklich findet?», sage ich so leise, dass das Rauschen der Wellen meine Worte fast verschluckt. «Es schrecklich findet, dass ich sie gefunden habe?»
Und was, wenn ich sie schrecklich finde?