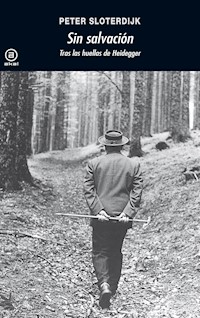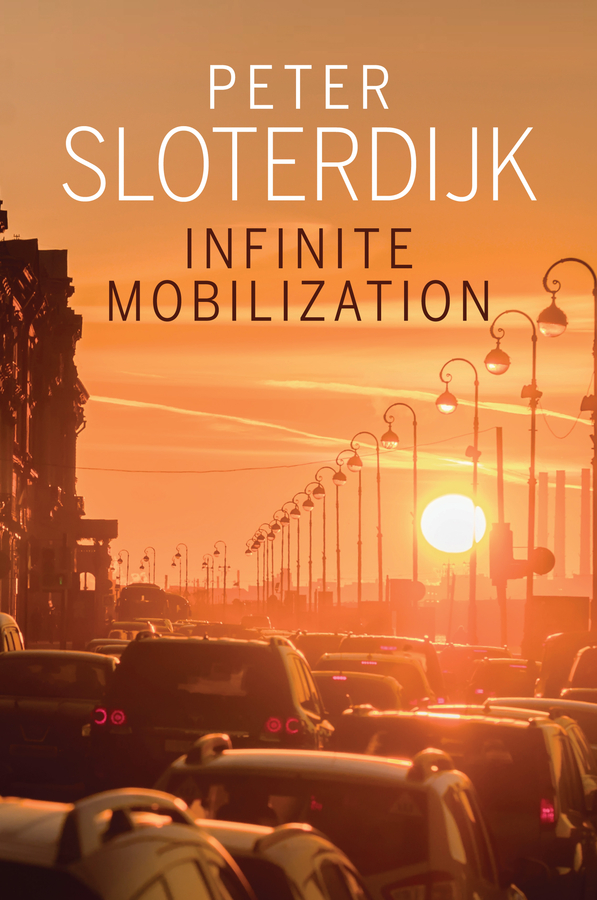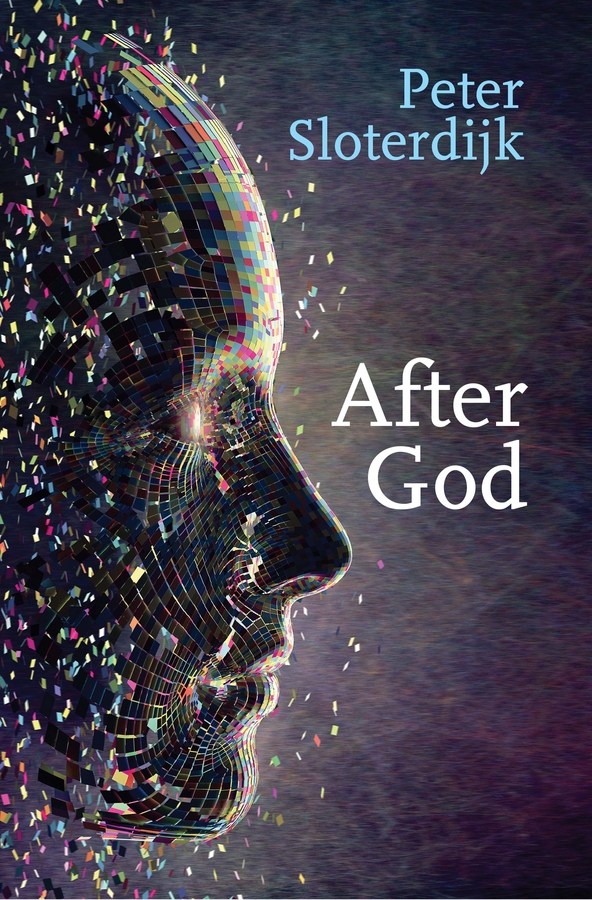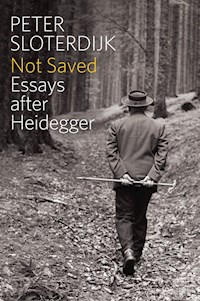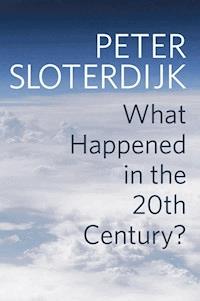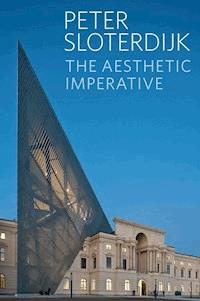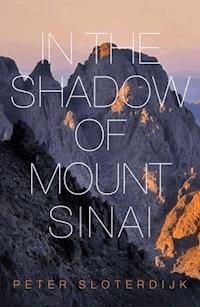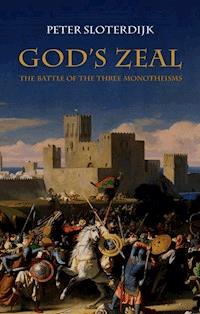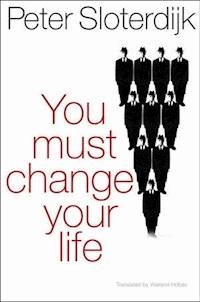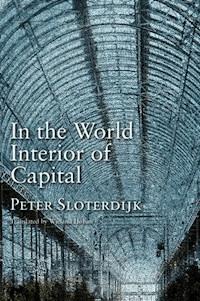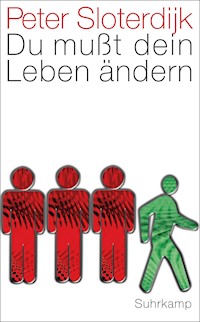
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In seinem neuen großen Essay über die Natur des Menschen betreibt Peter Sloterdijk Märchen-Kritik: Als Kritik des Märchens von der Rückkehr der Religion könnte man seine Thesen verstehen. Doch nicht die Religion kehrt zurück. Es verschafft sich vielmehr etwas ganz Fundamentales in der Gegenwart Raum: Der Mensch als Übender, als sich durch Übungen selbst erzeugendes Wesen. Rainer Maria Rilke hat den Antrieb zu solchen Exerzitien zu Beginn des 20. Jahrhunderts in die Form gefaßt: »Du mußt dein Leben ändern.« In seinem Plädoyer für die Ausweitung der Übungszone des einzelnen wie der Gesellschaft entwirft Peter Sloterdijk eine grundlegende und grundlegend neue Anthropologie. Den Kern seiner Wissenschaft vom Menschen bildet die Einsicht von der Selbstbildung alles Humanen. Seine Aktivitäten wirken unablässig auf ihn zurück: die Arbeit auf den Arbeiter, die Kommunikation auf den Kommunizierenden, die Gefühle auf den Fühlenden ... Es sind die ausdrücklich übenden Menschen, die diese Existenzweise am deutlichsten verkörpern: Bauern, Arbeiter, Krieger, Schreiber, Yogi, Rhetoren, Instrumentalvirtuosen oder Models. Ihre Trainingspläne und Höchstleistungen versammelt dieses Buch zu einer vergnüglich-instruktiven Lektüre von den Übungen, die erforderlich sind, ein Mensch zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Peter Sloterdijk fordert in seinem Bestseller eine grundlegende Veränderung der Sicht auf den Einzelnen und die Gesellschaft. Den Kern seiner Wissenschaft vom Menschen bildet die Einsicht von der Selbstbildung alles Humanen. Der Mensch, der sich als Übender immer wieder selbst erzeugt, wird zum über sich hinausgehenden Wesen.
In seiner großen Untersuchung zur Natur des Menschen versammelt Peter Sloterdijk Willensgymnastik und Höchstleistungen zu einer vergnüglich-instruktiven Lektüre von den Übungen, die erforderlich sind, ein Mensch zu sein und zu bleiben.
Peter Sloterdijk, geboren 1947, ist Professor für Ästhetik und Philosophie an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und deren Rektor.
Zuletzt erschienen von ihm: Scheintod im Denken (eu 28, 2010), Die nehmende Hand und die gebende Seite (2010) und Streß und Freiheit (2011).
Peter Sloterdijk
Du mußt dein Leben ändern
Über Anthropotechnik
Suhrkamp
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
ebook Suhrkamp Verlag Berlin 2013
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2009
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski
Umschlagabbildung:
Umschlagfotos: Jean Kobben / Fotolia.com
eISBN 978-3-518-74030-9
www.suhrkamp.de
INHALT
Einleitung: Zur anthropotechnischen Wende
Der Planet der Übenden
1Der Befehl aus dem Stein Rilkes Erfahrung
2Ferner Blick auf den asketischen Stern Nietzsches Antikeprojekt
3Nur Krüppel werden überlebenUnthans Lektion
4Letzte HungerkunstKafkas Artistik
5Pariser BuddhismusCiorans Exerzitien
Übergang: Religionen gibt es nichtVon Pierre de Courbertin zu L. Ron Hubbard
I Die Eroberung des Unwahrscheinlichen Für eine akrobatische Ethik
Programm
1HöhenpsychologieDie Hinaufpflanzungslehre und der Sinn von »Über«
2»Kultur ist eine Ordensregel«Lebensformen-Dämmerung, Disziplinik
3Schlaflos in EphesosVon den Dämonen der Gewohnheit und ihrer Zähmung durch die Erste Theorie
4Habitus und TrägheitVon den Basislagern des übenden Lebens
5Cur homo artistaVon der Leichtigkeit des Unmöglichen
II Übertreibungsverfahren
Prospekt: Rückzüge in die Ungewöhnlichkeit
6Erste ExzentrikVon der Absonderung der Übenden und ihren Selbstgesprächen
7Vollendete und UnvollendeteWie der Geist der Perfektion die Übenden in Geschichten verstrickt
8MeisterspieleVon den Trainern als Garanten der Übertreibungskunst
9Trainerwechsel und RevolutionÜber Konversionen und opportunistische Kehren .
III Die Exerzitien der Modernen
Perspektive: Wiederverweltlichung des zurückgezogenen Subjekts
10Kunst am MenschenIn den Arsenalen der Anthropotechnik
11Im auto-operativ gekrümmten RaumNeue Menschen zwischen Anästhesie und Biopolitik
12Übungen und FehlübungenZur Kritik der Wiederholung
Rückblick Von der Wiedereinbettung des Subjekts zum Rückfall in die totale Sorge
Ausblick
Ausführliches Inhaltsverzeichnis
Appamādena sampādetha.In Wachsamkeit strebt voran!
Mahaparinibbana Sutta, 6, 7.
Vor Allem und zuerst die Werke! Das heisst Übung, Übung, Übung!Der dazugehörige »Glaube« wird sich schon einstellen, – dessen seid versichert!
Friedrich Nietzsche, Morgenröthe
EINLEITUNGZUR ANTHROPOTECHNISCHEN WENDE
Ein Gespenst geht um in der westlichen Welt – das Gespenst der Religion. Landauf, landab wird uns von ihr versichert, nach längerer Abwesenheit sei sie unter die Menschen der modernen Welt zurückgekehrt, man tue gut daran, mit ihrer neuen Präsenz ernsthaft zu rechnen. Anders als das Gespenst des Kommunismus, der im Jahr 1848, als sein Manifest erschien, kein Wiederkehrer war, sondern eine Neuheit unter den drohenden Dingen, wird der aktuelle Spuk seiner wiedergängerischen Natur vollauf gerecht. Ob er nun tröstet oder droht, ob er als guter Geist begrüßt oder als irrationaler Schatten der Menschheit gefürchtet wird, sein Auftritt, ja schon dessen bloße Ankündigung, verschafft sich Respekt, wohin man sieht – sofern man die Sommeroffensive der Gottlosen von 2007 außer Betracht läßt, der wir zwei der oberflächlichsten Pamphlete der jüngeren Geistesgeschichte verdanken, gezeichnet: Christopher Hitchens und Richard Dawkins. Die Mächte des alten Europa haben sich zu einer pompösen Willkommensfeier verbündet – auf ihr versammeln sich ungleiche Gäste: der Papst und die islamischen Gelehrten, die amerikanischen Präsidenten und die neuen Kremlherren, alle Metterniche und Guizots unserer Tage, die französischen Kuratoren und die deutschen Soziologen.
Bei der versuchten Wiedereinsetzung der Religion in ihre ehemals verbrieften Rechte kommt ein Protokoll zum Tragen, das von den neu Bekehrten und frisch Faszinierten die Beichte ihrer bisherigen Verkennungen fordert. Wie in den Tagen des ersten Merowingers, der sich aufgrund einer gewonnenen Schlacht zum Kreuz bekannte, sollen auch heutigen Tags die Kinder der banalisierten Aufklärung verbrennen, was sie anbeteten, und anbeten, was sie verbrannten.1 Bei dieser Umkehr setzen sich versunkene liturgische Intuitionen in Szene. Sie verlangen von den Novizen der postsäkularen »Gesellschaft« eine öffentliche Distanzierung von den religionskritischen Lehrsätzen der aufklärerischen Jahrhunderte. Diesen war die menschliche Selbstbestimmung allein zu dem Preis erlangbar erschienen, daß die Sterblichen ihre an die Überwelt verschwendeten Kräfte zurückfordern und sie zur Optimierung der irdischen Verhältnisse einsetzen. Man mußte von »Gott« große Quanten an Energie abziehen, um endlich für die Menschenwelt in Form zu kommen. In dieser Kraftübertragung gründete der Elan des Zeitalters, das sich dem großen Singularwort »Fortschritt« verschrieben hatte. Die humanistische Angriffslust ging soweit, die Hoffnung zu einem Prinzip zu erklären. Aus dem Proviant der Verzweifelten sollte das primum mobile besserer Zeiten werden. Wer sich zu dieser ersten Ursache bekannte, wählte die Erde zum Einwanderungsland, um dort und nur dort sich zu verwirklichen. Ab nun hieß es, die Brücken zu den Sphären da droben abzubrechen und alle frei gewordenen Kräfte in die profane Existenz zu investieren. Wenn es Gott gäbe, er wäre damals die einsamste Größe im Universum geworden. Die Abwanderung aus dem Jenseits nahm Züge einer Massenflucht an – die aktuelle demographisch ausgedünnte Lage Osteuropas erscheint daneben wie Überbesiedlung. Daß die breite Masse, von Immanenzideologien unbeirrt, auch in den Tagen der triumphierenden Aufklärung sich ihre heimlichen Ausflüge über die Grenze gestattete, steht auf einem anderen Blatt.
Inzwischen haben ganz andere Antriebslagen die Oberhand gewonnen. Kompliziertere Wahrnehmungen der menschlichen Chance bestimmen die Lage. Die über sich selber ins Bild gesetzte Aufklärung hat ihre Paradoxien offengelegt, sie ist bis in die Bezirke vorgedrungen, wo die Dinge, um einen bekannten Erzähler zu zitieren, »kompliziert und traurig werden«. Vom alten unbedingten Vorwärts sind nur noch müde Reste in Gebrauch. Es fehlt nicht mehr viel, und die letzten Hoffnungsheger aufklärerischen Stils ziehen sich aufs Land zurück, als wären sie die Amish der Postmoderne. Andere ewig Progressive folgen den Rufen von Nicht-Regierungsorganisationen, die sich der Rettung der Welt verschrieben haben. Fürs übrige deuten die Zeichen der Zeit auf Revision und Regreß. Nicht wenige enttäuschte Zeitgenossen möchten sich an den Herstellern und Vertreibern ihrer progressiven Illusionen schadlos halten, als ob es möglich wäre, einen Verbraucherschutz für Ideen anzurufen. Der juristische Archetypus unseres Zeitalters, der Schadensersatzprozeß, springt auf weite Lebensbereiche über. Hat man nicht an seinen amerikanischen Spielformen gelernt, wie man am Anfang exorbitante Summen fordern muß, um am Ende des Advokatenkriegs auch nur halbwegs befriedigende Abfindungen zu erhalten? Ganz offen sinnen die Nachkommen der Himmelsvertriebenen auf üppige Reparationen, ja, sie wagen es, von epochalen Wiedergutmachungen zu träumen. Ginge es nach ihnen, sollte die Enteignung der Überwelt insgesamt rückgängig gemacht werden. Manche neureligiösen Unternehmer würden die stillgelegten metaphysischen Produktionsstätten am liebsten von heute auf morgen wieder in Betrieb nehmen, als habe man eine bloße Rezession hinter sich gebracht.
Europäische Aufklärung – eine Formkrise? Ein Experiment auf der schiefen Ebene zumindest, und im globalen Horizont gesehen eine Anomalie. Die Religionssoziologen sagen es unverblümt: Überall auf der Welt wird weiterhin kräftig geglaubt, nur bei uns hat man die Ernüchterung verherrlicht. Tatsächlich, warum sollten allein die Europäer metaphysisch Diät halten, wenn der Rest der Welt unbeirrt an den reich gedeckten Tischen der Illusion tafelt?
Ich darf daran erinnern: Marx und Engels hatten das Kommunistische Manifest in dem Vorsatz geschrieben, das Märchen von einem Gespenst namens Kommunismus durch eine angreiferische Selbstaussage des wirklichen Kommunismus zu ersetzen. Wo bloße Geisterfurcht vorgeherrscht hatte, sollte begründete Furcht vor einem realen Feind des Bestehenden entstehen. Auch das vorliegende Buch widmet sich der Kritik eines Märchens und ersetzt es durch eine positive These. In der Tat, dem Märchen von der Rückkehr der Religion nach dem »Scheitern« der Aufklärung muß eine schärfere Sicht auf die spirituellen Tatsachen entgegengestellt werden. Ich werde zeigen, daß eine Rückwendung zur Religion ebensowenig möglich ist wie eine Rückkehr der Religion – aus dem einfachen Grund, weil es keine »Religion« und keine »Religionen« gibt, sondern nur mißverstandene spirituelle Übungssysteme, ob diese nun in Kollektiven – herkömmlich: Kirche, Ordo, Umma, sangha – praktiziert werden oder in personalisierten Ausführungen – im Wechselspiel mit dem »eigenen Gott«, bei dem sich die Bürger der Moderne privat versichern. Damit wird die leidige Unterscheidung zwischen »wahrer Religion« und Aberglauben gegenstandslos. Es gibt nur mehr oder weniger ausbreitungsfähige, mehr oder weniger ausbreitungswürdige Übungssysteme. Auch der falsche Gegensatz zwischen den Gläubigen und Ungläubigen entfällt und wird durch die Unterscheidung zwischen Praktizierenden und Ungeübten bzw. anders Übenden ersetzt.
Tatsächlich kehrt heute etwas wieder – doch die geläufige Auskunft, es sei die Religion, die sich zurückmelde, kann kritische Nachfragen nicht befriedigen. Es handelt sich auch nicht um die Rückkehr einer Größe, die verschwunden gewesen wäre, sondern um einen Akzentwechsel in einem nie zertrennten Kontinuum. Das wirklich Wiederkehrende, das alle intellektuelle Aufmerksamkeit verdiente, hat eher eine anthropologische als eine »religiöse« Spitze – es ist, um es mit einem Wort zu sagen, die Einsicht in die immunitäre Verfassung des Menschenwesens. Nach mehrhundertjährigen Experimenten mit neuen Lebensformen hat sich die Einsicht abgeklärt, daß Menschen, gleichgültig unter welchen ethnischen, ökonomischen und politischen Bedingungen sie leben, nicht nur in »materiellen Verhältnissen«, vielmehr auch in symbolischen Immunsystemen und rituellen Hüllen existieren. Von deren Gewebe soll im folgenden die Rede sein. Warum ihre Webstühle hier mit dem kühlen Ausdruck »Anthropotechniken« bezeichnet werden, mag sich im Gang der Darstellung selbst erläutern.
Den ersten Schritt zur Rechtfertigung des Interesses an diesen Gegenständen möchte ich tun, indem ich an Wittgensteins bekannte Forderung erinnere, dem »Geschwätz über Ethik« ein Ende zu machen. Es ist inzwischen möglich, den Teil des ethischen Diskurses, der kein Geschwätz ist, in anthropotechnischen Ausdrücken zu reformulieren. Die Arbeit an dieser Übersetzung bildet – wenn auch noch unter anderen Namen – seit den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts die konfuse Mitte der modernen »Kulturstudien«. Für einen Augenblick war das ethische Programm der Gegenwart scharf ins Blickfeld gekommen, als Marx und die Junghegelianer die These artikulierten, der Mensch selbst erzeuge den Menschen. Was dieser Satz besagte, wurde im Nu von einem anderen Geschwätz verstellt, das von der Arbeit als der einzig wesentlichen Handlung des Menschen sprach. Wenn aber der Mensch tatsächlich den Menschen hervorbringt, so gerade nicht durch die Arbeit und deren gegenständliche Resultate, auch nicht durch die neuerdings viel gelobte »Arbeit an sich selbst«, erst recht nicht durch die alternativ beschworene »Interaktion« oder »Kommunikation«: Er tut es durch sein Leben in Übungen.
Als Übung definiere ich jede Operation, durch welche die Qualifikation des Handelnden zur nächsten Ausführung der gleichen Operation erhalten oder verbessert wird, sei sie als Übung deklariert oder nicht.2
Wer von der Selbsterzeugung des Menschen spricht, ohne von seiner Formung im übenden Leben zu reden, hat das Thema von vorneherein verfehlt. Wir müssen folglich praktisch alles, was über den Menschen als Arbeitswesen gesagt wurde, suspendieren, um es in die Sprache des Übens bzw. des selbstformenden und selbststeigernden Verhaltens zu übersetzen. Nicht nur der ermattete homo faber, der die Welt im Modus »Machen« vergegenständlicht, hat seinen Platz im Zentrum der logischen Bühne zu räumen, auch der homoreligiosus, der sich mit surrealen Riten an die Überwelt wendet, darf den verdienten Abschied nehmen. Gemeinsam treten Arbeitende und Gläubige unter einen neuen Oberbegriff. Es ist an der Zeit, den Menschen als das Lebewesen zu enthüllen, das aus der Wiederholung entsteht. Wie das 19. Jahrhundert kognitiv im Zeichen der Produktion stand, das 20. im Zeichen der Reflexivität, sollte die Zukunft sich unter dem Zeichen des Exerzitiums präsentieren.
Die Einsätze, um die gespielt wird, sind nicht niedrig. Es geht in unserem Unternehmen um nicht weniger als um die Einführung einer alternativen Sprache, und mit der Sprache einer veränderten Optik, für eine Gruppe von Phänomenen, für welche die Tradition Ausdrücke wie »Spiritualität«, »Frömmigkeit«, »Moral«, »Ethik« und »Askese« anzubieten pflegte. Gelingt das Manöver, so wird der herkömmliche Religionsbegriff, jener unselige Popanz aus den Kulissenhäusern des modernen Europa, als der große Verlierer aus diesen Untersuchungen hervorgehen. Gewiß, von jeher gleicht die Ideengeschichte einem Asyl für mißgeborene Begriffe – und nach dem folgenden Gang über die Stationen wird man nicht nur das Konzept »Religion« hinsichtlich seines verunglückten Designs durchschauen, ein Konzept, das an Schiefheit allein durch den Hyperpopanz »Kultur« übertroffen wird. Man wird dann auch verstehen, warum es angesichts der veränderten Expositionen ebenso sinnlos wäre, für die negative Bigotterie Partei zu ergreifen, die sich in unseren Breiten seit nahezu zwei Jahrhunderten als plakativer Atheismus präsentiert – ein Geßlerhut, den elegante Intellektuelle gerne grüßten, sooft sie an ihm vorbeikamen, nicht ohne bei dieser Gelegenheit das Prädikat »intellektuell redlich«, wahlweise: »kritisch« oder »autonom«, für sich in Anspruch zu nehmen. Es gilt jetzt, die ganze Bühne um 90 Grad zu drehen, bis sich das religiöse, spirituelle und ethische Material unter einem aufschlußgebenden neuen Winkel zeigt.
Die Einsätze sind hoch, ich wiederhole es. Wir haben gegen eine der massivsten Pseudo-Evidenzen der jüngeren Geistesgeschichte anzugehen: gegen den seit erst zwei- oder dreihundert Jahren in Europa grassierenden Glauben an die Existenz von »Religionen«, mehr noch, gegen den ungeprüften Glauben an die Existenz des Glaubens. Der Glaube an die Gegebenheit von »Religion« ist das Element, das Gläubige und Nicht-Gläubige heute wie gestern vereint. Er ist von einer Unbeirrbarkeit, der jeden Präfekten der römischen Glaubenskongregation vor Neid erblassen lassen müßte. Die Ökumene der Mißverständnisse hat die modernen Zeiten unangetastet überstanden. Kein Überwinder der Religion hat an der Existenz der Religion gezweifelt, so sehr man ihr jedes einzelne Dogma streitig machte. Keine Ablehnung hat dem Abgelehnten die Frage vorgelegt, ob es seinen Namen zu recht trüge und ob es als solches überhaupt Bestand habe. Allein aufgrund der Gewöhnung an eine Fiktion vergleichsweise jungen Datums – sie kam erst seit dem 17. Jahrhundert in Gebrauch – kann heute von einer »Wiederkehr der Religion« die Rede sein.3 Es ist der ungebrochene Glaube an die Religion als einer konstanten und universellen Größe, die gehen und wiederkommen kann, der der aktuellen Legende zugrunde liegt.
Während die Psychoanalyse auf dem Theorem von der Wiederkehr des Verdrängten aufbaute, geht eine Ideen- und Verhaltensanalyse wie die hier vorgelegte auf das Theorem von der Wiederkehr des Unverstandenen zurück. Rotationsphänomene dieses Typs sind unvermeidlich, solange das, was da war, untertaucht und wieder emporkommt, in seiner Eigenart nicht zureichend begriffen wurde. Bei dem Vorhaben, der Sache selbst auf den Grund zu gehen, ist nur voranzukommen, wenn man den Gegenstand weder bejaht noch ablehnt, vielmehr mit einer tiefer ansetzenden Explikation beginnt. Dies ist ein Projekt, das durch eine Vorhut von Forschern des 19. und frühen 20. Jahrhunderts auf den Weg gebracht wurde, wenngleich mit Mitteln, deren Unzulänglichkeit längst ins Auge springt – ich denke an Autoren wie Feuerbach, Comte, Durkheim und Weber. Immerhin, in ihren Untersuchungen nahmen die sogenannten Religionen als symbolisch geordnete Verhaltenssysteme nach und nach bestimmtere Konturen an – freilich wurden die Übungsnatur des »religiösen« Verhaltens und seine Fundierung in autoplastischen Prozeduren noch nirgendwo angemessen formuliert. Erst der spätere Nietzsche hat in seinen diätologischen Überlegungen der achtziger Jahre – man denke an die entsprechenden Seiten in seiner SelbstkreuzigungsschriftEcce homo – Ansätze zu einer Lebensübungslehre bzw. einer allgemeinen Asketologie vorgelegt. Mögen sie auch von flüchtigen Lesern als Rückzug der Philosophie auf das apothekarische Niveau mißverstanden worden sein,4 wer sie mit der gebührenden Aufmerksamkeit studiert, kann in ihnen die seminalen Ideen zu einer umfassenden Theorie des übenden Daseins entdecken.
Die hier vorgeschlagene Übersetzung der religiösen, spirituellen und ethischen Tatsachen in die Sprache und Optik der allgemeinen Übungstheorie versteht sich als ein aufklärungskonservatives Unternehmen – ja sogar ein konservatorisches in der Sache selbst. Ein doppeltes Bewahrungsinteresse liegt ihm zugrunde: Zum einen bekennt es sich zu dem Kontinuum kumulativen Lernens, das wir Aufklärung nennen und das wir Gegenwärtigen, allen Gerüchten von neuerdings eingetretenen »post-säkularen« Verhältnissen zum Trotz, als den inzwischen schon vier Jahrhunderte überspannenden Lernzusammenhang moderner Zeiten weitertragen; zum anderen nimmt es die zum Teil jahrtausendealten Fäden auf, die uns an frühe Manifestationen menschlichen Übungs- und Beseelungswissens binden, vorausgesetzt, wir sind bereit, explizit an ihnen anzuknüpfen.
Damit ist das Schlüsselwort für alles, was man von hier an lesen wird, hingeschrieben. Das Wort »explizit«, auf die bezeichneten Gegenstände angewendet, enthält das folgende Buch in nuce. Die erwähnte Drehung der geistesgeschichtlichen Bühne bedeutet nichts anderes als ein logisches Manöver zur Explizitmachung von Verhältnissen, die in den Überlieferungsmassen unter »impliziten«, sprich: in sich eingefalteten und zusammengedrängten Formen vorliegen. Wenn Aufklärung in technischer Hinsicht das Programmwort für den Fortschritt im Bewußtsein der Explizitheit darstellt, darf man ohne Scheu vor großen Formeln sagen, daß die Explizitmachung des Impliziten die kognitive Form des Schicksals ist. Wäre es anders, hätte man zu keiner Zeit glauben dürfen, das spätere Wissen müsse zugleich das bessere sein – auf dieser Annahme beruht bekanntlich alles, was wir seit Jahrhunderten mit dem Ausdruck »Forschung« belegen. Nur wenn die eingefalteten »Dinge« oder Sachverhalte von ihnen selbst her einer Tendenz unterliegen, sich auszufalten und für uns verständlicher zu werden, darf man – sofern die Ausfaltung gelingt – von wirklichem Wissenszuwachs sprechen. Allein sofern die »Materien« spontan bereit sind (oder sich durch aufgezwungene Untersuchung nötigen lassen), in vergrößerten und besser ausgeleuchteten Flächen ans Licht zu kommen, kann man im Ernst – und Ernst meint hier ontologischen Nachdruck – behaupten: Es gibt Wissenschaft in progress, es gibt reale Erkenntnisgewinne, es gibt Expeditionen, durch welche wir, das epistemisch engagierte Kollektiv, in verhüllte Wissenskontinente vordringen, indem wir bisher Unthematisches thematisch machen, noch Unbekanntes ans Licht bringen und nur dunkel Mitgewußtes in ausdrücklich Gewußtes umwandeln. Auf diese Weise mehren wir das kognitive Kapital unserer Gesellschaft – das letztere Wort hier ohne Anführungszeichen. Früher hätte man wohl gesagt, die Arbeit des Begriffs münde in eine »Produktion«. Hegel ging so weit, zu erklären, die Wahrheit sei wesenhaft Resultat – sie stehe darum unvermeidlich erst am Ende ihres Dramas. Wo sie sich in fertiger Gestalt enthülle, feiere der menschliche Geist den Sonntag des Lebens. Da ich mich hier nicht mit dem Begriff des Begriffs befassen möchte und mit dem Konzept Arbeit etwas anderes vorhabe, begnüge ich mich mit einer etwas weniger triumphalen, doch nicht weniger verbindlichen These: Es gibt kognitiv Neues unter der Sonne.
Die Neuheit des Neuen geht, wie bemerkt, zurück auf die Auseinanderfaltung des Bekannten in größere, hellere, profilreichere Oberflächen. Sie kann infolgedessen nie im absoluten Sinn innovativ sein, sie bildet stets auch die Fortsetzung des kognitiv Vorhandenen mit anderen Mitteln. Dabei laufen Neuheit und höhere Explizitheit auf eins hinaus. Daher gilt: Je höher der Explikationsgrad, desto tiefer die mögliche, ja unumgängliche Befremdlichkeit des neu erworbenen Wissens. Daß dieser Tisch aus Kirschholz gemacht sei, habe ich bisher als eine konventionelle Tatsache gelten lassen. Daß sich das Kirschholz aus Atomen zusammensetze, nehme ich mit der Duldsamkeit des Gebildeten zur Kenntnis, obschon die vielzitierten Atome, diese epistemologischen Zeitgenossen des 20. Jahrhunderts, in ihrem Realitätswert für mich noch immer mit Einhornpulver und Saturneinflüssen auf einer Stufe stehen. Daß sich die Kirschholzatome bei weiterer Explikation in einen Nebel aus subatomaren Beinahe-Nichtsen auflösen: Auch dies muß ich als Endabnehmer der physikalischen Aufklärung akzeptieren, selbst wenn hierdurch meine Annahmen über die Substanzialität der Substanz entschieden verletzt werden. Die letzte Erklärung illustriert mir am nachdrücklichsten, wie das spätere Wissen dazu tendiert, das befremdlichere zu sein.
In der Fülle der kognitiven Neuheiten unter der modernen Sonne gibt es keine, die an Folgenreichtum auch nur von ferne mit dem Auftauchen und Bekanntwerden der Immunsysteme in der Biologie des späten 19. Jahrhunderts vergleichbar wäre. Seither kann in den Wissenschaften von den Integritäten – den animalischen Organismen, den Arten, den »Gesellschaften«, den Kulturen – nichts mehr so bleiben, wie es war. Erst zögernd hat man begonnen zu verstehen, daß es die Immundispositive sind, durch welche die sogenannten Systeme erst eigentlich zu Systemen werden, die Lebewesen zu Lebewesen, die Kulturen zu Kulturen. Allein aufgrund ihrer immunitären Qualitäten steigen sie auf in den Rang von selbstorganisierenden Einheiten, die sich unter ständigem Bezug auf eine potentiell wie aktuell invasive und irritationenträchtige Umwelt erhalten und reproduzieren. Diese Leistungen sind bei den biologischen Immunsystemen – deren Entdeckung auf die Forschungen von Ilja Metschnikow und der Schüler Robert Kochs, namentlich Paul Ehrlich, am Ende des 19. Jahrhunderts zurückgehen – besonders eindrucksvoll ausgebildet. An ihnen läßt sich die verblüffende Idee ablesen, wonach schon relativ einfache Lebewesen wie Insekten und Mollusken eine Art angeborenes »Vorauswissen« von den insekten- und molluskentypischen Lebensrisiken in sich tragen. Folglich kann man die Immunsysteme dieses Niveaus als verkörperte Verletzungserwartungen und als entsprechende Schutz- und Reparaturprogramme a priori definieren.
Unter diesem Licht gesehen, erscheint das Leben selbst als eine mit autotherapeutischen oder »endoklinischen« Kompetenzen ausgestattete Integrationsdynamik, die sich auf einen artspezifischen Überraschungsraum bezieht. Ihm kommt eine ebenso angeborene wie – bei höheren Organismen – adaptiv erworbene Zuständigkeit für die Verletzungen und Invasionen zu, die ihm in der fest zugeordneten Umwelt oder in der eroberten Umgebung regelmäßig begegnen. Solche Immunsysteme könnte man ebensogut als organismische Vorformen eines Sinns für Transzendenz beschreiben: Dank der ständig sprungbereiten Effizienz dieser Vorrichtungen setzt sich das Lebewesen mit seinen potentiellen Todbringern aktiv auseinander und stellt ihnen sein körpereigenes Vermögen zur Überwindung des Tödlichen entgegen. Solcher Leistungen wegen hat man Immunsysteme dieses Typs mit einer »Körperpolizei« oder einer Grenzschutztruppe verglichen. Da es aber schon auf dieser Ebene um die Aushandlung eines modus vivendi mit fremden und unsichtbaren Mächten geht – und ferner, sofern diese todgebend sein können, mit »höheren« und »unheimlichen« Mächten –, liegt hier eine Vorstufe des Verhaltens vor, das man in menschlichen Kontexten als religiöses oder spirituelles zu bezeichnen gewohnt ist. Für jeden Organismus ist seine Umwelt seine Transzendenz, und je abstrakter und unbekannter die Gefahr ist, die von der Umwelt her droht, desto transzendenter steht sie ihm gegenüber.
Jede Geste des »Hineingehaltenseins« ins Offene, um mit Heidegger zu reden, schließt das zuvorkommende Gefaßtsein des lebenden Systems auf die Begegnung mit potentiell todgebenden Irritations- und Invasionsmächten ein. »Mit allen Augen sieht die Kreatur/das Offene«, statuiert Rilke am Beginn der Achten Elegie – das Leben selbst ist ein Exodus, der Inneres auf Umwelt bezieht. Der Zug ins Offene geschieht evolutionär mehrstufig: Obwohl praktisch alle Organismen oder Integritäten in die Überraschungs- und Konflikträume erster Stufe transzendieren, die ihnen jeweils als ihre Umwelten zugeordnet sind (sogar Pflanzen tun dies, und Tiere um so mehr), erreichen nur die wenigsten – soviel wir wissen allein die Menschen – die Transzendenzbewegung zweiter Stufe. Kraft dieser wird die Umwelt zur Welt entgrenzt, als Integral aus Manifestem und Latentem. Der zweite Schritt ist das Werk der Sprache. Diese errichtet nicht nur das »Haus des Seins« – Heidegger entlieh die Wendung bei Zarathustras Tieren, die dem Genesenden vorhalten: »ewig baut sich neu das Haus des Seins«; sie ist auch das Vehikel für die hausflüchtigen Tendenzen, mit denen der Mensch kraft seiner inneren Überschüsse dem Offenen entgegengeht. Unnötig zu erklären, warum erst beim zweiten Transzendieren der älteste Parasit der Welt, die Überwelt, in Erscheinung tritt.
Ich verzichte darauf, schon jetzt die Konsequenzen dieser Überlegungen für den Humanbereich anzudeuten. Vorläufig genügt es, festzuhalten, daß die Fortsetzung der biologischen Evolution in der sozialen und kulturellen zu einer Aufstufung der Immunsysteme führt. Wir haben Grund, bei Menschen nicht bloß mit einem einzigen Immunsystem zu rechnen, dem biologischen, das in evolutionärer Sicht an erster, in entdeckungsgeschichtlicher jedoch an letzter Stelle steht. In der Humansphäre existieren nicht weniger als drei Immunsysteme, die in starker kooperativer Verschränkung und funktionaler Ergänzung übereinandergeschichtet arbeiten: Über dem weitgehend automatisierten und bewußtseinsunabhängigen biologischen Substrat haben sich beim Menschen im Lauf seiner mentalen und soziokulturellen Entwicklung zwei ergänzende Systeme zur vorwegnehmenden Verletzungsverarbeitung herausgebildet: zum einen die sozio-immunologischen Praktiken, insbesondere die juristischen und solidaristischen, aber auch die militärischen, mit denen Menschen in »Gesellschaft« ihre Konfrontationen mit fern-fremden Aggressoren und benachbarten Beleidigern oder Schädigern abwickeln;5 zum anderen die symbolischen beziehungsweise psycho-immunologischen Praktiken, mit deren Hilfe es den Menschen von alters her gelingt, ihre Verwundbarkeit durch das Schicksal, die Sterblichkeit inbegriffen, in Form von imaginären Vorwegnahmen und mentalen Rüstungen mehr oder weniger gut zu bewältigen.6 Es gehört zur Ironie dieser Systeme, daß sie einer Explikation ihrer dunklen Seite fähig sind, obwohl sie von Anfang an bewußtseinsabhängig existieren und sich für selbsttransparente Größen halten. Sie funktionieren nicht hinter dem Rücken der Subjekte, sondern sind ganz in deren intentionales Verhalten eingebettet – nichtsdestoweniger ist es möglich, dieses Verhalten besser zu verstehen, als es von seinen naiven Agenten verstanden wird. Weil es sich so verhält, ist Kulturwissenschaft möglich; und weil nicht-naiver Umgang mit symbolischen Immunsystemen heute zu einer Überlebensbedingung der »Kulturen« selbst geworden ist, ist Kulturwissenschaft nötig.7
Wir werden es in diesem Buch naturgemäß vor allem mit den Manifestationen der dritten Immunitätsebene zu tun bekommen. Ich trage Materialien zur Biographie des homo immunologicus zusammen, wobei ich mich durch die Annahme leiten lasse, hier sei vor allem der Stoff zu finden, aus dem die Anthropotechniken sind. Ich verstehe hierunter die mentalen und physischen Übungsverfahren, mit denen die Menschen verschiedenster Kulturen versucht haben, ihren kosmischen und sozialen Immunstatus angesichts von vagen Lebensrisiken und akuten Todesgewißheiten zu optimieren. Erst wenn diese Prozeduren in einem breiten Tableau der menschlichen »Arbeiten an sich selbst« erfaßt sind, lassen sich die jüngsten gentechnischen Experimente evaluieren, auf die man in der aktuellen Debatte den 1997 wiedergeprägten Begriff »Anthropotechnik« gern verengt.8 Was ich zu diesem Gegenstand aus heutiger Sicht zu sagen habe, werde ich im Gang der Darstellung ad hoc einflechten. Die Tendenz meiner Stellungnahme läßt sich bereits am Titel dieses Buchs ablesen: Wer darauf achtet, daß es heißt: »Du mußt dein Leben ändern!« und nicht: »Du sollst das Leben verändern!«, hat schon im ersten Durchgang verstanden, worauf es ankommt.9
Der Held der folgenden Geschichte, der homo immunologicus, der seinem Leben mitsamt dessen Gefährdungen und Überschüssen eine symbolische Fassung geben muß, ist der mit sich selbst ringende, der um seine Form besorgte Mensch – wir werden ihn als den ethischen Menschen näher charakterisieren oder besser: als den homo repetitivus, den homo artista, den Menschen im Training. Keine der kuranten Verhaltens- und Handlungstheorien ist imstande, den übenden Menschen zu erfassen – im Gegenteil, wir werden verstehen, wieso die bisherigen Theorien ihn systematisch zum Verschwinden bringen mußten, egal, ob sie das beobachtete Feld in Arbeit und Interaktion einteilten oder in Verfahren und Kommunikationen oder in aktives und kontemplatives Leben. Mit einem anthropologisch breit fundierten Übungsbegriff bekommen wir endlich das Instrument in die Hand, um die methodisch angeblich unüberwindliche Kluft zwischen den biologischen und den kulturellen Immunitätsphänomenen, also zwischen natürlichen Prozessen einerseits, Handlungen andererseits, zu überbrücken.
Daß von der einen Sphäre in die andere keine direkten Übergänge offenstehen, ist in endlosen Diskussionen über die Differenz von Natur- und Kulturphänomenen – und über die Methoden ihrer wissenschaftlichen Erschließung – oft genug behauptet worden. Die Forderung nach einem Direktübergang stellt jedoch eine überflüssige Schikane dar, von der man sich nicht beirren lassen sollte. Auf ihr bestehen bezeichnenderweise vor allem diejenigen, die für die hierzulande so genannten Geisteswissenschaften ein von metaphysischen Zäunen abgeschirmtes Reservat reklamieren. Manche Verteidiger der Geisteswelt wollen den Graben zwischen Naturereignissen und Freiheitswerken so tief wie möglich ausheben – nötigenfalls bis in die Abgründe eines ontologischen Dualismus, vorgeblich um die Kronkolonien des Geistigen vor naturalistischen Übergriffen zu bewahren. Wir werden sehen, was hiervon zu halten ist.
In Wahrheit steht der Übergang von der Natur in die Kultur und umgekehrt seit jeher weit offen. Er führt über eine leicht zu betretende Brücke – das übende Leben. Für ihre Errichtung haben die Menschen sich engagiert, seit es sie gibt – vielmehr, es gibt die Menschen erst dadurch, daß sie sich für besagten Brückenbau verwenden. Der Mensch ist das pontifikale Lebewesen, das von den ältesten Stadien seiner Evolution an zwischen den Brückenköpfen in der Leiblichkeit und denen in den Kulturprogrammen traditionstaugliche Bögen schlägt. Von vorneherein sind Natur und Kultur durch eine breite Mitte aus verkörperten Praktiken verbunden – in ihr haben die Sprachen, die Rituale und die Handgriffe der Technik ihren Sitz, sofern diese Instanzen die universalen Gestalten automatisierter Künstlichkeiten verkörpern. Diese Zwischenzone bildet eine formenreiche, variabel-stabile Region, die sich mit konventionellen Ausdrücken wie Erziehung, Sitte, Gewohnheit, Habitusformung, Training und Exerzitium vorläufig hinreichend klar bezeichnen läßt – ohne daß man auf die Vertreter der »Humanwissenschaften« warten müßte, die mit ihrem Kultur-Getöse für die Verwirrung sorgen, zu deren Auflösung sie dann ihre Dienste anbieten. In diesem »Garten des Menschlichen« – um an eine geglückte nichtphysikalische Formel des Physikers Carl Friedrich von Weizsäcker zu erinnern10– werden die folgenden Untersuchungen ihre Gegenstände finden. Gärten sind umfriedete Bezirke, in denen Gewächse und Künste zusammentreffen. Sie bilden »Kulturen« in einem unkompromittierten Sinn des Wortes. Wer die Gärten des Menschlichen betritt, stößt auf die mächtigen Schichten geregelter innerer und äußerer Handlungen mit immunsystemischer Tendenz über biologischen Substraten. Angesichts der weltweiten Kulturenkrise, zu der auch die eingangs erwähnten gespenstischen neu-religiösen Episoden zählen, ist es kein bloßes akademisches Plaisir, wenn die Explikation dieses Bereichs auf die Tagesordnung der Zivilisationsparlamente gesetzt wird.11
Eine übungsanthropologische Studie kann aus internen Gründen unmöglich unengagiert und unparteilich verfahren. Dies ergibt sich aus dem Umstand, daß jeder Diskurs über »den Menschen« früher oder später über die Grenzen der bloßen Beschreibung hinausgeht und normative Ziele verfolgt – ob diese nun offengelegt werden oder nicht. Zu keiner Zeit war das deutlicher zu erkennen als in der frühen europäischen Aufklärung, als die Anthropologie als die ursprüngliche »bürgerliche Wissenschaft« aus der Taufe gehoben wurde. Damals begann die neue Wissenschaft vom Menschen sich als das moderne Paradigma von Philosophie vor die überlieferten Disziplinen der Logik, der Ontologie und der Ethik zu schieben. Wer sich in die Debatte über den Menschen einschaltete, tat dies, um – »progressiv« – die Gleichung von Bürger und Mensch geltend zu machen, wobei man entweder die Adligen als Sezessionisten der Menschheit abschaffen wollte oder die Menschheit insgesamt in den Adelsstand zu erheben suchte, oder um – »reaktionär« – den Menschen als das erbsündige, korrumpierte und labile Tier zu portraitieren, das man in seinem eigenen Interesse besser nie aus der Hand seiner Zuchtmeister, mittelalterlich gesprochen: seiner correctores, entläßt.
Die unüberwindbare Parteilichkeit der anthropologischen Theorie ist mit der Natur des Gegenstands intim verflochten. Denn sosehr die allgemeine Rede über »den Menschen« von einem egalitaristischen Pathos durchdrungen ist, ob es sich nun um die reale oder behauptete Gleichheit der Menschen vor dem biologischen Gattungserbe handelt oder um die virtuelle Gleichwertigkeit der Kulturen vor dem Gerichtshof der Überlebenswürdigkeit: Sie muß doch stets der Tatsache Rechnung tragen, daß Menschen unumgänglich unter vertikalen Spannungen stehen, in allen Epochen und in sämtlichen Kulturräumen. Wo immer man Menschenwesen begegnet, sind sie in Leistungsfelder und Statusklassen eingebettet. Der Verbindlichkeit solcher Hierarchiephänomene kann sich selbst der äußere Beobachter nicht ganz entziehen, sosehr er sich um die Einklammerung seiner Stammesidole bemüht. Ganz offensichtlich gibt es gewisse Meta-Idole, deren Autorität sich kulturenübergreifend geltend macht – es handelt sich offensichtlich um Universalien der Leistungsrollen, der Statuserkennung und der Exzellenz, von denen sich niemand emanzipieren kann, beim Eigenen sowenig wie beim Fremden, ohne in die Position des Barbaren zu geraten.
Fatalerweise liefert der Terminus »Barbar« das Paßwort, das den Zugang zu den Archiven des 20. Jahrhunderts öffnet. Es bezeichnet den Leistungsverächter, den Vandalen, den Statusleugner, den Ikonoklasten, den Verweigerer der Anerkennung für jede Art von Ranking-Regel und Hierarchie. Wer das 20. Jahrhundert verstehen will, muß stets den barbarischen Faktor im Auge behalten. Gerade für die jüngere Moderne war und blieb es typisch, eine Allianz zwischen Barbarei und Erfolg vor großem Publikum zuzulassen, anfangs mehr unter der Form von trampelhaftem Imperialismus, heute in den Kostümen der invasiven Vulgarität, die durch die Vehikel der Popularkultur in praktisch alle Bereiche vordringt. Daß die barbarische Position im Europa des 20. Jahrhunderts selbst unter den Vertretern der Hochkultur zeitweilig als wegweisend galt, bis hin zu einem Messianismus der Unbildung, ja einer Utopie des Neuanfangs auf der leeren Tafel der Ignoranz, illustriert das Ausmaß der Zivilisationskrise, die dieser Kontinent in den vergangenen einhundertfünfzig Jahren durchlaufen hat – die Kulturrevolution nach unten inbegriffen, die in unseren Breiten das 20. Jahrhundert durchzieht und ihren Schatten auf das 21. Jahrhundert vorauswirft.
Da die nachfolgenden Seiten vom übenden Leben handeln, führen sie, ihrem Gegenstand entsprechend, zu einer Expedition in das wenig erforschte Universum der menschlichen Vertikalspannungen. Der platonische Sokrates hatte das Phänomen für die okzidentale Kultur erschlossen, als er expressis verbis davon sprach, der Mensch sei das Wesen, das potentiell »sich selbst überlegen« ist.12 Ich übersetze diesen Hinweis in die Beobachtung, daß alle »Kulturen«, »Subkulturen« oder »Szenen« auf Leitdifferenzen aufbauen, mit deren Hilfe das Feld menschlicher Verhaltensmöglichkeiten in polarisierte Klassen unterteilt wird. So kennen die asketischen »Kulturen« die Leitdifferenz Vollkommen versus Unvollkommen, die »religiösen« »Kulturen« die Leitdifferenz Heilig versus Profan, die aristokratischen »Kulturen« die von Vornehm versus Gemein, die militärischen »Kulturen« die von Tapfer versus Feige, die politischen »Kulturen« die von Mächtig versus Ohnmächtig, die administrativen »Kulturen« die von Vorgesetzt versus Nachgeordnet, die athletischen »Kulturen« die von Exzellenz versus Mittelmaß, die ökonomischen »Kulturen« die von Fülle versus Mangel, die kognitiven »Kulturen« die von Wissen versus Unwissen, die sapientalen »Kulturen« die von Erleuchtung versus Verblendung.13 Was diese Differenzierungen durchweg gemeinsam haben, ist die Parteinahme für den ersten Wert, der im jeweiligen Feld als Attraktor gilt, während dem zweiten Pol durchwegs die Funktion eines Repulsionswerts oder einer Vermeidungsgröße zukommt.
Was ich hier die Attraktoren nenne, sind ihrer Wirkungsweise nach die Richtgrößen von Vertikalspannungen, die in psychischen Systemen für Orientierung sorgen. Die Anthropologie darf die Wirklichkeit solcher Größen nicht länger außer Betracht lassen, will sie an den entscheidenden Vektoren der conditio humana nicht vorbeireden. Nur aus der Wahrnehmung der »von oben« her ansetzenden Zugkräfte läßt sich begreiflich machen, warum und unter welchen Formen sich der homo sapiens, den uns die Paläontologen bis in den Eingangsbereich der geisteswissenschaftlichen Fakultät anliefern, zu dem aufsteigenden Tendenztier hat entwickeln können, als das die Befunde der Ideenhistoriker und der Weltreisenden ihn mehr oder weniger unisono beschreiben. Wo immer man den Angehörigen der humanen Gattung begegnet, sie verraten überall die Züge eines Wesens, das zur surrealistischen Anstrengung verurteilt ist. Wer Menschen sucht, wird Akrobaten finden.
Der Hinweis auf den Pluralismus der Leitunterscheidungen soll nicht nur auf die Betriebsbedingungen der vielfältigen »Kulturen« oder »Szenen« aufmerksam machen. Ein solcher Pluralismus der Leitunterscheidungen deutet auch eine Erklärung an, wie es in der Geschichte der »Kulturen«, zumal in ihren heißeren und kreativeren Phasen, zu Überlagerungen und Vermischungen der anfangs geschiedenen Bereiche, zu Umkehrungen der Wertvorzeichen und Überkreuzungen der Disziplinen hat kommen können – zu Phänomenen mithin, die den bis heute attraktiven Formen von Spiritualität und Zivilisiertheit zugrunde liegen. Weil die Leitunterscheidungen aus ihrem ursprünglichen Feld auswandern können, um sich erfolgreich in fremden Zonen einzunisten, gibt es die spirituellen Chancen, die uns noch immer als die höheren und höchsten Möglichkeiten des Menschen faszinieren: Dazu rechnen eine nicht-ökonomische Definition von Reichtum; eine nicht-aristokratische Definition des Vornehmen; eine nicht-athletische Definition von Spitzenleistung; eine nichtherrschaftliche Definition von Oben; eine nicht-asketische Definition von Vollkommenheit; eine nicht-militärische Definition von Tapferkeit, eine nicht-bigotte Definition von Weisheit und Treue.
Um diese vorbereitenden Bemerkungen abzuschließen, möchte ich ein zusätzliches Wort über die Parteilichkeit des vorliegenden Buchs sagen und einen Warnhinweis auf ein naheliegendes Mißverständnis geben. Die folgenden Untersuchungen gehen von ihrem eigenen Ergebnis aus: Sie bezeugen die Erfahrung, daß es Gegenstände gibt, die ihrem Kommentator keine vollkommene epochè, keinen Rückzug in die Interesselosigkeit, gestatten, auch wenn die Zeichen auf Theorie stehen – somit auf Abstinenz von Vorurteilen, Kapricen und eifernden Obsessionen. Mit einem solchen Gegenstand, der seinen Analytiker nicht in Ruhe läßt, haben wir es hier zu tun. Es wäre dem Thema nicht gemäß, wollte sich der Autor ganz hinter dem Zaun der Absichtslosigkeit verbergen. Die Materie selbst verwickelt ihre Adepten in eine unentrinnbare Selbstbezüglichkeit, indem sie ihnen den übenden – den »asketischen«, formfordernden und habitusbildenden – Charakter ihres eigenen Verhaltens vor Augen stellt. In seiner Abhandlung über die Götterkämpfe, die dem antiken dionysischen Theater zugrunde liegen, hatte der junge Nietzsche notiert: »Ach! Es ist der Zauber dieser Kämpfe, dass, wer sie schaut, sie auch kämpfen muss!«14 Auf analoge Weise wird eine Anthropologie des übenden Lebens von ihrem Gegenstand infiziert. Beim Umgang mit Übungen, Askesen und Exerzitien, sie seien als solche deklariert oder nicht, stößt der Theoretiker unweigerlich auf seine eigene Verfaßtheit, jenseits von Bejahung und Verneinung.
Dasselbe gilt für das Phänomen der Vertikalspannungen, ohne die es keine absichtsvollen Übungen gibt. Hinsichtlich Spannungen dieser Art wird der Theoretiker nichts unternehmen, um seine Befangenheit abzuwehren – von der üblichen Bereitschaft zur Abklärung des Befangenmachenden abgesehen. Das anthropologische Studium begreift die Affektion durch die Sache selbst als Zeichen seiner philosophischen Ausrichtung. Tatsächlich stellt die Philosophie den Modus des Denkens dar, der durch die radikalste Form der Voreingenommenheit geprägt ist – die Passion des In-der-Welt-Seins. Die Leute vom Fach als einzige ausgenommen, spürt praktisch jeder, daß philosophisch alles ohne Belang bleibt, was weniger als dieses Passionsspiel bietet. Für die umfassend absorbierenden Beschäftigungen des Menschen schlagen Kulturanthropologen den schönen Terminus deep play vor. Aus der Perspektive einer Theorie des übenden Lebens ist zu ergänzen: Die tiefen Spiele sind diejenigen, die von den Höhen bewegt werden.
Zuletzt die Warnung vor dem Mißverständnis, von dem ich behauptete, es läge nahe. Es folgt aus dem Umstand, daß gegenwärtig eine Vielzahl von »religiös« Interessierten an einer breit angelegten anti-naturalistischen Mobilmachung teilnimmt, mit deren Hilfe die vorgeblichen wie die tatsächlichen Übergriffe der reduktiven Wissenschaften auf die geheiligten Bezirke des Erlebten und des qualitativ Empfundenen abgewehrt werden sollen. Man versteht unmittelbar, wie die Argumente gegen den Naturalismus der epistemologischen Frühverteidigung von Glaubenstatbeständen dienen. Wer das Erlebte in eine innere Burg versetzt, welche die szientistischen Sarazenen von heute und morgen nicht erobern können, darf fürs erste glauben, genug getan zu haben, um diese empfindlichen Güter unter philosophischen Schutz zu stellen. Damit werden, wenn schon nicht die Glaubensinhalte selbst, so doch die Bedingungen der Möglichkeit von Gläubigkeit überhaupt abgesichert. Was man den Naturalisten – heute vor allem durch forsche Neurologen vertreten – vorhält, und in der Regel zu Recht, ist ihre vom Fach her vorgegebene Neigung, die Tatsachen des Bewußtseins in funktionaler Verfremdung und äußerer Reflexion aufzufassen, ohne dem unauflösbaren Eigensinn von Vorstellungsinhalten, wie sie in der Erste-Person-Perspektive auftreten, gerecht werden zu können.
An die Adresse derer gerichtet, die mit diesen Denkfiguren umgehen,15 möchte ich erklären, daß die folgenden Untersuchungen in ihrem Kernbereich weder naturalistische noch funktionalistische Interessen bedienen, obschon mir die Wahrung der Chance von Anschlüssen an die Ergebnisse solcher Forschungen auch von der »Geist-Seite« her wünschenswert erscheint – insbesondere unter dem bereits erwähnten immunologischen Aspekt. Wenn es in meinem Vorhaben zu einer Verfremdung oder stellenweise provozierenden Neubeschreibung der Gegenstände kommt, dann nicht, weil externe Logiken an sie herangetragen werden, wie man es etwa beobachtet, wenn Neurowissenschaftler über Christologie16 oder Genetiker über die DNA von Monotheisten sprechen.17 Die Verfremdung, die von meinen theoretischen Übungen ausgeht, falls sie als solche empfunden wird, erklärt sich ausschließlich durch interne Übersetzungen, dank welcher die anthropotechnischen Binnensprachen in den spirituellen Systemen selbst explizit gemacht werden. Die hier so genannten Binnensprachen sind, so läßt sich zeigen, bereits in den zahllosen »religiös« oder ethisch codierten Übungssystemen enthalten, so daß ihre Explizitmachung keine Überfremdung mit sich bringt. Mit ihrer Hilfe wird das, was die heiligen Schriften und altehrwürdigen Regeln von sich aus sagen, in einer dicht anschließenden Alternativsprache noch einmal gesagt. Wiederholung plus Übersetzung plus Generalisierung ergibt, richtig gerechnet, Verdeutlichung. Wenn so etwas wie Progress in Religion existiert: Er kann sich nur als wachsende Explizitheit manifestieren.
Der Planet der Übenden
1 DER BEFEHL AUS DEM STEINRILKES ERFAHRUNG
Ich stelle zunächst ein ästhetisches Exempel vor, um das Phänomen der Vertikalspannungen und ihre Bedeutung für die Reorientierung der konfusen Existenz moderner Menschen zu erläutern: Rainer Maria Rilkes bekanntes Sonett Archaïscher Torso Apollos, das den Zyklus Der Neuen Gedichte Anderer Teil aus dem Jahr 1908 eröffnet. Der Ansatz bei einem dichterischen Text scheint günstig – abgesehen davon, daß ich aus ihm den Titel dieses Buchs entliehen habe –, weil ein solcher wegen seiner Zugehörigkeit zum künstlerischen Feld weniger gefährdet ist, jene anti-autoritären Reflexe zu provozieren, die sich heute bei Berührungen mit dogmatisch Gesagtem oder aus der Höhe Gesprochenem nahezu zwanghaft einstellen – »was heißt schon Höhe!« Am ästhetischen Gebilde, und nur an ihm, haben wir gelernt, uns einer nicht-versklavenden Form von Autorität, einer nicht-repressiven Erfahrung von Rangdifferenz auszusetzen. Das Kunstwerk darf sogar uns, den der Form Entlaufenen, noch etwas »sagen«, weil es ganz offensichtlich nicht die Absicht verkörpert, uns zu beengen. »La poésie ne s'impose plus, elle s'expose.«18 Was sich selbst ausgesetzt und in der Prüfung bewährt hat, gewinnt unangemaßte Autorität. Im ästhetischen Simulationsraum, der zugleich der Ernstfallraum für Gelingen und Mißlingen des künstlerischen Gebildes ist, kann die machtlose Superiorität der Werke auf Beobachter einwirken, die ansonsten empfindlich darauf achten, keinen Herrn über sich zu haben, keinen alten und keinen neuen.
Rilkes Torso-Gedicht ist auf besondere Weise geeignet, die Frage nach der Quelle der Autorität zu stellen, weil es von sich her ein Experiment über das Sich-etwas-sagen-Lassen darstellt. Wie man weiß, hatte Rilke unter dem Einfluß Auguste Rodins, dem er zwischen 1905 und 1906 als Privatsekretär in Meudon zur Hand gegangen war, sich von der jugendstilhaften, sensibilistisch-atmosphärischen Dichtungsweise seiner Anfangsjahre abgewandt, um eine stärker vom »Vorrang des Objekts« bestimmte Kunstauffassung zu verfolgen. Das proto-moderne Pathos, dem Gegenstand den Vortritt zu lassen, ohne ihn in der Façon der alten Meister »naturgetreu« abzubilden, führte bei Rilke zum Konzept des Ding-Gedichts – und hierdurch zu einer vorübergehend überzeugenden neuen Antwort auf die Frage nach der Quelle ästhetischer und ethischer Autorität. Von nun an sollen es die Dinge selbst sein, von denen alle Autorität ausgeht – oder besser: von diesem jeweils aktuellen singulären Ding, das sich an mich wendet, indem es ganz den Blick beansprucht. Dies ist nur möglich, weil Ding-Sein jetzt von sich her nichts anderes bedeuten soll als: etwas zu sagen haben.
Rilke führt auf seinem Gebiet und mit seinen Mitteln eine Operation aus, die man philosophisch als die »botschaftliche Transformation des Seins« (vulgo linguistic turn) umschreiben könnte. »Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache«, wird Heidegger sagen – was umgekehrt die These impliziert: Sprache, die vom »Sein« verlassen ist, gerät zum Geschwätz. Dann und nur dann, wenn das Sein sich in privilegierten Dingen zusammenzieht und auf dem Umweg über diese Dinge sich an uns wendet, besteht Grund zu der Hoffnung, der anschwellenden Beliebigkeit zu entgehen, ästhetisch wie philosophisch. Angesichts der galloppierenden Inflation des Geschwätzes mußte eine solche Hoffnung zahlreiche Künstler und »Geistige« um 1900 in ihren Bann ziehen. Inmitten der allgegenwärtigen Geschäfte mit den prostituierten Zeichen konnte das Ding-Gedicht eine Aussicht auf die Möglichkeit einer Rückkehr zu glaubwürdigen Sinnerfahrungen eröffnen. Es vermochte dies, indem es die Sprache an den Goldstandard des von den Dingen selbst Mitgeteilten band. Wo Beliebigkeit ausgeschaltet wird, soll Autorität aufleuchten.
Es liegt auf der Hand, daß nicht jedes beliebige Etwas in den Rang eines Dings befördert werden kann – ansonsten wäre erneut alles und jedes sprechend, ja, das Geschwätz würde sich von den Menschen auf die Sachen ausdehnen. Rilke privilegiert zwei Kategorien von »Seienden«, um es in der pergamentenen Diktion der Philosophie zu sagen, die für die hohe Aufgabe, botschaftliche Dinge zu sein, in Frage kommen – die Artifizien und die Lebewesen –, wobei die letzteren von den ersten her ihre besondere Note erhalten, als wären die Tiere die höchsten Kunstwerke des vormenschlichen Seins. Beiden ist eine botschaftliche Energie inhärent, die sich nicht von selber aktiviert, sondern des Dichters als Decoders und Überbringers bedarf. Hierin hat die Komplizenschaft zwischen dem sprechenden Ding und der Rilkeschen Dichtung ihren Grund – so wie nur wenig später die Heideggerschen Dinge mit der »Sage« einer besinnlichen Philosophie konspirieren, die keine bloße Schuldisziplin mehr sein will.
Mit diesen etwas akzelerierten Hinweisen ist ein Rahmen umrissen, innerhalb dessen wir eine kurze Lektüre des Torso-Gedichts versuchen können. Ich gehe davon aus, daß der Torso, von dem im Sonnett die Rede ist, ein »Ding« im eminenten Sinn des Worts verkörpern soll, und zwar gerade deswegen, weil er bloß den Rest einer vollständigen Skulptur darstellt. Aus Rilkes Biographie wissen wir: Er brachte von seinem Aufenthalt bei den Werkstätten Rodins die Erfahrung mit, auf welche Weise die moderne Plastik zur Gattung des autonomen Torsos vorgestoßen war.19 Die Sicht des Dichters auf den verstümmelten Körper hat darum nichts mit der Fragment- und Ruinenromantik des vorangehenden Jahrhunderts zu tun; sie gehört in den Durchbruch der modernen Kunst zum Konzept des sich mit Autorität selbst aussagenden Objekts und des sich mit Vollmacht selbst veröffentlichenden Körpers.
ARCHAÏSCHER TORSO APOLLOS
Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt
darin die Augenäpfel reiften. Aber
sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber,
in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt,
sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug
der Brust dich blenden, und im leisen Drehen
der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen
zu jener Mitte, die die Zeugung trug.
Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz
unter der Schultern durchsichtigem Sturz
und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle;
und bräche nicht aus allen seinen Rändern
aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle,
die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.
Wer von dem Gedicht bei erster Lesung schon Bestimmteres aufnimmt, versteht soviel: Hier wird von einer Vollkommenheit gehandelt – einer Vollkommenheit, die um so verbindlicher und mysteriöser zu sein scheint, als es bei ihr um die Perfektion eines Bruchstücks geht. Man darf unterstellen, Rilke bedanke sich mit diesem Werk bei Rodin, dem Lehrmeister seiner Pariser Zeit, für das Konzept des für sich stehenden Torsos, dem er bei ihm begegnet war. Das Vollkommene, das in den vierzehn Zeilen beschworen wird, findet seinen Daseinsgrund in dem Umstand, daß es – unabhängig von der Verstümmelung des materiellen Trägers – die Vollmacht besitzt, eine aus sich selbst appellierende Botschaft zu bilden. Diese Appellkraft liegt bei dem hier vergegenwärtigten Gegenstand in exquisiter Weise vor. Vollkommen ist, was einen ganzen Satz des Seins artikuliert. Nicht mehr und nicht weniger hat das Gedicht zu leisten, als den Satz des Seins im Ding zu vernehmen und ihn dem eigenen Dasein anzugleichen – mit dem Ziel, selber ein Gebilde von ebenbürtiger Botschaftsmächtigkeit zu werden.
Der Rilkesche Torso kann als Träger des Prädikats »vollkommen« erfahren werden, weil er etwas mitbringt, was es ihm erlaubt, die gewöhnliche Erwartung einer Gestaltganzheit zu brüskieren. In dieser Geste hat die Wende der Moderne gegen das Prinzip Naturnachahmung – im Sinn von Nachahmung von vorgegebenen Gestalterwartungen – eines ihrer Motive. Sie vermag botschaftliche Ganzheiten und autonome Dingsignale auch dann wahrzunehmen, wenn keine morphologisch integren Figuren mehr vorliegen – ja gerade dann. Der Sinn für Vollkommenheit zieht sich aus den Naturformen zurück – wohl deswegen, weil die Natur selbst dabei ist, ihre ontologische Autorität zu verlieren. Auch durch die Popularisierung der Photographie werden die Standardanblicke der Dinge zunehmend abgewertet. Als erste Auflage des Sichtbaren gerät die Natur in Mißkredit. Sie vermag sich als Absenderin von verbindlichen Botschaften nicht mehr zu behaupten – aus Gründen, die letztlich auf ihre Entzauberung durch wissenschaftliche Erforschung und technische Überbietung zurückgehen. Nach dieser Verschiebung nimmt »vollkommen sein« eine veränderte Bedeutung an: Es heißt, etwas zu sagen haben, was bedeutsamer ist als das Gerede der geläufigen Ganzheiten. Nun kommen die Torsi und ihresgleichen zum Zug, es schlägt die Stunde der Formen, die an nichts erinnern. Die Bruchstücke, die Krüppel, die Hybride bringen etwas zur Aussprache, was die gewöhnlichen Ganzformen und die glücklichen Integritäten nicht mehr zu übermitteln imstande sind. Intensität schlägt Standardperfektion. Hundert Jahre nach Rilkes Wink verstehen wir diesen Hinweis wohl noch besser als dessen eigene Zeitgenossen, da unser Wahrnehmungsvermögen wie das keiner Generation vor uns von dem Geschwätz der makellosen Körper betäubt und ausgeplündert wird.
Mit diesen Hinweisen dürfte deutlich geworden sein, wie das Phänomen des Von-oben-angesprochen-Werdens sich in einem ästhetischen Gebilde verkörpert. Zum Verständnis eines Appell-Erlebnisses solcher Art ist es zunächst nicht nötig, auf die von Rilke akzeptierte Vermutung einzugehen, es handle sich bei dem von ihm besungenen Torso um das Relikt einer Götterstatue – damalige Kuratoren meinten zu wissen: eines Apollo. Es ist nicht völlig auszuschließen, bei der Skulpturerfahrung des Dichters habe ein Element von jugendstilhafter Bildungspietät mitgespielt – Rilke soll der realen Vorlage bei einem Besuch im Louvre begegnet sein, und soviel man weiß, wäre sie kein archaisches Kunstwerk, sondern eines aus der klassischen Zeit griechischer Bildhauerei gewesen. Was der Dichter jedoch zu dem Torso des mutmaßlichen Apolls zu sagen weiß, ist mehr als eine Notiz über einen Ausflug in den Antikensaal. Es kommt dem Autor nicht darauf an, daß das Ding einen erloschenen Gott zeigt, für den humanistisch Gebildete sich interessieren könnten, sondern darauf, daß der Gott im Stein ein Ding-Gebilde darstellt, das noch immer auf Sendung ist. Wir haben es mit einem Zeugnis dafür zu tun, wie die neuere botschaftliche Ontologie den hergebrachten Theologien über den Kopf wächst. In ihr wird das Sein selbst gegenüber Gott, dem machthabenden Götzen der Religionen, als die sprechendere, die sendungsmächtigere, die autoritätspotentere Größe verstanden. Auch ein Gott kann in modernen Tagen leicht unter die schönen Figuren geraten, die uns nichts mehr zu sagen haben – sofern sie uns nicht offen lästig werden. Das seinserfüllte Ding hingegen hört nicht auf, uns anzusprechen, wenn sein Moment gekommen ist.
Wir nähern uns dem kritischen Punkt: Seit jeher haben die beiden Schlußzeilen die Leser in ihren Bann gezogen. Sie wecken Bedeutsamkeitsgefühle, die das lyrische Gebilde im ganzen gleichsam aus den Angeln heben – als wäre es nur der Hinweg zu einem Höhepunkt, um dessentwillen das übrige ausgebreitet wird. Tatsächlich haben die zwei Schlußsätze: »denn da ist keine Stelle / die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.« eine fast selbstständige Karriere angetreten und sich dem Gedächtnis der Gebildeten eingeprägt, nicht nur bei Rilkeverehrern und Lyromanen. Ich gestehe, für diesmal neige ich dazu, dem Bedürfnis, Sätze aus dem Zusammenhang zu reißen, recht zu geben, nicht zuletzt deswegen, weil sich in der populären Vorliebe für schöne Stellen gelegentlich ein gültiges Urteil über authentische Gipfelmomente nachweisen läßt. Man muß kein Schwärmer sein, um zu verstehen, warum die beiden Schlußsätze ein Eigenleben entwickelt haben. In ihrer gediegenen Bündigkeit und mystischen Simplizität strahlen sie eine kunstevangelische Energie aus, wie sie an kaum einer anderen Wendung der jüngeren Sprachkunst beobachtet wird.
Auf den ersten Blick erscheint der vorausgestellte Satz als der geheimnisvollere. Wer ihn versteht oder akzeptiert oder im lyrischen Zusammenhang gelten läßt – was im gegebenen Fall dasselbe meint –, wird auf der Stelle wie von einer hypnotischen Suggestion erfaßt. Man gibt, indem man sich im »Verstehen« übt, einer sprachlichen Wendung Kredit, die das alltägliche Verhältnis zwischen dem Sehenden und dem Gesehenen umkehrt. Daß ich den Torso mit seinen gedrungenen Schultern und seinen Stümpfen sehe, ist das eine; daß ich mir die fehlenden Teile, den Kopf, die Arme, die Beine, das Geschlecht, träumerisch hinzudenke und assoziativ animiere, ist ein zweites. Ich kann mir, unter Rilkes Anregung, zur Not sogar ein Lächeln vorstellen, das von einem unsichtbaren Mund bis zu einem verschwundenen Genital reicht. Das völlig Andere jedoch, das durch und durch Inkommensurable, besteht in der Zumutung, hinzunehmen, daß der Torso mich sieht, während ich ihn betrachte – ja, daß er mich schärfer ins Auge faßt, als ich ihn anzusehen vermag.
Die Fähigkeit, die innere Geste auszuführen, mit der man für diese Unwahrscheinlichkeit in sich Platz schafft, dürfte ziemlich genau in dem Talent bestehen, von dem Max Weber leugnete, es zu besitzen. Es ist das der »Religiosität«, als mitgebrachte Disposition und entwickelbare Begabung verstanden und hierin zu Recht der Musikalität vergleichbar. Man kann sie üben, wie man melodische Passagen oder syntaktische Muster übt. Unter diesem Aspekt ist Religiosität mit einer gewissen grammatischen Promiskuität kongruent. Wo sie am Werk ist, tauschen Objekte mit Subjekten elastisch die Plätze. Mithin: Wenn ich akzeptiere, daß da – an der schimmernden Oberfläche des verstümmelten Steins – lauter »Stellen« sind, die Augen gleichkommen und die mich sehen: dann vollziehe ich eine Operation von mikroreligiöser Qualität – und die man, einmal begriffen, als primäres Modul einer »frommen« inneren Handlung auch in den makroreligiös ausgebauten Systemen auf allen Ebenen wiedererkennt. Auf der Position, wo üblicherweise das Objekt erscheint, welches ebendarum, weil es Objekt ist, niemals zurückschaut, »erkenne« ich nun ein Subjekt, das die Fähigkeit besitzt, zu schauen und Blicke zu erwidern. Ich lasse mich also, hypothetisch gläubig, auf die Unterstellung eines Subjekts ein, das der betreffenden Stelle innewohnt, und warte ab, was diese nachgiebige Wendung aus mir macht. (Wir merken an: Zu mehr als habitualisierten Unterstellungen kann auch die »tiefste« oder virtuoseste Gläubigkeit es niemals bringen). Der Lohn für meine Bereitschaft zur Beteiligung an der Objekt-Subjekt-Umkehrung fällt mir unter der Form einer privaten Erleuchtung zu – im vorliegenden Fall als ästhetische Ergriffenheit. Auch der Torso, an dem keine Stelle ist, die mich nicht sieht, zwingt sich nicht auf – er setzt sich aus. Er setzt sich aus, indem er es darauf ankommen läßt, ob ich ihn als Sehenden sehe. Ihn als Sehenden auffassen heißt soviel wie an ihn »glauben«, wobei glauben, wie bemerkt, hier die inneren Operationen bezeichnet, die nötig sind, um das vitale Prinzip im Stein als einen Absender von diskreten adressierten Energien zu denken. Gelingt mir dies irgendwie, so ist es mir auch möglich, dem Stein sein subjekthaftes Glühen abzunehmen. Ich akzeptiere versuchsweise sein modellhaft strahlendes Dastehen und empfange seinen sternenhaft ausbrechenden Überschuß an Autorität und Seele.
Nur in diesem Zusammenhang spielt der Name des Dargestellten eine Rolle. Was in der vormaligen Apollo-Statue erscheint, ist aber nicht ohne weiteres mit dem gleichnamigen Olympier gleichzusetzen, der in den Tagen seiner Vollständigkeit für Licht, Kontur, Vorauswissen und Formensicherheit zu sorgen hatte. Er steht vielmehr, wie der Gedichttitel ahnen läßt, für etwas viel Älteres, das aus vorzeitlichen Quellen aufsteigt. Er symbolisiert ein göttliches Magma, in dem etwas von der ersten Ordnungsmacht, alt wie die Welt selbst, zur Erscheinung kommt. Kein Zweifel, daß hier bei Rilke Erinnerungen an Rodin und sein zyklopisches Arbeitsethos wirksam werden. In der Zeit seines Umgangs mit dem großen Künstler erlebte er, was es bedeutet, die Oberflächen von Körpern so lange zu traktieren, bis sie nur noch ein einziges Gewebe von durchgeformten, luminosen, gleichsam sehenden »Stellen« bilden.20 Von Rodins Skulpturen hatte er einige Jahre zuvor geschrieben: »es gab Stellen ohne Ende, und keine, an der nicht etwas geschah.«21 Jede Stelle ist ein Ort, an dem Apollo, der Gestalt- und Oberflächengott, mit seinem älteren Gegenspieler Dionysos, dem Drang- und Strömungsgott, einen visuell prägnanten und haptisch fühlbaren Kompromiß schließt. Daß dieser energetisierte Apollo eine Erscheinung des Dionysos verkörpert, geht aus dem Hinweis hervor, der Stein flimmere wie Raubtierfelle: Rilke hatte seinen Nietzsche gelesen. Hier tritt uns das zweite mikroreligiöse bzw. protomusikalische Modul entgegen: jenes notorische »Dieses steht für Jenes«, »das Eine erscheint im Anderen«, »die Tiefe ist in der Oberfläche gegenwärtig« – Figuren, ohne die kein religiöser Diskurs je zustande kam. An ihnen kann man ablesen, daß Religiosität eine Form von hermeneutischer Beweglichkeit ist und eine trainierbare Größe darstellt.
»Denn da ist keine Stelle, / die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.« Es bleibt zu zeigen, warum der zweite Satz, an dem es scheinbar nichts zu deuten gibt, bei weitem der geheimnisvollere ist. An ihm ist nicht nur seine fehlende Vorbereitung, seine Plötzlichkeit mysteriös. »Du mußt dein Leben ändern« – das scheint aus einer Sphäre herzustammen, in der keine Einwände erhoben werden können. Auch ist nicht zu entscheiden, von wo aus der Satz gesprochen wird, allein seine absolute Vertikalität steht außer Zweifel. Man weiß nicht, ob dieses Diktum senkrecht aus dem Boden schießt, um mir wie ein Pfeiler im Weg zu stehen, oder ob es vom Himmel stürzt, um die Straße vor mir in einen Abgrund zu verwandeln, so daß der nächste Schritt, den ich tue, schon zu dem geänderten Leben, das gefordert wird, gehören müßte. Es ist nicht genug, zu sagen, Rilke habe die Ethik ästhetisierend ins Lapidare, Zyklopische, Altertümlich-Brutale zurückübersetzt. Er hat einen Stein entdeckt, der den Torso der »Religion«, der Ethik, der Askese überhaupt verkörpert: ein Gebilde, das einen Anruf von oben abstrahlt, reduziert auf den puren Befehl, die unbedingte Weisung, die durchlichtete Äußerung des Seins, das verstanden werden kann – und das nur in Imperativen spricht.
Wollte man alle Lehren der Papyrusreligionen, der Pergamentreligionen, der Stylus- und Federkielreligionen, der kalligraphischen und typographischen Religionen, alle Ordensregeln und Sektenprogramme, alle Meditationsanleitungen und Stufenlehren, alle Trainingsvorschriften und Diätologien in eine gemeinsame Werkstatt versetzen, wo sie in einer letzten Redaktion zusammengefaßt werden müßten: Ihr äußerstes Konzentrat würde nichts anderes sagen als das, was der Dichter in einem transluziden Moment aus dem archaischen Torso Apollos emanieren läßt.
Du mußt dein Leben ändern! – so lautet der Imperativ, der die Alternative von hypothetisch und kategorisch übersteigt. Es ist der absolute Imperativ – der metanoetische Befehl schlechthin. Er gibt das Stichwort zur Revolution in der zweiten Person Singular. Er bestimmt das Leben als ein Gefälle zwischen seinen höheren und niedereren Formen. Ich lebe zwar schon, aber etwas sagt mir mit unwidersprechlicher Autorität: Du lebst noch nicht richtig. Die numinose Autorität der Form genießt das Vorrecht, mich mit »Du mußt« anzusprechen. Es ist die Autorität eines anderen Lebens in diesem Leben. Diese trifft mich an in einer subtilen Insuffizienz, die älter und freier ist als die Sünde. Sie ist mein innerstes Noch-nicht. In meinem bewußtesten Moment werde ich vom absoluten Einspruch gegen meinen status quo betroffen: Meine Veränderung ist das eine, das not tut. Änderst du daraufhin dein Leben wirklich, tust du nichts anderes, als was du selber mit deinem besten Willen willst, sobald du spürst, wie eine für dich gültige Vertikalspannung dein Leben aus den Angeln hebt.
Neben dieser ethisch-revolutionären Lesart liegen auch etwas handfestere und psychologisch eingängigere Deutungen des Torso-Gedichts nahe. Es zwingt uns nichts, den Kommentar auf kunst- und seinsphilosophische Hochlagen zu beschränken. Das Autoritätserlebnis, das den Dichter für einen Moment an die antike Statue fesselt, läßt sich auf einer eher sinnlichen, ästhetisch leichter greifbaren Ebene vielleicht noch plausibler rekonstruieren. Hier wäre von den somatischen, genauer: den autoerotischen und maskulin-athletischen Anmutungen der Skulptur zu sprechen, die im Dichter (in der Sprache seiner Zeit ein Neurastheniker und schwachleibiger Introvertierter) eine Einfühlung in die antipodische Seinsweise der starken »Körpermenschen« hervorgerufen haben muß. Dem entspricht eine Tatsache, die Rilke nicht verborgen war: daß in der unermeßlich reichen Statuenkultur der Griechen zwischen Göttern und Athleten ein physisches und psychisches Verwandtschaftswesen herrschte, in dem die Verähnlichung bis zur Gleichsetzung reichen konnte. Ein Gott war immer auch eine Art Sportler, und der Sportler, zumal der im Preislied gefeierte und vom Lorbeer gekrönte, auch immer eine Art Gott. Daher bietet sich der Athletenkörper, der Schönheit und Disziplin zu einer in sich ruhenden Sprungbereitschaft vereinigt, als eine der verständlichsten und überzeugendsten Erscheinungsformen von Autorität an.
Der autoritative Körper des Gott-Athleten wirkt auf den Betrachter unmittelbar durch seine Vorbildlichkeit. Auch er sagt lapidar: »Du mußt dein Leben ändern!«, und indem er es sagt, zeigt er zugleich, an welchem Modell die Veränderung sich zu orientieren hat. An ihm ist ablesbar, wie Sein und Vorbildlichsein konvergieren. Jede der klassischen Statuen war eine petrifizierte oder in Bronze gegossene Lehrbefugnis in ethischen Angelegenheiten. Was man den Platonismus nannte, ansonsten eher eine ungriechische Affaire, konnte in Griechenland nur insofern eine Heimstätte finden, als die sogenannten Ideen dort bereits unter der Form von Statuen eingebürgert waren. Die platonische Liebe war als Trainingsaffekt zwischen den somatisch Vollendeten und den Anfängern bei den Übungen schon eine Weile vor Platon populär verankert, und dieser Eros wirkte in beiden Richtungen, vom Vorbild auf seinen Nacheiferer ebenso wie vom Begehrenden zu seinem Modell. Nun möchte ich Rilke gewiß keine narzißtische Beziehung zu einem im Louvre ausgestellten Bruchstück altgriechischer Männerkörperkultherrlichkeit andichten. Plausibel ist jedoch, daß der Verfasser des Sonetts aus dem realen Torso, der ihm zu Gesicht kam, etwas von der Strahlkraft des antiken Athletenvitalismus und von der muskulären Theologie der Ringer in der Palästra herausgelesen hat. Das Vitalitätsgefälle zwischen dem erhöhten und dem profanen Körper muß ihn selbst angesichts eines bloßen Relikts verklärter Männlichkeit auf unmittelbare Weise angesprochen haben.