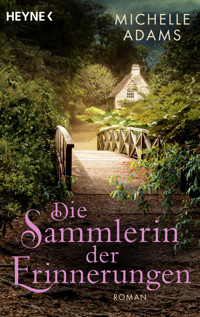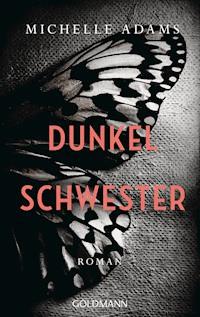
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Irini Haringford wurde von ihren Eltern fortgegeben, als sie drei Jahre alt war. Ihre unberechenbare Schwester Elle dagegen durfte in der Familie bleiben. Auch als erwachsene Frau kann sich Irini diese Entscheidung nicht erklären. Dann erhält sie eines Tages einen Anruf von Elle, die ihr mitteilt, dass die gemeinsame Mutter verstorben ist. Irini macht sich auf den Weg nach Schottland, um herauszufinden, was damals geschehen und wodurch ihre Mutter umgekommen ist – denn sie wird den Gedanken nicht los, dass Elle mit beiden Ereignissen etwas zu tun haben könnte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Irini Harringford wurde vor fast dreißig Jahren von ihren Eltern weggeben und wuchs bei Verwandten auf. Auch wenn sie ihren Wunsch nach einer Wiedervereinigung mit ihrer Familie hinter einer kühlen Fassade verbirgt, sehnt sie sich danach zu verstehen, warum ihre Eltern sie damals fortgaben, aber ihre ältere Schwester Elle behielten. Als diese sich nach jahrelanger Funkstille eines Tages bei ihr meldet und ihr erzählt, dass die gemeinsame Mutter verstorben ist, spürt Irini, dass dies ihre einzige Chance sein könnte herauszufinden, was damals wirklich passiert ist. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum sie sich überreden lässt, nach Schottland zu fliegen. Es ist auch Elle, zu der Irini sich trotz ihrer Unberechenbarkeit hingezogen fühlt – doch genau das macht ihr Angst, denn sie hat Elle am Telefon nur aus einem Grund nicht gefragt, wie ihre Mutter umgekommen ist: weil sie annahm, dass sie es bereits wusste …
Autorin
Michelle Adams ist Britin, lebt aber seit Jahren auf Zypern. Sie ist Teilzeitwissenschaftlerin und hat bereits einige Science-Fiction-Romane unter Pseudonym veröffentlicht. Ihre wahre Leidenschaft aber gilt der psychologischen Spannung. »Dunkelschwester« ist ihr Debüt in diesem Genre.
Michelle Adams
Dunkelschwester
Roman
Aus dem Englischen
von Petra Knese
Das erste Buch widme ich dir, lieber Stasinos, denn ohne dich wäre es nie zustande gekommen.
Jedes weitere ist für all jene, die sich in ihrem Leben schon mal wertlos gefühlt haben. Ihr wisst hoffentlich jetzt, dass das nicht stimmt.
1.
Das Summen meines Handys ist wie das Schaben einer Kakerlake unterm Bett. Keine echte Gefahr, trotzdem bin ich zu Tode erschrocken. Es ist die gleiche Angst, die einen befällt, wenn es kurz vorm Einschlafen noch an der Tür klopft. Das kann nichts Gutes verheißen, womöglich steht dort ein Mörder, bereit zur Tat. Ich drehe mich zu Antonio um, der neben mir schläft, nackt, nur ein weißes Laken wie eine Toga um die Hüften geschlungen. Sein Atem geht gleichmäßig, friedvoll. Er hat schöne Träume, das weiß ich, denn er schmatzt und zuckt wie ein zufriedenes Baby. Auf dem Wecker steht in roten Leuchtziffern: 02:02. Eine Warnung.
Im Zeitlupentempo greife ich nach dem Handy und schaue aufs Display. Unbekannt. Ich tippe auf das grüne Symbol, um den Anruf entgegenzunehmen, und mir schallt eine heitere, fröhliche Stimme entgegen, in der eine Lüge lauert, die mir nur Sand in die Augen streuen will. »Hi, ich bin’s. Hallo?« Die Stimme wartet auf Antwort. »Hörst du mich?«
Eine Gänsehaut überläuft mich, schützend ziehe ich das Laken höher.
Ich bedecke meine Brüste. Die linke hängt ein wenig tiefer, die Freuden einer Skoliose von 15 Grad. Natürlich ist Elle dran, war ja klar. Die letzte Verbindung zu einer Vergangenheit, die ich mit aller Macht vergessen will. Und doch ist es Elle nach sechs Jahren Funkstille gelungen, sich wie ein Wurm durch den schlammigen Graben zu winden, den ich zwischen uns ausgehoben habe.
Ich mache die Nachttischlampe an, die noch den finstersten von Ungeheuern verseuchten Winkel erleuchtet. Als ich das Handy wieder ans Ohr halte, höre ich Elles Atem, der im Dunkeln darauf lauert, dass ich etwas sage.
Ein pochender Schmerz durchfährt mich, als ich mich von Antonio wegrolle. »Was willst du?«, frage ich möglichst selbstbewusst. Ich habe gelernt, unhöflich zu sein, mich nicht einzulassen. Sie bloß nicht zu ermutigen.
»Mit dir reden, also wage es nicht, einfach aufzulegen. Warum flüsterst du?« Sie kichert, als wären wir Freundinnen, als wäre dies ein stinknormales Gespräch unter albernen Teenagern. Ist es aber nicht. Das wissen wir beide. Ganz egal, was sie sagt, ich sollte auflegen, schaffe es aber nicht. Dafür ist es schon zu spät.
»Es ist mitten in der Nacht.« Meine Stimme bebt. Ich zittere. Schlucke.
Es raschelt, wahrscheinlich sieht sie auf die Uhr. Wo ist sie jetzt? Was will sie um diese Zeit? »Also eigentlich ist es früh am Morgen, aber egal.«
»Was willst du?«, frage ich wieder. Sie durchbricht meine Abwehr, kriecht mir unter die Haut.
Elle ist meine Schwester. Meine einzige Schwester aus einem früheren Leben, an das ich nur wenige Erinnerungen habe. Und die sind so verschwommen, als würde man durch eine total verregnete Fensterscheibe blicken. Ich weiß nicht einmal, ob sie noch stimmen. Neunundzwanzig Jahre sind eine lange Zeit, da können sich Erinnerungen verändern und in etwas anderes verwandeln.
Mein zweites Leben, in dem ich jetzt stecke, begann im Alter von drei Jahren. Die Frühlingssonne hatte das winterliche Eis getaut, und die Tiere der umliegenden Wälder wagten sich zum ersten Mal aus ihrem Bau. Ich war in einen dicken Wollmantel gemummelt und in so viele Lagen gehüllt, dass ich mich kaum rühren konnte. Die Frau, die mich zur Welt gebracht hatte, zog mir wortlos rote Handschuhe an. An was sich eine Dreijährige erinnert!
Sie trug mich einen mit Grasbüscheln bewachsenen Modderweg entlang bis zu einem wartenden Wagen. Ich war ein Spätentwickler, und Körperteile wie meine Hüfte waren noch gar nicht richtig entwickelt. Laufen konnte ich noch nicht. Ich machte kein Theater, als sie mich auf den Rücksitz des Wagens schob und anschnallte. Jedenfalls glaube ich, dass es so war. Vielleicht erinnere ich mich auch an gar nichts, und mein Gehirn spielt mir einen Streich, gaukelt mir eine Vergangenheit vor. Ein Leben, in dem ich Eltern hatte. Eine Vergangenheit, die nicht bloß aus Elle besteht.
Manchmal meine ich, mich an das Gesicht meiner Mutter zu erinnern, das meinem gleicht, es ist nur älter und röter, mit Falten, die sich wie Spinnennetze um die Lippen weben. Dann wieder bin ich nicht so sicher. Sicher bin ich nur, dass sie mich weder ermahnt hat, artig zu sein, noch mir zum Trost einen Kuss gegeben hat. Würde man sich daran nicht erinnern? Nachdem sie die Wagentür zugeschlagen hatte, trat sie einen Schritt zurück, und mein Onkel und meine Tante fuhren mit mir davon, als wäre es das Normalste der Welt. Schon damals spürte ich, dass etwas vorbei war. Man hatte mich weggegeben, verstoßen, ausrangiert.
»Hörst du, Irini? Ich will mit dir reden.« Elles messerscharfe Stimme holt mich schlagartig in die Gegenwart zurück.
»Worüber?«, flüstere ich. Nun geht es wieder los. Ich kann sie auf mir spüren, sie schlängelt sich auf ihren alten Platz.
Elle holt Luft, um sich zu beruhigen. »Wann haben wir das letzte Mal miteinander gesprochen?«
Ich rücke weiter von Antonio ab, ich will ihn nicht aufwecken. »Es ist zwei Uhr morgens, Elle. Morgen muss ich arbeiten. Ich habe dafür jetzt keine Zeit.« Armselig, aber wenigstens habe ich es probiert. Ein letzter Versuch, sie abzuwehren.
»Lügnerin«, faucht sie. »Morgen ist Sonntag. Da musst du nicht arbeiten.« Geschafft. Jetzt ist sie wütend. Ich werfe die Decke ab, schwinge die Beine aus dem Bett und streiche mir den Pony aus dem Gesicht. Mein Puls rast, als ich den Hörer ans Ohr presse. »Sag einfach, was du willst.«
»Es geht um Mum.« Mir versetzt es einen Stich, wenn sie das Wort so beiläufig benutzt. Sie lässt es fallen wie einen Spitznamen unter Freunden. Es fühlt sich fremd an, macht mich verletzlich. Mum, sagt sie. Als würde ich die Frau kennen. Als würde sie zu mir gehören.
»Was ist passiert?«, flüstere ich.
»Sie ist gestorben.«
Sekundenlang halte ich den Atem an. Sie ist fort. Ich habe sie schon wieder verloren. Mit feuchter Hand halte ich mir den Mund zu. Elle wartet auf eine Reaktion. Als nichts kommt, sagt sie irgendwann: »Und? Kommst du zur Beerdigung?«
Eine berechtigte Frage, auf die ich keine Antwort parat habe. Denn Mutter ist für mich nicht mehr als ein abstraktes Konzept, eine kindische Hoffnung. Ein Traum. Doch die Neugier treibt mich. Manches muss ich einfach wissen.
»Wahrscheinlich schon«, stottere ich.
»Musst dich nicht zwingen. Vermissen tut dich eh keiner.«
Auch nach so vielen Jahren ist es schmerzhaft, sich diese Tatsache vor Augen zu führen. Leider. »Warum fragst du mich dann überhaupt?« Allmählich schwindet die Maske des Selbstbewusstseins.
»Weil ich dich brauche.« Es klingt, als sei sie überrascht, dass ich es nicht gleich kapiert habe, als hätte sie keinen blassen Schimmer, dass ich ihre Anrufe nicht annehmen will, dass ich meine Nummer schon dreiundzwanzig Mal geändert habe und sogar umgezogen bin, nur um sie abzuschütteln. Sechs Jahre lang habe ich sie erfolgreich gemieden, meine beste Quote bislang. Aber meine Abwehr bröckelt, von ihr gebraucht zu werden macht mich schwach. Gefügig. »Und du schuldest mir noch was, Irini. Oder hast du schon vergessen, was ich für dich getan habe?«
Sie hat recht. Ich stehe in ihrer Schuld. Wie konnte ich das nur vergessen? Unsere Eltern haben mich weggegeben, aber Elle hat das nie hingenommen. Mit allen Mitteln hat sie sich immer wieder in mein Leben zurückgekämpft und wie ein Tornado überall Trümmer hinterlassen. »Nein, ich habe es nicht vergessen.« Vorsichtshalber drehe ich mich zu Antonio um, der immer noch tief und fest schläft. Ich kneife die Augen zu, als könnte ich damit alles ungeschehen machen. Ich bin gar nicht da. Ihr könnt mich nicht sehen. Kindisch. Mir entschlüpft eine Träne, meine Hand krallt sich ins Laken. Am liebsten würde ich Elle fragen, woher sie meine Nummer diesmal hat. Irgendjemand wusste sie wohl. Vielleicht Tante Jemima, die einzige Mutterfigur in meinem Leben. Wenn wir noch in Kontakt wären, könnte ich mich melden und nachfragen. Ihr mitteilen, was ich von dem jüngsten Vertrauensbruch halte.
»Sag mir morgen Bescheid, ob du kommst«, sagt Elle. »Hoffentlich. Sonst fahre ich nach London und komme dich holen.« Sie legt auf, bevor ich antworten kann.
2.
Wie betäubt sitze ich auf der Bettkante und schaue zu, wie die Uhr von 2.06 auf 2.07 springt. In nicht einmal fünf Minuten sind die Anstrengungen der letzten sechs Jahre einfach verpufft. Elle ist wieder Teil meines Lebens, als wäre es nie anders gewesen. Beim Aufstehen bin ich richtig wacklig auf den Beinen, als wäre selbst die Erdanziehung durcheinandergeraten. Ich ziehe den Morgenmantel an, knote ihn fest zu und steige über eine Reisetasche am Bettende. Antonio will wohl irgendwohin fahren, sicher ohne mich.
Ich schiebe die Tasche beiseite und schlüpfe in die grauen Kaschmirhausschuhe. Ein Geschenk von Antonio, eines von vielen, die er mir in den drei Jahren unseres Zusammenseins gemacht hat. Zunächst schien alles so unkompliziert, aber dann hat sich nach und nach die Realität eingeschlichen. Und der Gedanke, Elle könnte jeden Moment auftauchen und alles zunichtemachen, hat seinen Tribut gefordert. Natürlich wusste Antonio damals noch nichts von Elle, und als wir unsere ersten Probleme hatten, hat er es mit Geschenken versucht. Wenn ich ihn anschaue, wie er im Kernschatten unseres alten Lebens schläft, die gepackte Reisetasche mal wieder in greifbarer Nähe, wird mir klar, dass auch noch so viele Geschenke die Entfremdung nicht hätten verhindern können. Elle ist mein Schicksal. Unentrinnbar. Sie ist zurückgekehrt, um alles zu zerstören. Ich habe es von Anfang an gewusst.
Lautlos gleite ich über den Laminatboden meines trostlosen Reihenendhauses im finsteren Brixton. Vom Treppenhausfenster habe ich die Straße im Blick, keine Menschenseele im Schatten der Dunkelheit. In der Ferne verschmelzen die Retortenhäuser miteinander, der warme Glanz der Stadt ist gerade eben sichtbar und erinnert mich daran, wo ich bin. In einer Stadt, die so groß ist, dass man vor aller Augen verschwinden kann. Fast.
Wäre Antonio jetzt wach, würde er mich in den Arm nehmen, mir zuhören und sagen, dass es mir nun sicher besser ginge, weil ich meinem Herzen Luft gemacht hätte. Den Ausdruck hat er irgendwo aufgeschnappt, so wie Leute, die eine Fremdsprache lernen und ihren Wortschatz im unpassenden Moment vom Stapel lassen. Allgemeinplätze sind viel zu banal für solche Situationen. So wie das eine Mal, als ich ihm erzählte, dass Elle ihren Hund umgebracht hat. Antonio meinte, nun wäre alles gut, weil ich meinem Herzen Luft gemacht hätte. Als würde Reden alles wettmachen und der Hund mit dem eingedellten Kopf wieder fröhlich hechelnd angesprungen kommen wie Toto aus dem Zauberer von Oz. Trautes Heim, Glück allein. Bullshit.
Ich gehe die Treppe hinunter, mache vorsichtige Schritte im Dunkeln, taste mich an der Wand entlang zur Küche.
So, denke ich. Meine Mutter ist also tot.
Ich stehe vor der Arbeitsplatte und spiele mit dem benutzten Weinglas, schwenke die letzten Tropfen Chianti. Dann stelle ich es weg und hole möglichst geräuschvoll zwei Becher aus dem Schrank. Womöglich wacht Antonio ja davon auf. Vielleicht wird er sich zu mir setzen und wie immer sagen, dass alles wieder ins Lot kommt. Das täte mir gut. Damit könnte ich die Panik in den Griff kriegen, die Elles Rückkehr ausgelöst hat. Ich mache sogar einen Schritt Richtung Schlafzimmer, bestimmt würde ich mich mit Antonio weniger einsam fühlen. Doch dann fällt mir die fertig gepackte Reisetasche ein, also stelle ich den zweiten Becher klammheimlich in den Schrank zurück. Will Antonio mich verlassen? Kann sein. Ist wohl Schicksal. Dann werde ich mich in Zukunft eben an das Alleinsein gewöhnen müssen. Ich schiebe eine Kapsel in die Kaffeemaschine, und als die rote Lampe leuchtet, nehme ich den Becher. Heißer Dampf schlägt mir ins Gesicht, und ich verbrenne mir beim ersten Schluck die Lippen. Ich taste mich an der Wand entlang, knipse alle Lampen an, bevor ich mich an den tristen Glasschreibtisch setze und den Computer einschalte. Mir sind moderne Möbel lieber. Nichtssagende Objekte ohne Geschichte. Dinge, die man bedenkenlos zurücklässt. Ich stelle den Becher ab und öffne den Browser, bade im kalten blauen Licht. Einen Moment verharre ich reglos. Atme kaum. Was mache ich hier eigentlich? Will ich wirklich zur Beerdigung? Als ich hinter mir Schritte zu hören glaube, drehe ich mich erwartungsvoll um, aber da ist niemand. Ich lehne mich zurück, schaue die Stufen hinauf, ein letzter Check, doch nichts als die Dunkelheit, aus der ich gekommen bin. Ich wende mich wieder dem Computer zu, tippe Edinburgh in die Flugsuchmaschine ein, unsicher, ob ich für so eine Entscheidung überhaupt wach genug bin. Soll ich wirklich dorthin zurück? Nächstes Feld. Hin- und Rückflug oder nur Hinflug?
»Was machst du da?«, fragt Antonio.
»Spinnst du!«, brülle ich und springe vor Schreck fast aus dem Stuhl. »Schleich dich doch nicht so an.« Mein Herz hämmert wie verrückt.
»Mann, Rini.« Überrascht taumelt er rückwärts. »Du bist doch diejenige, die hier nachts rumschleicht. Ich habe mich total erschrocken.« Antonio steht in einem Paar weißer, viel zu enger Unterhosen vor mir, in der Hand einen meiner Stöckelschuhe wie zur Waffe erhoben. Seine Stimme ist dunkel wie Schokolade, stark wie mein Espresso. »Was machst du hier unten?«
»Ich suche was im Netz«, sage ich noch immer atemlos. Antonio kommt näher, stellt den Schuh auf den Schreibtisch, und als er sich über mich beugt, rieche ich mein Parfüm auf seiner Haut. Er streicht mir über die Schultern, legt mir kurz die Hand in den Nacken und lässt seine Finger über meine Brüste gleiten. Antonio ist nach wie vor sehr zärtlich. Auch wenn er wütend auf mich ist, möchte er meine Nähe nicht missen.
»Entspann dich einfach, okay? Atme einmal tief durch«, sagt er und massiert mich. Mir fällt ein, was wir vor einer Stunde noch getan haben. Dahin würde ich jetzt gerne zurück, auch wenn der Streit nach dem Sex unschön war. Mittlerweile ist alles zwischen uns kompliziert. Während er mir die Schultern massiert, lehnt er sich vor und liest, was auf dem Bildschirm steht. Dann hält er inne und sieht mich entgeistert an. »Willst du wegfahren?«
Das Gleiche könnte ich ihn auch fragen. Stattdessen nehme ich noch einen Schluck Kaffee, froh, nicht mehr allein zu sein. »Cassandra ist gestorben.«
Mit dem Namen kann er nicht sofort etwas anfangen, weil er ihn kaum gehört hat. »Wann?«, fragt er, als der Groschen endlich gefallen ist. Er hockt sich hin, dabei öffnet sich mein Morgenmantel und entblößt meine Beine und den unteren Teil der Narbe. Antonio reibt kräftig über meine schwächere, linke Hüfte, streicht bis zur dicken roten Narbe. An meinem Gesicht versucht er abzulesen, wie ich die Nachricht aufnehme. Ich bin leer wie ein unbeschriebenes Blatt. »Wie?«, fragt er, während ich von ihm abrücke. Mir ist die Berührung auf dem erhabenen Fleisch meiner vernarbten Hüfte unangenehm.
Erst jetzt wird mir bewusst, dass ich Elle gar nicht gefragt habe, was mit unserer Mutter passiert ist. Ich weiß nicht, ob sie im Schlaf gestorben ist oder bei einem Autounfall? Ob unter Schmerzen oder in Frieden? Ich würde ja gerne behaupten, dass ich nicht nachgefragt habe, weil es mir egal ist, aber das stimmt nicht. Mir ist es nicht egal, auch nach neunundzwanzig Jahren nicht.
»Weiß ich nicht«, sage ich.
Antonio hakt nicht nach, auch wenn er meine Distanziertheit nicht nachvollziehen kann. Zum Thema Familie hat er ganz eigene Vorstellungen. Und die fangen alle mit der Heirat an. Aber jetzt ist er bei mir und hat mir den Streit von heute Nacht vergeben, der mit etwas so Banalem wie seinem Phlegma im Haushalt begann und bei meiner Abneigung gegen das Kinderkriegen endete.
»Fährst du hin?«, fragt er.
Ich zucke mit den Achseln. So viele Gründe sprechen dagegen. Noch könnte ich aussteigen, einfach die Telefonnummer wechseln und umziehen, bevor Elle mich holen kann. Ich könnte so tun, als schuldete ich ihr nichts. Aber wenn ich hinfahre, könnte ich von meinem Vater endlich die Wahrheit erfahren. Ich könnte herausbekommen, warum sie Elle behalten und mich weggegeben haben.
»Du musst wohl hin«, meint Antonio. Er greift nach der Maus und scrollt durch die Flugangebote. Er wählt einen Flug um 15.30 Uhr aus und kreist mit dem Cursor darüber, damit ich hinschaue. »Das klingt doch gut. Dann wärst du am Spätnachmittag da.«
Lächelnd nicke ich, denn für ihn steht außer Frage, dass ich dabei sein sollte. »Gib mir mal mein Portemonnaie«, sage ich und klicke mit zitternder Hand auf den Link. Ich wähle nur einen Hinflug, denn ich weiß ja noch nicht, wann ich wieder zurückkann, und sofort verlässt mich der Mut wieder. Antonio bietet nicht an mitzukommen. Vielleicht ist er einfach froh, mal ein bisschen Abstand zu haben. Vielleicht sind wir beide froh darüber.
»Und nun komm wieder ins Bett«, sagt er.
Gemeinsam gehen wir zurück; Antonio führt mich an der Hand, als wäre ich ein junges Mädchen, das gleich zum ersten Mal Sex haben wird. Wir schlüpfen unter die Decke, und er schlingt die Arme um mich. In den letzten Wochen, in denen er so unnahbar und distanziert war, habe ich das sehr vermisst. Ich schmiege mich an ihn, wünschte, es würde sich noch anfühlen wie am Anfang. Tut es aber nicht. Antonios Berührungen sind ungelenk, als wären wir zwei Teile eines Puzzles, die nicht zusammenpassen, und seine Nähe blendet meine Vergangenheit auch nicht mehr aus.
Die Uhr zeigt 2.46. Schon jetzt vergeht die Zeit kaum, und ganz gleich, wie sehr ich kämpfe und mich abstrample, sie zieht mich nach unten. Schon bald wird die Uhr rückwärtslaufen, tick-tack, tick-tack, bis ich wieder bei der stummen Frau angelangt bin, die angeblich meine Mutter gewesen ist. Und in der Dunkelheit des Schlafzimmers, in Antonios Armen, frage ich mich, was mich nur geritten hat?
Ich hätte gleich sagen sollen, dass ich nicht komme. Sollte kein schlechtes Gewissen haben. Sollte weglaufen, wie damals, vor fünfzehn Jahren, als ich im Schlafanzug, tränenüberströmt und mit blutendem Arm vor Elle getürmt bin, weil ich genau wusste, dass es für mich eine Zukunft nur ohne sie gibt. Was an jenem Tag passiert ist, hat uns entzweit und gleichzeitig für immer zusammengeschweißt. An dem Tag hat sie mich gerettet und mir im selben Augenblick Angst eingejagt.
Aber es ist nicht allein der Wunsch nach Wahrheit, der mich nach Hause treibt, es ist auch Elle. Trotz aller Gefahren fühle ich mich zu ihr hingezogen. Ich kann mir nicht helfen. All die Jahre habe ich geglaubt, ich könne sie aus meinem Leben verbannen, doch das kann ich nicht. Ich habe geglaubt, ich bräuchte sie nicht, doch ich brauche sie. Und das macht mir Angst. Denn ich habe sie nur deshalb nicht gefragt, wie unsere Mutter umgekommen ist, weil ich annahm, dass ich es bereits wusste: Elle hatte sie getötet.
3.
Das letzte Mal hat Elle mich in der Notaufnahme eines Krankenhauses aufgespürt, in der ich damals gearbeitet habe. Aus sicherer Entfernung beobachtete ich von einem Fenster im 1. Stock ihren Kampf auf dem Parkplatz. Als sie einer Schwester, die sie aufzuhalten versuchte, eine Ohrfeige verpasste, witzelte ein Kollege, da wäre ja wohl mal wieder eine aus der Klapse ausgebrochen. Ich lachte mit und machte selbst noch ein paar abfällige Bemerkungen über ihr Outfit. Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass Elle einen Wollpulli trug, der so gar nicht zur Jahreszeit passte. Er quoll am Kragen und unter den Ärmeln einer Art Uniformbluse hervor, die Elle schief darübergeknöpft hatte. Dazu Hotpants. Doc Martens. Angezogen, als wollte sie im tiefsten Winter auf einen Rave. Es war aber Juni, und die Sonne schien. Elle rief nach mir, fuchtelte mit den Händen wild in der Luft herum und streckte dabei die Krankenschwester neben sich nieder. Am Ende warfen die Sicherheitsleute sie zu Boden und schleiften sie vom Parkplatz. Dabei zerrissen sie ihr die Bluse. Wegen des Küchenmessers in Elles Hand konnten sie kein Risiko eingehen.
An dem Tag schaffte sie es nicht, mit mir zu sprechen. Doch sie wusste genau, dass ich dort war, das spürte ich. Alles in mir zog sich zusammen, als ihre Augen die Scheibe streiften, hinter der ich stand. Bevor ich an jenem Abend nach Hause fuhr, reichte ich meine Versetzung ein, und die folgenden sechs Jahre bin ich so weit gelaufen, wie ich nur konnte. Viel hat es nicht gebracht.
Denn trotz allem, was ich über Elle weiß, bin ich schon wieder auf dem Weg zu ihr. Unterwegs zum Flughafen habe ich im Queen’s College Hospital angerufen und drei Tage Urlaub genommen, wegen eines Notfalls. Dass ich der Notfall bin, habe ich nicht erwähnt.
Ich nehme Platz auf Sitz 28 A und ziehe den Gurt straff. In der winzigen Kabine rüttelt es ordentlich, als wir über die Startbahn holpern, und beim Abheben dreht sich mir der Magen um. In letzter Sekunde schicke ich noch ein Stoßgebet gen Himmel, dass einer der Flügel abbricht und die Nachricht von einem schrecklichen Absturz landesweit übertragen wird. Aber mein Gebet wird nicht erhört. Stattdessen steigen wir hoch und höher, London ist nichts weiter als eine Spielzeugstadt, bis wir die dichte graue Wolkenschicht durchstoßen.
In meiner Tasche habe ich zweimal Wechselwäsche, eine Schachtel Zigaretten, ein Buch, das ich ohnehin nicht lesen werde, und eine Klinikpackung Valium ohne Etikett, die ich aus dem Krankenhaus habe mitgehen lassen. Ich schraube den Deckel ab, werfe eine Tablette ein und spüle sie mit Brandy runter. Die Mischung aus Alkohol und Tabletten würde manche Leute ausknocken, aber ich bin es gewohnt. Als Anästhesistin greife ich bei der Selbstmedikation wohl einfach beherzter zu. Nur wenn es um meine Familie geht, zeige ich Schwäche. Das Valium wirkt und nimmt mir ein wenig die Angst, so dass ich zumindest nicht mehr mit den Zähnen knirsche.
Ich hole mein Handy heraus und scrolle durch die Nachrichten. Eine von Antonio habe ich verpasst. Ich klicke sie an.
Ich wünsche dir einen guten Flug. Melde dich, wenn du gelandet bist. Ti amo, A x
Antonio habe ich auf einem Schmerzkongress kennengelernt. Er servierte das Abendessen, reichte Brötchen, hinterließ eine Spur aus Krümeln. In den ersten glückseligen Wochen hatte ich noch keine Ahnung, dass auf dem Abstellgleis noch eine Freundin wartete. Als sie das mit uns herausbekam, schmiss sie ihn raus, während ich vor dem Haus im Wagen wartete. Am gleichen Tag noch zog er bei mir ein, tönte laut, wie erleichtert er sei, endlich frei zu sein. Aus seinem Mund klang es, als würden seine kühnsten Träume wahr werden, aber im Nachhinein denke ich, dass er nur nicht wusste, wohin. Mir ist es selbst unbegreiflich, dass ich mich mit allem abfand und Verständnis aufbrachte. Doch wenn ich mit ihm im Bett lag, seine nackten Schenkel spürte, konnte ich die Vergangenheit vergessen, so tun, als hätte mein Leben gerade erst begonnen. Ich war wie besessen. Mit ihm hörte ich auf zu existieren. Aber das war gut, endlich musste ich nicht mehr ich sein, die arme, einsame Irini. Irini verschwand im Wir. Ich gehörte zum Wir. Na schön, am Anfang hat er mich ein bisschen verarscht. Und wenn schon. Da hatte mir meine Familie weitaus Schlimmeres angetan. Außerdem wollte er mich.
Zum Glück lernten wir uns in einer Elle-freien Zeit kennen, so konnten wir einfach unser Leben leben, mit unserer gemeinsamen Vorliebe für Tierdokumentationen und mit seinen Kochkünsten. In den zwei Jahren habe ich ihm lange Zeit gar nicht erzählt, dass ich eine Schwester habe, und mit dieser Lüge lebte es sich herrlich. Sobald ich Antonio hatte, brauchte ich Elle nicht mehr.
Nach einer Italienreise, bei der er mich seiner Familie vorgestellt hatte, fing er plötzlich an, von Heirat und Kindern zu reden. Ich stellte mich quer. Was für eine Mutter würde ich wohl abgeben, wo ich doch selbst nie eine gehabt hatte? Seither ist unsere Beziehung stetig den Bach runtergegangen. Diese trägen italienischen Sommertage, an denen wir uns zu zweit in einen Liegestuhl gekuschelt und in den Sonnenuntergang geschaut haben, waren wohl die letzten glücklichen Momente unserer Beziehung.
Am Anfang dachte ich, er würde mich verlassen. Doch er blieb, weinte, sagte, er könne ohne mich nicht leben. Ich war erleichtert, denn ich war mir nicht sicher, ob ich ohne ihn leben konnte. Was sollte ich bloß ganz allein anfangen? Ich hätte mich in Arbeit und Büchern verlieren können, aber ich wusste, welche Leere mich erwartet hätte, denn das hatte ich schon hinter mir. Mit Antonio hatte ich Nähe erfahren, und selbst eine oberflächliche Verbindung zu ihm war besser als Einsamkeit. Ich wollte nicht wieder nur Irini sein, das Mädchen ohne Freunde und Familie.
Aber nun verändert sich alles, als würde unsere Beziehung verrotten, von Motten zerfressen. Langsam werde ich wieder Irini, und die Einheit, hinter der ich mich versteckt habe, zerfällt. Antonio versteht nicht, warum ich Heirat und Kinder so kategorisch ausschließe, und ich kann nicht zugeben, dass ich mir eigentlich auch eine Familie wünsche. Schon der Wunsch allein kommt mir gefährlich vor. Ich kann ihm nicht die Wahrheit sagen, deshalb stopfe ich das Handy zurück in die Tasche und bestelle noch einen Brandy.
Unter Applaus, der wirklich unnötig ist, setzt das Flugzeug auf. Ich erhebe mich und humple zum Ausgang, meine Hüfte schmerzt von der unbequemen Sitzposition. Je näher das Wiedersehen rückt, desto nervöser werde ich, mir ist übel, und ich bekomme schlecht Luft. Es wird ja nur ein kurzer Besuch, ich werde in einem Hotel wohnen und bloß zur Beerdigung erscheinen, tröste ich mich. Ich rede mir ein, dass es meine Entscheidung war herzukommen. Dass ich Elle ja gar nicht alleine sehen muss, wenn ich nicht will. Ich bin kurz davor durchzudrehen, bekomme mich aber wieder in den Griff. Doch als ich am Zoll ankomme, sehe ich Elle schon draußen warten, obwohl sie ja gar nicht wissen kann, mit welchem Flug ich komme.
Ihre Erscheinung hat sich in den letzten Jahren verändert, und trotz meiner trockenen Kehle und meiner feuchten Hände gebe ich mich der Hoffnung hin, dass es ein Zeichen sein könnte, dass es auch anders geht. Vorher hat sie immer Aufsehen erregt, als wäre sie außerstande, sich den gesellschaftlichen Normen gemäß zu kleiden oder zu verhalten. Das war mehr als offensichtlich. Die Raver-Kluft war nur ein Beispiel. Doch nun wirkt Elle vornehm, ihr Haar ist blond und ordentlich frisiert, zu einem kurzen Bob gestutzt. Ihre ranke Gestalt steckt in engen sportlichen Klamotten, und sie hält eine Flasche Evian in der Hand. An den Ohren baumeln dicke Klunker, Perlen so riesig und stumpf, als hätte man sie aus Knochen modelliert. Eine Stepford-Frau wie sie im Buche steht, womöglich mit zwei perfekt geratenen Kindern und einem Schmorbraten im Ofen, die sich nach einem Blowjob vornehm die Lippen abtupft. Hat Elle sich doch verändert? Lächelt sie etwa? Sie wirkt geerdet, als würde sie beim Blick in den Spiegel das Gleiche sehen wie der Rest der Welt. Nur die rosafarbene Narbe auf ihrer Stirn ist nach wie vor da. Bei uns bleiben immer Narben. Unsere Wunden heilen schlecht.
Ich frage mich, wer Elle wirklich ist. Oberflächlich betrachtet scheint sie das komplette Gegenteil von mir zu sein. Elle geht hocherhobenen Hauptes, während ich dank meiner Hüftfehlbildung humple, was sich bei Kälte noch verschärft. Elle ist gertenschlank, im Vergleich dazu bin ich regelrecht pummelig. Mein linker Oberschenkel ist trotz intensiver Zuwendung nicht gut ausgebildet. Antonio gibt sich beim Sex immer extra Mühe, streichelt und küsst den Schenkel, fährt mit der Hand über die verschrumpelte Haut, als wäre es eine erogene Zone. Ist es aber nicht. Vielleicht will er mich damit auch nur daran erinnern, dass ich ein Krüppel bin und ein wenig mehr Dankbarkeit für seine Liebe zeigen sollte, indem ich mir in Sachen Heirat einen Ruck gebe. Kein Mann würde sich das bei Elle trauen.
Aus der Nähe sehe ich, wie Elle vor lauter Anspannung die Zähne aufeinanderpresst. Also doch kein Lächeln, mit konzentriertem Blick scannt sie die Menge. Ich lege einen Zahn zu und schlüpfe durch die Zollabsperrung, einen dicken Kloß im Hals. Kaum hat Elle mich entdeckt, lässt sie mich nicht mehr aus den Augen, drängt sich an einer Frau mit einem weinenden Kleinkind vorbei, stößt den Buggy halb um. Missbilligend schnalzt sie, so wie es Leute tun, die keine Kinder haben, um die Eltern zu beschämen, deren Kinder aus Versehen gestört haben. Diese Unverfrorenheit ist typisch für Elle, und anders als ich hat sie sich noch nie in Frage gestellt. Ihr Selbstvertrauen ist bestrickend, daran hat sich nichts geändert. Sie hat ihr Outfit geändert, ist aber immer noch Elle. Mir wird noch einmal deutlich, dass ich mich bei meiner Schwester eigentlich nur auf eines verlassen kann: dass sie nie müde wird, mich ausfindig zu machen.
Am Anfang habe ich es ihr noch leicht gemacht. Hab einfach die Telefonnummer gewechselt, bin innerhalb derselben Stadt umgezogen. Immer auf sich allein gestellt zu sein, ist hart; irgendwie hat es mir immer Auftrieb verliehen, dass Elle mich sucht, auch wenn ich mit achtzehn vor ihr geflüchtet bin. Also habe ich sie mit falschen Fährten und Sackgassen auf die Probe gestellt, so dass sie ihre Entschlossenheit mehr und mehr beweisen musste. Dass sie nach mir suchte, versetzte mich in einen Rausch, von dem ich abhängig war. Gewollt zu sein. Wie herrlich! Nur eines war schlimmer als ihre Abwesenheit: ihre Anwesenheit.
»Ich habe mich schon gefragt, wie lange ich hier noch auf dich warten soll.« Sie mustert mich von oben bis unten, ihr Kiefer ist noch immer angespannt, ihre Lippen zu einem Grinsen verzerrt. Ich lächle, gebe mir alle Mühe, freundlich zu wirken, so als hätte ich nicht mein halbes Leben damit verbracht, ihr aus dem Weg zu gehen.
»Ich bin gerade angekommen. Habe dich eben erst gesehen«, sage ich und spiele mit dem Griff meiner braunen Reisetasche, traue mich noch nicht, ihr in die Augen zu sehen. Dann nimmt sie mich ganz überraschend in den Arm. Unbeholfen stolpere ich ihr entgegen, dabei schaut uns ein mittelalter Mann mit aufgeblähtem Bauch lächelnd zu und freut sich über unser Wiedersehen. Elle nimmt mich daraufhin noch fester in den Arm und schnurrt dabei fast wie ein Kätzchen. Als ich mit der Wange ihren kühlen Hals streife, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Kaum ist sie sich eines Publikums bewusst, setzt sie ein strahlendes Lächeln auf. Dann löst sie sich von mir, schlingt den Arm um mich und zieht mich an sich. Ich rede mir ein, dass ihr Griff nicht fester ist als nötig, trotzdem verabschiedet sich mein Selbstbewusstsein gerade und flattert wie ein sturmzerfetztes Segel nutzlos im Wind.
Du wolltest ja unbedingt herkommen, sage ich mir. Du willst die Wahrheit wissen. Was kommt als Nächstes? Ich bin gerade mal fünf Minuten hier und schon vollkommen unter ihrem Bann, blindlings folge ich ihr. Wie werde ich mich erst morgen fühlen?
»Toll siehst du aus«, ruft sie auf dem Weg zum Ausgang, aber es klingt total aufgesetzt. »Du hast ja richtig zugelegt!« Um ihre Begeisterung zu unterstreichen, kneift sie mir mit ihren manikürten Fingern in die Wange. Elle schnappt sich meine Tasche; ich lasse sie gewähren. Dann drängt sie sich durch die Menge und zerrt mich hinter sich her.
Draußen weht es ordentlich, und mir tränen sofort die Augen. Mit dem Handrücken tupfe ich mir die Augenwinkel trocken. Ich bleibe stehen und zwinge auch Elle, stehen zu bleiben. »Bevor wir weitergehen, muss ich dich noch etwas fragen.«
Aber sie stellt sich einfach taub. »Es ist ja schon eine Ewigkeit her«, sagt sie und dreht sich zu mir um. Als sie schwer schluckt, rechne ich kurz damit, dass sie gleich weint. Sofort habe ich Mitleid, sogar ein schlechtes Gewissen. Doch das ist mal wieder nur eine Masche von ihr, sie lässt mich glauben, dass sie mich braucht.
Ich unternehme einen neuen Versuch. »Elle«, sage ich leise, denn ich kenne mich, wenn ich jetzt nicht frage, verlässt mich der Mut ganz. »Wie ist sie gestorben?«
In Elles kalte, eisblaue Augen tritt ein Funkeln. Sie greift meine Hand, verschränkt ihre Finger mit meinen, so wie sie es vielleicht als Kind getan hätte, wenn wir je die Chance gehabt hätten, als Schwestern aufzuwachsen. Elle hat einen festen Griff. Schweigend zieht sie mich über den Parkplatz, ein schiefes Grinsen umspielt ihre Mundwinkel. Für mich ist ihr Schweigen ein Schuldeingeständnis, mein Selbstvertrauen rutscht in den Keller.
Und in dem Moment wird mir klar, was hier vor sich geht. In all den Jahren ohne Elle habe ich vergessen, wer ich wirklich bin. Ich habe vorgegeben, jemand anders zu sein als das verlassene kleine Mädchen. Doch kaum bin ich mit Elle vereint, ist es wieder da. Keine drei Minuten mit meiner Schwester und schon offenbart sich ein Teil der Wahrheit, wegen der ich doch hergekommen bin: Ich werde immer das Mädchen bleiben, das keiner wollte. Da kann ich mich auf den Kopf stellen und mir weiter einreden, dass Antonio der Einzige ist, den ich brauche.
Ich muss an all die Male denken, die ich vor Elle davongelaufen bin, um endlich ich selbst zu sein. An die Zeit mit Antonio, in der ich glaubte angekommen, ja, heil zu sein und der armen Irini Holzbein ein für alle Mal Lebewohl gesagt zu haben. Jahrelang habe ich studiert, um Ärztin zu werden – eine Fassade, hinter der ich mich verstecken konnte. Zeitverschwendung. Elle drängt sich wie Gift in die Risse meines Lebens, füllt sie auf, macht mich ganz, das spüre ich jetzt schon. Mit jedem Schritt schnellen die Spitzen ihres scharfkantigen Haarschnitts wie Messer hervor. Mir ist zum Heulen, denn endlich weiß ich, dass ich von Geburt an immer nur eines sein durfte: ich, das kleine, unerwünschte Mädchen.
4.
Elle reicht mir meine Tasche, und wir suchen in einem bleigrauen Mercedes-E-Klasse Schutz vor dem harschen schottischen Wind. Meine Schwester dreht den Schlüssel im Zündschloss, der Motor erwacht zum Leben, und ein Opernchor plärrt über die Lautsprecher. Sofort schaltet Elle den CD-Spieler aus; Stille senkt sich über uns. Im Wagen ist es kalt, obwohl die Heizung voll aufgedreht ist und mir die Lüftung Tränen in die Augen treibt. Ich sitze wie ein Idiot auf dem Beifahrersitz und weiß nicht, was ich sagen soll, denn Elle hat meine Frage immer noch nicht beantwortet.
»Elle«, sage ich leise, fast entschuldigend und streiche mir den Pony aus den Augen. »Ich möchte wissen, wie sie gestorben ist.«
Sie schnallt sich an, korrigiert die Gurtlänge, als hätte ich nichts gesagt. »Willst du sie sehen? Soll ich dich zu ihr bringen?«, fragt sie und überprüft die Anzeigen am Armaturenbrett. »Wäre doch schön, wenn du sie noch mal zu Gesicht bekommst.« Dabei lächelt sie matt und starrt vor sich hin. »Der kleine Schmetterling kehrt nach all den Jahren ins Nest zurück.«
»Wohl kaum«, sage ich mit einem kurzen Kopfschütteln, meine Augen sind angstvoll geweitet. So habe ich mich schon oft gefühlt, als Teenager, wenn ich unsicher war, wohin Elle mich führen würde. Nun testet sie auch noch die Scheibenwischer, obwohl es gar nicht regnet. Die Scheibenwischer bewegen sich über die Windschutzscheibe – quietsch, schab, quietsch, schab – bis Elle einen Spritzer schaumig grünes Wasser aus der Scheibenwaschanlage dazugibt. Beim Anfahren werfe ich noch einen letzten Blick auf die Abflughalle, auf Passagiere, die mit glücklichen Gesichtern in die Fremde reisen. »Warum sollte ich ihre Leiche sehen wollen? Du willst mir ja noch nicht einmal sagen, wie sie gestorben ist.«
»Sie ist einfach gestorben, okay? Tot. Sie ist scheißtot. Was musst du denn noch wissen?« Elle seufzt. »Wo willst du denn hin, wenn du unsere tote Mutter nicht sehen willst?« Es klingt, als könnten wir uns nicht einigen, ob wir zu Costa oder Starbucks gehen sollen. Sie nimmt die nächste Autobahnauffahrt Richtung englische Grenze. Obwohl sie gefrustet ist, fährt sie vorbildhaft. Vor uns erstrecken sich endlos grüne Felder, nur hie und da blitzen durch die weniger dichten Hecken die erhabene Burg und die Turmuhr des Balmoral Hotel auf. Dort, zwischen Steinen und Menschen, könnte ich es aushalten, obwohl ich auch in der Stadt Erinnerungen an Elle habe. Doch das Land ist wie die offene See, tief und weit, unüberwindlich. Als gäbe es kein Entkommen. »Wenn du sie nicht sehen willst, können wir ja was zusammen unternehmen.« Elle tätschelt mein Bein wie eine Mutter, die ihrem Kind Mut machen will. So wie Tante Jemima es bei ihren eigenen Kindern tat, Wunschkindern, woran sie mich immer wieder gerne erinnerte. Mich schaudert es bei der Berührung, ich verkrampfe mich. Fühle mich wie eine Sprungfeder unter Spannung.
»Ich will in ein Hotel.« Ich gebe mir Mühe, selbstbewusst zu klingen, mich an die Person zu erinnern, die ich all die Jahre bis zu diesem Zeitpunkt sein wollte. Ich will ein Bad nehmen und schlafen. Ein bisschen rauchen, Wein trinken. Ein paar Valium einwerfen. Das würde mir wirklich helfen. Eigentlich würde alles helfen, solange es nichts mit Elle zu tun hat. Als sie gar nicht auf meine Bitte reagiert, werde ich wieder unsicher, stelle mich in Frage. Ich hätte niemals herkommen sollen, das ist mir jetzt auch klar. »Irgendetwas in der Nähe. Was dir so einfällt«, füge ich hastig hinzu. Ein unbeholfener Versuch, meine Entschlossenheit abzumildern.
Ohne auf die Uhr zu sehen, sagt Elle: »Es ist doch erst fünf nach fünf. Was willst du denn um diese Zeit im Hotel, wo wir uns – wie viele Jahre noch mal? – nicht gesehen haben?« Und bei hundert Sachen auf der Autobahn dreht sie sich zu mir und sieht mir in die Augen. »Sechs Jahre? Du kommst mit mir, sonst gehst du nirgends hin!« Damit teilt sie mir unmissverständlich mit, dass ich nicht die Einzige bin, die ambivalente Gefühle hat, Gefühle, die der Höflichkeit halber unterdrückt werden.
»Ich bin müde vom Flug«, sage ich, doch das hätte ich mir schenken können, ich habe verloren. Elle hat sechs lange Jahre auf ein Wiedersehen warten müssen. Als ich noch jünger war, war es für uns beide einfacher. Damals war ich viel aufgeschlossener. Mit dreizehn ist das ja auch kein Wunder!
So alt war ich, als Elle das erste Mal unangekündigt auftauchte, obwohl unsere Eltern sich bemühten, uns voneinander fernzuhalten. Wie eine Heldin ist sie in mein Leben getreten und hat mich vor Robert Kneel und seiner Gang gerettet. Dann gab es noch die mitternächtlichen Ausflüge in den Park, wenn Tante Jemima mich schlafend im Bett wähnte, die Sachen, die Elle für mich klaute, den Alkohol, den sie für mich kaufte, und ihre zaghafte Fürsorge, wenn ich alles wieder auskotzte.
»Im Hotel übernachtest du jedenfalls nicht«, sagt sie. Spucke fliegt, ihre Geduld ist erschöpft. Ich weiß schon, was sie sagen wird. Sie will, dass ich bei ihr im Haus übernachte. In meinem Beinahe-Elternhaus. Doch in einem Haus zu schlafen, das niemals mein Zuhause sein könnte, ist undenkbar. Ein Witz. »Außerdem leben wir mitten in der Walachei. Dort gibt es keine Hotels. Du wohnst bei mir im Haus.« Ich unternehme den kläglichen Versuch zu widersprechen, doch ich bin machtlos. Als wäre ich Treibholz, das den Wellen hilflos ausgeliefert ist. Elle hat sich wieder im Griff, sie tätschelt mir abermals das Bein, und wir setzen unsere Fahrt schweigend fort. Warum habe ich es ihr bloß wieder so leicht gemacht? Ich fasse es nicht.
Nach einer Stunde Fahrt geht es langsamer voran. Wir schlängeln uns durch kleinere Straßen, die uns zu dem Ort bringen, der nur gerade eben nördlich der Grenze liegt. Zum ersten Mal seit unserer Auseinandersetzung riskiere ich einen Blick aus dem Fenster. Mehr als wuchernde Hecken und Berge in der Ferne kann ich nicht ausmachen, darüber eine bedrückende graue Wolkendecke, die mich zu verschlingen droht. Hier kann man sich nirgends verstecken. Keine orangefarbenen Großstadtlichter wie in London. Noch nicht einmal die Sonne ist zu sehen. Dafür aber ein Schild, dreckverschmiert und von rosa Fingerhut umwachsen: Willkommen in Horton. Ich erkenne es wieder. Jetzt dauert es nicht mehr lange.
Als wir endlich die Einfahrt zum Familienanwesen erreichen, habe ich ein tränengroßes Stück Haut von meinem Daumen geknabbert, eine Angewohnheit aus der Kindheit, die ich nie ganz abgelegt habe. Der Hautfetzen löst sich, und Blut schießt heraus. In dem Moment passieren wir eine Schiefertafel mit der Aufschrift: Mam Tor. Ich schließe die Finger um die Wunde und traue mich nicht aufzuschauen, denn irgendwie weiß ich, dass wir da sind. Über unwegsamen Untergrund holpern wir eine lange Auffahrt hinauf. Als wir uns den Toren nähern, werden wir langsamer, und ich zwinge mich aufzuschauen. Am Ende einer Allee steht ein Haus. Mir dreht sich der Magen um, als wir darauf zufahren.
Das Anwesen ist ein hochherrschaftliches Monstrum, groß genug für fünf Familien. Linker Hand steht ein Gewächshaus, dahinter ragen Bäume in die Höhe, wahrscheinlich ein Obstgarten, dichter Nebel hängt über den Kronen. Rechts entdecke ich ein weiteres Gebäude, Garagen, sechs an der Zahl. Sechs verdammte Garagen.
»Die hat das Bauunternehmen meines Vaters in den Siebzigern errichtet«, sagt Elle wie eine Stadtführerin, bevor sie in sich hineinlacht. »Sorry, ich meine unseres Vaters.« Meine Lippen zucken, halb Lächeln, halb epileptischer Anfall. In pseudoviktorianischer Manier treten die Fenster erkermäßig hervor, dahinter Schwaden aus Vorhängen, schwer und üppig erdrücken sie die Rahmen. Sonst sieht man nichts, als wäre dieser Ort ein einziges schwarzes Loch, das nur darauf wartet, mich zu verschlingen.
Elle hält vor dem Garagenbau, der Kies knirscht unter den Reifen. Beim Aussteigen schlägt sie die Tür so heftig zu, dass der Wagen wackelt, dann verfällt sie in einen halbherzigen Trab und schnellt leicht wie eine Feder in ihren superangesagten Sportklamotten und Turnschuhen auf das Eingangsportal zu. Vor dem Hintergrund dieses Hauses sind mir Elles teure Schuhe und Klamotten urplötzlich nicht mehr egal.
Denn vorher konnte ich mir immer einreden, dass meine Herkunftsfamilie arm ist. Arm und durchgeknallt wie Elle. Dass es auch seine guten Seiten hatte, nicht bei ihnen aufzuwachsen. Aber das stimmt nicht. Jedenfalls nicht der Teil mit der Armut. Ich könnte kotzen bei all dem Reichtum hier. Ob Elle mir in dem Fall auch wieder die Haare aus dem Gesicht halten und den Mund abputzen würde?
Natürlich spielt es eine Rolle, weil ich als Kind immer die Sachen von anderen auftragen musste, die kratzigen No-Name-Klamotten, die nie richtig passten. Abgelegte Kleidung für das abgelegte Kind. Tante Jemima war nicht sonderlich erpicht darauf, die Familienkasse für mich zu schröpfen, stattdessen begnügte sie sich mit den monatlichen Unterhaltszahlungen meines Vaters, die anscheinend nie sehr weit reichten. Einmal erbte ich ein Paar Reeboks, braun und abgestoßen, aber immerhin Reeboks. Und zum ersten Mal in meinem Leben war ich richtig stolz. Wie die Königin von Saba bin ich in die Turnhalle geschwebt. Aber dieses Haus schert sich einen Dreck um solche Schuhe. Das Haus ist so groß, dass die Bewohner sich Hunderte neuer Reeboks leisten könnten.
Ich steige aus dem Wagen, knalle die Tür zu und klemme den Zipfel meiner Strickjacke darin ein. Mit einem Ruck reiße ich ihn heraus, dabei löst sich ein schlangenähnlicher silberner Faden. Ich atme einmal tief durch. »Du bist wegen der Wahrheit hier«, flüstere ich. Als ich noch einmal ins Wagenfenster schaue, taucht hinter der Spiegelung von Gesicht und Haus meine Tasche auf. Ich rüttele an der Tür, aber das Auto ist verschlossen. »Meine Tasche«, rufe ich Elle zu und warte, bis sie die Fernbedienung drückt. Die Lichter gehen an und aus, ich probiere es wieder an der Tür. Immer noch verschlossen. Elle lacht höhnisch und verschwindet im Haus.
Der Kies knirscht unter den Füßen, als würde man über zerbrochene Knochen laufen. Erschrocken drehe ich mich um, als sich die Eisentore der Einfahrt mit metallenem Quietschen schließen. Die knorrigen Bäume auf der Auffahrt bilden ein gewundenes, verwachsenes Blätterdach. Hinter dem Gewächshaus geht es steil bergan, der Boden ist schwarz und vom Regen gut getränkt, hier und da ragen Felsnasen empor.
Elle hat die schwere Eichentür einen Spalt breit offen gelassen. In der Halle dahinter ist außer langen Schatten und Staub nichts zu sehen. Irgendwo im Hintergrund tickt eine Uhr, ich schiebe die Tür ein wenig weiter auf. Nicht, um das Haus zu betreten, sondern um die späte Nachmittagssonne hineinzulassen. Ins Dunkle möchte ich nicht.
An den Wänden lauter Ölgemälde, eine Ansammlung erlauchter Gesichter, die sich irgendwie alle gleichen. Mir fällt auf, dass die Augen den meinen nicht unähnlich sind. Vorfahren? Familienmitglieder? Auf einem Obelisken neben der Tür steht eine chinesische Urne, überhaupt kommt man sich hier vor wie im Museum, es ist alles da, bis hin zum Modergeruch. Im Grunde ist es ja auch das Museum meiner Lebensgeschichte, von der ich nichts wissen durfte. Ich bin eine Archäologin – Indiana Jones, nur ohne coolen Hut und treuen Helfer –, die in den frühen Jahren ihres Lebens gräbt. Mein Blick fällt auf ein ausladendes Treppenhaus, das zu den anderen Stockwerken führt. Ich will gar nicht wissen, was sich dort oben befindet.
Elle kommt angeflattert, leicht und federnd, in der Hand eine neue Flasche Evian. Sie betätigt den Lichtschalter, und der Kronleuchter taucht alles in harsches Licht, Muster tanzen umher wie ausgeschnittene Papierschneeflocken.
»Was ist mit deiner Tasche?«, fragt sie todernst, als würde sie wirklich damit rechnen, dass ich sie dabeihabe.
»Das Auto ist zu. Du hast es zugemacht.«
»Na, die brauchst du doch, oder?«
Sie bietet mir die Wasserflasche an, und obwohl ich vor Durst fast umkomme, lehne ich ab. »Nein, danke.« Mit einem Fuß stehe ich schon im Haus. Elle zieht mich hinein und schließt die Tür. Einen Moment herrscht Stille, nur wir beide. Und dann sehe ich ihn, reglos steht er auf der Treppe und betrachtet mich.
»Irini.« Das muss mein Vater sein, auch wenn ich ihn nicht richtig sehen kann, sein Gesicht liegt im Schatten. Ich mache den Mund auf, um etwas zu sagen, Elle klammert sich richtig an mich. Ich bewege die Lippen, doch es kommt kein Laut heraus. Was soll ich überhaupt sagen? Wo anfangen? Ich gebe einen Kiekser von mir. »Du bist hier.« Es klingt … herzlich. »Ich könnte uns doch Tee kommen lassen und wir …« Elle gibt ihm nicht die Möglichkeit auszureden, und er macht einen Schritt zurück, als sie sich zu ihm umdreht.
»Sie ist müde von der Reise«, sagt sie. Als Elle mir die Hand tätschelt und mich wegzieht, durchfährt mich ein Schauder wie ein Riss in brüchigem Eis. Sie lässt den Mann nicht aus den Augen. Ich schaue zu Boden, hebe nur kurz den Blick. Elle zerrt mich fort, und obwohl mir die Frage Warum? Warum ich? auf der Seele brennt, bleibe ich stumm. »Ich zeige dir dein Zimmer.«
»Ja, das ist vielleicht auch das Beste«, ruft er uns hinterher und geht zwei weitere Stufen zurück. »Zum Reden haben wir ja später noch Zeit, wenn du ausgeruht bist.« Mein Herz setzt einen Schlag aus, mein Mund ist wie zugeklebt. Ich ringe nach Luft. Er will wirklich mit mir reden.
Elle zerrt mich in die Küche und schließt die Tür hinter uns. Hier ist es heller als in der Eingangshalle, die Luft ist auch etwas frischer, nicht so abgestanden. In Gedanken bin ich noch bei meinem Vater, doch als ich die nackten Fenster und die filigran gemusterten Fliesen sehe, kommt eine Erinnerung hoch. Aus dem Nichts schlägt sie zu. Ich taumle rückwärts, wahrscheinlich verhindert nur Elles fester Griff, dass ich stürze. Ich habe ein Bild von mir als Baby vor Augen, wie ich meinen schlaffen Körper juchzend über den schwarz-weißen Boden ziehe und jemand hinter mir Gut gemacht! ruft. Eine Frauenstimme. Starke Arme. Ich habe schon immer starke Arme gehabt. Mussten sie ja auch sein, ich konnte ja nicht laufen. Der Boden hat sich kalt angefühlt, bis auf die eine Fliese bei der Spüle, die sich vom Heißwasserrohr erwärmt hat. Kann das sein? Ist es möglich, dass ich Erinnerungen an dieses Haus habe?
Elle zieht mich weiter, das Bild verschwimmt. Bevor wir durch eine weitere Tür entschwinden, schaue ich mich noch einmal um, die Erinnerung, wenn es denn eine war, ist längst futsch. Unsanft führt Elle mich am Arm durch ein Labyrinth aus Korridoren, die sich wie ein gezacktes Tunnelsystem durchs Haus ziehen und dabei immer dunkler und enger werden, bis wir zu einer Treppe gelangen. Sofort spüre ich den Staub in der Kehle. Als hätten wir den unbenutzten Flügel eines alten Schlosses betreten, wo sonst nur das Personal hinkommt. Ich höre sogar den Boiler über uns ticken. Im Vergleich zum Treppenhaus in der Eingangshalle ist diese Treppe schmal und verläuft schnurgerade an der Wand entlang. Die Wände sind schmucklos, keine Porträts, Gemälde oder exotischen Erbstücke.
Die Stufen sind mit einem dicken, roten Teppich überzogen, der wohl schon seit dem Bau des Hauses dort liegt. Reich verzierter Stuck an der Decke, um gefällig zu wirken. Hier scheint alles alt, irgendwie antiquiert, als wäre es jahrelang nicht benutzt worden. So ganz anders als in meinem Haus in London, wo ich mir große Mühe gegeben habe, es so unpersönlich wie nur möglich zu gestalten. Der Treppenabsatz ist ähnlich schwach beleuchtet wie der dahinterliegende Flur. Von dort geht eine Reihe holzvertäfelter Türen mit schmiedeeisernen Klinken ab, außerdem gibt es noch einen toten Korridor, der ins Nichts führt. An der Wand befindet sich eine Kommode mit hohen Regalen, in denen lauter Fotos stehen. Als ich sie mir ansehen will, stellt Elle sich vor mich.
»Badezimmer«, faucht sie und deutet in eine Richtung. »Schlafzimmer.« Sie deutet in die andere Richtung. Ihr lässiges Auftreten ist wie weggeblasen. Still und mit gesenktem Kopf huscht sie die Treppe hinunter, verabschiedet sich nicht einmal. Ich sehe ihr nach, überrascht, wie schnell sich ihre Stimmung ändert. Wieder wird mir bewusst, dass sie immer noch die gleiche Elle ist. Ich schaue mich nach den Bildern um. Ob ich auch auf einem der Fotos bin? Doch als ich Elle und meinen Vater in der Küche laut streiten höre, will ich nur noch weg. Auch wenn ich die Wahrheit wissen möchte, ist mir das gerade zu schnell, zu viel.
Ich versuche, die Schlafzimmertür zu öffnen, rüttle am Griff, der klemmt. Endlich gibt die Tür nach, aber drinnen sieht es nicht viel besser aus. Ein feuchter Modergeruch schlägt mir entgegen. Als ich mich auf dem schmalen Bett niederlasse, verschwinde ich in einer Staubwolke. Eine Handvoll alter Möbel steht im Zimmer, an der Wand ein langweiliges Schmetterlingsbild in gedämpften Farben, vielleicht sind sie auch nur verblichen. Über dem Bett hängt ein Haken, der wohl mal Teil einer alten Lampe war. Das Fenster ist bloß ein Schlitz, die Scheibe aus billigem Doppelglas mit Rautenmuster. Draußen geht eine leichte Brise. Beim Versuch, das Fenster zu öffnen, merke ich, wie zerbrechlich die Konstruktion ist. Ein Kind würde womöglich hindurchfallen, wenn es sich dagegen lehnt. Ich mache das Fenster auf und lasse Luft hinein. Das tut gut. Endlich durchatmen.
Links hinter den Garagen sind Arbeiter auf einem Baugerüst zugange. Sie schnippeln an den Koniferen herum, hinter denen direkt der Wald beginnt. Krampfhaft versuche ich mich zu erinnern. Kommen mir die Bäume bekannt vor? Wenn ich mir dreißig Jahre wegdenke, waren es nur kleine quadratische Büsche. Vielleicht war die Garage damals noch nicht einmal gebaut. Doch anders als in der Küche kommen keine Erinnerungen hoch. Ich entdecke einen weiteren Arbeiter, der sich vor den Garagen zu schaffen macht. Er poliert den Wagen, in dem ich gekommen bin. Die Türen stehen offen, meine Tasche liegt dort auf dem Sitz. Zwei Pullis und Wechselwäsche, Zigaretten und das Valium. Und das Handy. Lose Verbindungen zu einer Außenwelt ohne Geschichte, wo ich nicht plötzlich von irgendwelchen Erinnerungen überfallen werde, denn es gibt keine. Hätte ich mich vor der Abreise doch bloß noch mit Antonio vertragen! Im Moment ist er das einzige Bindeglied zu der Person, die ich unbedingt sein will; Antonio ist meine Rettungsinsel. Ich drehe mich zur Tür um, will nach unten gehen. Ich brauche das Handy, ich sollte Antonio anrufen. Aber hier in diesem Zimmer fühle ich mich gefangen.
Als ich mich umschaue, entdecke ich auf dem Nachttisch ein altes Telefon. Es ist schwarz, das Kabel brüchig, an manchen Stellen fehlt die Isolierung. Ein altes Gerät mit Drehscheibe. Ich setze mich aufs Bett, die Matratze ächzt und stöhnt, Staub steigt auf. Meine Knie reichen fast bis an die Ohren, weil das Bett so tief ist. Ich nehme den Hörer ab, um Antonio anzurufen. Doch statt eines Tutens vernehme ich Stimmen.
»Ja, sie ist hier«, sagt die erste Stimme. Ein Mann. Er? Mein Vater?
»Hat sie also darauf bestanden?«, fragt ein weiterer Mann.
»Ja.« Eine lange Pause, in der nur Atmen zu hören ist. »Aber es ist ja nicht für lang. Hoffentlich werde ich einigermaßen mit ihr fertig.«
»Bald bist du sie los, Maurice. Jetzt dauert es nicht mehr lange.«
Maurice. Ja, Maurice. So hieß er. Maurice und Cassandra. Meine Beinahe-Eltern.
»Stimmt. Wie schnell kannst du kommen, um den Papierkram zu erledigen?«
Langsam drücke ich die Gabel mit dem Finger herunter, lege den Hörer zurück. Ich lasse mich aufs Bett sinken, halte mir die Ohren zu.
»Ich will nicht hier sein«, flüstere ich, aber selbst in diesem Moment weiß ich, dass es nicht stimmt. Im Grunde ist mir klar, warum ich hier bin. Um die Wahrheit herauszufinden, die mir keiner verraten wollte. Nicht Elle, nicht Tante Jemima. Ich bin gekommen, um endlich Klarheit zu haben. Warum musste ich dieses Haus und diese Familie verlassen, um bei einer Frau zu leben, die mich nicht wollte? Warum haben sie Elle behalten und mich weggegeben? Und nach all den Jahren können sie es schon wieder nicht abwarten, bis ich wieder abreise? Ich bin auf der Suche nach dem fehlenden Teil meiner selbst, dem Teil, der zurückgeblieben ist, und den ich nur hier finden kann.
5.
Das erste Mal hat Elle mich mit dreizehn in der Schule aufgespürt. Den Nachhauseweg hatte ich wegen eines Jungen hinausgezögert. Robert Kneel hatte an meinem Gang Anstoß genommen. Damals eierte ich noch böse mit links, was ich mit einem entschlossenen Schritt rechts auszugleichen versuchte. Gepaart mit einem leichten Buckel brachte es mir den Spitznamen Bison ein, eine unschöne Alternative zu Irini Holzbein.
Kneel war ein fieser kleiner Wicht, dessen Arme zu lang für seine Hemden waren und dessen Knöchel unter den Hosenbeinen hervorschauten. Er war arm, und das sah man auch. Seine Haut hatte immer diesen gräulich blassen Ton, als bekäme er nicht genügend Eisen über das kostenlose Schulessen, auf das er angewiesen war, weil seine Eltern ihm kein Essen mitgeben konnten. Jeden Tag lauerte er mir am Schultor auf.
Ich dachte, ich hätte lange genug gewartet, aber vierzig Minuten nach dem Klingeln stand er immer noch da. Als ich ihn entdeckte, war es zu spät zum Umkehren. Also senkte ich den Kopf und beschleunigte den Schritt. Hhhhhhhuuuummmmmm. Der Laut eines Bisons, so tief und kehlig, wie es Kneels brüchige Stimme zuließ. Hhhhhhhuuuummmmmm, setzten seine drei Gefolgsleute ein, und schon bald skandierten sie im Chor. Die Jungs ließen mich erst vorbei, was mich noch mehr verunsicherte, um sich gleich darauf an meine Fersen zu heften.
In dem Moment tauchte Elle vor mir auf. Jemanden wie sie hatte ich noch nie gesehen. Damals war sie siebzehn. Das pinke Haar stand in Büscheln vom Kopf ab, der Nasenring glitzerte im Sonnenlicht. Erst erkannte ich sie gar nicht, aber dann rief die kleine dreieckige Narbe auf ihrer Stirn eine fast verschüttete Erinnerung wach. Und zwar an unsere einzige Begegnung im Alter von neun. Meine Eltern hatten dieses Treffen arrangiert, aber sie sollten es bereuen. Anschließend sagte Tante Jemima, wir müssten umziehen, damit Elle uns nicht fände. Tante Jemima wäre glatt bereit gewesen, das Land zu verlassen, wenn Onkel Marcus zugestimmt hätte. Irgendwann hat Elle eine unserer Cousinen zufällig in Edinburgh getroffen und ist ihr bis zu unserem neuen Haus gefolgt. Meine Schule aufzuspüren war dann nur noch ein Kinderspiel.
»Hi«, rief sie mir fröhlich zu. Die Jungen, die mich eingeholt hatten, blieben stehen. Elle begrüßte mich, als wären wir alte Freunde, als würde ich sie kennen.
»Hi«, entgegnete ich mit zitternder Stimme. Ich war den Tränen nah, meine Wangen waren gerötet von der Anstrengung, dem Schmerz und der Scham. Elle marschierte direkt auf Robert Kneel zu, von Fröhlichkeit keine Spur mehr. Die Jungs wollten Reißaus nehmen, ihnen war klar, dass das Spiel aus war, doch Elle erwischte Kneel an der Kapuze seines Pullis. Denn so kleideten sich die ganz Coolen 1996, trugen unter ihrer Schuluniform verbotene Hoodies. Selbst die Bettelarmen.
»Du kleine Fotze«, sagte sie zu ihm und schlug ihm ins Gesicht. Er wehrte und wand sich, strampelte und trat. Und ich dachte die ganze Zeit nur daran, dass ich morgen in der Schule, wenn Elle nicht mehr dabei wäre, bitter bezahlen müsste. Vielleicht würde Kneel mich sogar umbringen.
»Lass mich in Ruhe, du Schlampe«, brüllte er. Kaum hatte er das gesagt, hatte sie ihn auch schon zu Boden geschleudert. Und ich meine wirklich und wahrhaftig geschleudert, als würde sie bowlen oder Teller zerdeppern, jedenfalls als wollte sie mutwillig etwas zerstören. Unwillkürlich wich ich zurück, kreischte, als er auf die Erde schlug. Ein Vorderzahn schoss wie eine Kanonenkugel aus Kneels Mund, Blut rann ihm übers Kinn. Elle drehte sich grinsend zu mir um, zog die Brauen etwas hoch und verpasste ihm einen Tritt zwischen die Beine. Er schrie auf vor Schmerz, aber sie lachte nur. Damals konnte ich es nicht fassen. Ich sah mich nach Zeugen um, als wäre ich die Schuldige. Doch da war niemand. Dieser Teil der Straße war von den Häusern aus nicht einzusehen. Elle hatte die Stelle gut gewählt.
»Kleine Fotzen brauchen keine Eier«, sagte sie und trat ihm erneut zwischen die Beine. »Ich beobachte dich schon seit Wochen.« Zweimal trat sie noch nach, bevor sie mich bei der Hand nahm und loslief. Ich stolperte hinter ihr her, mein Ranzen, beschmiert mit den Kritzeleien meiner Cousine aus dem Vorjahr, hüpfte auf und ab.
Wir kamen zu einem grünen Volvo-Kombi, der gleich um die Ecke geparkt war. Ich weiß noch, wie froh ich war, denn meine Hüfte hätte nicht viel länger mitgemacht. Ich saß auf dem Beifahrersitz und konnte nicht fassen, was Elle gerade getan hatte, während sie uns in aller Seelenruhe zu McDonald’s kutschierte. Bei Big Macs und sechs Portionen Pommes, die wir uns teilten, lachte Elle über Robert Kneel und wie sie ihn fertiggemacht hatte. Ich lachte halbherzig mit. Meine Gedanken kreisten vor allem um den nächsten Tag, was dann passieren würde. Anschließend kaufte sie mir noch eine heiße Apfeltasche, an der ich mir in meiner Hast, mich dankbar zu zeigen, die Lippen verbrannte. Und die ganze Zeit über fackelte Elle Streichhölzer ab bis die Flammen ihre Fingerkuppen erreichten. Einmal roch ich sogar ihre angesengten Nägel.