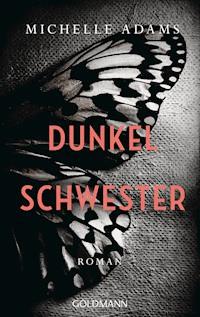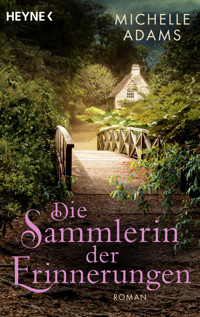
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein kleines Dorf in Südfrankreich in den 80er-Jahren: Für die junge Frances ist Benoit die erste große Liebe und der gemeinsam verlebte Sommer erscheint ihr unendlich. Doch dann vertraut ihr Benoit ein Geheimnis an, das sie für immer trennen wird.
2022, Cotswolds, England: Harry Langley löst den Haushalt seiner verstorbenen Mutter Frances auf, die ihm ein Vermächtnis hinterlassen hat. Gemeinsam mit seiner Exfreundin Tabitha, einer Kunsthistorikerin, soll er nach einer wertvollen Schatulle suchen. Während sie die Erbschaft der sammelwütigen Frances sichten und Harry Stück für Stück die Vergangenheit seiner Mutter aufdeckt, kommen sich auch die beiden wieder näher. Doch was hat es mit der Schatulle und jenem längst vergangenen Sommer in Frankreich auf sich?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
»Ich habe dich vermisst«, flüsterte er und gab ihr einen Kuss. »Jetzt wo du zurück in Frankreich bist, will ich nirgendwo anders sein als bei dir.« Mit seinen weichen, heißen Händen auf ihrer Haut und seinem atemlosen Flüstern zwischen Küssen und sanften Berührungen konnte sie sich ihr restliches Leben bildlich vorstellen. Es wirkte ganz genauso perfekt wie dieser Moment, in dem alles möglich erschien. Alles sah wie Benoit aus.
»Du hast mich doch erst gestern Abend gesehen«, kicherte sie.
»Und ich werde dich wiedersehen, jeden einzelnen Abend. Wie auch nicht? Aber wird das jemals genügen? Wie kann ich dich nicht vermissen, wenn wir getrennt sind?« Er küsste sie erneut, bevor er den Blick zurück aufs Lenkrad richtete.
Die Autorin
Michelle Adams wuchs in England auf und lebt mit ihrer Familie auf Zypern. Sie hat Medizin studiert und als Kardiologin gearbeitet, bis sie ihre Liebe zum Schreiben entdeckte. Heute verbringt sie den Großteil ihres Tages mit der Arbeit an ihren Romanen, wenn sie nicht gerade für einen Marathon trainiert. Nach Ausflügen in die Science Fiction und die Psychologische Spannung hat Michelle Adams mit »Mein Wunsch für dich« und »Die Sammlerin der Erinnerungen« das perfekte Genre für sich entdeckt: große Liebesgeschichten, die zu Tränen rühren, das Herz wärmen und unseren Blick auf das Leben für immer verändern.
Lieferbare Titel
978-3-453-42424-1 – Mein Wunsch für dich
MICHELLE ADAMS
Aus dem Englischen von Beate Brammertz
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe Hidden Treasures erschien erstmals 2021 bei William Morrow, HarperCollins New YorkDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 by Michelle Theodorou
Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Michelle Stöger
Umschlaggestaltung: t.mutzenbach Design, München, unter Verwendung von Motiven von © Trevillion Images (Victoria Davies) und Shutterstock.com (Andrey Yurlov, RUNGSANNANTAPHUM)
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-26403-1V001
www.heyne.de
Für Lelia
Prolog
Die Cotswolds, Winter 1982
Das Auto war wieder da. Rote Lichter brannten in der Dunkelheit, und aus dem Auspuff qualmte dicker Rauch. Frances hatte es auch am Vorabend dort bemerkt und einmal in der Woche davor. In ihrem Gässchen in dem ruhigen Dorf in den Cotswolds war der Anblick eines fremden Autos ungewöhnlich. Beim ersten Mal hatte sie angenommen, die Leute im Wagen wären womöglich Touristen, Wanderer, die sich in eine Sackgasse verirrt hatten und nun nicht wussten, wo ihre Route begann. Sie wäre stehen geblieben, um den zwei Männern den Weg zu beschreiben, wäre es nur nicht so kalt gewesen, aber nach dem stürmischen Nachmittagsspaziergang musste sie Harry unbedingt zurück nach Hause bringen. Später am selben Abend, als sie aus dem Fenster blickte, war das Auto verschwunden, und sie hatte keinen weiteren Gedanken mehr daran verschwendet. Doch jetzt waren sie zurück, und dieser Umstand veränderte alles. Selbst aus der Ferne wusste Frances, dass es sich um dieselben Männer handelte, diejenigen, die Zigarettenstummel auf dem gefrorenen Boden zurückgelassen hatten. Sie waren ihretwegen hier, wegen dem, was sie besaß.
Sie waren wegen der Klinkosch-Schatulle gekommen.
Als sie das Wimmern ihres Sohns vernahm, drehte sie sich vom Fenster weg und eilte durchs Zimmer. Immer noch schlafend, aber unruhig in seiner Wiege, hatte Harry den Mund geöffnet und seine Lippen saugten an eisiger Winterluft. Frances zog ihm die Decke bis ans Kinn und fischte den verloren gegangenen Schnuller unter einem Teddybären hervor, ehe sie ihn behutsam zurück in Harrys zahnloses Mündchen steckte. Abgelenkt von ihrem Sohn hatte Frances das Auto draußen fast vergessen, doch schon bald drängte sich ihr der Gedanke wieder auf und ermahnte sie, dass sie nicht sicher waren. Wäre es nicht fünf Uhr morgens gewesen, hätte sie vielleicht Mrs. Gillman von nebenan angerufen und zu sich eingeladen. Es würde leichter, wenn sie jetzt nicht allein wäre. Sie hätten eine Tasse Tee trinken und ein Stück Kuchen essen können, und für eine Weile hätte sie sich vormachen können, alles wäre in Ordnung. Doch was könnte Mrs. Gillman schon gegen zwei Männer ausrichten, wenn diese sich entschieden, Ärger zu machen? Der einzige Mensch, der sie wirklich hätte beschützen können und den sie sich in diesem Moment herbeiwünschte, hatte es vorgezogen, nicht bei ihr zu bleiben.
Nachdem Harry sich endlich beruhigt hatte, schlich sie zurück zum Fenster und schob den Vorhang für einen weiteren Blick nach draußen zur Seite. Das Auto war immer noch da, genau wie sie angenommen hatte. Frances wusste, sie würde alles in ihrer Macht Stehende tun, um Harry in Sicherheit zu bringen. Es war leicht gewesen, vor einem Jahr ein Versprechen zu geben und anzubieten, die Schatulle an sich zu nehmen, sie zu verstecken und dafür zu sorgen, dass sie nie wieder gefunden wurde. Doch die Dinge hatten sich verändert, und jetzt war alles anders. Damals hätte sie sich nicht vorstellen können, dass irgendetwas wichtiger als Benoit oder die wertvolle Antiquität sein könnte, die ihr anvertraut worden war. Jetzt allerdings war Harry da, und er war wichtiger als alles andere auf der Welt. Wichtiger als Benoit. Wichtiger als eine gestohlene Schmuckschatulle. Es gab nichts, was sie nicht gegeben hätte, um Harry zu beschützen.
Ganz langsam, um ihren schlafenden Jungen nicht zu wecken, zog sie eine kleine Trittleiter an den Kleiderschrank und kletterte dann hinauf. Sie wusste, was zu tun war. In ihrem Versteck hinter den Hutschachteln fanden Frances’ Finger das kühle Metall der Klinkosch-Schatulle und zogen sie langsam hervor. Das Kleinod, das sie jetzt vom Regalbrett hob, war schwerer als in ihrer Erinnerung, aber immer noch genauso schön. Die Details waren herrlich, die filigranen Silberarbeiten entlang der Kanten, die Putten an den Seiten. Während sie die Leiter wieder nach unten stieg, hielt sie die Schatulle fest an die Brust gepresst und dachte an den Moment, als sie die Schmuckkassette zum ersten Mal gesehen hatte, und an Benoits Gesicht, als er sie ihr überreichte.
»Ich habe sie an mich genommen, weil ich dich geliebt habe«, flüsterte sie leise zu sich selbst und rief sich in Erinnerung, was Benoit damals immer zu ihr gesagt hatte. »Aber ich muss sie loswerden, weil ich Harry jetzt so viel mehr liebe.«
Die Entscheidung war gefallen. Sie würde ihnen die Schmuckkassette überlassen, ihnen das geben, was sie wollten. Doch als sie einen letzten Blick auf Harry warf, der sicher in seiner Wiege lag, kam ihr eine spontane Idee. Und wenn die Rückgabe der Schatulle nicht ausreichte? Wenn es ihnen um Rache für den Diebstahl ging? Vielleicht genügte es längst nicht mehr, sie ihnen zu geben, damit Harry und sie in Sicherheit waren. Was, wenn die Männer ihr wehtaten und Harry allein zurückblieb? Oder noch schlimmer, wenn sie Harry verletzten? Es war ein unlösbares Dilemma. Nicht gewillt, sein Leben aufs Spiel zu setzen, stellte sie die Schatulle beiseite, ging zur Wiege und holte Harry heraus. Als er zu wimmern anfing, setzte sie sich in die Zimmerecke und drückte sich ihren Sohn fest an die Brust. Bei dem Gedanken, sie könnte keinen Weg aus diesem Chaos finden, lief ihr eine Träne die Wange hinab.
»Alles ist gut, keine Sorge, mein Liebling.« Während sie ihren Sohn hin und her wiegte, durchdachte sie die Situation, in der sie feststeckte. Die Schatulle zu behalten brächte sie in Gefahr, ebenso, wie sie den fremden Männern zu übergeben. »Mami wird einen Weg finden, dich zu beschützen«, flüsterte sie, auch wenn sie nicht den blassesten Schimmer hatte, wie sie das anstellen sollte. »Ich werde niemals zulassen, dass sie dir wehtun.« Und dann, als sie ihrem Sohn sanft einen Kuss auf den Kopf drückte, gab sie ihm ein Versprechen, von dem sie nicht wusste, wie sie es halten sollte. »Ich schwöre dir, alles Nötige zu tun, Harry. Vielleicht werden sie die Schatulle finden, aber dich auf gar keinen Fall.«
Erstes Kapitel
Nook Cottage, Die Cotswolds, Sommer 2022
In genau demselben kleinen Cottage am Ende der Schotterstraße saß Harry Langley auf der Kante eines abgewetzten Sessels, in dem seine Mutter den Großteil der vergangenen zehn Jahre verbracht hatte. Jeder Muskel in seinem Körper schmerzte, die vornübergebeugte Position, die er eingenommen hatte, war ungewohnt für seine hochgewachsene Statur, seine Beine viel zu lang. Zu diesem Zeitpunkt hockte er bereits zwei Stunden so da, immer noch in dem schwarzen Anzug, der eine Nummer zu klein war und in dem er sich wie ein kleiner Junge in der Schuluniform vom Vorjahr fühlte. Die Augen zu Schlitzen verengt, versuchte er, das Chaos um ihn herum auszublenden. Dann stand er auf, lockerte die Krawatte, schüttelte das Sakko ab und wünschte sich, seine Mutter wäre bei ihm, um ihm bei der vor ihm liegenden Herkulesaufgabe zu helfen. Doch sie war nicht hier und er war allein, denn heute um fünfzehn Uhr war ihre Asche beigesetzt worden.
Mit den letzten Sonnenstrahlen des Tages, die sich glitzernd in dem Spiegel über dem Kamin brachen, ließ Harry den Blick über den Rest des Durcheinanders schweifen. Nichts, was er hier sah, war neu für ihn, immerhin hatte er die letzten zehn Jahre inmitten all dieser Dinge gelebt. Doch das Chaos traf ihn dennoch unerwartet. Die Sammlung seiner Mutter bedeckte jeden Zentimeter des Zimmers, die Tür zum Gang war irgendwo halb geöffnet eingekeilt und ließ nur einen kleinen Spalt frei, durch den man zur Haustür gelangte. Genau wie Bakterien in einer Petrischale wuchsen, vervielfältigte sich das Volumen an Habseligkeiten in der Küche und die Treppe in den ersten Stock hinauf, ein ganzes Leben des Hortens, das jede freie Oberfläche in Beschlag nahm. Es hatte weder vor Wänden, dem Teppich und an einigen Stellen sogar der Decke Halt gemacht. Und nun, nach dem Tod seiner Mutter, war es seine Aufgabe, das Chaos zu beseitigen, damit das Haus verkauft werden konnte. Doch er wusste nicht, wo oder wie er anfangen sollte.
»Komm schon«, sagte er zu sich selbst, leise Gedanken, laut ausgesprochen, so wie er es sich mittlerweile angewöhnt hatte. Ohne seine eigene Stimme wäre die Stille unerträglich. »Irgendwann müssen wir das angehen. Warum dann nicht jetzt gleich?« Er kniete sich hin und hob den Deckel einer Kiste mit der Aufschrift Ersatzteile an. Ein metallischer Geruch wehte ihm entgegen, mit einem Hauch Eisen, scharf wie der Geschmack von Blut. Nachdem er in dem Wust herumgewühlt hatte, zog er etwas heraus, das er für eine Zündkerze hielt, und danach etwas Undefinierbares, vielleicht eine Art Pumpe. Schwarzes Schmierfett verfärbte seine Fingerspitzen und er wischte sie sich an dem Anzug ab, von dem er wusste, dass er ihn nie wieder tragen würde. Durch die Unkenntlichkeit der Dinge wurde ihm nur noch deutlicher bewusst, dass dieses Haus bis zum Dach wie eine Dose Sardinen mit unnützen Habseligkeiten vollgestopft war. »Herrgott, Mum. Du hast auch wirklich einfach alles behalten.«
Nun, fast alles, dachte er.
Von seinem Platz am Boden blickte er durch das Zimmer zu der Stelle, wo seine Mutter immer gesessen hatte, mit dem eingedellten Kissen in der Mitte, als erwarte es ihre Rückkehr. In ihm stiegen jäh Erinnerungen an Abende auf, an denen eine sanfte Sonne den Raum in ein rosafarbenes Licht getaucht, Leben in die Wangen seiner Mutter und Wärme in das zugige Haus gebracht hatte. Sobald sie im Sessel eingenickt war, hatte er sie häufig betrachtet und sich Gedanken über sie gemacht. Über das Warum. Über das Wann. Doch meistens hatte er sich dann nur noch verwundert gefragt, wie sie es über sich gebracht hatte. War es ihr schwergefallen, ihn wegzugeben? Hatte sie sich jemals gewünscht, zu dem Moment zurückzukehren, als sie einfach fortgegangen war und ihn auf der Bank im Einkaufszentrum ausgesetzt hatte, und alles rückgängig zu machen?
Hatte sie sich jemals gewünscht, ihn behalten zu haben?
Wie alt war er damals gewesen? Alt genug, um sich an das Eis zu erinnern, das der Wachmann ihm gekauft hatte, während die Polizei gerufen wurde, und an den Zettel, den sie ihm in die pummelige heiße Hand gedrückt hatte. Fast zehn Jahre waren vergangen, seit sie wieder Kontakt hatten, seit er sie gefunden hatte, und während dieser Zeit hatte er alles in seiner Macht Stehende getan, um ihr ein guter Sohn zu sein, war sogar bei ihr eingezogen in der Hoffnung, die Antworten auf all seine Fragen zu erhalten. Jetzt war sie tot und er war wieder allein, zurück in ihrem Haus, und konnte sich immer noch nicht erklären, warum sie ihn weggegeben hatte.
Allmählich brach an diesem Sommertag der Abend an und die grauen Schleierwolken, die sich am Himmel ballten, brachten das Versprechen von Regen mit sich. Die Luft surrte in Erwartung eines Gewitters. Wenn es regnete, stieg der Wasserpegel des Flusses in River View, dem Pflegeheim, in dem Harry die vergangenen zehn Jahre als Pflegehelfer gearbeitet hatte, bis er den Teil des Gartens flutete, in dem die Blumen blühten. Bei dem Gedanken an Margaret in Zimmer drei fragte er sich besorgt, ob jemand in seiner Abwesenheit Blumen zu ihr brachte, wie er es jeden zweiten Tag tat. Auch Joseph, der zwar nicht mehr lesen konnte, aber jeden Tag einen unstillbaren Hunger auf Zeitungsnachrichten hatte, würde ihn vermissen. Harry nahm sich stets etwas Zeit, um ihm vorzulesen, aber würde einer der anderen Pfleger dasselbe tun? Der Mehrwert, den er ihrem Leben verlieh, wirkte unbedeutend im Vergleich zu dem, was sie seinem schenkten: Sie gaben ihm das Gefühl, auf eine Art wertvoll und nützlich zu sein, die er sonst nicht empfand. Wie sehr er sich danach sehnte, wieder zurück zur Arbeit zu kommen. Die vergangenen zwei Wochen hatte er fast ausschließlich in diesem Haus verbracht, was allmählich unerträglich wurde.
Am Nachmittag, während Harry der Schweiß in Strömen den Rücken hinabgelaufen war, hatte er die Gesichter von allen Menschen auf der Beerdigung betrachtet. Abgesehen von Victor, seinem Chef im Pflegeheim, und Mrs. Gillman, der alten Dame von nebenan, waren es nur er und die vier Sargträger gewesen, die beim Gottesdienst geblieben waren, um für zahlenmäßige Verstärkung zu sorgen. Höchstwahrscheinlich auf Mrs. Gillmans Geheiß, wie er vermutete. Doch zwanzig Liedblätter lagen unberührt in den Kirchenbänken, als hätte Frances Langley sich von der Welt verabschiedet und nur ein winziges Kräuseln auf der Oberfläche des Lebens hinterlassen. Kurz vor ihrem sechsundfünfzigsten Geburtstag war sie gestorben, viel zu früh, um an einer tiefen Venenthrombose zu leiden, die auf dem Weg durch ihre Lunge stecken geblieben war. Harry hatte gehofft, die Beerdigung würde einen Wendepunkt für ihn bedeuten, aber die Reise, die vor ihm lag, war zweifelsohne schwierig, und er wusste nicht, wie er sie allein bewältigen sollte.
Als er das unverkennbare Quietschen des Gartentors hörte, gefolgt von Schritten auf dem Kopfsteinpflaster, war er überzeugt, eingenickt und jetzt irgendwo in einem Traum gefangen zu sein. Doch wenige Augenblicke später erklang ein Klopfen auf der abblätternden Farbe der Haustür. Er erwartete niemanden, und für Besuch war es etwas spät.
Wie viel Uhr war es? Auf seine Armbanduhr zu blicken war ihm zur Gewohnheit geworden, auch wenn sie lang vor dem Tag, seitdem er sie trug, stehen geblieben war. Sie gehörte zu den wenigen Dingen, die seine Mutter ihm mitgegeben hatte, und bevor sie ihn auf jener Bank zurückließ, hatte sie ihm die Uhr um sein Handgelenk gelegt. Obwohl er es nicht mit Sicherheit wissen konnte, war er immer überzeugt gewesen, dass sie früher einmal seinem unbekannten Vater gehört hatte. In seiner Kindheit hatte ihm dieser Gedanken gefallen, doch als er bei seiner Mutter nachgefragt hatte, hatte sie ihm nur gesagt, sie wäre von jemandem, der ihn liebte. Unvorbereitet auf Gäste, setzte er sich aufrecht hin, als das Klopfen erneut erklang. Beim Aufstehen erhaschte er aus den Augenwinkeln einen Blick auf sein Spiegelbild. Sein Haar war fast schwarz, seine Haut wie blasser Honig, doch sein Gesicht war auf eine Weise gefurcht wie nie zuvor und seine Augen schimmerten dunkler und trüber. Rasch drehte er sich weg und zwängte sich in Richtung Korridor. In Wahrheit wollte er überhaupt nicht sehen, wie sehr er sich verändert hatte.
»Einen Moment«, rief er und schob sich an dem Gerümpel vorbei. Vielleicht war es Mr. Lewisham, der Anwalt, der mit dem Hausverkauf beauftragt worden war und der ihm unmissverständlich zu verstehen gegeben hatte, dass er nicht lang herumtrödeln und endlich die notwendigen Papiere unterschreiben sollte. Zwanghaftes Horten war anscheinend fast ein Synonym für unbezahlte Rechnungen, und das Cottage musste, ob es Harry nun gefiel oder nicht, verkauft werden. Aber was wollte er zu dieser späten Stunde hier? Harry hatte noch drei Wochen, bevor die Auktion stattfand. Mit einer gewissen Dringlichkeit setzte das Klopfen wieder ein.
»Schon gut, schon gut«, sagte Harry und schob die Kette aus der Schiene. Wenn er es sich recht überlegte, war es wahrscheinlich Mrs. Gillman. Sie hatte versprochen, ihm ein Abendessen zuzubereiten, auch wenn sie selbst allmählich auf die neunzig zuging und körperlich nicht in der Verfassung war, sich um einen Mann zu kümmern, der mit großen Schritten auf sein fünftes Lebensjahrzehnt zuging. Doch sie war die Art Mensch, die helfen wollte, wann immer es ging, und jegliche Probleme mit dem Mut einer Löwin löste, was Harry bewundernswert fand. Zweifellos wäre sie die perfekte Wahl gewesen, um ihm beim Ausräumen des Hauses seiner Mutter zu helfen, wäre es nicht beinahe ein Ding der Unmöglichkeit, sich mit einer Gehhilfe in dem Chaos zu bewegen.
»Ich habe fast den ganzen Tag gebraucht, um diesen Ort wiederzufinden«, sagte Tabitha, als Harry die Tür öffnete. Ihr Gesicht war eine sanfte Silhouette, dennoch war es ganz unverkennbar sie. Goldenes Haar mit feurigen Strähnen ergoss sich über ihre Schultern. Schatten zeichneten ein schmales Gesicht, geformt vom Meißel des Alters, der Harry an alte Fotografien erinnerte, an Jugend und wie sie verloren ging. Die leicht spitze Nase, nicht ganz so gerade wie in seiner Erinnerung. Ihr Körper war noch derselbe, schlank, mit blasser Haut, als wäre kein einziger Tag vergangen, seit er sie das letzte Mal gesehen hatte. Ihm stockte der Atem, das Sprechen fiel ihm schwer.
»Was tust du hier?«, fragte er mit heiserer, angespannter Stimme. Gedanken über sein Äußeres trafen ihn wie Peitschenhiebe und trieben seinen Puls in die Höhe. Was würde sie in ihm sehen, und wie sehr hatte er sich in den zehn Jahren seit ihrer Trennung verändert?
»Ganz ehrlich?«, fragte sie mit geschürzten Lippen. »Ich habe nicht die leiseste Ahnung.« Scharf wie eine Rasierklinge hatte ihre Stimme einen schneidenden Unterton, als wären sie direkt in einem Streitgespräch gelandet, weit entfernt von jedem Kompromiss. Sie wiederzusehen, denselben Menschen, verändert durch die Zeit, den Menschen, dessen Berührung er früher so gut gekannt und dessen moschusartigen Duft er allein durch Gedankenkraft hatte heraufbeschwören können, verschlug ihm die Sprache. Vor ihm stand die Frau, die er verloren und die er nie zu lieben aufgehört hatte. Schließlich trat sie einen weiteren Schritt vor, doch er rührte sich immer noch nicht vom Fleck. »Willst du mich denn nicht reinlassen?«
Während er über ihre Nähe nachdachte, wie sie so dicht bei ihm stand, dass er die Hand ausstrecken und sie berühren könnte – und oh, wie sehr er das wollte! –, kam es ihm vor, als wäre die Zeit zurückgedreht worden. Vor zehn Jahren hatte er zugesehen, wie sie von diesem Haus weggegangen war, doch jetzt spielte sich die Szene in umgekehrter Reihenfolge ab. Sie war wieder da und für einen Moment war es, als hätte sich nichts verändert, als kehrte sie nach nur ein paar kurzen, wütenden Stunden der Trennung zurück und als gehörten sie immer noch zusammen. Doch dann erinnerte er sich, wie sehr sich sein Spiegelbild verändert hatte, wie die Zeit vorangeschritten und wie das Leben verstrichen war. Wie Tabitha sich zweifellos weiterentwickelt hatte. Den Blick auf den Boden gerichtet, wich er einen Schritt zurück.
»Tut mir leid, ja, natürlich.« Er hielt sich bei ihrem Eintreten krampfhaft aufrecht. Vögel sangen draußen in den Bäumen. Wasser blubberte, das Umland war von Regen getränkt und weich. Als sie direkt neben ihm war, fing er ihren Geruch ein, und Gänsehaut überzog seine zitternden Arme. Zuckende Finger wollten sie schon berühren, nur um herauszufinden, ob sie real war. In allerletzter Sekunde zog er die Hand jedoch zurück, zu groß war seine Angst, das Trugbild zu zerstören oder irgendetwas zu tun, was dazu geführt hätte, dass sie wieder verschwand. »Ich kann nicht glauben, dass du hier bist«, brachte er hervor, während er die Tür schloss.
Einen Moment lang sagte sie nichts, während ihr Blick über das heillose Durcheinander glitt. »Ich auch nicht. Und es ist sogar noch schlimmer als damals«, sagte sie und klopfte mit einem braunen Briefumschlag gegen ihr Bein. Schamgefühle hüllten ihn wie ein zugezogener Vorhang ein, da sie nun wusste, wie sehr sein Leben aus dem Ruder gelaufen war.
»Ich weiß«, erwiderte er leise. »Ich schätze, es ist viel passiert«, fügte er nach einer Weile hinzu. »Ich versuche, das Haus auszuräumen. Aber wie du siehst, ist es jede Menge Arbeit.«
»Das kann man wohl laut sagen. Sieh dir nur all das hier an!«, sagte sie kopfschüttelnd. »Anscheinend hast du mich nicht erwartet.«
»Nein.« Er zögerte, da er nicht wusste, wo er anfangen sollte. »Versteh mich bitte nicht falsch, ich bin froh, dass du hier bist, aber warum sollte ich dich nach all den Jahren erwarten?«
»Zehn«, sagte sie. »Zehn Jahre.« Sie bewegte sich auf die Wohnzimmertür zu. »Es gibt etwas, das wir besprechen müssen.« Als er sich nicht rührte, sagte sie: »Können wir da reingehen und uns hinsetzen?«
»Es tut mir leid«, stammelte er, »es ist nur …«
»Nur was?«
»Nun, ich hatte nicht erwartet, dich zu sehen.«
»Das hast du bereits gesagt.«
»Ich weiß, aber jetzt stehst du in meinem Flur und du siehst, ich meine, du hast schon immer, aber damals waren wir jung, und jetzt, na ja, bist du eine Frau, und, na ja …«
»Oh, spuck’s einfach aus, wenn du etwas zu sagen hast!«
»Nun, das habe ich«, sagte er und war sich der Hitze in seinen Ohren und der Röte seiner Wangen schmerzlich bewusst. »Ich wollte sagen, dass du toll aussiehst. Wunderschön. Das wollte ich sagen.« Er holte tief Luft. »Es tut mir leid. Ich fasele unzusammenhängendes Zeug«, fuhr er dann fort. Auf die Wohnzimmertür zeigend, winkte er sie weiter. »Bitte, hier lang!«
Er schlängelte sich zwischen Kartons und Tüten voller Secondhandkleidung hindurch, führte sie durch die Tür zum Wohnzimmer, die einen Spalt offen stand, und bot ihr dann den Sessel seiner Mutter an. Als sie an ihm vorbeiging, kribbelte seine Haut bei der Erinnerung an ihren Körper, der Art, wie sie ihn damals gehalten und sie früher perfekt zusammengepasst hatten. Wie es sich angefühlt hatte, sie zu berühren. Es mochten zehn Jahre vergangen sein, aber er wollte sie immer noch, als wäre es gestern gewesen. Das Verlangen hatte nie aufgehört. Während er sich in die Nähe des Fensters stellte, nahm sie Platz.
»Und, wo ist sie?«, fragte sie dann.
»Wer?« Einen Moment lang hatte er vergessen, dass sonst noch jemand auf der Welt existierte.
Missbilligend schnalzte sie mit der Zunge und ließ den Blick zu seinem Gesicht gleiten. »Natürlich deine Mutter.«
Er hatte angenommen, Tabithas Ankunft hinge mit dem Tod seiner Mutter zusammen, weshalb ihn ihre Frage etwas aus der Bahn warf. Zögerlich stolperte er durch eine Antwort. »Nun, sie ist nicht hier.«
»Wann kommt sie zurück?«
»Äh, gar nicht«, sagte er leicht stotternd. »Sie, äh, sie ist gestorben.«
Tabitha hörte auf, mit den Fingern auf den Briefumschlag zu klopfen, ihr nervöses Gezappel beschwichtigt durch diese neue Information. »Gestorben?«, fragte sie, und ihre Augen fanden seine, das erste Mal, dass ihre Stimme ihre eigentlich sanftmütige Natur verriet. Das Grau-Blau ihrer Iris zog ihn an, wie ein See, in dem er einer besseren Zukunft entgegenschwimmen konnte. »Wann?«, fragte sie leicht argwöhnisch.
»Vor zwei Wochen.«
»Das verstehe ich nicht«, sagte sie. »Das ist unmöglich.«
Er zuckte mit den Schultern. »Leider doch. Wir haben heute ihre Asche beigesetzt.«
Tabitha blickte zum Briefumschlag und zeigte auf den Poststempel. »Aber sie hat mir vor zwei Tagen geschrieben.« Sie streckte sich weit, um ihm den Briefumschlag zu reichen. »Sie hat mich gebeten hierherzukommen, weil du meine Hilfe bräuchtest.«
Einen Augenblick schien alles zu erstarren, ohne jede Möglichkeit für Harry, Luft zu holen, ohne jegliches Gefühl für seine Umgebung. Es war, als wären zwei Welten aufeinandergeprallt, und er befand sich in dem Moment direkt nach dem Aufprall, kurz bevor die Explosion alles zerstörte, was er einst gekannt hatte. Er hätte sich keine Situation vorstellen können, in der seine Mutter und Tabitha jemals zusammengekommen wären, doch jetzt war Tabitha hier und behauptete, seine Mutter habe es in die Wege geleitet und Tabitha zu ihm zurückgebracht. Es war zu viel für ihn, und als er endlich wieder zu Atem kam, ließ er sich auf seinen Sessel plumpsen.
»Du musst dich täuschen. Das kann sie nicht getan haben.«
»Hat sie aber.« Auf ihr Drängen hin nahm er den Brief entgegen. Auf den Umschlag war Tabithas Name und eine Adresse gekritzelt, die er nicht kannte. Der Falz war bereits aufgerissen. Die schrägen Buchstaben besaßen alle Merkmale der Handschrift seiner Mutter, die geschwungenen Konsonanten, die runden Vokale. Er griff hinein, und seine Finger fanden einen zweiten Umschlag. Als er ihn herauszog, bemerkte er seinen eigenen Namen auf der Vorderseite.
Nach einer Antwort suchend sah er zu Tabitha. »Ich verstehe das nicht.«
»Glaubst du, etwa ich?«, fragte sie, lehnte sich in ihrem Sessel zurück und überschlug die Beine. »Lies den Brief durch, den sie mir geschrieben hat. Es dauert nicht lang.« Nachdem er den gefalteten Zettel herausgeholt hatte, überflog er die kurze Nachricht.
Liebe Tabitha,
vor zehn Jahren, als Harry zurück nach Hause kam, habe ich nicht verstanden, was er verloren hat, indem er dich zurückließ. Obwohl ich ihn nicht darum bat, wusste ich, es war meine Schuld, dass er eure Beziehung beendet hat. Er wusste nicht, wie er mein Sohn sein sollte, und glaubte, es gäbe bei dem Versuch, es zu sein, keinen Platz für jemand anderen. Und ich war nicht stark genug, ihm zu zeigen, wie es ihm gelingen könnte. Bitte geh jetzt zu ihm, bring ihm diesen Brief und hilf ihm, das Unrecht der Vergangenheit wiedergutzumachen. Hilf ihm, sein Zuhause zu retten. Ich fürchte, du bist der einzige Mensch, der dazu in der Lage ist.
Frances
»Na schön«, sagte sie, als ihr klar wurde, dass er mit Lesen fertig war. »Was ist das für ein Unrecht, bei dem ich dir helfen soll, es wiedergutzumachen?«
Das war wohl der Dreh- und Angelpunkt. Als er den Briefumschlag wendete, sah er, dass er tatsächlich erst vor zwei Tagen abgestempelt worden war.
»Ich habe nicht den blassesten Schimmer«, sagte er nach einer Weile.
»Und der Teil über mich, dass ich in der Lage wäre, das Haus zu retten. Worum geht es da?«
»Das weiß ich auch nicht.«
»Wirst du es verlieren, oder was?«
»Ja, in drei Wochen. Meine Mutter hat eine Menge Schulden angehäuft, und ich muss sie tilgen. Mir bleibt keine andere Wahl. Es wird verkauft werden, und ich weiß nicht, wohin ich dann soll.«
»Dann solltest du lieber deinen Brief öffnen. Und nachschauen, ob er mehr Sinn ergibt als meiner.«
Harry nickte und riss den Umschlag auf, indem er mit dem Finger unter die Lasche glitt. Als er in der Erwartung, einen Brief vorzufinden, hineingriff, war er überrascht, auf eine dicke Ecke eines Polaroids zu stoßen. Auf dem Foto war eine Schmuckschatulle zu sehen, reichlich verziert, aus Silber. Vielleicht Zinn, mutmaßte er, falls sie alt war, und nicht sonderlich wertvoll. Sie war sehr schön, egal, woraus sie bestand, mit Putten an den Seiten und Griffen in Form von Olivenzweigen. Auf die Rückseite des Polaroidfotos hatte seine Mutter etwas geschrieben.
Harry,
vor vielen Jahren habe ich etwas versteckt, das mir lieb und teuer ist. Es war das Wertvollste, was ich überhaupt besessen habe. Such nach dieser Schatulle. Sie ist hier, irgendwo im Haus. Während du die Dinge durchgehst, die ich behalten habe, und sobald du findest, was in dieser Schatulle ist, wirst du die Antworten bekommen, die ich dir nie geben konnte.
Jetzt, wo ich tot bin, muss ich dir die Chance geben, damit du verstehst, wer du bist, egal, welche Auswirkungen es haben mag. Tabitha ist der einzige Mensch, von dem ich glaube, er könnte dir dabei helfen.
Ich weiß, du hattest Zweifel, ob ich dich jemals hier haben wollte, aber ich wollte nichts weiter, als dich in Sicherheit zu wissen.
Verzeih mir bitte.
Mum
Harry legte das Foto auf seine Knie. »Ich verstehe das nicht«, sagte er. Das Chaos erhob sich überall um ihn herum, als er aufblickte und dann zu Tabitha sah, deren Anwesenheit er immer noch nicht recht glauben konnte. Sie streckte die Hand in seine Richtung, weshalb er ihr das Bild reichte, ihre Finger nun wenige Zentimeter voneinander entfernt. »Zwischen all dem hier?«, fragte er. »Ich soll sie in dieser Unordnung finden? Ich weiß einfach nicht …«, begann er, doch sie fiel ihm ins Wort.
»Oh mein Gott«, flüsterte sie und beugte sich vor. Sekunden später war sie aufgesprungen und starrte das Chaos an.
»Was ist los?«
»Sie will, dass du diese Schatulle findest. Will sie das damit sagen, dass sie irgendwo in diesem Haus versteckt ist?«
»Ich schätze schon.«
Unerwartetes Gelächter löste sich von ihren Lippen. »Aber das kann nicht sein«, sagte sie zu sich selbst. »Wie könnte sie hier gelandet sein?«
»Wie könnte was hier gelandet sein?«, fragte Harry, immer noch verunsichert. Tabithas Reaktion machte ihn nervös. Er spürte, wie sich sein Herzschlag beschleunigte, angesteckt durch ihre Aufregung.
»Erkennst du diese Schatulle denn nicht?« Kopfschüttelnd und mit wachsender Verwirrung sah er, wie sich ein Lächeln in Tabithas Gesicht grub. »Herrgott, Harry! Hast du in der Schule gar nicht aufgepasst? Du hast wirklich nicht den leisesten Schimmer, was das ist?«
»Nein, Tabitha. Ich habe sie nie zuvor in meinem Leben gesehen.«
»Nun, zumindest verstehe ich, warum sie dachte, ich könnte dir eine Hilfe sein. Denn das hier ist ein Stück Geschichte, Harry. Als ich ihren Brief erhielt, hätte ich mir das nicht einmal in meinen kühnsten Träumen vorstellen können. Das ist die ›Klinkosch-Schatulle‹, eine Antiquität, die seit fast achtzig Jahren als verschollen gilt. Eines der berühmtesten Schmuckstücke, das von den Nazis während des Zweiten Weltkriegs geraubt worden ist. Niemand weiß, wo sie ist. Unzählige Menschen suchen wahrscheinlich auf die eine oder andere Art nach ihr, und deine Mutter will uns weismachen, dass sie hier ist, in diesem Haus.« Bebende Finger legten sich auf ihren Mund, um ihre Aufregung zu verbergen. »Harry, hast du auch nur den blassesten Schimmer, welche Bedeutung das hat? Wie viel sie wert ist?«
Hoffnung stieg wie der Luftballon eines Kindes in ihm hoch. Eine Zukunft, in der er die Schulden seiner Mutter abbezahlen und in dem Cottage bleiben konnte, das zu seinem Zuhause geworden war. »Wäre es genug, um dieses Haus zu retten?«
Einen Moment lang legte sich ein weicher Zug auf ihr Gesicht, und er erkannte in ihr die Frau wieder, in die er sich damals verliebt hatte. Die er immer noch liebte. Zehn Jahre der Trennung hatten seine Gefühle für sie nicht geschmälert. Und das Wiedersehen hatte es nur bestätigt. Als er sich wegdrehte, blickte er im Spiegel zu seinem Spiegelbild, den müden Augen, die zu ihm zurückstarrten, den Falten in seinen Wangen, die sich im Lauf der Jahre, die sie getrennt voneinander gewesen waren, gebildet hatten. Könnte sie ihn so sehen, wie er früher gewesen war, oder sah sie nur, was jetzt von ihm übrig war? Damals hatte er keine andere Wahl gehabt, als sie zu verlassen, aber nun, wo sie wieder hier war, erkannte er, wie sehr er sich wünschte, es wäre anders gewesen.
»Nein«, sagte sie kopfschüttelnd. »Mit dieser Schatulle könnte man dein Haus zehnmal retten.«
Zweites Kapitel
Eine versteckte Schatulle, wertvoll genug, um sein Haus zu retten? Etwas Bedeutendes, das seine Mutter ihm hinterlassen hatte, ein Vorgeschmack dessen, dass er ihr die ganze Zeit über wichtig gewesen war? Es war absurd, konnte unmöglich wahr sein. Wie sollte etwas so Kostbares in den Besitz seiner Mutter gelangt und zwischen all dem Plunder verloren gegangen sein? Fest davon überzeugt, dass seine Mutter sich irrte, war er durchaus bereit, die Sache als Unsinn abzutun, doch zu seiner Überraschung schien Tabitha weniger sicher zu sein, dass alles nur den Wahnvorstellungen einer Frau geschuldet war, der es seit langer Zeit nicht besonders gut ging.
»Das ist der Grund, weshalb sie mir geschrieben hat«, erklärte Tabitha. »Sie wusste, mir wäre klar, worum es sich hier handelt.« Immer wieder bemerkte er, wie ihr Blick über das Chaos schweifte, vielleicht in verwundertem Erstaunen, dass ein solcher Schatz womöglich darin vergraben war. Harrys Aufmerksamkeit hingegen wurde nicht von der Aussicht auf eine wertvolle Schmuckkassette erregt, sondern von Tabitha selbst. Nach zehn Jahren der Trennung war sie auf einmal hier, in seinem Haus. Jedes Mal, wenn sie zu reden aufhörte, wartete er gierig auf ihre nächsten Worte. Der anfängliche Funken Wut in ihrer Stimme hatte sich verflüchtigt und war durch die weiche Satzmelodie ersetzt worden, die ihn daran erinnerte, wie unglaublich sicher er sich in ihrer Gegenwart immer gefühlt hatte. Wie brennend sie sich für Dinge und Menschen interessiert hatte, die sie liebte. Wie sie immer eine Ausrede fand, um ihn zu berühren, und wie sie scheinbar immer wusste, wenn er sich gedankenversunken in seiner nie ausgesprochenen Vergangenheit verloren hatte. Doch diese Erinnerungen brachten gleichzeitig die Erkenntnis mit sich, dass er sie damals, als er fortging, schmählich im Stich gelassen, wie er ihre Beziehung in der Hoffnung auf eine Wiederannäherung mit seiner Mutter zerstört hatte. Es war hart, sich seine eigenen Fehler einzugestehen. Aber welches Recht hatte er auf diese Gefühle, wenn es seine eigene Entscheidung gewesen war, Tabitha zu verlassen?
»Ich kann nicht glauben, dass du nie von der Schatulle gehört hast«, staunte sie. »Als Nächstes wirst du mir noch sagen, dass du auch noch nie vom Bernsteinzimmer gehört hast? Oder Der Frau in Gold? Gustav Klimt?« Er schüttelte den Kopf, und sie erhob sich, nahm ihm das Foto aus der Hand und zeigte darauf. »Okay, na gut, es sind alles Kunstwerke, die während des Zweiten Weltkriegs gestohlen worden sind. Von den Nazis erbeutet. Das«, sagte sie und deutete auf das Bild, »ist die Klinkosch-Schatulle. In Frankreich geraubt, als Paris fiel.« Während sie vor Harry auf- und abschritt, schien sie zwischen Schock und Gelächter zu schwanken. »Ich kann nicht glauben, dass sie gefunden wurde.«
»Nun, sie ist nicht wirklich gefunden worden, nicht wahr?«, sagte er in dem Versuch, den Fokus nicht zu verlieren. »Wie zum Teufel soll ein Kunstwerk, das im Krieg verschollen ist, in einem Cottage in den Cotswolds wieder auftauchen?«
»Keine Ahnung«, erwiderte sie. »Aber was, wenn es doch hier ist? Das wäre unglaublich!«
Ihre Aufregung wegen der Schatulle war ansteckend. Fäden desselben Enthusiasmus verwebten sich zwischen ihnen. Obwohl der größere Teil in ihm überzeugt war, dass diese Schmuckkassette unter gar keinen Umständen hier sein konnte, konnte ein anderer Teil in ihm die verführerische Vorstellung des Was, wenn? nicht abschütteln.
»Okay«, sagte er. »Mal angenommen, sie wäre wirklich gefunden worden. Und befindet sich hier in diesem Haus. Warum um alles in der Welt sollte meine Mutter dir davon erzählen, wo wir seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr haben?«
Für einen kurzen Moment war alles still. »Okay«, sagte sie, als wappnete sie sich innerlich, die Finger fest aufeinandergepresst. »Deine Mutter wusste, dass ich als Kunsthistorikerin gearbeitet habe, nicht wahr?«
Harry verlagerte das Gewicht in seinem Sessel. »Natürlich.« Er sprach leise. »Ich habe ihr alles von dir erzählt.«
»Dann hätte sie gewusst, dass ich die Schatulle als eines der berühmtesten, jemals von den Nazis gestohlenen Kunstwerke wiedererkennen würde. Es hieß, sie sei für immer verloren, eingeschmolzen und zu etwas anderem gemacht. Vielleicht verschollen während eines Bombenangriffs. Seitdem hat es immer wieder Gerüchte gegeben, aber dieses Foto ist der erste eindeutige Beweis, dass sie den Krieg überlebt hat. Es ist ein wahres Wunder.«
»Wie kannst du dir da so sicher sein?«, fragte Harry.
Sie beugte sich vor und zeigte auf die Fotografie. »Du warst noch nie ein begnadeter Detektiv, nicht wahr? Sieh dir den Hintergrund an!« Nach einem zweiten Blick bemerkte Harry, dass neben der Klinkosch-Schatulle eine alte großformatige Zeitung lag, und das Kästchen etwa ein Drittel davon einnahm. »Sieh dir das Datum an«, sagte sie. »Diese Zeitung ist von 1981, was bedeutet, dass die Schatulle zweifelsohne knapp vierzig Jahre, nachdem sie das letzte Mal gesichtet wurde, existiert hat. Das ist eine Riesenentdeckung.«
»Das ist das Jahr vor meiner Geburt.« Er konnte es kaum glauben, aber es gleichzeitig nicht mit derselben Überzeugung wie noch Augenblicke zuvor abstreiten. »Aber wie ist es möglich, dass meine Mutter in ihren Besitz kam? Die Zeitung sieht aus, als wäre sie auf Deutsch. Und warum sollte sie bis nach ihrem Tod warten, um mir davon zu erzählen?«
Tabitha ließ sich, scheinbar tief in Gedanken versunken, in ihren Sessel zurückfallen. »Nun, ich kann dir keine dieser Fragen beantworten. Ich kann dir nur sagen, was ich weiß.«
Harry erschien das alles surreal. Vor zehn Minuten war er allein in einem Haus voller Müll gewesen. Jetzt saß er bei der Frau, von der er einmal geglaubt hatte, den Rest des Lebens mit ihr zu verbringen, und unterhielt sich über Raubkunst von erheblichem finanziellem und historischem Wert. All die Tage, an denen seine Mutter an diesem Fenster gesessen und, wie er glaubte, ins Nichts gestarrt hatte. Die Art, wie sie ihn auf einer Bank in einem Einkaufszentrum ausgesetzt hatte und aus seinem Leben verschwunden war. Jetzt kam er nicht umhin, sich zu fragen, ob es womöglich einen größeren Zusammenhang gab, den er bisher nie gesehen hatte. Mit der rechten Hand fuhr er zu seiner Armbanduhr.
»Okay«, sagte er. »Erzähl mir alles, was du weißt.«
Eine knappe Stunde später, nachdem Tabitha schließlich fort war, fühlte sich das Haus leerer als jemals zuvor an. Eine Weile schlenderte er ziellos durch die Zimmer, verwirrt und verloren, und wühlte in dem halbherzigen Versuch, nach der Schatulle zu suchen, in dem Durcheinander. Als läge das verschollene Schmuckstück einfach unter der Zeitung vom Vortag. Doch er konnte sich nicht konzentrieren, konnte sich nicht einmal genug entspannen, um sich ruhig hinzusetzen. Tabitha war immer noch bei ihm, wie ein Geist oder ein Schatten, der ihm auf Schritt und Tritt folgte.
Sie hatte ihm alles erzählt, was sie über die Geschichte der Schatulle wusste, ihre Fertigung im siebzehnten Jahrhundert und ihre anschließende Reise durch Österreich, bis sie letztendlich während des Zweiten Weltkriegs gestohlen worden war. Dann war Tabitha mir nichts, dir nichts, so unerwartet, wie sie gekommen war, wieder verschwunden. Und an ihrer Stelle hatte sie nicht nur eine physische Leere hinterlassen, sondern das Rätsel, wer seine Mutter wirklich gewesen war und welche Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit sie mit ins Grab genommen hatte. Die Klinkosch-Schatulle zu finden, kam Harry allmählich, könnte ihm helfen, sie auf eine Weise zu verstehen, wie es ihm nie zuvor möglich gewesen war. Vielleicht könnte sie sogar die Fragen zum Verstummen bringen, die immer unbeantwortet geblieben waren, etwa die Identität seines Vaters und warum sie ihn ausgesetzt hatte. Doch nach einer Weile, von körperlicher Erschöpfung gebeutelt wegen dem hinter ihm liegenden Tag, sank er schließlich auf seinem Sessel in den Schlaf und träumte von seiner Mutter, Tabitha und natürlich dem, was hätte sein können.
Am Ende einer langen Nacht schwappte Sonnenlicht wie eine ans Ufer rollende Welle durch die Fenster und brachte die Morgendämmerung mit sich. Zu diesem Zeitpunkt war Harry bereits seit vielen Stunden wach, zu aufgedreht, um Ruhe zu finden oder Tabitha oder ihren Besuch aus dem Kopf zu verbannen. Jedes Mal, wenn er die Augen schloss, sah er ihr Gesicht, die Liebesbriefchen, die sie ihm immer hinterlassen, und ihr Lächeln, wenn er ihre Hand gehalten hatte. Aber auch die Schatulle war nichts, was er einfach vergessen konnte. Wenn sie sich hier befand und tatsächlich so viel wert war, wie Tabitha behauptete, wäre er vielleicht in der Lage, sein Zuhause zu retten. Mit seinem Handy – einen Internetanschluss hatte seine Mutter im Haus nie gestattet – durchforstete er das Netz nach Informationen. So schwach, wie das Signal war, schaffte er es, ungefähr das bestätigt zu bekommen, was Tabitha ihm bereits erzählt hatte. Nachdem er auf das Kalendersymbol getippt hatte, zählte er die Tage – ihm blieben noch knapp drei Wochen, bevor das Haus versteigert wurde. Würde er die Klinkosch-Schatulle rechtzeitig finden, um sein Zuhause zu retten?
Als es an der Tür klingelte, war er bis zum Hals in Staub und Papieren begraben. Es kam ihm vor, als würde er eine Stecknadel im Heuhaufen suchen. Doch als er die Tür öffnete und Tabitha auf der anderen Seite stehen sah, entzündete sich ein Funke Hoffnung in ihm, dass er vielleicht nicht allein suchen müsste.
»Oh«, sagte er, sein Erstaunen unüberhörbar im Zittern seiner Stimme. »Du bist zurück.« Schönheit starrte ihn an, das Gesicht, das er so schmerzlich vermisst hatte. Während Tabitha ein paar behutsame Schritte in den Gang machte und sich vorsichtig an den Papierhaufen und Kisten vorbeischlängelte, glitt ihr Blick von einem Gegenstand zum anderen. Über Zeitungsberge, Puppenköpfe und schließlich zu ihm.
»Ich weiß. Und glaub mir, ich hatte nicht erwartet, überhaupt hierherzukommen, ganz zu schweigen von zweimal an zwei Tagen.« Ein Teil ihrer anfänglichen Wut war zurück. Es musste schwer für sie sein, seine Gegenwart auszuhalten nach dem, wie er sie damals im Stich gelassen hatte. Seine Entscheidung, bei seiner Mutter einzuziehen, hatte automatisch den Entschluss nach sich gezogen, die Beziehung zu beenden, die er mit Tabitha geführt hatte. Bereits vor zehn Jahren war es offensichtlich gewesen, dass seine Mutter fast rund um die Uhr betreut werden musste, und das zwanghafte Horten und die Depressionen ins Reich des Nichtbeherrschbaren geglitten waren. Tabitha hatte ein gemeinsames Leben gewollt, eine Familie, ein Zuhause voller Liebe. Er hatte nicht gleichzeitig für seine Mutter da sein und Tabitha das Leben schenken können, das sie sich ersehnt hatte. Dennoch war es ihm nie gelungen, die nagenden Schuldgefühle und die Reue hinter sich zu lassen.
»Nun, es ist wundervoll, dich schon so bald wiederzusehen.«
»Ich musste kommen. Die Klinkosch-Schatulle aufzuspüren ist von historischer Bedeutung. Ich hatte befürchtet, du würdest dir womöglich nicht einmal die Mühe machen, nach ihr zu suchen«, sagte sie, während ihre Augen weiterhin die Umgebung scannten.
»Nein«, sagte er und bedeutete ihr weiterzugehen, erstaunt über sein Glück, Zeit mit ihr verbringen zu dürfen. »Sieh dich ruhig um. Ich habe bereits angefangen, aber ich muss gestehen, dass die Fortschritte nur minimal sind.« Im Schatten der riesigen Papierstapel seufzte er, als sähe er das Chaos zum ersten Mal. »Wie du dir gewiss vorstellen kannst.«
Als sie am Türrahmen zum Wohnzimmer ankamen, stand Tabitha der Mund weit offen. »Ich hatte keine Ahnung, dass es so …«, begann sie, nach dem richtigen Wort suchend, »kompliziert ist. Gestern Abend ist mir nicht mal die Hälfte davon aufgefallen. Es ist, als würde jedes Teil ein anderes stützen. Wie bei dem Spiel, das wir früher oft gespielt haben.«
»Du meinst Jenga.«
»Genau das.« Gegen eine der Kisten sinkend, um sich zu setzen, hob sie den Kopf in Richtung Decke und ließ die schiere Masse von allem auf sich wirken. »Da hast du aber alle Hände voll zu tun, so viel steht fest.«
War es etwa möglich, dass sie ihre Entscheidung, hierher zurückgekommen zu sein, schon wieder bereute? »Es ist in Ordnung, wenn du es dir anders überlegt hast, nun da du es am helllichten Tag siehst.«
»Ich habe es mir nicht anders überlegt«, erwiderte sie, die linke Hand an ihrer Kehle, als holte sie einen tiefen staubigen Atemzug. »Nichts, was im Lauf der Geschichte verloren gegangen ist, wurde jemals leicht wiedergefunden. Es ist immer mit Anstrengung verbunden. Und ich bin hier, weil ich Kunsthistorikerin bin. Wir müssen diese Schatulle aufspüren. Es könnte das Bedeutendste sein, was ich jemals beruflich tun werde.« Das war die offizielle Version, viel einfacher, als zuzugeben, sie wäre seinetwegen gekommen. »Nun, wir werden uns jeden Tag hier treffen und die Ärmel hochkrempeln, um alles Unnötige wegzuwerfen.« Sie seufzte wieder. »Es wird kein Kinderspiel werden, aber wir werden uns Zimmer für Zimmer vornehmen und sollte die Klinkosch-Schatulle hier sein, werden wir sie finden.«
»Bietest du mir etwa deine Hilfe an?«
»Ja. Wenn du möchtest.«
»Nun, ich kann jede Hilfe gebrauchen, die ich bekommen kann.« Genau in diesem Moment klingelte es an der Haustür. »Hast du für Verstärkung gesorgt?«, fragte er.
Mit einer gewissen Erleichterung über die Unterbrechung sagte sie: »Das hat nichts mit mir zu tun.«
Harry ging in den Flur zurück und öffnete die Tür. »Oh, guten Morgen, Elsie. Ist heute Freitag?«
Elsie Gillman, einst hochgewachsen, aber jetzt vornübergebeugt mit einem kleinen Buckel und grauen Haaren, bewegte sich langsam, die Augen fest auf den Boden geheftet, während sie die Stufe in Angriff nahm. Eine Gehhilfe wies ihr den Weg. Jeden Freitagvormittag schaute sie auf eine Tasse Tee vorbei. Sie war schon lange vor Harrys Einzug vorbeigekommen, hatte seine Mutter regelmäßig besucht und war, wie Harry vermutete, einer der Hauptgründe, dass seine Mutter überhaupt so lang stabil geblieben war. Harry freute sich immer auf ihre Besuche. Ihr Witz war bissig, ihr Verstand messerscharf. Zudem war sie die einzige Person, die seine Mutter ins Haus gelassen hatte, weshalb sie einer der wenigen Menschen war, mit dem Harry während der vergangenen zehn Jahre regelmäßige Gespräche geführt hatte.
»Ist es nicht, aber ich habe gesehen, dass du Gesellschaft hast, und wusste, dass nichts im Kühlschrank ist, was du ihr anbieten könntest.« Elsie trippelte nah an Tabitha heran, die ebenfalls an die Tür gekommen war, und holte einen benutzten Eisbehälter aus einer Tüte an ihrer Gehhilfe. »Käse-Scones«, sagte sie. »Ich nehme an, du hast Butter im Haus.«
»Natürlich«, sagte Harry, »aber das wäre doch nicht nötig gewesen.«
»Oh, hör auf! Ich habe sie nicht nur für dich gebacken. Sie liegen seit meinem letzten Besuch im Brotkasten.« Sie legte Tabitha eine Hand auf den Arm. »Hallo, meine Liebe.«
»Hallo«, sagte Tabitha mit einem Lächeln.
»Oder«, grinste Harry, »du hast dir eine Ausrede ausgedacht, um vorbeizukommen und herauszufinden, wer hier ist.«
»Nun ja, das auch«, erwiderte Elsie, die es kein bisschen zu stören schien, auf frischer Tat ertappt worden zu sein. »Tja«, sagte sie mit einem Blick auf Tabitha. »Erlösen Sie mich von meinem Elend, ja? Wer sind Sie?«
»Tabitha«, sagte Tabitha. »Ich bin eine alte Freundin von Harry.«
»Tabitha, hm? Aber nicht die Tabitha?«, fragte sie und sah zu Harry zurück.
»Ich schätze, das reicht jetzt«, sagte Harry, packte Elsie an den Schultern und lenkte sie behutsam den Flur zurück. »Danke für die Scones, aber wir haben heute Vormittag viel zu tun. Ich bringe nachher den Behälter zurück.« Sobald sie an der Tür waren, beugte er sich herab, um ihr ins Ohr flüstern zu können. »Tut mir leid, aber es ist ein bisschen seltsam.«
»Natürlich ist es das. Du kannst mich ja gar nicht schnell genug loswerden.«
»Es tut mir leid. Ich erzähle dir später alles. Versprochen.«
Neugierig warf sie ein letztes Mal einen Blick über die Schulter und sagte: »Sie ist aber zauberhaft. Ich verstehe, warum du sie immer gemocht hast.«
»Ich weiß, dass sie das ist. Aber du bist nicht gerade besonders diskret. Dein Flüstern ist eine Katastrophe.«
»Man hat keine Zeit für Diskretion, wenn der neunzigste Geburtstag im nächsten Monat ansteht, Harry. Manchmal muss man bei Leuten direkt sein.« Und wenige Sekunden später schlurfte sie den Weg hinab und zog mit einem Lächeln im Gesicht das Gartentor hinter sich zu.
»Okay«, sagte Tabitha, sobald die Haustür ins Schloss gefallen war. »Du hast ihr von mir erzählt.«
Harry starrte auf seine Füße und wünschte inständig, seine Socke hätte kein Loch. »Könnte sein, dass ich dich ein- oder zweimal erwähnt habe.« Am liebsten hätte er ihr gesagt, dass er Elsie alles über sie erzählt hatte, darüber, wie er den wundervollsten Menschen in seinem Leben, der ihm gezeigt hatte, die Welt auf eine Art zu genießen, die ihm zuvor fremd gewesen war, verloren hatte. Doch er brachte nichts davon über die Lippen. »Warum fangen wir nicht erst mal an, und machen dann eine Pause für die Scones?«
»Hört sich nach einem guten Schlachtplan an. Wohin geht es hier?«, fragte sie und zeigte zu einem niedrigen Gang, der parallel zur Treppe verlief. Darüber türmte sich ein Papierberg, der einen Tunnel geformt hatte, nachdem er vor zwei Jahren zur Seite gekippt war und nun allein durch Spannkraft zusammengehalten wurde, ohne jegliche tragende Stützkonstruktion. Doch das Bauwerk hatte seit dem Tag gehalten, an dem es sich gebildet hatte.
»Die Küche«, erklärte er ihr.
»Und das ist der einzige Zugang? Man muss auf Händen und Knien krabbeln, um sie zu erreichen?«
»Es ist gar nicht mal so schlimm. So ist es schon seit Jahren. Es ist recht sicher.«
In der Hocke taxierte sie das Chaos. »Nun, ich bin keine Ingenieurin, aber ich schätze, uns bleibt wohl keine andere Wahl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schatulle zwischen dem ganzen Papierkram versteckt ist, aber hier sollten wir anfangen. Ich will nicht sterben, weil ich unter einem Haufen Zeitungen aus den Siebzigern begraben werde. Und wir brauchen sowieso die Butter für die Scones.« Zum ersten Mal, seit sie wieder hier war, bemerkte er den Anflug des Lächelns, in das er sich vor über zehn Jahren verliebt hatte. »Na los, ich lasse dir den Vortritt.«
Es kostete sie den Großteil des Vormittags, aber allmählich, jeweils ein Teil nach dem anderen aussortierend, schlugen sie langsam eine Schneise durch den Berg. Zeitung um Zeitung zogen sie aus den Ausläufern des Tunnels heraus, zusammen mit genügend Reklamesendungen, um eine eigene kleine Recyclinganlage eröffnen zu können.
Bei der Arbeit dachte er an die Schatulle und die Antworten, die sie enthalten könnte. Die Vergangenheit seiner Mutter war immer ein Geheimnis gewesen, doch nun keimte das Gefühl in ihm auf, dass eine Erklärung in greifbarer Nähe wäre. Nachdem sie acht schwarze Plastiksäcke gefüllt hatten, brachten die beiden sie hinaus in den Garten, wo Harry sie an einem der seltenen, nicht zugemüllten Orte entlang der Hauswand stapelte. Bei seinem letzten Gang blieb er stehen, um nach seinen Tauben zu sehen, da hörte er, wie Tabitha ihm folgte.
»Harry, ich bräuchte deine Hilfe bei … oh«, sagte sie und verstummte beim Anblick der Tauben. »Was ist das?«
»Tauben«, erwiderte er, steckte den Finger durch das Drahtgeflecht und lächelte still in sich hinein, als einer seiner Vögel an seiner Fingerspitze pickte. »Ich habe sechs.«
»Warum?«
Niemand hatte ihn bisher gefragt, warum er Vögel hielt. Niemand außer seiner Mutter hatte sie jemals gesehen. Das Leben in den Cotswolds im Cottage seiner Mutter war eine einsame Angelegenheit. Er hatte sich überlegt, sich eine Katze oder einen Hund anzuschaffen, wusste jedoch, dass es für ein Haustier keine sichere Umgebung war. Dann, durch Zufall oder Glück, fand er eines Tages eine Taube im Garten, flugunfähig durch einen, wie er annahm, gebrochenen Flügel. Die Aufgabe, sie wieder gesund zu pflegen, sie mit kleinen Leckerbissen zu füttern und ihr mit einer Pipette, von denen seine Mutter unerklärlicherweise einen Haufen besaß, Wasser in den Schnabel zu tröpfeln, hatte sich wie eine wunderbare Fügung angefühlt. Einen zweiten Vogel als Gesellschaft für den ersten zu fangen war ihm als durchaus gerechtfertigt erschienen. Sich jeden Tag um sie zu kümmern, war für Harry zum Lebensinhalt geworden, und er erklärte sein Verhalten damit, dass die Vögel zu etwas wurden, das nur ihm allein gehörte. In einem Leben, in dem seine Identität zu wenig mehr als einem hoffnungsvollen Sohn zusammengeschrumpft war, gaben die Vögel ihm einen Teil seiner selbst zurück. Außerdem war eine tägliche Unterhaltung mit einer Schar eingesperrter Vögel besser als überhaupt keine, wenn seine Mutter einen schlechten Tag hatte. Innerhalb kürzester Zeit hatte er einen Stall aus alten Paletten gebaut und über zwanzig Vögel eingefangen. Im Moment besaß er sechs Tiere nach ein paar Todesfällen und einer Handvoll Ausbrüchen. Er spürte Tabithas Blick auf sich, die immer noch auf eine Antwort wartete.
»Ich schätze mal, ich mag sie einfach. Es gefällt mir, mich um sie zu kümmern.«
Die anschließende kurze Stille fühlte sich angespannt an, vibrierte zwischen ihnen mit Dingen, die ungesagt blieben. »Nun, im Haus wartet noch viel Arbeit auf uns«, sagte sie. »Und diese Scones essen sich auch nicht von allein. Komm, lass uns eine Pause machen.« Als Tabitha zurück ins Cottage eilte, drehte Harry sich um und folgte ihr.
Sie standen schweigend nebeneinander, während sie die Scones im Ofen erwärmten. Harry spürte eine Veränderung in der Stimmung, obwohl er es nicht verstand oder die Ursache kannte. Er hatte das Gefühl, es hinge mit den Vögeln zusammen, und sein Blick wurde immerzu von einem Tattoo auf ihrer Schulter angezogen, ein Neuzuwachs auf ihrem Körper, den er früher in- und auswendig gekannt hatte und der ihm jetzt fremd war. Es war ein Vogel, das Bild wie ein Spritzer von unterschiedlichen Wasserfarben, Violett an Orange an Gelb.
»Wir haben gute Fortschritte gemacht«, sagte Tabitha und brach das Schweigen, während sie von ihrem ersten Scone abbiss.
»Ich kann nicht glauben, wie viel wir bereits aussortiert haben. Aber ich wette, du wünschst dir, du hättest diesen Brief ignoriert, nicht wahr?«
»Nicht wirklich«, erwiderte sie und biss erneut ab. Nachdem sie sich über die Lippen geleckt hatte, sagte sie: »Allein dafür hat es sich gelohnt. Die Scones sind unglaublich lecker.«
»Backen ist ihre Superkraft«, sagte Harry. »Mit ihren warmen Rosinenbrötchen könnte sie einen Krieg beenden.«
»Ha«, lachte Tabitha. »Aber sie ist niemand, der lang um den heißen Brei herumredet, nicht?«
»Äh, nein. Tut mir leid, wenn sie dich in eine unangenehme Situation gebracht hat.«
»Hat sie nicht. Es war irgendwie schön, dass sie wusste, wer ich bin. Das bedeutet, dass du mich nicht ganz vergessen hast.«
»Dich vergessen? Soll das ein Scherz sein?« Sollte er es tun? Sollte er ihr sagen, dass er immer noch Gefühle für sie hatte? Nach zehn Jahren mochten sich ihre für ihn vielleicht geändert haben. Doch wenn er es nicht sofort sagte, sich zumindest dafür entschuldigte, wie ihre Beziehung geendet hatte, bekäme er womöglich keine zweite Chance. »Tabitha, ich wollte …«
»Pst«, unterbrach ihn Tabitha. »Hast du das gehört?«
»Was gehört? Ich höre gar nicht.« Das war’s. Er würde es tun. Er würde ihr erklären, dass es ein Fehler gewesen war, sie zu verlassen. »Ich wollte dir sagen …«
»Nein, Harry, Augenblick. Ich kann …«, setzte sie an, brach dann jedoch mitten im Satz ab, als ein schweres Donnern über ihnen grollte. Ihr Blick glitt zur Treppe. Da sah Harry, wie sich Tabithas Augen weiteten. »Harry, schnell, weg da!«
In fieberhafter Hast zerrte sie ihn tiefer in die Küche und wenige Sekunden später beobachteten sie schwer keuchend von ihrem Platz in relativer Sicherheit, wie sich die Zeitungen auf den Treppenstufen bewegten und ins Wanken gerieten. Einer Lawine gleich stürzten die überquellenden Berge in Richtung Flur. In den letzten Winkel der Küche gedrängt, beobachteten sie, wie die Papiere sich zu einem staubigen Haufen ansammelten und ein paar vereinzelte Blätter wie Schneeflocken auf den Boden schwebten.
»Was zum …?«, flüsterte Tabitha und trat einen Schritt vor.
Harry wollte ihr schon folgen, erkannte jedoch kurz darauf, dass es ihm Mühe bereitete. Ein Gefühl der Enge breitete sich in seiner Brust aus, doch sein Asthmaspray befand sich auf der anderen Seite des Durcheinanders. Staub wallte wie dicker Nebel durchs Zimmer, und seine Lungen würden gleich kollabieren, sie pfiffen bereits heftig. Er beugte sich vor, wie er es gelernt hatte, die Hände auf die Knie gestützt, wo er mit aller Verzweiflung versuchte, Ruhe zu bewahren und dem Atem nicht nachzustolpern, der ihn verließ.
»Harry, wir brauchen hier wohl professionelle Hilfe. Ich glaube nicht, dass wir das allein schaffen. Harry?«, sagte sie und drehte sich verwundert um, da er ihr nicht antwortete. Doch als Tabitha zu ihm sah, war Harry bereits auf die Knie gesunken, den Kopf tief gebeugt, und röchelte schwer, während seine Brust sich auf- und absenkte. »Großer Gott, Harry!«, rief sie und stürzte zu ihm. Sie packte ihn an den Taschen, während er krampfhaft versuchte, zu Atem zu kommen, und schrie: »Der Staub hat bei dir einen Asthmaanfall ausgelöst. Wo ist dein Spray, Harry? Sag mir, wo es ist!«
Schließlich, nachdem er einen guten Atemzug in die Lunge gepresst hatte, brachte er hervor: »Wohnzimmer. Auf dem Tisch.«
Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, sprang sie in den Gang, und Harry konnte nichts weiter tun, als zu lauschen, wie sie über die wegrutschenden Papierstapel hinwegstolperte. Er beobachtete, wie sie in den Dunstschleiern verschwand, und spürte die Angst zurückkehren, die Hand in Hand mit dem Kampf um Luft einherging. Doch wenige Augenblicke später war Tabitha zurück, sein Asthmaspray fest umklammernd. Nach einem kurzen Schütteln und raschen Wegziehen der Kappe reichte sie es ihm, als hätte sie es erst gestern zum letzten Mal getan.
»Luft kurz anhalten«, sagte sie, als er den Sprühstoß einatmete, dann setzte sie sich neben ihn und rieb ihm den Rücken. Sobald sich seine Atmung ein wenig beruhigt hatte, war sie erneut auf den Beinen, und bevor Harry sie aufhalten konnte, rief sie den Notarzt.
»Mir geht’s schon besser«, sagte er, als sie wieder neben ihm stand und sein Zustand sich fast normalisiert hatte.
Der Ausdruck auf ihrem Gesicht verriet, dass sie sich nicht umstimmen lassen würde. »Du hattest gerade einen Asthmaanfall, Harry. Da gibt es nichts zu diskutieren.« Einen weiteren Moment lang konnte er nicht atmen, als sie sich herabbeugte, um seine Hände in ihre zu nehmen. »Der Krankenwagen ist gleich da. Bis dahin bleib einfach gerade sitzen. Und benutz noch mal das Spray. Komm schon, Harry, tu einfach, was ich dir sage. Ich weiß doch noch, was zu tun ist.«
In diesem Moment war es, als wäre er nie gegangen, als gehörte Tabitha immer noch zu ihm und als wäre er der Mann an ihrer Seite.
»Du hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt«, sagte sie später an dem Tag von einem Stuhl neben dem Krankenhausbett. »Es ist eine Weile her, seit ich mit Asthmaanfällen zu tun hatte.«
»Ich ebenfalls«, erwiderte er. »Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen hatte.«
»Dann ist es sowieso besser, wenn du über Nacht hierbleibst, wie die Ärzte geraten haben. Mit so etwas ist nicht zu spaßen, Harry. Sorg dich im Moment nicht ums Haus.«
Die Anspannung, die zwischen ihnen brodelte, die Last all dessen, was ungesagt geblieben war, schien angesichts seines Asthmaanfalls verblasst zu sein. Vielleicht nicht völlig verschwunden, aber sicherlich in den Hintergrund gerückt. »Was ist mit den Vögeln? Sie müssen gefüttert werden.«
»Die Tauben müssen freigelassen werden«, sagte sie. Gefangenschaft war etwas, das ihr gegen den Strich ging. Ihre freie Hand glitt zu ihrer Schulter, ihre Fingerspitzen strichen über die Tätowierung. Es war keine Kleinigkeit, wie sich ihre Leben verändert hatten. Mauern waren zwischen ihnen erwachsen, jede in einer anderen Form und Größe. Eine hatte zufälligerweise die Gestalt eines Taubenstalls. Erst jetzt kam ihm wieder in den Sinn, mit welch zärtlicher Liebe sie sich um Tiere gekümmert hatte, etwa den Igel, den sie durch den Winter hindurch gepflegt hatte, oder die Spinnen, die sie vorsichtig fing, bevor sie sie wieder in die Natur aussetzte. Einmal hatte er einen Besuch im Londoner Zoo vorgeschlagen, und sie hatte die folgenden zwei Stunden damit verbracht, ihn über die Unmenschlichkeit zu belehren, Tiere in Käfigen und – in ihren Worten – als Geiseln zu halten.
»Es tut mir leid. Ich hatte vergessen, wie deine Einstellung dazu ist.«
»Es sind Wildvögel.«
»Ich kümmere mich gut um sie. Versprochen.«
»In Freiheit könnten sie sich selbst um sich kümmern. Aber ich schätze, einstweilen könnte ich mich durchringen, die armen Dinger zu füttern.«
»Vielen Dank«, sagte er daraufhin. »Das weiß ich zu schätzen.« Die Vorstellung, die Tauben gehen zu lassen, bedrückte ihn, aber sobald das Haus verkauft war, müsste er es wohl oder übel sowieso tun. Dennoch würde er die Sache erst einmal auf sich zukommen lassen. »Aber ich will dir nicht nur für deine Hilfe mit den Vögeln danken. Auch für dein Kommen, als sie dir geschrieben hat. Und weil du jetzt hier bist.«
»Keine Ursache«, sagte sie, als wäre es eine unbedeutende Kleinigkeit, als wäre dieses Szenario vor ein paar Tagen nicht noch undenkbar gewesen. »Aber ich schätze, wir sind uns einig, dass das Haus mehr Arbeit ist, als wir erwartet haben. Wir sollten eine Entrümpelungsfirma anrufen.«