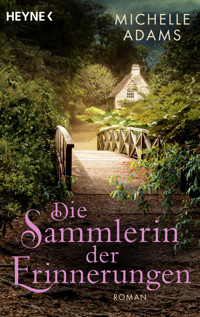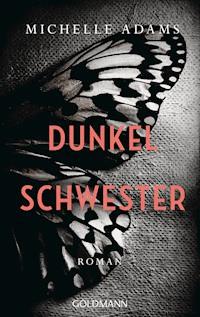3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nur mit Glück überlebt Chloe Daniels einen schweren Autounfall – doch seitdem kann sie sich an nichts mehr erinnern. Sie weiß nicht, wer sie ist, sie erkennt ihre Familie nicht, sie hat keine Ahnung, was am Abend des Unfalls und zuvor in ihrem Leben passiert ist. Als sie aus dem Krankenhaus entlassen wird, zieht Cloe wieder zu ihren Eltern. Sie will ihre Amnesie überwinden, doch ihr Vater, ein angesehener Psychiater, drängt sie, die Vergangenheit loszulassen. Zudem darf sie das Grundstück nicht verlassen, die Tür ist mit einem Code gesichert. Und schließlich bestätigt sich Chloes schlimmste Angst: Sie kann ihren Eltern nicht vertrauen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Chloe Daniels kann sich nach einem schlimmen Unfall an nichts mehr erinnern. Sie erkennt ihre eigene Familie nicht mehr und weiß weder, was am Abend des Unfalls, noch überhaupt in ihrem Leben bisher passiert ist. Frisch aus dem Krankenhaus entlassen, wohnt sie zunächst wieder bei ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester, ohne sich dort wirklich zu Hause oder emotional zugehörig zu fühlen. Ihr Vater, ein angesehener Psychiater und Neurologe, der sich mit Verfahren zur Traumabewältigung einen Namen gemacht hat, versucht ihr zu helfen, die Vergangenheit loszulassen. Doch dann kommt eine Wahrheit ans Licht, die Chloe zeigt, dass sie den Geschehnissen jener Nacht auf die Spur kommen und sich ihrer Geschichte stellen muss …
Weitere Informationen zu Michelle Adams sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Michelle Adams
Lügengift
Spannungsroman
Aus dem Englischen von Petra Knese
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Die englische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Between the Lies« bei Headline Publishing Group, a Hachette UK Company, London.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung Juni 2019
Copyright © der Originalausgabe 2018 by Michelle Adams
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Redaktion: Julie Hübner
AG · Herstellung: kw
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-19433-8V002
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für dich, Leila, meinen wahr gewordenen Traum.
Mein Wunder.
Ertrinken. Du sagtest, so würde es sich anfühlen. Als würde man unter die Oberfläche gleiten, immer tiefer sinken, bis einem die Luft ausgeht. Deine Finger sanft auf meiner Brust, in diesem stickigen, kleinen Zimmer, der Welt entrückt. »Es ist, als würdest du mich verschlingen«, meintest du, »mir den Atem rauben.« Dann hieltest du den Kopf in die Hand gestützt, die Finger hattest du im Haar vergraben, und mir zugezwinkert. Beim Anblick deines Lächelns erkannte ich, dass du wusstest, dass du nichts dagegen tun konntest.
Aber Chloe, für mich war es kein Ertrinken. Es war etwas vollkommen anderes. Denn wenn man ertrinkt, gerät man in Panik, kämpft, schlägt um sich. Ringt verzweifelt nach Atem, will entkommen. Wenn man ertrinkt, ist man irgendwann tot.
Vielleicht ist es dir entfallen, aber dagegen gekämpft hast du nicht. Du bist freiwillig untergegangen. Du willst nicht weg. Du willst mich nicht vergessen. Du sagst, du hättest dich verändert, aber für mich bist du immer noch alles, was ich je wollte.
Das ist kein Ertrinken, Chloe, das kann ich dir garantieren.
Ich will nicht sterben. Ich will auch nicht, dass du stirbst.
Das wäre doch keine Liebe.
1.
Im ersten Moment spüre ich nichts. Keinen Schmerz, keine Angst. Blinzelnd öffne ich die Augen. Im grauen Mondlicht nehme ich schemenhaft meine Umgebung wahr, dunkles Leder und den Teil eines Lenkrads. Glänzend ölige Spritzer, dunkles Blut auf meiner Haut. Was ist passiert? Wo bin ich?
Ich hebe den Kopf. Ein höllischer Schmerz im Nacken. Ist das Regen, der mir kalt ins Gesicht sprüht? Ich höre nur meinen Atem, werfe einen Blick auf den leeren Beifahrersitz neben mir, auf die zerschlagene Windschutzscheibe. Die zersplitterten Ränder sind feuerrot. Mit zitternder Hand taste ich nach dem Sicherheitsgurt, fingere am Gurtschloss herum. Ich habe nicht die Kraft, den Knopf zu drücken. Mir verschwimmt alles vor den Augen. Ich sacke nach vorne wie totes Gewicht, aber ich glaube, ich bin noch am Leben.
Immer wieder verliere ich das Bewusstsein. Wie lange bin ich wohl schon an diesem seltsam einsamen Ort? Kalte Schauer wecken mich, Regen peitscht gegen die Fenster. Mir steht eine ungestüme Nacht bevor. Ich habe Schmerzen in der Brust, die sich bis in die Arme ziehen. In der Ferne blitzt eisblaues Licht auf, das sich in den Scherben der Windschutzscheibe spiegelt und dann wieder zwischen den Bäumen verschwindet. Die Augen fallen mir zu, ich reiße sie wieder auf. Wieder und wieder. Wie Seetang in den Wellen werde ich zwischen Leben und Tod hin- und hergeworfen.
Während der Regen auf das Autodach trommelt, ruft eine Stimme: »Können Sie mich hören?« Jemand schlägt gegen die Seitenscheibe. Öffnet die Tür. Hände zerren an mir, rutschen ab. Blutige Strähnen fallen mir über die Augen. Im Augenwinkel sehe ich eine gelbe Jacke, einen schwarzen Helm, der das Gesicht des Mannes verdeckt. Er ruft irgendetwas. Sind da noch mehr Leute? Wasser rinnt ihm von den Schultern, die eisigen Spritzer treffen mich. Als ich mich rege, knirscht unter mir Glas.
»Halten Sie durch. Bewegen Sie sich möglichst nicht.« Ich spüre, wie er sich über mich beugt. »Können Sie mir sagen, wie Sie heißen?«
Keine Ahnung.
Jemand legt mir eine Halskrause um. Es wird kälter, stiller. Ich spüre meine Hände nicht mehr. Immer wieder fallen mir die Augen zu. Dann ertönt ein Kommando, und sie ziehen mich aus dem Wagen. Es geht alles ganz schnell. Ihre Stimmen werden vom Wind davongetragen. »Wir verlieren sie!«
Ich schlage die Augen auf. Es ist kein sanftes Erwachen, kein seichtes Treiben zwischen Traum und Realität. Es geht schnell, wie das Abreißen eines Pflasters oder der Schnitt mit einem scharfen Messer. Ich bin außer Atem und verschwitzt. Allmählich fällt der Traum von mir ab, ich sehe mich im Zimmer um, führe mir ganz bewusst vor Augen, wo ich bin. Dass ich nichts zu befürchten habe. Dass ich am Leben bin.
Ich drehe mich auf den Rücken und setze mich im Bett auf, leise prasselt der Regen gegen die Fensterscheibe. Ich reibe mir die Augen, eine Tür öffnet und schließt sich. Schritte auf der Treppe, gedämpftes Geschnatter aus der Küche.
Familienleben.
Sie sagen, ich heiße Chloe. Als ich im Krankenhaus aufgewacht bin, die Stimme kratzig und heiser, die Kehle so wund, dass ich kaum sprechen konnte, wusste ich nicht, wer ich war. Ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Wer ich war, was ich beruflich tat. Wie mein Leben aussah. Ich fragte eine der Krankenschwestern, eine mollige Frau namens Helen, deren zierliche Brille oberhalb der Nasenspitze saß. Sie stemmte eine dicke Hand in die Hüfte. »Erinnern Sie sich denn nicht?«, fragte sie.
Ich schüttelte den Kopf. Er pochte, fühlte sich schwer an. Wenn ich in Gedanken zurückging, kam es mir vor, als könnte ich mich vage an den Unfall erinnern, von dieser Erinnerung träumte ich dann jede Nacht. Aber sicher war ich nicht. Ich sah aus dem Fenster, irgendetwas am Regen kam mir vertraut vor, etwas am entfernten Schlagen der Wellen an den Strand. Aber was?
»Ihr Name ist Chloe. Sie hatten einen Unfall. Sie lagen über einen Monat im Koma«, sagte sie. »Aber Ihnen geht es schon viel besser, machen Sie sich keine Sorgen.«
Helen widmete sich wieder ihren Notizen, kontrollierte meinen Puls, meinen Blutdruck, meine Temperatur und hielt alles fest. Ich sah mir die Karte auf dem Nachttisch an: Gute Besserung, Chloe stand darauf. In Liebe Mum, Dad und Jess. Offenbar meine Familie.
An sie konnte ich mich auch nicht mehr erinnern.
Nun schiebe ich die üppig bestickte Decke von mir und nehme das Glas Wasser vom Nachttisch. Seit ich hier bin, habe ich ständig einen trockenen Mund. Das liegt an dem ganzen Staub hier überall. Das Anwesen meiner Familie ist alt und riesig, manche Räume wurden schon seit Jahrzehnten nicht mehr betreten. Ich taste nach dem Schalter der Lampe mit den kleinen Troddeln und schalte sie ein. Doch das Licht kann das Zimmer nicht nennenswert erhellen, die Ecken bleiben dunkel, in ewige Schatten getaucht.
Ich schaue mich um. Hier bin ich jetzt zu Hause, aber selbst nach ein paar Wochen fühle ich mich noch fremd. An der Wand klebt eine mit Rosen überladene Strukturtapete in kitschigem Lachsrosa. In den Ecken löst sich die Tapete schon. Die Decke ist weiß, wirkt aber wegen des dichten Nebels draußen schmutzig grau. Schon seit Tagen hängt er in der Luft. Um das Deckenlicht herum blättert die Farbe ab. Hier ist alles in Auflösung begriffen. Jeden Morgen nehme ich jede Einzelheit in mir auf, weil ich hoffe, etwas wiederzuerkennen. Aber hier ist nichts meins. Ich gehöre woanders hin. In ein anderes Leben, an das ich mich nicht mehr erinnern kann. Das nicht mehr existiert.
Ich trete ans Fenster, schiebe die fadenscheinigen Vorhänge beiseite. Vom ersten Stock des alten Pfarrhauses aus, in dem ich angeblich aufgewachsen bin, kann man die Weite des Familienanwesens gar nicht ganz erfassen. Das Haus ist umgeben von großen Flächen feuchten Ackerlands, die sich bis hin zu bewaldeten Hügeln erstrecken. Irgendwo in der Ferne liegt ein Dorf. Da würde ich gerne hinlaufen, das Haus mal verlassen, aber mein Vater meint, es sei noch zu früh. Ich bin eine erwachsene Frau, werde aber im Haus gehalten wie ein kleines, schutzbedürftiges Kind. Meine Eltern sagen, sie wollen nur mein Bestes. Also höre ich auf sie. Doch es ist schwer, Leuten zu vertrauen, wenn man nicht mal sicher ist, dass man sie kennt.
Ich begebe mich nach unten, die gedeckten Farben im Treppenhaus deprimieren mich. Draußen steht die Sonne tief, ihr winterliches Licht scheint sanft und silbern. Mir macht es deutlich, wie viel Zeit ich verloren habe, eine ganze Jahreszeit. Woran kann ich mich überhaupt noch erinnern? Keine Ahnung. Nicht mal an den Sommer vor dem Unfall kann ich mich entsinnen. Also muss ich mich fürs Erste mit diesem Haus, diesen Menschen arrangieren. Mit dieser Version meiner selbst.
Chloe. Wer immer das ist.
Als ich in die Küche komme, sitzt mein Vater schon am Tisch, meine Mutter macht sich noch an der Arbeitsplatte zu schaffen. Meine Schwester Jess zieht mir einen Stuhl heran. Mit ängstlichen Schritten geht meine Mutter auf mich zu, einen Becher Tee in der einen, einen Teller mit Muffins in der anderen Hand. Noch immer macht sie ein Gewese um mich, als wäre es mein erster Tag hier. Sie ermuntert mich, mir einen Schokoladenmuffin zu nehmen, dann stellt sie den Teller auf den langen Küchentisch.
»Möchtest du Toast?«, fragt sie. »Wir haben leckere Marmelade da.« Lächelnd nicke ich. Sie schaut zu meinem Vater, der ihr Zustimmung signalisiert. Bange Erwartung liegt in der Luft, eigentlich seitdem ich hier bin. Ich glaube, es ist Verzweiflung, der Wunsch, dass ich mich heimisch fühle. Damit alles wieder ins Lot kommt, wünschen sie sich, dass ich gerne hier bin.
»Chloe, ich muss leider heute Morgen in die Klinik«, sagt mein Vater, während ich an den trockenen Rändern des Muffins knabbere. »Ich habe ein paar Verpflichtungen, die ich nicht länger hinausschieben kann. Deine Mutter und deine Schwester werden auch unterwegs sein.«
»Kein Problem«, antworte ich. »Ich komme schon alleine klar.«
Er erhebt sich und leert seine Kaffeetasse, bevor er meine Mutter auf die Wange küsst. Als er Jess durchs Haar zausen will, bringt sie sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit. Dann beugt er sich über mich und drückt mir einen kalten, trockenen Kuss auf die Wange. Mir läuft ein Schauder über den Rücken. »Mach dir keine Sorgen«, sagt er. »Alles ist bestens, aber heute sollten wir mal wieder eine Sitzung machen, was meinst du? Die letzte ist schon ein paar Tage her.«
Eine Sitzung. Damit will er mich darin unterstützen, mir wieder ein Leben aufzubauen. Angefangen haben wir gleich nach meiner Ankunft hier. Als Psychiater fühlt er sich berufen, meine Genesung zu beschleunigen und mir zu helfen, mich an die Vergangenheit zu erinnern. Doch selbst nach ein paar Wochen entzieht sich mir diese Vergangenheit. Mittlerweile hätte meine Familie mir ja ein wenig über mein Leben erzählen können. Wo ich gewohnt habe. Mit wem ich befreundet gewesen bin. Was ich gemacht habe. Aber keiner rückt mit der Sprache raus, und ich bin unfähig, mich daran zu erinnern. Alles zu seiner Zeit, heißt es immer. »Ich helfe dir«, kommt von meinem Vater. Er will ja, dass ich mich erinnere. Aber alles hat nach seinen Regeln abzulaufen.
Mein Vater klemmt sich die Times unter den Arm. »Bald bist du wieder ganz die Alte, Chloe. Wir machen schon großartige Fortschritte. Aber wenn du hier heute allein bist, geh nicht aus dem Haus. Du bist noch nicht so weit. Ach ja, das hätte ich ja fast vergessen.« Er fördert ein kleines Porzellanschälchen zutage, in dem drei Tabletten liegen. »Nimm die.«
Ich lege mir die Tabletten auf die Zunge, ein Mischmasch aus Schmerzmitteln und Antiepileptika, und spüle sie mit einem Schluck Wasser hinunter. Durch die vereiste Scheibe im Arbeitszimmer meines Vaters beobachte ich, wie er in sein Auto steigt. Jess klettert zu meiner Mutter in den Wagen, und einer nach dem anderen fahren sie davon. In ein Leben, von dem ich nichts weiß. Ich schaue den Autos hinterher, bis ihre Lichter von der dichten Nebelwand verschluckt werden. Und während ich dort stehe, in Kleidern, die nicht wirklich meine sind, in einem Haus, in das ich nicht gehöre, denke ich über die Anweisung meines Vaters nach, das Haus nicht zu verlassen. Jeden Tag geht mir das Gleiche durch den Kopf. Wenn ich rausginge, wohin würde ich gehen? Die Frage kann ich nicht beantworten, denn außer diesem Haus und diesen drei quasi Fremden, weiß ich nichts über mein Leben.
Sobald wir die Therapie beendet haben, wird alles wieder wie früher, Vergangenheit und Gegenwart werden nur durch eine blasse, gut verheilte Narbe getrennt, sagt mein Vater. Aber da kann er sich anstrengen, wie er will, ich werde nicht wieder in mein altes Leben zurückfinden. Der Mensch, der ich war, ist tot, beim Unfall ausgelöscht. Und wenn ich auch sonst ziemlich durcheinander bin, weiß ich eines genau: Tote kann man nicht wieder lebendig machen. Ich fürchte, die alte Chloe werde ich nie wieder zurückbekommen.
Und ich fürchte noch mehr, dass meine Familie das auch gar nicht will.
2.
Alleine kämpfe ich erst mal mit der erstickenden Stille, der Ruhe in diesem fremden Haus, der Leere in mir. So geht das jeden Tag. In den ersten Momenten allein befällt mich eine panische Angst, wie ich wohl die Zeit herumbringen soll, bis sie wiederkommen und meinem Dasein einen Zweck verleihen, mir einen Platz in der Welt geben. Denn trotz aller Vorbehalte habe ich ja nur meine Familie. Bis sie zurückkommen, gibt es nur mich, und ich habe keinen Schimmer, wer das ist.
Ein paar Dinge haben sie mir schon über mein Leben erzählt, aber es ist wie ein Puzzle, bei dem die meisten Teile fehlen. Was ich weiß, ist extrem beschränkt und vage. Ich weiß, dass ich Chloe heiße und zweiunddreißig Jahre alt bin. Vor meinem Unfall habe ich als Anwältin gearbeitet. Ich hatte ein eigenes Haus ganz hier in der Nähe. Doch ich kenne keine Einzelheiten, die dem Farbe verleihen würden. Angeblich war ich glücklich. Hatte ein schönes Leben. Aber mir kommt alles so schal und falsch vor. Es ist wie bei einem Pflaster, das man von einer Wunde abreißen muss, um zu sehen, was sich darunter verbirgt.
Über den Tag verteilt, schlafe ich viel, wie ein Baby. Ohne Ruhepausen halte ich nicht durch. Fernsehen ist eine totale Zeitverschwendung. Ich kann mich einfach nicht lange genug konzentrieren, um der Handlung zu folgen. Selbst wenn mir meine Schwester sagt, dass ich die Sendung schon x-mal gesehen habe, scheint sie mir kompliziert und verworren. Dennoch schaue ich mir jeden Abend nach dem Abendbrot die Nachrichten an, um mir bewusst zu machen, dass es auch noch ein Leben außerhalb dieses Gemäuers gibt und dass die Zeit vergeht. Ich kann Stunden über Papieren brüten, die mein Vater mir gegeben hat: meine Geburtsurkunde, Schulzeugnisse und ein Fotoalbum von meiner Mutter. All diese Dinge beweisen, dass ich mal ein Leben hatte. Dass Chloe Daniels existiert hat. Statt eines Lebens habe ich nun eine Narbe links auf dem Schädel, wo Dr. Gleeson, der Neurochirurg, ein Epiduralhämatom entfernt hat. Die Narbe reagiert auf alles empfindlich. Inzwischen bin ich dazu übergegangen, immer eine Wollmütze zu tragen, aber ich bin nicht so weltfremd, als dass ich nicht wüsste, wie seltsam das auf die Menschen wirken muss, mit denen ich zusammenlebe.
Erst wollte ich gar nicht mitgehen. Mit meinen Eltern. Meiner Familie. Die Vorstellung, in einem Haus mit Leuten zu leben, die ich nicht kannte, kam mir seltsam vor. Als ich mit Dr. Gleeson mal allein war, habe ich ihm gestanden, dass ich fürchtete, die Leute könnten Hochstapler sein, die meinen Gedächtnisverlust ausnutzen. Für mich rochen sie auch so komisch. Das finde ich immer noch. Ein ausgeprägter Geruchssinn ist offenbar eine Begleiterscheinung der OP. So ein Skalpell im Kopf kann die Sinne beeinträchtigen.
Dr. Gleeson hat nur gelacht, seine schlanke Hand auf meine gelegt und mir gesagt, ich solle mir keine Sorgen machen. Es seien gute Menschen und es gebe Dinge, die meinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen könnten. Wie zum Beispiel das Fotoalbum, das meine Mutter zusammengestellt hat, um mir eine Brücke zur Vergangenheit zu bauen.
Jeden Morgen blättere ich es am Küchentisch durch in der Hoffnung, mich an etwas zu erinnern. Ich als Kind beim Füttern einer Ziege, bei einem Ausflug nach Weymouth in einer Kutsche mit Shire Horses. Mitunter kommt eine Empfindung hoch. Ich rieche das Meer, oder mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn mein Vater von Essig-Chips spricht. Als wüsste mein Körper, was mein Kopf nicht mehr weiß.
Ich gehe zum Kühlschrank und werfe einen Blick auf die Liste, die mein Vater kurz nach meiner Rückkehr aus dem Krankenhaus erstellt hat. Da habe ich mich wie ein Zombie gefühlt, war all die Medikamente nicht gewöhnt. Noch immer nehme ich Kortison, Antibiotika und Antiepileptika, um Schwellungen zu lindern, Infektionen zu verhindern und die Gefahr von Krämpfen einzudämmen. Aber nach wie vor habe ich Probleme mit meinem Tagesablauf, deshalb die Liste mit meinen täglichen Aufgaben.
An erster Stelle stehen meine Übungen. Einfache Arm- und Beinhebeübungen, damit ich wieder Muskelkraft aufbaue. Wir haben auch einen großen Gymnastikball, auf dem ich im Sitzen auf- und abhüpfe. Angeblich stärkt das die Mitte. Als Nächstes stehen die Medikamente auf der Liste. Wie im Krankenhaus liegen sie schon abgezählt bereit, aber die nächste Ration soll ich erst nehmen, wenn meine Mutter nach Hause kommt. Da gehen sie lieber auf Nummer sicher. Der dritte Punkt ist Essen. Als ich den Kühlschrank öffne, steht dort ein Teller mit Broten, fest verpackt unter Klarsichtfolie.
Ich hole ein Brot heraus und nehme einen Bissen, doch trotz der Steroide, die angeblich meinen Appetit anregen sollten, bin ich eigentlich nie richtig hungrig. Das einzige Verlangen, das ich habe, ist, rauszugehen und mein eigenes Leben wiederzufinden. Eingesperrt in dieses Haus mit seinen hohen Decken und zugigen Durchgängen, ist auch nicht anders, als im Koma zu liegen. Nachdem ich das Brot gegessen habe, tue ich deshalb das, was ich jeden Tag tue, wenn ich allein bin. Ich schlüpfe mit den Armen in den Mantel meiner Mutter, mit den Füßen in ihre Schuhe. Schnappe mir die Schlüssel, öffne die Haustür und gehe mithilfe eines Stocks, den ich für die Arbeit mit dem Physiotherapeuten mit nach Hause nehmen musste, bis zum Ende der Auffahrt. Es ist beschwerlich und ermüdend, und jedes Mal muss ich mich anschließend ins Bett legen und eine Stunde schlafen. Trotzdem zwinge ich mich dazu, um die feuchtkalte Luft draußen zu spüren, die sich wie eine Decke um mich legt. Was anderes bleibt mir nicht.
Seit einer Woche lege ich die Strecke bis zum Tor täglich zurück, seit mein Vater sich geweigert hat, mich zurück in mein eigenes Haus zu bringen. Dort, wo ich mein altes Leben verbracht habe. Ich weiß noch nicht, wo es liegt und wie es aussieht, aber es würde mir garantiert helfen, mich zu erinnern. Mein Vater meinte, ich sei noch nicht so weit. Ich sei noch zu krank. Als ich ihn bat, mir ein Bild von meinem Haus zu zeigen, mir davon zu erzählen, wollte er nicht. Flehend sah ich meine Mutter an. Doch sie schlug nur die Augen nieder, schwieg unter den wachsamen Blicken meines Vaters.
»Du bist noch nicht so weit, Chloe. Ich gebe dir Bescheid, wenn es so weit ist. Damit verdiene ich mein Geld. In solchen Dingen kenne ich mich bestens aus.« Mehr sagte er dazu nicht.
Also entschloss ich mich, einfach zu gehen. Und da hatte ich dann entdeckt, dass das Tor verschlossen ist. Dass ich nicht gehen konnte, selbst wenn ich wollte. Nun stehe ich wieder am Ende des Anwesens, halte mich am feuchten Holztor fest. Weiter komme ich dank eines durchgehenden Zauns rund ums Gelände nicht. Die Straße dahinter verliert sich im dichten weißen Nebel. Auch wenn ich es nicht sehen kann, weiß ich, dass dort das Dorf liegt, mit seinem Friseur, seiner Autowerkstatt und all den Häusern voller Leben. Bestimmt. Wie jeden Tag rüttle ich am Tor, aber es ist mit einer Zahlenkombination verschlossen. Noch etwas, das ich nicht weiß. Noch etwas, das mir niemand verrät.
So eingesperrt fühle ich mich wie eine Gefangene.
3.
Meine Mutter kehrt kurz vor dem Mittagessen zurück und setzt sich zu mir an den Tisch, während ich esse. Sie passt auf, dass ich die Tabletten nehme, dann macht sie mir einen Tee und hilft mir ins Bett. Mir entgeht nicht, wie ihr Blick über meinen Körper gleitet und sie eine mentale Inventur meiner Verletzungen macht, bevor sie mir die Decke bis zum Kinn zieht.
»Wenn du dich ausgeruht hast, willst du dich dann vielleicht mal zum Abendessen anziehen?«
»Weiß nicht.« Sie schlägt mir das oft vor, als würde damit alles gut werden.
»Du kannst ja nicht den Rest deines Lebens im Schlafanzug verbringen. Und vergiss nicht, was dein Vater vorhin gesagt hat. Er will sich heute noch mal mit dir hinsetzen. Bestimmt würde er sich über eine angezogene Tochter freuen.«
Ich schaue zu den Schränken. »Aber es sind nicht mal meine Sachen. Alle meine Sachen sind noch in meinem Haus. In dem Haus, von dem mir keiner von euch etwas erzählen will.«
»Nicht alle«, sagt sie ungehalten. »Ein paar Sachen haben wir dir mitgebracht, das weißt du doch.« Mum hält einen kleinen Beutel hoch. »Dein Zuhause ist jetzt hier bei uns, Chloe.«
Mein Vater kommt früh aus der Klinik zurück. Mums Auto war nämlich in der Werkstatt, und Jess musste von der Uni abgeholt werden. Irgendein Seminar zu forensischer Toxikologie, das Jess über die Semesterferien besucht. Doch Dads Arbeit in der Klinik ist längst nicht beendet, und so bestellt er einen Kollegen zu uns nach Hause, um ein paar dringende Fälle durchzusprechen. Ich höre den Arzt kommen, die Reifen graben sich in den Kies. Es dämmert schon, als ich ans Fenster trete und ihn durch den Nebel auf unser Haus zuschreiten sehe.
Seltsamerweise erkenne ich ihn. Gut möglich, dass ich ihn schon mal im Krankenhaus gesehen habe. Durch den Türspalt beobachte ich, wie er hereinkommt und seine Jacke übers Geländer schlingt. Mein Vater hasst so was, aber er sagt nichts dazu.
Nach einer Stunde gehe ich nach unten. Ihre Stimmen dringen durch die halboffene Arbeitszimmertür, gedämpft zunächst, dann aber deutlicher. Offenbar unterhalten sie sich noch über Berufliches.
»Wir müssen uns damit abfinden, dass ihr Zustand wesentlich schlimmer ist, als ursprünglich angenommen, Guy. Nun gilt es, die harte Linie beizubehalten, damit keine Verwirrung aufkommt.«
Als ich das Ende der Treppe erreiche, höre ich ein tiefes Seufzen. »Ich weiß Ihre Meinung zu schätzen, Dr. Daniels, aber ich mache mir Sorgen.«
»Um unser weiteres Vorgehen?«
»Darum, was passiert, wenn wir zu lange warten, sie in ihr altes …«
Er hält inne, als ich an der Tür vorbeilaufe.
»Chloe, bist du das?«, ruft mein Vater. Ich mache ein paar Schritte zurück Richtung Arbeitszimmer und drücke die schwere Holztür auf. »Ich dachte, du schläfst.«
»Habe ich auch, aber ich bin schon eine Weile wach.«
Der Mann, der mir vage bekannt vorkommt, sitzt meinem Vater gegenüber auf einem Stuhl, die Finger vor sich zu einem Dach gefaltet. Sofort denke ich an das Fadenspiel, das wir immer in der Schule gespielt haben. Der Arzt lächelt mich an und scheint unschlüssig, ob er mir zuwinken oder die Hand schütteln soll.
»Hallo«, sage ich.
»Hallo, ich bin Guy. Wir sind uns schon mal …«
»… im Krankenhaus begegnet.« Er scheint überrascht. »Ich kann mich an Ihr Gesicht erinnern.«
»Dr. Thurwell ist ein Kollege, Chloe. Er hat dich besucht, kurz nachdem du aus dem Koma erwacht warst.«
»Schön, dass es Ihnen so gut geht.«
»Danke«, entgegne ich. Danach herrscht erst mal Schweigen, keiner weiß so recht, was er sagen soll. »Dann lasse ich euch mal lieber in Ruhe weiterarbeiten.«
Mein Vater nickt mir zu. »Danke, Chloe. Wir sehen uns dann beim Abendessen.«
Um sieben Uhr setzen wir uns an den Abendbrotstisch. Der Himmel ist dunkel, der Wind stark. Wie jeden Abend warten wir schweigend auf das Signal meines Vaters. Er trägt uns auf, während meine Mutter ihm ein Glas Rotwein einschenkt. Wie gewöhnlich unterhalten sie sich, ohne dass ich einen Beitrag leiste. Stattdessen höre ich zu. Meine Schwester hängt meinem Vater an den Lippen. Ob ich wohl auch so gewesen bin? War ich auch ein Papakind? Als abgeräumt wird, wendet er sich mir zu. Sofort schlägt mein Herz schneller, als müsste ich aus den Trümmern meines Lebens eine Antwort auf jede seiner Fragen hervorzaubern.
»Was hast du heute Vormittag gemacht? Hast du dir das Fotoalbum angesehen?«
»Ja, sonst eigentlich nichts weiter. Die meiste Zeit bin ich müde.«
Er nickt zufrieden. »Das ist nicht anders zu erwarten. Gib dir Zeit, Chloe.« Und dann greift er über den Tisch nach meiner Hand. Mir stockt der Atem, ich bin wie erstarrt. »Gemeinsam schaffen wir es. Vergiss nur deine Tabletten nicht.« Ich nehme das kleine Schälchen vom Tisch und schlucke meine Abendration. »Lass uns anfangen.«
Ich schwinge die Beine aufs Sofa, und mein Vater rückt die Kissen zurecht, damit ich es bequem habe. Er zieht sich einen Stuhl heran und quetscht sich mit seiner Leibesfülle darauf. Der Stuhl ist zu klein. Mit dem Sitzen gibt er sich große Mühe, offene Haltung, entspannte Schultern. Er wolle mich nicht zwingen, mich zu öffnen. Das hat er kurz nach meiner Ankunft hier gesagt. Er hat sich zu mir heruntergebeugt, die Freundlichkeit in Person, während ich ihn verschreckt angesehen habe. »Du weißt, dass ich dich nicht zwinge, mit mir zu reden, nicht wahr, Chloe? Sei ganz unbesorgt. Aber wenn wir zusammenarbeiten, kann ich dir helfen, dich an Vergessenes zu erinnern.«
Doch drei Wochen später habe ich immer noch keine konkreten Erinnerungen. Die Sitzungen bewirken nur, dass ich mich noch verunsicherter und sehr durcheinander fühle. Im Arbeitszimmer meines Vaters hängen lauter Auszeichnungen, also scheint er ein versierter Arzt zu sein. Natürlich ist es möglich, dass bei mir Hopfen und Malz verloren sind, aber genausogut frage ich mich, ob das Unternehmen nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt war.
»Findest du es nicht ein wenig merkwürdig?« Ich versuche es mir auf dem Sofa bequem zu machen. »Du bist mein Vater. Eigentlich sollte man ja nicht jemanden aus der eigenen Familie therapieren.«
Mein Vater rutscht auf dem Stuhl hin und her, streicht seinen Block glatt. »Aber Chloe, ich bin vom Fach. Soll ich untätig zusehen und dir nicht helfen?« Er holt tief Luft und atmet langsam durch die Nase aus.
»Vielleicht könnte ich zu einem anderen Arzt aus deiner Klinik gehen? Wie wäre es mit Guy, der vorhin hier war?« Ich erinnere mich, dass er lächelnd bei mir auf der Bettkante gesessen hat. »Womöglich kann er mir helfen.«
Mein Vater kneift die Augen zusammen, als würde er sich den Vorschlag durch den Kopf gehen lassen. »Dr. Thurwell? Er ist sicher ein sehr guter Arzt, aber es wäre nicht angebracht, wenn du als Patientin zu ihm gehst. Er ist viel jünger als ich, Chloe. Ich bin sein Mentor. Ich kümmere mich schon um dich und helfe dir, die Vergangenheit wachzurufen.«
»Aber wir sind schon seit drei Wochen dabei, und es hat sich noch nichts getan.«
Er fährt sich über den Bart, die rosa Lippen geschürzt. »Chloe, das menschliche Gehirn kann eine unglaubliche Menge an Informationen speichern. Es ist alles da drin.« Dabei tippt er mir leicht gegen den Kopf. »Dein Leben in kleinen Datenpaketen. Durch den Unfall ist alles durcheinandergeraten. Überall liegen die Dinge verstreut, wie früher in deinen Schubladen.« Ködert er mich wieder mit der Vergangenheit? War ich ein unordentliches Kind? »Doch das Gehirn vollbringt Erstaunliches. Normalerweise erinnern wir uns in allen Einzelheiten selbst an Erlebnisse aus der Kindheit, als wären sie erst gestern geschehen.« Er schnippst mit den Fingern. »Innerhalb von Sekunden! Du aber hast diese Fähigkeit verloren. Nun müssen wir schauen, dass das Unbewusste wieder bewusst wird, müssen deine periphere Wahrnehmung auf ein Minimum reduzieren, um die verschütteten Erinnerungen freizulegen. Quasi alles neu vernetzen. Hypnose ist dabei ein wunderbares Hilfsmittel.«
Die Aussicht, mich wieder an mein Leben zu erinnern, ist zu verführerisch. Ich lehne mich in die Kissen zurück und schaue ihn an. Im Schein des Kaminfeuers leuchtet das Weiß seiner Augen, wirken die Schatten darunter tief und dunkel. Ich weiß immer noch nicht, ob ich ihm trauen kann, doch anscheinend ist er momentan meine einzige Hoffnung.
»Zunächst möchte ich, dass du deinen Atem tiefer werden lässt. Entspann dich einfach. Atme bewusst durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Genau. Nein, sieh nicht mich an. Schau auf den Stift.« Mein Vater hält einen silbernen Füller hoch. Schwarze Tinte ist ihm über die Finger gelaufen, hat sich in die Hautrisse gesetzt. »Nun erlaubst du dir, dich ganz dem Rhythmus deines Atems hinzugeben. Gut machst du das. Ein und aus. Sehr gut, aber nicht so viel zwinkern. So ist’s richtig. Du machst das sehr gut.«
Nach einer Weile werde ich ruhiger, sogar etwas schläfrig. Schwer liegen meine Arme auf dem Sofa. Ich gähne, der Regen, der gegen die Scheibe trommelt, erinnert mich an Wellen, die sich an einem steinigen Strand brechen. Die Steine werden von der Strömung mitgerissen. Brighton, glaube ich. Woher kenne ich Brighton? Warum kommt es mir ausgerechnet jetzt in den Sinn?
»Nun, Chloe. Was weißt du von dem Abend noch?«
»Regen«, sage ich. »Es hat geregnet.«
»Sehr gut. Wo bist du?«
»Im Auto. Mir tut der Kopf weh.«
»Geh weiter zurück. Schau dich um, Chloe. Was siehst du noch? Geh so weit zurück wie möglich, bis zum Beginn der Fahrt. Ich möchte, dass du zu dem Moment zurückgehst, als du die Schlüssel genommen hast und ins Auto gestiegen bist. Kannst du das für mich tun, Chloe? Kannst du versuchen, dich zu erinnern?«
Ich schrecke aus dem Schlaf. Als ich die Augen blinzelnd öffne, beugt mein Vater sich lächelnd über mich. Das Feuer im Kamin ist erloschen, nur die Asche glüht noch. Um mich herum ist es kalt und dunkel. Wie spät mag es sein? Wie lange habe ich hier wohl gelegen?
»Gut gemacht, Chloe. Wie fühlst du dich?«
Auf der Uhr im Wohnzimmer ist es kurz nach elf. Ich fühle mich duselig, beschwipst. Als hätte man mich unter Wasser getaucht. Ich habe mich in seiner Traumwelt verloren, in die er mich bei jeder Sitzung lullt. Ich fasse mir an den Verband am Kopf. Mein Vater nimmt meine Hand. Macht ein besorgtes Gesicht. »Was ist? Geht es dir nicht gut?«
»Ich bin eingeschlafen.« Ich setze mich auf, schaue erneut zur Uhr auf dem Kamin. Fast drei Stunden sind vergangen. Wieder denke ich an den Traum. An den Strand, den Pier, meinen rasenden Wagen und dann … Nichts. Woran habe ich mich noch erinnert? Ich weiß es nicht mehr. »Habe ich was gesagt? Habe ich im Schlaf geredet?«
»Ein bisschen. Nichts von Belang. Die meiste Zeit hast du dich ausgeruht. Zugehört. Aber du hast dich gut geschlagen, Chloe. Hast mir ein paar Einzelheiten verraten. Wie schnell du gefahren bist, wie das Wetter war. Die Informationen werden wichtig sein, wenn die Polizei mit dir sprechen wird.«
»Die Polizei? Wollen die noch immer mit mir sprechen?« Im Krankenhaus waren sie auch schon mal bei mir gewesen. Daran kann ich mich aber kaum erinnern, die ersten Wochen sind ein einziger Nebel.
Mein Vater erhebt sich, zieht sich das Hemd aus der Hose. Während ich geschlafen habe, hat er seine Arbeitskleidung gelockert. Die Krawatte abgelegt, das Hemd aufgeknöpft, sodass ein Büschel Brusthaar oben herausguckt. »Ja, irgendwann. Aber das hat keine Eile. Du scheinst dich nach wie vor nicht sehr gut an den Abend zu erinnern. Vielleicht ist das auch besser so. Es war ein schlimmer Unfall.« Mit seiner großen Hand streicht er mir über die feuchte Stirn. »Wie wär’s, wenn ich uns einen Kakao mache?« Er setzt sich in Bewegung. Mit bleischweren Armen stemme ich mich hoch. Bevor mein Vater das Zimmer verlässt, dreht er sich noch mal mit einem Lächeln zu mir um. »Das hast du heute großartig gemacht, Chloe. Ich bin sehr stolz auf dich.«
Kann ja sein, dass er stolz ist, aber irgendetwas stimmt hier nicht, stimmte auch von Anfang an nicht. Nach unserer letzten Therapiesitzung vor zwei Tagen habe ich ihn gefragt, ob er etwas vor mir verbirgt. Ich habe den Eindruck, dass etwas passiert ist, über das keiner sprechen will. Ich habe ihn gefragt, ob wir uns gestritten hätten und ich deshalb so schnell gefahren wäre. Doch mein Vater hat mir versichert, dass vorher alles gut gewesen sei. Ein schlimmer Unfall, verzerrt durch unfertige Erinnerungen.
Doch im Grunde meines Herzens weiß ich, dass er mich anlügt. In meinem Leben vor dem Unfall hat es etwas gegeben, das mir keiner sagen will. Ich spüre es in ihrem Schweigen, in meiner Einsamkeit. Meine Mutter und meine Schwester sind den ganzen Tag unterwegs, obwohl sie nirgends sein müssen. Und bis ich nicht genau weiß, was am Abend des Unfalls passiert ist, werde ich keine Fortschritte machen. Ich werde von einem Mann gefangen gehalten, der mir nicht die Wahrheit sagen will und der mich mit jeder Therapiesitzung weiter verwirrt.
Und wenn das stimmt, wenn ich damit recht habe, dann muss ich ganz allein herausfinden, was wirklich passiert ist.
Du wolltest ausbrechen, hast du gesagt. Allem entfliehen. Und was als Spiel begann, wurde bald sehr viel mehr. Statt bloß Spaß zusammen zu haben, wurde es ernst, wir haben es beide gespürt. Ich dachte, endlich geht es um uns. Doch so traurig mich das auch macht, muss ich mir eingestehen, dass es dir immer nur um dich ging.
Als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich gleich, dass es mit dir anders werden würde. Dass du anders bist. Ich habe es körperlich, in meiner Haltung, in meinen Bewegungen gespürt. Und ich habe mich gefragt, wann du mich wohl endlich anschauen wirst? Wie es wohl wäre, ein Mädchen wie dich zu berühren, zu liebkosen, deine Hände auf meiner Haut zu spüren? Für mich war es wie ein Traum, Chloe. Du warst der Traum. Ich hätte dich vom Fleck weg geheiratet.
Du hast zugesehen, wie ich mich in dich verliebe, hast mich glauben lassen, dass du mich auch liebst. Würdest du immer noch behaupten, mich zu lieben? Würdest du mir immer noch sagen, dass du nur an mich denkst? Weißt du noch, dass du mir ewige Liebe geschworen hast? Denkst du an mich, wenn du abends ins Bett gehst? Erinnerst du dich überhaupt noch an uns? Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass du mich vergessen hast. Mir bleibt nichts anderes übrig als zu warten. Warten, dass du dich wieder an uns erinnerst. Durch dich bin ich jetzt nichts weiter als ein armseliger Bettler, der sich mit leeren Versprechungen begnügen muss. Manchmal glaube ich, das war es jetzt für mich. Und manchmal hasse ich dich dafür, mein Liebling.
4.
Ich schlage die Augen auf, über mir das gequälte Gesicht meines Vaters. Ich bin schreiend erwacht. Im letzten Moment, in dem Tag und Nacht eins sind und man weder schläft noch wacht, habe ich mich selbst gehört. Die Falten meines Vaters sind tief wie tektonische Bruchstellen, seine Stimme schrill und alarmiert. Noch immer wirft sich der Regen gegen das Fenster und läuft in Strömen über die Scheibe, so wie der Schweiß über mein Gesicht. Kirchenglocken läuten den neuen Tag ein, den ersten des neuen Monats. Dezember, der letzte Monat im Jahr, wieder so ein Endpunkt.
»Chloe.« Er zieht mich zu sich heran, schlaff hänge ich in seinen Armen. »Es war nur ein Traum. Alles wieder gut.« Er streicht mir das feuchte Haar aus dem Gesicht und drückt mich an seine weiche, fleischige Brust. Durch die Berührung pocht mein Kopf. Mir schlägt ein starker Deo-Geruch entgegen, mein Vater ist frisch geduscht.
»Er ist ertrunken.« Ich versuche mich aus seiner Umarmung zu winden. Unsere Blicke treffen sich. Im fahlen Licht wirken seine Augen glasig, die Pupillen treten schwarz hervor wie bei einem Seehund. »Er ist ertrunken, und ich konnte ihn nicht retten.«
»Wer ist ertrunken?« Mein Vater schaut zu meiner Mutter, die soeben im Türrahmen erschienen ist.
»Weiß ich nicht. Ein Junge. Oh Gott, ich konnte ihn nicht retten.«
»Ach, Chloe, das war bloß ein Albtraum.« Mein Vater drückt mich noch fester an sich. »Du Arme.« Er legt mir die Hand auf den Kopf. »Du zitterst ja.«
Ich befreie mich endgültig aus seiner Umklammerung und stoße die Decke von mir. Trotz des Wetters glühe ich. Ich höre Jess kommen. Meine Mutter schickt sie weg.
»Ich bekomme keine Luft.« Ich stürme zum Fenster, reiße es auf und nehme einen tiefen Atemzug. Für meine Lunge ist die kalte Luft ein Schock.
Sofort steht mein Vater hinter mir, reibt mir über den Rücken. »Vor Träumen muss man sich nicht fürchten, Chloe.« Er scheucht meine Mutter fort, zögernd akzeptiert sie seine Anweisung. »Aber du musst dich ausruhen. Du musst langsam machen, das hat Dr. Gleeson extra gesagt. Besonders mit der Kopfverletzung. Spring nicht so eilig auf.« Mein Vater dirigiert mich zurück ins Bett, schüttelt die Kissen auf. Ich lasse mich von ihm zudecken. »Versuch einfach weiterzuschlafen.«
Nach den Sitzungen mit meinem Vater träume ich immer sehr lebhaft. Eben gerade von einem gesichtslosen Jungen, der unter der Seebrücke von Brighton ertrunken ist. Erst lief er den Strand entlang bis ins Wasser und ging dann zwischen den Brückenpfeilern unter. Ich bin zum Wasser gerannt, habe mich nicht reingetraut, wollte ihn retten, war aber machtlos. Ein paar Nächte zuvor war ich in eine Verfolgungsjagd verwickelt gewesen. Verzweifelt hatte ich versucht, das Auto vor mir einzuholen. Das Gesicht des Jungen hatte ich auch da nicht sehen können. Nur seinen Körper, kurz bevor ich wach wurde. Im Wald. Blutüberströmt.
Als ich endlich nach unten gehe, sind meine Eltern beide schon weg. Ich bin so neidisch, dass sie einfach nach Lust und Laune kommen und gehen können. Jess ist in der Küche, in den Händen hält sie einen Teebecher.
»Guten Morgen«, sagt sie lächelnd. »Geht es dir gut?«
Schon von dieser einfachen Frage bin ich vollkommen überfordert. Geht es mir gut? Keine Ahnung. Ich weiß ja kaum, wer ich bin oder was ich hier soll. Ich fühle mich wie eine Pappfigur meines früheren Selbst.
»Weiß nicht so genau.« Jess lächelt und deutet auf einen Stuhl. Ich setze mich. »Ist alles noch etwas verwirrend.«
Eigentlich geht Jess von den dreien am entspanntesten mit mir um. Als ich am ersten Tag ins Haus trat und keinen Schimmer hatte, wie ich mich in dieser fremden Umgebung verhalten sollte, hat Jess mir geholfen, die Jacke auszuziehen. Dann habe ich mir mühsam die Turnschuhe abgestreift und sie hochgehalten. »Wo soll ich die hinstellen?«
Erst hat sie mich verdutzt angesehen, als würde sie die Frage nicht verstehen, dann nahm sie mir die Schuhe ab und schleuderte sie unter den runden Tisch, der mitten in der großen Eingangshalle steht. »Du bist doch kein Besuch«, sagte sie mit einem traurigen Lächeln auf den Lippen. Ich wusste nicht, wie ich ihr vermitteln sollte, dass ich mich aber genau so fühlte. Dieses Haus und dieses Leben waren mir fremd. Wie sollte ich mich sonst verhalten?
»Natürlich ist es verwirrend«, sagt sie jetzt. »Du kannst nicht erwarten, vom Koma direkt in dein altes Leben zurückzufinden.« Allein das Wort schreckt mich. Koma. Es sind nur vier Buchstaben, aber die erscheinen riesig. »Du schaffst das schon. Du musst dir einfach Zeit lassen.« Verlegen wendet sie den Blick ab. »Jedenfalls sagt Dad das immer.«
»Mir kommt alles so fremd vor. Ich würde so gerne mal hier raus, wenigstens einen Spaziergang machen. Vielleicht erkenne ich ja was wieder. Im Haus fällt mir noch die Decke auf den Kopf.«
Jess steht auf und stellt die Tasse ab. »Keiner da, der dich aufhalten könnte. Wollen wir zusammen gehen?«
»Dad meinte doch, ich soll nicht.«
»Ja, aber Dad ist nicht da.« Jess zwinkert mir zu. »Außerdem bin ich ja dabei. Ich passe auf dich auf.«
Wir ziehen uns Mäntel über und verlassen das Haus. Draußen ist es ungemütlich und kalt, sofort sind Locken und Wollmütze klamm. Jess und ich laufen nebeneinander die Auffahrt hoch, die Sicht ist so schlecht, dass wir nicht einmal die Bäume erkennen können. Als wir ans Tor kommen, versuche ich mir die Zahlenkombination einzuprägen, die meine Schwester eingibt. Ich sage mir die Zahlen immer wieder vor. Mit leisem Piepen öffnet sich das Tor. Nachdem wir durchgegangen sind, schließt Jess es wieder. Vier Zahlen. Mehr nicht. Wir haben das Grundstück verlassen und laufen Richtung Rusperford.
Unterwegs erzählt mir Jess von ihrem Chemiediplom, explosiven Experimenten und davon, dass sie forensische Toxikologin werden möchte. Von einem Jungen, von dem sie sich wohl trennt, wenn sie nach Weihnachten wieder zurück an die Uni geht. Doch ich höre nur mit halbem Ohr hin. Ich achte mehr auf die Bäume und die Straße, warte darauf, dass das Dorf in den Blick rückt. Durch den Spaziergang fühle ich mich befreit, gerade tut mir auch gar nichts weh. Rechts kommen eine Kirche und ein Friedhof in Sicht, schemenhaft taucht ein Ehrenmal auf. Meine Welt wächst. Gegenüber liegt ein Hotel, von dem allerdings nur das Eingangsschild an der Einfahrt zu sehen ist. Bin ich da früher schon mal gewesen? Vielleicht. Ich zeige zum Hotel.
»Manchmal sind wir da zu Weihnachten hingegangen«, sagt Jess. »Als es zwischen Mum und Dad noch unkomplizierter war.« Ich schaue hinüber zum Hotel, das im Nebel liegt. Bislang ist es bloß ein Gedanke, eine Ahnung. Eher eine Illusion, die sich wie der Nebel jederzeit in Luft auflösen kann. Ich könnte Jess nichts über das Hotel erzählen, also nichts über die Einrichtung, und ich hätte auch keine lustige Anekdote parat, wie sich Dad mal an einer Gräte verschluckt hat. Was Konkretes weiß ich nicht, verstehe nicht mal Jess’ Kommentar über Mum und Dad. Doch erstmalig spüre ich meine Vergangenheit. Schweigend setzen wir unseren Weg fort, ich will mehr sehen.
Als wir uns dem Dorfkern nähern, wird mir klar, dass wir auf dem Weg vom Krankenhaus hier vorbeigekommen sind, dennoch habe ich das Gefühl, dass ich seit Jahren nicht mehr hier war. Es gibt einen Gebrauchtwagenhändler und weiter die Straße hinauf einen Frisörsalon. Einen kleinen Park mit einem Ententeich, über dem eine Dunstglocke hängt. Die Straße, der wir folgen, führt am Wald entlang. Obwohl ich erst zehn Minuten gelaufen bin und Jess mich untergehakt hat, melden sich meine Verletzungen schon. Mein Bein tut weh, und unter der Wollmütze pocht der Kopf immer stärker. Meinen Gehstock habe ich zu Hause gelassen, ich wollte mal sehen, ob es auch ohne geht. Wieder ein Test, durch den ich gerasselt bin.
Ich muss eine Verschnaufpause einlegen und halte mich an der Pforte zu einem Spielplatz fest. Als ich über das nasse Gras zu den Schaukeln blicke, habe ich das Gefühl, meine Lunge wollte jeden Moment explodieren. Atemwölkchen steigen vor mir auf, als ich gierig nach Luft schnappe. Die Feuchtigkeit hängt selbst in den Bäumen, wie kleine Juwelen hängen die Wassertropfen an den Ästen. Neben den Spielgeräten steht eine Holzhütte, außerdem gibt es noch eine Rutsche und eine Bank.
Und in dem Moment habe ich ein ganz klares Bild vor Augen, wie ich auf einer ganz ähnlichen Bank sitze. Ich warte auf etwas, auf jemanden vielleicht. Ich bin so zappelig, dass ich mich auf meine Hände setzen muss. Es ist Sommer, die warme Brise trägt den Duft von Rosen herbei. Doch dann hakt sich Jess bei mir unter, und das Bild ist genauso schnell verschwunden, wie es gekommen ist.
»Als Kinder waren wir oft hier«, sagt Jess. Erst reagiere ich gar nicht, weil ich in Gedanken noch ganz bei der Bank bin. Was hat diese Bank mit der in meiner Vorstellung gemein? Ist es eine Erinnerung? Wenn ja, von wann und woher? »Weißt du noch?«, fragt Jess.
»Nicht so richtig. Mir geht alles Mögliche durch den Kopf, das ich mir nicht erklären kann. Ich wünschte, ich würde mich an was erinnern, das mir hilft. Was Konkretes.«
»Vielleicht kann ich ja helfen.« Jess zuckt die Achseln. »Also, wenn du das Gefühl hast, du kannst dich mir anvertrauen. Früher war es so. Früher standen wir uns nah.«
Ich denke an die Bilder aus dem Fotoalbum: Jess und ich in aller Eintracht. Dagegen jetzt das fremde Gefühl, wenn sie mich berührt. Wenn wir uns nahestanden, dann in einem anderen Leben. Ich war eine andere.
»Ich kann das nicht, Jess. Mir fällt es schwer, mich Leuten zu öffnen, die …« Ich bremse mich, denn ich möchte sie nicht kränken, wo sie doch so nett war und mich gegen den Willen unseres Vaters nach draußen gebracht hat.
»Die du nicht kennst?« Beschämt nicke ich. Zum Glück nimmt Jess es nicht persönlich. »Auch wenn du dich nicht an mich erinnern kannst, kann ich mich an dich erinnern, Chloe. Vielleicht gibt es Dinge, die dich interessieren, über die wir schon mal geredet haben. Vielleicht hilft dir unsere gemeinsame Vergangenheit dabei herauszufinden, wer du warst …« Nun ist Jess verlegen. Ihr steigt die Röte in die Wangen. »Bist, meine ich. Wer du bist, Chloe.«
Sie spielt mit dem Türgriff der Pforte, kratzt mit dem Nagel an der Farbe. Selbst Jess begreift, dass es die alte Chloe nicht mehr gibt. Ich habe immer geglaubt, es gäbe einen klaren Unterschied zwischen Leben und Tod, entweder oder. Nun weiß ich, dass man am Leben sein und sich trotzdem von der Welt völlig abgeschnitten fühlen kann.
»Na, jedenfalls kann ich dir ganz bestimmt helfen. Du musst mir nur eine Chance geben.«
Ich schaue auf. Könnte sie recht haben? »Echt? Wir waren uns also nah?« Schwer vorstellbar, dass ich mich an all das gar nicht mehr erinnere. Aber wenn ich den Mut habe, mich ihr zu öffnen, kann sie mir vielleicht wirklich helfen, etwas über die Frau zu erfahren, die ich war – und noch bin?
»Wir hatten Vertrauen zueinander. Haben uns Dinge gesagt, über die wir sonst mit niemandem gesprochen haben. Wenigstens bevor du zu Hause ausgezogen bist.« Mit einem Lächeln schwingt sie sich auf die Pforte, die unter ihrem Gewicht scheppert. Das einzige Geräusch, das die Stille durchbricht. »Dinge, die Dad nicht wissen durfte.«
»Okay.« Ich lasse den Blick über die Spielgeräte schweifen. »Ich habe das Gefühl, Dad verheimlicht mir was. Dass vor dem Unfall was passiert ist, an das ich mich möglichst nicht erinnern soll. Kannst du dir das erklären?«
Jess schüttelt den Kopf. »Ich dachte eher daran, dass du dir stundenlang Wiederholungen von Friends angeschaut hast oder dass du einen ganzen Becher Eis auf einmal essen konntest. So was in der Art.«
Weitere sinnlose Fakten. »Mir geht es aber um Dad.« Leicht fällt es mir nicht, den nächsten Gedanken laut auszusprechen. Ich atme einmal tief durch. »Er macht mir Angst, Jess. Ich habe immer wieder die gleichen Träume, und ich bin überzeugt, dass sie mit dem Unfall zu tun haben, aber Dad geht nicht darauf ein. Ich träume von einem Jungen. Erst habe ich ihn mit einem Auto gejagt, dann wieder ist er im Meer verschollen. Einmal wurde er lebendig begraben.« Das hatte ich noch im Krankenhaus geträumt. »Ich fürchte, dass was Schreckliches passiert ist.«
»Ist es auch, Chloe. Du hast dein Gedächtnis verloren. Und das ist schrecklich.« Jess springt von der Pforte und hakt mich wieder unter.
»Ich glaube, es steckt mehr dahinter.« Mit der Zunge fahre ich mir über die kalten, rissigen Lippen. »Bitte sag’s mir, Jess. Habe ich bei dem Unfall jemanden verletzt? Habe ich jemanden überfahren?«
Eine Weile schweigt sie, und ihr treten die Tränen in die Augen. Jess streichelt mir über die Wange. Auch wenn sie bestimmt zehn Jahre jünger ist als ich, kommt sie mir gerade viel älter vor. »Meinst du nicht, wir hätten es dir längst gesagt, wenn so was passiert wäre?«
»Nicht, wenn Dad es euch verboten hat. Sei ehrlich. Wenn du was weißt, sag es mir.«
»Chloe, es war einfach ein schrecklicher Unfall, mehr nicht. Es hat geregnet, und die Stelle, an der du verunglückt bist, ist bekanntermaßen gefährlich.«
In dem Augenblick komme ich mir so dämlich vor, so hilflos und naiv. Wenn man sich selbst nicht traut, wie soll man da anderen trauen? »Wahrscheinlich hast du recht.«
»Dad ist schwierig, das stimmt, aber er hätte dir doch garantiert was gesagt. Nun komm, ich will dich nicht zu sehr erschöpfen. Zu Hause setze ich Tee auf, dann machen wir es uns gemütlich und schauen ein paar Folgen Friends.«
Jess stützt mich wieder, sodass ich das verletzte Bein schonen kann. Beim nächsten Mal muss ich unbedingt den Stock mitnehmen.
Auf halbem Weg kommt uns eine junge Frau entgegen, sie hat es eilig und schiebt einen Buggy vor sich her. Darin strampelt ein kleiner blonder Junge, wie der Junge in meinen Träumen. Und als die Frau an uns vorbeigeht, starre ich diesen kleinen Jungen an, als wäre er alles, was ich mir je gewünscht habe.
5.
Als wir nach Hause kommen, gehe ich direkt nach oben in mein Zimmer. Dort öffne ich die Nachttischschublade und hole einen Stift und eine alte Bibel hervor. Im Buchdeckel steht mein Name, den ich irgendwann mal da hineingeschrieben haben muss: Chloe Daniels. Als ich durch die Bibel blättere, entsteht vor meinem inneren Auge ein Bild, wie ich irgendwann mal in einer Kirche gestanden und gesungen habe, während im Hintergrund ein Baby schrie. Ist das eine Erinnerung, oder spielen mir meine Gedanken einen Streich? Keine Ahnung. Ich packe den Stift und setze ihn mit viel Druck auf das Papier. Nachdem ich den Code aufgeschrieben habe, kritzle ich die Seite mit meinem Namen voll. Die Buchstaben sind wacklig wie bei einem Kind. Aber es ist mein Name. Das zählt. Chloe. Ich. Noch da. Kurz darauf schlafe ich ein.
Stunden später werde ich vom Motorengeräusch eines Wagens wach. Ich stehe auf und mache das Fenster einen Spaltbreit auf, um sehen zu können, wer gekommen ist. In der Einfahrt steht der weiße Land Rover meiner Mutter, der aus der Werkstatt zurück ist. Meine Mutter hastet über den gefrorenen Boden. Der Wind spielt mit den schweren Blumenvorhängen, und mich fröstelt in der leichten Baumwollbluse, also schließe ich schnell das Fenster. Ich muss mir etwas überziehen.
Im Schrank befinden sich lauter Sachen, die mir nicht gehören, entweder hat meine Mutter sie aussortiert oder Jess. Abgelegte Klamotten, die sonst von der großen zur kleinen Schwester wandern. Mir gefällt nichts im Schrank, weil mir nichts gehört.
Unter dem Bett steht einen Tasche, der Griff lugt hervor, seit Mum sie gestern hervorgezerrt hat. Ich schnappe mir die Tasche und stelle sie aufs Bett. Ziehe den Reißverschluss auf, schaue hinein.
Jeans, T-Shirts, ein paar schlichte graue Pullis. Nichts kommt mir auf Anhieb bekannt vor. Ein Schlafanzug, den ich im Krankenhaus getragen habe, innen am linken Ärmel noch ein Tropfen Blut vom Wechseln der Kanüle. Ich versuche mich an die Zeit im Krankenhaus zurückzuerinnern, stelle mir vor, wie ich den Schlafanzug getragen habe. Selbst diese Tage habe ich nur noch schemenhaft vor Augen.
Ich wühle tiefer in der Tasche und fördere ein weiteres Fotoalbum zutage, das meine Mutter für mich gemacht hat, um mir das Gefühl zu geben, Teil der Familie zu sein. Ich klettere ins Bett und schaue mir Seite für Seite an. Auf den ersten Bildern spiele ich als Kind im Garten, angle im Fluss, trage einen Kranz aus Gänseblümchen, den ich wohl selbst geflochten habe. Andere Bilder sind im Urlaub geschossen, ich posiere am Strand, im grünblauen Badeanzug mit Abzeichen für meine Schwimmkünste.
Im Laufe des Albums werde ich älter, ich blättere zur Teenagerzeit vor, wo ich mich dann nicht mehr so gerne habe fotografieren lassen. Auf fast allen Bildern aus der Zeit lächle ich albern in die Kamera, geniere mich. Mein Haar ist viel heller, entweder von der Sonne oder ich habe nachgeholfen. Ich sehe ein wenig aus wie Jess. Da ist ein Bild von der Abschlussfeier an der Uni. Rechts und links neben mir meine Eltern, vor meiner Mutter die kleine Jess, die vielleicht erst neun ist. Wer hat das Bild wohl gemacht? Ein liebenswürdiger Fremder oder jemand aus meiner Vergangenheit, den ich vergessen habe?
Das letzte Bild von meiner Abschlussfeier ist verrutscht. Darunter lugt die Ecke eines weiteren Fotos hervor. Ich pule die Selbstklebefolie ab und ziehe das Foto heraus. Darauf sitze ich in der Küche und esse ein Stück Kuchen. An meinen Stuhl ist ein Luftballon gebunden, Jess steht neben mir und schneidet eine Grimasse. In der Hand hält sie ein Messer, und vor ihr steht ein Geburtstagskuchen. Ich zähle die Kerzen. Fünfzehn. Fünf Jahre her also. Mum ist auch in der Küche, werkelt an der Arbeitsplatte, neben ihr ein Glas Wein. Mein Blick kehrt immer wieder zu zwei Details zurück, die überhaupt keinen Sinn ergeben.
Erstens trage ich einen Ring, einen schlichten Goldring an der linken Hand, der im Blitzlicht funkelt. Er sieht aus wie ein Ehering. Und zweitens habe ich einen kleinen Jungen auf dem Schoß. Die Arme fest um ihn geschlungen, das Kinn in seinem Nacken vergraben.
Donner rollt über den wolkenschweren grauen Himmel, als ich mir den Ringfinger der linken Hand anschaue. Die Haut am Finger ist trocken, und er ist ein wenig dünner als sein rechtes Pendant. Habe ich einen Ring getragen? War ich verheiratet? Bin ich verheiratet? Wenn ja, wo zum Teufel steckt mein Mann? Und wer ist dieser kleine Junge? Ist es der Junge aus meinen Träumen?
Als ich mich nach unten begebe, regnet es inzwischen heftig, wellenartig strömen Schauer übers Küchenfenster, malen wilde Schatten an die Wände. Vom Spaziergang heute Morgen tut mir das Bein weh, außerdem brummt mir der Schädel. Ich rufe nach Mum, dann nach Jess. Als keiner antwortet, setze ich mich an den Tisch und warte. Das Licht nimmt weiter ab, trotz der frühen Stunde senkt sich die Dunkelheit über das Land, hinterlässt den kalten Glanz eines heraufziehenden Sturms. Und dann sehe ich meine Mutter, die vom Schauer überrascht mit der Reitjacke über dem Kopf über den gewundenen Gartenweg gerannt kommt. Offenbar war sie bei den Pferden in den Ställen hinter dem Haus.
So stürmt sie durch die Hintertür, schreit auf, als kalter Regen ihr den Rücken hinunterrinnt. Lachend zieht sie die Tür hinter sich zu. Als sie sich umdreht und mich sieht, bekommt sie fast einen Herzinfarkt.
»Chloe!«, kreischt sie. Dann schüttelt sie sich das Wasser von der Jacke. »Du hast mich vielleicht erschreckt. Jess meinte, du schläfst.«
»Ich bin aufgewacht. Ich habe mir die Fotos angesehen, die du mir ins Krankenhaus mitgebracht hat. Eines der Alben, das du für mich zusammengestellt hast.«
»Ach ja?« Mum verschließt die Hintertür, hängt ihre Reitjacke über einen schwarzen Eisenhaken. »Hast du was Neues für dich herausgefunden?« Sie lässt sich auf einer kleinen Bank nieder und zieht ihre schlammigen Stiefel aus. Bevor sie sich zu mir an den Tisch gesellt, setzt sie noch Wasser auf.