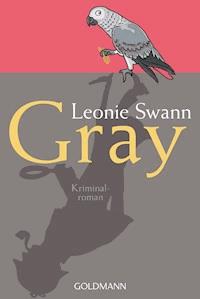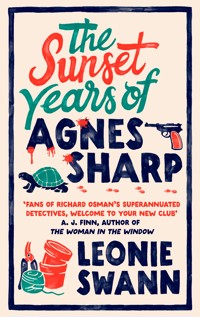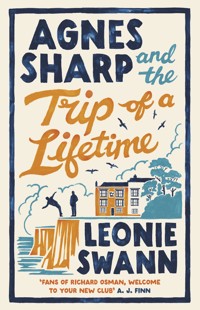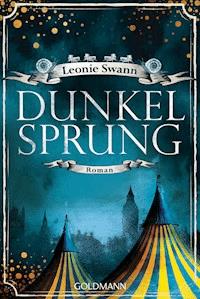
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein Flohzirkus in London, eine verwunschene Villa
in Yorkshire und eine geheimnisvolle Meerjungfrau –
entdecken Sie eine ganz neue Welt!
Julius Birdwell, Goldschmiedemeister, Flohdompteur und unfreiwilliger Einbruchkünstler, wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich eine ruhige, unbescholtene Existenz führen zu können. Doch als seine Flohartisten einem plötzlichen Nachtfrost zum Opfer fallen und die geheimnisvolle Elizabeth Thorn in sein Leben tritt, überstürzen sich die Ereignisse. Ein Magier wird ohnmächtig, eine alte Dame macht sich in einem gestohlenen Lastwagen davon, ein Detektiv mit Konzentrationsstörungen findet zu einem ungewöhnlichen Haustier, und Julius sieht sich auf einmal mit existentiellen Fragen konfrontiert: Wie befreit man eine Meerjungfrau? Wie viele Flöhe passen auf eine Nadelspitze? Und warum ist das Leben trotz allem kein Märchen? Julius bleibt nichts anderes übrig, als sich weit über den Tellerrand seiner Welt hinauszulehnen und den Sprung ins Unbekannte zu wagen. Ein phantastisches Abenteuer beginnt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Text zum Buch
Julius Birdwell, Goldschmiedemeister, Flohdompteur und unfreiwilliger Einbruchkünstler, wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich eine ruhige, unbescholtene Existenz führen zu können. Doch als seine Flohartisten einem plötzlichen Nachtfrost zum Opfer fallen und die geheimnisvolle Elizabeth Thorn in sein Leben tritt, überstürzen sich die Ereignisse. Ein Magier wird ohnmächtig, eine alte Dame macht sich in einem gestohlenen Lastwagen davon, ein Detektiv mit Konzentrationsstörungen findet zu einem ungewöhnlichen Haustier, und Julius sieht sich auf einmal mit existenziellen Fragen konfrontiert: Wie befreit man eine Meerjungfrau? Wie viele Flöhe passen auf eine Nadelspitze? Und warum ist das Leben trotz allem kein Märchen? Julius bleibt nichts anderes übrig, als sich weit über denTellerrand seinerWelt hinauszulehnen und den Sprung ins Unbekannte zu wagen. Ein phantastisches Abenteuer beginnt …
Weitere Informationen zu Leonie Swann sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Leonie Swann
Dunkelsprung
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Originalausgabe1.Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2014 by Leonie Swann
Copyright © der Originalausgabe November 2014
by Wilhelm GoldmannVerlag, München,
in derVerlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung: UnoWerbeagentur, München
Covermotiv: FinePic®, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-15152-2V004
www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den GoldmannVerlag im Netz
Dramatis Creaturae
Julius Birdwell – Goldschmied und Flohdompteur
Elizabeth Thorn – eine Dame mit Mütze und Plan
Frank Green – Privatdetektiv mit dunklerVergangenheit
Das Legulas – ein grünesWesen mit gesundem Appetit
Lazarus Dunkelsprung – Albinofloh, der Star von Julius’Truppe
Marie Antoinette
Zarathustra
Oberon
Tesla
Lear – Julius’ Flohartisten
Faust
Freud
Cleopatra
Madame P.
Spartacus
Professor Isaac Fawkes – Magier
Thistle – doch kein Mädchen
Hunch – ein Typ mit Bogarthut
Rose Dawn – eine ältere Dame mitVergangenheit
Emily – ein altes Mädchen ohne Zukunft
Mr. Fox
Die Schneckenfrau – Emilys Gäste
Mr. Hong
Odette Rothfield – eine Lady mit Geschmack und rotem Haar
Alisdair Aulisch – Vergessenstherapeut
Five-Finger-Fred – ein Gangster
Pete – ein Mann mit Hund und Hausboot
Mary – Luftsockenstrickerin
Claire Weathervane – eine Nachbarin
Nick – ein Ganove
Wilson – ein Unterganove
Hieronymus – Automat
Napoleon Luciferretti – keine große Leuchte
Der Mwagdu – wer weiß?
Even educated fleas do it …
Cole Porter
Hey! Hey Du!Genau!komm Näher!Sei nicht schüchtern… Wir Beißen nicht!
Vorspiel
Ein blauer Samtvorhang teilt sich, eine weiß behandschuhte Hand nimmt unser Ticket entgegen. Ein Wink, ein Lächeln, fast zu vertraulich. Wir flüchten an dem Kartenabreißer vorbei, hinein ins Foyer, wo schon andere Theatergäste warten, herausgeputzt, verlegen, fehl am Platz zwischen grellen Neonröhren und milchigen Spiegeln. Flüstern. Man weicht Blicken aus. Eine Zaubershow in einem Hinterhoftheater, nichts Besonderes eigentlich, und dennoch … dennoch … Der Eintrittspreis ist zu saftig, die Stunde zu spät, und wären da nicht die handschriftliche Einladung und all die Dinge, die einem Freunde und Kollegen erzählt haben …
Aber da sind die Dinge.
Gerüchte von Gerüchten.Wunder. Unbeschreibliches, nie Geahntes.
Nichts Genaues natürlich. Eigentlich gar nichts.
Geh nur selbst.
Du wirst schon sehen.
Nun gut.
Sehen wir also …
Im Zuschauerraum ist es dunkel, so dunkel, dass man kaum seinen Platz finden kann oder seinen Sitznachbarn erkennen. So dunkel, als wäre man allein. Ein seltsamer Geruch herrscht, erdig und wild und saftig wie einWald und gleich darunter ein bittererTon wie von giftigen Blumen. Im Schutze der Dunkelheit schleicht sich dieser Duft in jede Ecke unseres Bewusstseins.
Plötzlich ertönt laute Rockmusik. Das Publikum fährt zusammen.
I can’t get no – sa-tis-fac-tion.
Dann ist die Bühne zu sehen, in flackerndes Licht getaucht wie von einem sterbenden Feuer.Auf der Bühne ein Mann in einem bodenlangen roten Mantel. Makellose Haltung, orientalischer Hut. Ringe an den Fingern. Dunkle, bohrende Augen.
Das wird dann wohl dieser Professor Fawkes sein.
Der große Professor Fawkes.
Besonders groß ist er ja nicht.
Fawkes lässt sich den roten Zirkusmantel von den Schultern gleiten. Darunter trägt er Jeans und ein Muskelshirt. Und Muskeln. Er lächelt leise. Es ist, als würde er sich über uns und unsere Erwartungen und vielleicht auch über sich selbst ein wenig lustig machen.
Fawkes schlägt aus dem Stand drei Saltos, perfekt ausgeführt, ohne dabei den orientalischen Hut zu verlieren.
Dann steht er still und verbeugt sich. Die Musik bricht ab.
Zögernd plätschert Applaus durch den Raum.
Die eigentlicheVorstellung beginnt damit, dass der große Fawkes auf einmal weg ist. Nicht verpufft, mit Hilfe von Blitz, Donner, Nebel und Bühnenmaschinerie, einfach nur weg.
Dafür steht ein großer Blumentopf auf der Bühne. Der Blumentopf ist wirklich groß.
Dann nichts.
Noch immer nichts.
Genau in dem Moment, in dem das Publikum anfängt, unruhig zu werden, regt sich auf einmal etwas in demTopf, grün und windend. Eine Schlange? Ein Keim!
Der Keim entfaltet sich, erste Blätter glänzen, frisches grünes Laub sucht tastend denWeg nach oben, höher und höher, ein Baum entsteht, die Blätter ständig bewegt, blind suchend. Ein seltsames, elastisches Knistern erfüllt den Raum.
Auf der Bühne ist es Frühling geworden.
Knospen sprießen, Blüten öffnen sich. Nachtschwarze Bienen tanzen trunken von Blüte zu Blüte, Früchte wachsen, seltsam glatt und kalkig und weiß. Niemand hat je solche Früchte gesehen, und als der Bühnensommer sich seinerVollendung zuneigt, kann man erkennen, dass der Baum nicht wirklich Früchte trägt, sondern Eier.Aus den Eiern schlüpfen nach und nach weiße Vögel, keck und anmutig, spatzenhaft.
Plötzlich wirbelt Fawkes wieder auf die Bühne. Er pflückt einige der noch nicht völlig gereiften Eierfrüchte und beginnt damit zu jonglieren, drei, fünf, sieben, neun, schwindelerregend schnell. Noch während er jongliert, schlüpfen die Vögel und schwingen sich in die Luft. Endlich ist nur noch ein einziges Ei übrig, dann keines. Vögel schwirren durch den Raum und machen Jagd auf die Nachtbienen.
Fast unbemerkt sind die Blätter des Baumes inzwischen golden geworden, ein kühler Wind weht von nirgendwoher, Blätter fallen und tanzen in Wirbeln über die Bühne.
Die Vögel sammeln sich zu einem Schwarm, kreisen, steigen höher und höher.
Fawkes klatscht in die Hände, ein unnatürlich lauter Knall. Die Vögel sind verschwunden, weiße Federn fallen wie Schnee, der Baum steht kahl.
Der Professor haucht in seine Hände, so als wolle er sie wärmen, zwinkert uns zu und verbeugt sich.
Wir sind zu benommen für einen vernünftigen Applaus.
So geht es weiter,Wunder umWunder, Rehe und Kaninchen, Feuer und Eis, zu viel, zu schnell, zu unglaublich, um sich wirklich an etwas festhalten zu können.
Hinterher wird uns alles wie einTraum vorkommen, aber ein Moment bleibt im Gedächtnis, klar und kalt wieWasser: Leuchtende Luftquallen, die nach Quallenart ziellos durch den Raum schweben, schon vergessen, woher. Ihre Berührung hinterlässt fluoreszierende Male auf der Haut, seltsam kühl und angenehm, pulsierend und verblassend.
Als wir unsere Aufmerksamkeit wieder der Bühne zuwenden, ist da eine Frau, erhöht auf einem Gerüst. Ein dunkler Mantel umspielt ihre Gestalt. Ihr Gesicht ist glatt wie einTeich, ihr Haar eineWolke aus Licht.
Sie klammert sich an dem Gerüst fest, wie um sich zu stützen. In ihrem Haar bewegt sich etwas, eine kleine Schlange, nein, ein zierlicher Oktopusarm, der sich nervös kräuselt.
Die Frau lässt das Gerüst los und hält sich einen Moment lang aufrecht, leise schwankend. Dann fällt sie. Sie wird sich beim Aufprall verletzen, aber auf der Bühne steht auf einmal ein großer gläsernerWassertank, und die Frau taucht hinein. Ihr Mantel ist verschwunden, aber seltsamerweise kann sich nachher niemand mehr daran erinnern, ob sie darunter nun nackt war oder nicht. Ein Fischschwanz? Vielleicht …
DasWunderbare, das wirklich Unglaubliche ist, dass die Frau nicht wieder auftaucht. Luftperlen sind in ihrem Haar gefangen, aber sie scheint nicht zu atmen. Fawkes legt einen stabil aussehenden Stahldeckel über denTank. Der Deckel wird mit Riegeln und Schlössern fixiert.
Das Publikum stöhnt.
Dann vergehen quälend lange Minuten, in denen die Frau einfach nur durch denTank schwebt, den Oktopusarm nun animierter, das Gesicht leuchtend und still.
Eine kleine Ewigkeit.
Diese Nummer endet nicht wie üblich damit, dass die Dame triumphierend ihrem Gefängnis entsteigt, nein, auf eine Geste Fawkes’ hin rollen einige Assistenten denTank einfach hinter einenVorhang.
Fawkes wirbelt noch einmal radschlagend über die Bühne, dann kniet er da, schweißglänzend, die Arme weit ausgebreitet, auf den Lippen wieder sein halbes Lächeln.
Es sind natürlich alles nurTricks. Es müssenTricks sein. Doch was fürTricks!
Wir verlassen dieVorstellung stumm vor Staunen, trunken vonWundern, betört von Licht und Schatten, schlafwandelnd und mondsüchtig.
Was für ein origineller Typ dieser Fawkes doch ist! Wie fit und klug. Wie cool! Wir wollen ihm folgen, auf Facebook und Twitter und vielleicht sogar persönlich. Ob es einen Fanclub gibt? Ob man für ihn arbeiten kann? Oder wenigstens ein Autogramm?
Doch da ist mehr.
Unsere Blicke streifen die Assistenten des Professors, die im Foyer Getränke anbieten und Nachtbienenhonig verkaufen, und finden unerwartete Dinge: einen Huf, einen Schweif, glänzende braune Augen, schöne angelegte Rehohren, wo eigentlich nur Haar sein sollte. Wir wünschen und ahnen und hoffen auf einmal, dass dies alles vielleicht doch viel mehr ist als nur einTrick.
Leute in Abendgarderobe taumeln verzückt durch das Foyer, kaufen Gläser schwarzen Nachtbienenhonigs, Programmhefte und Fliedersekt. Wir versuchen, den rehohrigen Assistenten Geld zuzustecken, damit sie uns hinter die Bühne lassen.Vergebens. Ergriffen von einer ArtVerzweiflung stellen wir der »Fawkes Stiftung für das Unnatürlich-Natürliche« einen stattlichen Scheck aus. Zwei Herren im Smoking bewerfen sich gegenseitig mit Geldscheinen, um das letzte Programmheft zu erringen.
Mehr! Mehr! Wir wollen mehr tun, mehr geben. Vielleicht braucht der Professor ja noch einen Mäzen, einen Hilfsarbeiter, einen Sklaven?
Doch dann verlöschen eines nach dem anderen die Lichter, Samtvorhänge werden aufgezogen, Hände schieben uns sanft, aber bestimmt Richtung Tür in einen kalten, nassen Hinterhof.
Wir treten widerwillig nach draußen, die Hände voll Honig, die Seele voll Staunen, in den Regen.
Spät im September
Das Hausboot liegt im Morgennebel wie etwas Lebendiges, ein gestrandeterWal vielleicht oder eine faule Robbe, reglos, aber wach.Aufmerksam.Wartend.
»Mr. Birdwell? Julius Birdwell?«
Nichts. Draußen auf dem Kanal fliegt eine Ente auf.
Dave überprüft noch einmal die Bootsnummer, dann geht er über den schwankenden Holzsteg an Bord und klopft in Ermangelung einer Haustüre an eines der verbarrikadierten Fenster.
»Hallo? Halllooo? Mr. Birdwell?«
Weiter hinten an Deck öffnet sich plötzlich eine Klappe.
»Komm rein!«
»Ich komme von Joe, Sir, ich habe eine Lieferung für …«
»Jaja, komm rein, sage ich!«
Joe hat ihn gewarnt, dass der Job kein Zuckerschlecken ist, also fasst sich Dave ein Herz, taucht durch die niedrige Tür ins Innere des Bootes, macht einen Schritt – und steht auf einmal im Dunkeln.
Verdammt!
»Hallo? Mein Name ist Dave Collins, ich habe eine Lieferung für Julius Birdwell. Sind … sind Sie das?«
Kein Laut. Nur sein eigener Herzschlag.
»Mr. Birdwell?«
»Wo ist Joe?«
»Krank. Blinddarm. Pech, was? Ich … ich mache den Job, bis er wieder auf den Beinen ist.« Daves Stimme klingt piepsig.Warum klingt er immer so piepsig, wenn es darauf ankommt?
»Und du hast den Stoff?«
»Natürlich!« Dave hält die Hand mit dem Päckchen vor sich hin.
Wieder diese Stille. Sein Herz klopft noch lauter. Er hat keine Illusionen darüber, dass das, was er da ausliefert, nicht ganz legal ist. Keine richtigen Drogen, wie ihm Joe versichert hat, eher … Medikamente. Medikamente, die der Doktor seinen Kunden nicht verschreiben will und an die Joe als Sanitäter leicht herankommt.
Alles harmlose Typen, hat Joe gesagt, ein bisschen schräg vielleicht, aber solide. Na toll! Und jetzt steht Dave hier im Dunkeln mit irgendeinem irren Junkie!
»Weißt du, was da drin ist?«, fragt eine Stimme hinter ihm, näher, als ihm lieb ist.
Dave schüttelt den Kopf, aber natürlich hat er doch geguckt: Blutkonserven.Verschiedene Blutgruppen. Und frischer Fisch vom Billingsgate-Fischmarkt. Den Fisch hat Dave nach Joes Anweisungen selbst besorgt.
Fisch?
Joe hatte mit den Achseln gezuckt. Jeden Montag und Mittwoch. Solange er zahlt, stelle ich keine Fragen, und du solltest auch keine stellen.
Also hält Dave einfach nur weiter die Tüte mit Blut und Fisch vor sich hin und hofft darauf, dass alles bald vorbei sein wird.
Jemand nimmt ihm das Päckchen ab und schnüffelt.
»Warte hier!«
Dave hört Schritte, die sich entfernen. Eine Tür schließt sich. Plätschern und Schlürfen, zärtliches Murmeln und etwas, das wie das Kichern eines Mädchens klingt. Jedes Geräusch für sich genommen harmlos genug, aber zusammen genommen verursachen sie bei Dave eine Gänsehaut. Nur weg hier, Geld oder nicht!
Er will sich gerade im Dunkeln zurück zur Tür tasten, als plötzlich das Licht angeht und ein gutgekleideter junger Mann mit Sonnenbrille den Raum betritt und ihm lächelnd die Hand hinstreckt.
»Hi Dave, ich bin Julius.Tut mir leid wegen dem Licht vorhin. Mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Bruchbude!«
Dave blickt sich benommen um. FlauschigeTeppiche, Ledersessel und ein Glastisch. Wie in einer Bruchbude sieht es hier drin eigentlich nicht aus, ganz im Gegenteil, das Hausboot ist sehr viel besser ausgestattet, als er erwartet hat. Und dieser Julius … Gutaussehend. Elegant. Energische federnde Bewegungen. Alles andere als ein Junkie.
Julius blättert Geldscheine auf den Tisch und plaudert dabei über Sportfischen und dasWetter. Seltsam, was für einen Unterschied das Licht macht. Hat er sich wirklich gerade noch vor diesem umgänglichen Typen gefürchtet?
»Kaffee?«
Dave zögert. Joe hatte ihn davor gewarnt, sich mehr als nötig mit seinen Kunden einzulassen. Aber Dave ist auf einmal neugierig auf Julius, der ihn über den Rand der Sonnenbrille hinweg mit offenen grünen Augen anblickt.
»Warum nicht!«
»Hervorragend!« Julius Birdwell strahlt und macht sich in einer Kochnische an einer edelstahlglänzenden Espressomaschine zu schaffen.
Blut und Fisch – natürlich hat sich Dave da so seine Gedanken gemacht. Ein Satanist? Ein Vampir? Aber das scheint nicht zu Julius Birdwell zu passen, der Kaffee abmisst und sich anschließend die Hände an einem sauberen Geschirrtuch abwischt.
»Ich wüsste wirklich nicht, was ich ohne Leute wie dich und Joe machen würde. Es gibt einfach Beschwerden, gegen die man mit der Schulmedizin nicht wirklich ankommt. Cappuccino oder … Ach!«
Birdwell hat die Kühlschranktür geöffnet und äugt entschuldigend zu Dave hinüber.
»Die Milch ist alle. Schon wieder! Das ist wirklich …Trinkst du ihn auch schwarz?«
»Kein Problem.«
»Zucker?«
Die Espressomaschine hat ihre Arbeit getan, und Birdwell stellt eine dampfendeTasse vor Dave ab.
Plötzlich ist Dave verlegen. Er schüttelt den Kopf und rührt in derTasse herum, obwohl es eigentlich gar nichts umzurühren gibt. Er nippt. Viel zu heiß. Verdammt – jetzt muss er hier mit diesem Birdwell herumsitzen und Konversation treiben, bis sein Kaffee abgekühlt ist!
»Bist du auch Sanitäter? Wie Joe?«
Birdwell lässt sich neben ihm in einen Sessel fallen und überkreuzt die Beine.
»Medizinstudent.« Dave nimmt vorsichtig einen ersten Schluck. Schöne Augen hat er, der Julius, das muss man ihm lassen.
»Student, was?« Julius beugt sich vor, legt seine Hände aneinander und blickt Dave eindringlich an. »Dave, hast du vielleicht Lust, dir ein bisschen Geld dazuzuverdienen?«
Dave merkt, wie er rot wird.Woher weiß denn der Typ, wenn noch nicht einmal seine Eltern …? Ist es wirklich so offensichtlich …? Er holt tief Luft und nimmt sich zusammen. Joe hat ihn gewarnt, dass so etwas passieren kann. Wenn man illegales Zeug verhökert, scheinen manche Leute zu denken, der ganze Rest ist auch einfach so zu haben.
Er steht auf. »Nein, nicht mein Ding. Ich muss jetzt wirklich gehen, Mr Birdwell.«
»Julius.«
Julius sieht ihn einen Moment lang verblüfft an, dann lacht er los. »Setz dich, Dave, ich meine doch nicht das. Nein! Das hier ist eher eine äh … medizinische Angelegenheit.«
Julius’ Überraschung ist so echt, dass Dave nicht wie geplant aus dem Zimmer stürmt. Seine Phantasie ist da wohl wieder einmal mit ihm durchgegangen. Jetzt ist er wahrscheinlich richtig rot, puterrot, bis zum Haaransatz.
Er wendet sich von Julius ab und blickt verlegen umher. Eine Ecke des Raumes ist anders, verspielter irgendwie, nicht so hell und glatt wie der Rest. Dunkler. Intimer. Dave schlendert hinüber, halb aus Neugier, halb, um seinen roten Kopf vor Julius zu verbergen.
Eine Kommode aus dunklem Holz, darauf eine antik aussehende silberne Spieluhr, eine klassische Marmorbüste und eine kleine schwarze Kiste, bemalt mit goldenen Zeichen. Auf der Büste ein feiner schwarzer Zylinder, etwas zu groß für den Marmorkopf. Daneben so etwas wie eine winzige Bühne, Samtvorhang, Plattform – und eine Leiter, die hinauf in einenWattewölkchenhimmel führt, alles so klein und fein, dass noch nicht einmal ein ausgewachsener Marienkäfer dort auftreten könnte.
Über der Kommode hängen gerahmte Zeitungsausschnitte und ein Plakat.
Professor Fawkes’ Wunderkammer!Die größte Show der Welt!
Das Ganze erinnert Dave ein wenig an dieTrophäenecke, in der seine Mutter seine Jugendfotos und Rugbypokale ausstellt. Der Typ auf dem Plakat sieht allerdings ganz und gar nicht wie Julius aus, gedrungener, muskulöser.Trotzdem glaubt Dave eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den beiden festzustellen, im Blick vielleicht oder in der Haltung.
»Ist das einVerwandter?«
»Nicht wirklich.«
Dave streckt bewundernd die Hand nach der glänzenden Seide des Zylinders aus. »Bist du, äh, bist du Künstler oder so was?«
Künstler! Das würde alles erklären!
Plötzlich steht Julius neben ihm und setzt sich mit einer eleganten Bewegung den Zylinder auf.
»Zirkusdirektor, genau genommen.«
Wenig später sitzen eine ganze Menge Flöhe auf Daves Unterarm und saugen sich mit seinem Blut voll. Es kitzelt ein bisschen, aber nicht zu sehr. Schlimmer ist schon der Gedanke, dass sich gerade parasitische Insekten über seine Säfte hermachen.
Flohzirkusdirektor! Wie konnte er nur auf so etwas hereinfallen?
Dave rutscht unruhig auf seinem Sitz herum. »Wie lange wird das denn noch dauern?«
»Oh, eine kleineWeile.Wenn sie fertig sind, sind sie fertig.« Julius lächelt. »Mach dir’s bequem. Keine Sorge, sie fressen dich nicht auf.«
Dave nippt Kaffee. Der hat jetzt genau die richtigeTemperatur.
»Deine, äh, Beschwerden …«, fragt er so unauffällig wie möglich, »wie lange hast du die denn schon?« Dieser Julius interessiert ihn wirklich. Nur deshalb hat er sich von ihm zu der Blutspende überreden lassen. Das extra Geld schadet natürlich auch nicht.
»Was?« Julius blickt ihn irritiert an. Der Zylinder ist ihm ein wenig in die Stirn gerutscht, und auf einmal sieht er wirklich wie ein Zirkusdirektor aus einem Schwarz-Weiß-Film aus. Jeder Zoll ein Zirkusdirektor.
»Deine Beschwerden …«
»Ach so.« Julius blickt träumerisch zu dem Plakat hinüber. »Eigentlich noch gar nicht so lange. Eigentlich erst seit April …«
Bird
1. Im Fluss
Es war ein ungewöhnlich kalter Aprilabend. Julius Birdwell eilte die Straße entlang, eine kleine schwarze Kiste fest gegen die Brust gepresst. Es wurde schon dunkel, zu schnell, so als würde jemand mit einem Staubsauger das Licht aus London absaugen. Julius hasste die Dunkelheit. Dunkelheit stellte mit den Dingen seltsame Sachen an. Die Häuser rückten näher an ihn heran, vielgestaltig und irgendwie sprungbereit. Er guckte nicht so genau hin. Es war eine Abkürzung, die er nicht allzu oft nahm, aber der Wind ging ihm auf die Nerven, und er hatte es eilig, nach Hause zu kommen.
Ein schwarzesTaxi fuhr vorbei, dann war die Straße wieder menschenleer.
Plötzlich löste sich ein Schatten aus einerToreinfahrt und versperrte ihm denWeg.
»Birdie! Hey, Birdie! Bist du’s? Mensch, Birdie! Lange nicht gesehen!«
Oh shit! Julius blieb stehen, ein enges Gefühl in der Kehle. Er kannte die Stimme. Fred? Five-Finger-Fred oder irgend so ein idiotischer Ganovenname. Schließlich hatte so gut wie jeder fünf Finger.
»Mensch, wie lange haben wir uns schon nicht mehr gesehen. Seit der Beerdigung?«
»So ungefähr.« Julius schluckte. Es war jedes Mal seit der Beerdigung, obwohl ihm der Typ inzwischen schon vier Mal aufgelauert hatte.
»Schau dich an, der kleine Birdie mit Mantel und Anzug. Mann, dein Großvater wär stolz auf dich!«
Julius schwieg und umklammerte seine kleine schwarze Kiste. Er wusste, was als Nächstes kommen würde.
»Ich habe mich gefragt, ob du vielleicht wieder mit uns arbeiten möchtest. Das wär doch was!«
»Ich kann ja mal in meinenTerminkalender gucken«, sagte Julius geheuchelt beiläufig. »Aber ich fürchte, da sieht es schlecht aus.«
Finger-Fred, oder wie auch immer er genau hieß, lächelte, aber es war kein gutes Lächeln. »Nun ja, das ist aber doch so verdammt schade, weißt du, die ganzen schönenTricks, die dir dein Großvater beigebracht hat, alles für die Katz.«
Wie auf ein Kommando glitt neben ihm eine Katze unter einem Auto hervor, fauchte und schoss davon. Julius sah ihr neidisch nach.
»Ich arbeite nicht für Katzen.« Ein lahmer Witz, aber wenn schon. Hauptsache, der Typ merkte nicht, dass Julius Angst vor ihm hatte.
Schlösser knacken war nichts für ihn. Nicht nur weil er sich davor fürchtete, erwischt zu werden, das auch, natürlich, aber dahinter steckte eine noch viel größere, irrationalere Angst, die Angst, dass irgendwo in der Dunkelheit etwas auf ihn lauerte und »Buh!« machte. Er hatte einfach nicht die Nerven für eine Kriminellenkarriere. Der Großvater hatte das schließlich eingesehen, aber nun, nach seinemTode, fingen seine sogenannten Freunde an, Problem zu machen.
»Du müsstest nicht mal reinkommen. Nur Schmiere stehen. Und zehn Prozent plus Spesen. Fairer geht’s nicht!«
»Nein.«
Der Typ hatte auf die netteTour nichts erreicht und beschloss, ungemütlich zu werden. Er trat ganz nah an Julius heran, zupfte an seinem Kragen und prüfte den Stoff seines Mantels.
»Feine Klamotten tragen, aber für die alten Kumpels deines Großvaters hast du nichts übrig. Nicht schön, Birdie, gar nicht schön. Zu fein für richtige Arbeit, was?«
Julius senkte die Augen und umklammerte seine Kiste noch fester.
Finger-Fred bemerkte es.
»Was hast du denn da in dem Ding? Gib mal her!«
»Nein!«, sagte Julius, ein Zittern in der Stimme.
Finger-Freds Augen weiteten sich.
»Ach du Scheiße, sind das etwa die …?«
Er ließ los und trat mit angewidertem Gesichtsausdruck einen Schritt zurück.
»Genau!«, sagte Julius. Er hielt die Kiste hoch. »Sie haben seit gestern nichts gegessen. Sie sind hungrig.«
»Okay«, sagte Finger-Fred. »Schon gut. Lass den Quatsch. Aber überleg dir’s, Birdie. Vielleicht komme ich ja später mal in deinem feinen Atelier vorbei.«
Der Fingermann formte seine Finger zu einer unfeinen Geste, dann drehte er sich eilig um und ging die Straße hinunter. Bald war er um eine Biegung verschwunden.
Julius stand schwer atmend im kalten Wind. Panik überschwemmte ihn. Sie würden ihn nie in Ruhe lassen, sie würden in sein Atelier kommen, und dann, irgendwann …Wussten sie, wo er wohnte? Würden sie ihm folgen? Er rannte los, so schnell er konnte, die Straße entlang, gegen den peitschenden Wind, links, gerade, über die Kreuzung, herum um eine Frau mit Einkaufstüten, vorbei an dem kleinen Park.
Endlich stand er vor seiner Haustür. Seine Hände zitterten so sehr, dass er die schwarze Kiste abstellen musste, um mit beiden Händen mühsam den Schlüssel ins Schlüsselloch zu manövrieren.Wenn Finger-Fred gesehen hätte, wie er sich mit seiner eigenen Haustür anstellte, hätte er ihn vielleicht in Ruhe gelassen.
Endlich hatte er es doch geschafft, stürzte in den Flur und schob alle verfügbaren Riegel vor.
»Es ist nur die Kälte«, dachte er. »Ich zittere vor Kälte.«
Doch das war zumindest eine halbe Lüge.
Ein eisiger Wind wehte. DasTageslicht blinzelte bleich und lustlos auf den Kanal herab.
Julius Birdwell, bis zu den Knöcheln im Schlamm, blinzelte zurück.Wasser rann aus seinen Haaren in seine Augen, die Beine hinab, um sich dann in seinen Schuhen zu sammeln.Wasser leckteWelle umWelle an seinen Zehenspitzen.
Er stand im Niemandsland, nicht mehr imWasser, aber auch noch nicht so richtig imTrockenen.Vor ihm kräuselte sich der Kanal und spielte träge mit leeren Plastikflaschen, kaputtenVerkehrskegeln, Zigarettenstummeln und anderem städtischenTreibgut. Über ihm wölbte sich ein backsteinerner Brückenbogen. Efeu hatte sich in den Ritzen eingenistet und griff gierig nach dem Licht.
Etwas Schwarzes schoss plötzlich aus demWasser.
Julius zuckte zurück.
Kormoran.
Er drehte sich um, der flachen Böschung zu. Dürre Rankenpflanzen versperrten ihm denWeg, aber dahinter, etwas höher, führte glücklicherweise ein Fußweg am Ufer entlang. Ein Jogger rannte vorbei, sah ihn nicht oder wollte ihn nicht sehen.
»Alles ist gut«, wiederholte Julius zum hundertsten Mal und wickelte sich tiefer in die schmutzige alte Picknickdecke, die ihn wie ein freundlicher Rochen umhalste.
»Alles ist gut. Alles wird gut. Alles ist okay.«
Das allein war natürlich schon ein sicheres Zeichen dafür, dass rein gar nichts okay war. Genau solche Dinge sagten Leute in Filmen, kurz bevor sie von Aliens oder Sauriern gefressen wurden. Nun, so weit würde es heute wohl doch nicht kommen. Andererseits: Konnte er sich da nach den jüngsten Ereignissen wirklich noch so sicher sein? Wie war er hierhergekommen?War es wirklich erst gestern gewesen, dass Finger-Fred ihm aufgelauert hatte? Es schien eine Ewigkeit her.
Julius Birdwell begann, mit einer gewissen Dringlichkeit dieTaschen seines triefnassen Anzuges abzusuchen. Aber nach was? Zigaretten? Nein, er rauchte nicht, hatte nie geraucht und wollte ganz sicher nicht damit anfangen. Autoschlüssel? Das war es auch nicht, er hatte ja noch nicht einmal einen Führerschein.Wer brauchte in London schon einen Führerschein?Trotzdem hatte Julius das sichere Gefühl, dass ihm etwas fehlte, etwas Entscheidendes. Irgendetwas Wichtiges war plötzlich aus seinem Leben verschwunden, und er war nicht mehr ganz.
Julius fröstelte und versuchte, sich wieder daran zu erinnern, wie es ging, Julius Birdwell zu sein, Schmieder von Geschmeide, Sammler fluchbeladener Juwelen, größter Angsthase und bester Flohdompteur weit und breit.
Erst einmal musste er vomWasser weg. Er konnte sich nicht einmal mehr richtig daran erinnern, wie er auf die Brücke gekommen war, geschweige denn darunter, und mit der stinkigen alten Picknickdecke wollte er eigentlich auch nichts zu tun haben. Julius ließ sich die Decke von den Schultern gleiten und fröstelte noch mehr. Er watete durch öligen Schlamm, Plastiktüten, Kondome, Kronkorken und Gottwerweißwasnoch, dann kämpfte er sich, beobachtet von einer Stockente und drei kritischenTauben, bis zu dem Fußweg, der unter der Brücke hindurchführte, immer am Kanal entlang.
Nebel hing über demWasser. In der Ferne hörte er Baulärm, Kirchenglocken und den unermüdlichen Singsang des Londoner Straßenverkehrs. Er schlug den klatschnassen Kragen hoch und ging los, den Pfad entlang. Nur weg von hier, zurück in die Zivilisation.
»Sie hat dich also gehen lassen! Hätte ich nicht gedacht.«
Die Stimme kam vomWasser, so als hätte der Nebel gesprochen oder der Kanal selbst.
Julius blieb stehen. Am Ufer lag eine Reihe von Hausbooten, bunt und schäbig wie Zirkuswagen, und auf einem der Boote regte sich etwas. Jemand faltete sich mühsam aus einem Liegestuhl, ein Rausschmeißertyp mit Seemannsmütze und schlechten Zähnen. Neben ihm dampfte es aus einer Thermoskanne. Vermutlich war es der Anblick der Thermoskanne, der Julius davon abhielt, einfach Hals über Kopf davonzulaufen.
Der Mann hatte es endlich aus seinem Liegestuhl geschafft, trat an die Reling und schob sich die Mütze aus der Stirn.
»So was habe ich schon lange nicht mehr …Was hat sie dir denn versprochen? Und viel wichtiger: Was hast du ihr versprochen, Jüngelchen?«
»Ich … ich weiß nicht, was Sie meinen«, flüsterte Julius und schielte sehnsüchtig nach der Thermoskanne.
»Kalt?«
Julius klapperte zur Antwort mit den Zähnen.
»Komm an Bord, Junge, du holst dir denTod!« Der Mann deutete auf die schmale Planke, die zu dem Boot hinaufführte. Julius verspürte einen Widerwillen dagegen, auf das Schiff zu gehen, wieder hinaus aufsWasser, aber der Typ hatte Recht. Er konnte entweder weiterlaufen und sich unterwegs eine Lungenentzündung einfangen, oder er konnte sein Glück mit dem Hausboot versuchen.
Mittlerweile zitterte Julius so sehr, dass er es kaum noch die Planke hinauf schaffte.
Der Mann hatte inzwischen auf Deck eine Klappe geöffnet und winkte ihn einladend hinunter in den Bauch des Bootes. Drunten knurrte und kläffte es.
Schock. Es musste der Schock sein, sonst wäre er nie im Leben einfach so in ein fremdes Hausboot geklettert, hinein in die kläffende Dunkelheit.
Julius stieg schlotternd die Leiter hinab, rutschte auf einer der letzten Sprossen aus und landete mit einem Platsch auf dem Hosenboden.Vor ihm saß der hässlichste, bedrohlichste Pitbull, den er je gesehen hatte, und leckte ihm freundlich das Gesicht. Die warme Hundezunge brannte und prickelte auf seiner Haut wie tausend Nadelstiche.
»Das ist Bullseye. Und ich bin Pete.«
Pete tätschelte Bullseyes Kopf, und Bullseye sabberte freundschaftlich auf Julius’ Ärmel und wedelte dazu mit seinem Stummelschwanz.
»Birdwell. Julius Birdwell.«
Julius flüchtete mit letzter Kraft vor Bullseyes Mundgeruch auf einen Stuhl. Um ihn herum schälte sich das Hausbootinnere aus der Dunkelheit. Zwei Sessel. Ein Klapptisch. Ein Gaskocher und einWaschbecken, dahinter ein karierterVorhang. Julius schauderte. Er könnte nie auf so einem Hausboot leben, schwankend, glucksend, so dicht über dem dunklenWasser.
Pete knipste ein Licht an.
»Mann, Birdwell, du musst aus deinen nassen Sachen.«
Julius war inzwischen alles egal. Er riss sich schlotternd den Anzug vom Leib, während ihm Pete von hinter demVorhang Kleidungsstücke zuwarf.WeiteWollhosen, einen senfgelben Pullover, grüneWeste, Holzfällerhemd. Nicht gerade modisch. Aber warm.
Bullseye kläffte enthusiastisch.
Später saß Julius unter diversenWolldecken neben einem kleinen Holzofen, insTrockene gebracht wie ein sprichwörtliches, buntkariertes Schäfchen, und hörte endlich mit dem blöden Zähneklappern auf.
Pete hatte die Ärmel hochgekrempelt und machte sich mitWasserkessel und Gaskocher zu schaffen. Julius’ Blick fiel auf einTattoo auf Petes Unterarm: eine Meerjungfrau mit Kussmund und Fischschwanz und daneben, rot mit schwarzem Rand, ein Herz.
Julius schauderte. Da war es wieder, das Gefühl, dass ihm plötzlich etwas fehlte.
Pete bemerkte seinen Blick und schüttelte den Kopf.
»Mach dir nichts draus, mein Junge, sie sind nun mal ein launischesVolk.«
»Was?«, krächzte Julius. »Wer?«
»Du musst nicht darüber sprechen«, sagte Pete. »Ich verstehe schon.«
»Aber ich verstehe nicht.« Julius wurde langsam ungehalten.Was wollte dieser Pete von ihm? Hatte er noch alleTassen im Schrank?
Tassen.
Schrank.
Tee!
Pete hielt ihm eine dampfendeTeetasse unter die Nase. »Vielleicht besser so.«
Julius griff gierig zu. Es gab so gut wie nichts auf derWelt, was man mit heißemTee nicht wieder hinbekam. Eigentlich wäre ihm Grüntee natürlich lieber gewesen, aber Pete hatte Schwarztee gebraut, ein pechschwarzesTeufelszeug.
Pete tätschelte Julius’ Kopf, genau wie er vorher Bullseye getätschelt hatte.
»Ich muss wieder auf meinen Posten, Junge.Trink was. Wärm dich ordentlich auf. Bleib, solang du willst. Und wenn er zu laut ist, gib ihm ruhig eins hinter die Ohren!«
Letzteres galt Bullseye, der sich zu Julius’ Füßen zusammengerollt hatte und einen lautstarken Hundetraum träumte.
Julius nickte abwesend, während Pete die Leiter wieder hinaufkletterte und durch die Klappe verschwand.
Ruhe.Wenigstens so eine Art Ruhe, unterbrochen von Pitbulljapsen.
Er starrte in seinenTee.
Schwarz.
Beschützt vonWolldecken, Ohrensessel und dem schlafenden Pitbull wagte Julius vorsichtig den Blick zurück in die jüngsteVergangenheit.
Heute Morgen …
Heute Morgen hatte es keinenTee gegeben, eigentlich untypisch, aber nach der schlaflosen Nacht und dem Ärger mit Finger-Fred war er einfach zu mitgenommen gewesen für Nahrung, fest oder flüssig. Er hatte aus dem Küchenfenster geblickt und überlegt, wie er Fred und seine Kumpane ein für alle Mal loswerden konnte. Dann hatte er Raureif auf dem Fenstersims entdeckt, und auf einmal hatte sich ein flaues Gefühl in seiner Magengrube breitgemacht.
Noch flauer als Angst.
Schuld.
Frost! Nachtfrost. Noch so spät im Frühjahr?
Wo zumTeufel war der Flohpalast?
Der Flohpalast war eigentlich nur eine kleine hölzerne Kiste, schön lackiert in Schwarz und Gold, mit bequememTragegriff und guter Belüftung. Er befand sich weder auf seinem angestammten Platz neben Julius’ Bett noch unter seinem Bett noch …
Julius stürzte zur Haustüre und riss sie auf. Dann setzte er sich geschockt auf die obersteTreppenstufe. Dort, direkt neben ihm, stand der Flohpalast, hatte die ganze Nacht dort gestanden, vergessen in der Panik, in der Kälte, ungeschützt. Es hätte nicht passieren dürfen, aber es war passiert.
Seine Flöhe brauchten nicht viel, ein bisschen Blut, ein bisschen Dunkelheit, ein Stück Filz alsWohnungseinrichtung. Sie hätten die alte Decke unter der Brücke zu schätzen gewusst.
Julius schluckte ein paarTränen weg.
Denn eines brauchten Flöhe im Übermaß: Wärme. Jede Menge Wärme.
Er hätte eigentlich gar nicht nachsehen müssen, aber natürlich guckte er doch, durchsuchte jede Lumpenfalte nach Überlebenden. Marie Antoinette, Zarathustra, Oberon,Tesla, Lear, Faust, Freud, Cleopatra, Madam P., Lazarus der Albinofloh …
ImTode sahen sie sich alle erstaunlich ähnlich.
Seine kleinen Künstler. Seine Artisten. Seine – Blutsbrüder?
Der größte, der schönste und beste, der einzige freie Flohzirkus der westlichenWelt war nicht mehr.
Julius nahm einen Schluck zu heißenTee und beobachtete Bullseye, der zuckend überTraumwiesen rannte.
Er war nicht zurück ins Haus gegangen.Wozu? Sehr sacht hatte er den Flohpalast in der Diele abgestellt und sich seinen Zylinder aufgesetzt. Seinen Flohzirkusdirektorenzylinder. Eigentlich war der Hut für die Show gedacht, aber jetzt kam er Julius auf einmal alsTrauerkluft angemessen vor. Er hatte die Haustüre hinter sich abgeschlossen und begonnen, durch die Straßen zu wandern. Richtung Atelier, dachte er zuerst, aber bald bemerkte er, dass er die Gegend um sich herum nicht kannte. Die Häuser schienen kleiner, die winzigenVorgärten wilder, als er es sonst von London gewöhnt war.Verirrt.Verloren. Er wollte sich verlieren. Julius fühlte sich dunkel wie lange nicht mehr. Wie eine Kerze, deren Docht inWachs ersoff, dimm und flackernd und rußig und doof. So ungeheuer doof.
Der Flohzirkus war eine ihrer beiden Familientraditionen – diejenige, die Julius mochte.
Flohzirkus und Einbrüche.
Brot und Spiele, hatte sein Großvater gesagt. Seit er sich erinnern konnte, hatte Julius den Flöhen bei ihren Flohrennen und anderen Flohgeschäften zugesehen und ab und zu sogar bei der Fütterung geholfen.
Dann, sieben Jahre alt, hatte er beschlossen, sich selbst als Zirkusdirektor zu versuchen.
Sein Großvater, der gerade in dunklem Overall von der Arbeit zurückkehrte, war nicht begeistert gewesen.
»Es ist nicht wirklich ein Zirkus«, hatte er gesagt. »Es ist nur einTrick.«
Julius hatte den Großvater entgeistert angesehen. Er sah es doch, Flöhe, die tanzten oder auf dem Hochseil balancierten. Mit seinen eigenen zwei Augen.Wo sollte denn da derTrick sein?
»Ungeziefer!« Aber dann hatte der Großvater sich Julius doch auf sein Knie gesetzt, ihn an seinem Bier nippen lassen und ihm alles erklärt.
Die Flöhe mussten die Dinge tun, die sie taten. Sie wurden in Golddraht gebunden und bewegten Dinge, weil sie an ihnen festhingen – aber eigentlich wollten sie nur weg.
»So ist es im Leben«, sagte der Großvater und zuckte mit den Achseln.
»Warum?«, hatte Julius gefragt und damit ein bisschen das Leben und sehr den falschen Flohzirkus gemeint.
»Die Leute gucken eben gerne zu, wenn die Kleinen große Dinge tun«, meinte der Großvater. »Und sie glauben die Dinge, die sie glauben wollen.«
In vielen Flohzirkussen gab es überhaupt keine richtigen Flöhe mehr, nur Spielzeug, das sich mit Hilfe von Magneten und Mechanismen bewegte. Das Publikum bildete sich die Flöhe dazu ganz einfach ein.Verglichen damit war ihr Zirkus ein hochanständiger, grundsolider Betrieb.
»Man kann Flöhen nichts beibringen«, hatte der Großvater gesagt, »man kann sie nur benutzen.«
Zu diesem Zeitpunkt trainierte Julius heimlich schon eine hochmotivierteTruppe von fünf Flöhen, die papierene Wägelchen zogen, auf dem Rande eines Fingerhutes tanzten und durch Zwiebelringe sprangen, einfach so, ganz ohne Golddraht, nur weil Julius sie darum bat.
Ein bisschen benommen von der nacktenWahrheit und dem dunklen Bier des Großvaters hatte Julius damals beschlossen, dies alles für sich zu behalten.
Und bis heute wusste niemand, dass sein Flohzirkus anders war. Echt. Kein Ausbeuterladen. Freie, glückliche Flöhe. Es war Julius’ bestgehütetes Geheimnis. Viele Flohgenerationen waren seither ins Land gegangen, und Julius hatte mit seinerTruppe Kindergärten, Schulen, Pubs, Dinnerpartys und einmal einen Junggesellenabend besucht, sie waren im Fernsehen aufgetreten, auf Festivals und sogar vor einem Mitglied des Königshauses, bewundert, bestaunt und bejubelt. Der beste Flohzirkus weit und breit.
Nur Julius selbst wusste, wie gut sie wirklich waren.
Und jetzt?Wo in allerWelt sollte er im antibakteriellen, frischgeduschten London der Neuzeit Menschenflöhe herbekommen?
Bullseye war verstummt. Julius starrte verzweifelt hinunter in seinen beharrlich dampfenden Schwarztee.
Nebel.
Nebel über einem dunklen Fluss.
Julius brauchte den Flohzirkus. Der Zirkus war das Beste an ihm, das Echteste, vor aller Augen und doch vor allen verborgen.
Er war auf der Brücke angekommen.
Drunten tanzten Wirbel undWellen, Licht floss, spielte und brach, hypnotisch und überraschend attraktiv. Julius, erschöpft von seinem ziellosen Spaziergang und der Aussicht auf eine flohlose Zukunft, war einfach über das Brückengeländer geklettert, hatte sich weit vorgelehnt und vomWasser locken, necken und verführen lassen. Natürlich war es nur ein Spiel, ein dunkles Spiel. Natürlich war er nicht lebensmüde! Natürlich würde er nicht wegen ein paar Flöhen springen, schon gar nicht in diese Brühe.Was für ein Klischee! Wieso sprangen Leute überhaupt von Brücken?Weil es unten nicht so hart war? Und was war das für eine Einstellung, wenn man sowieso mit dem Leben abgeschlossen hatte?
Der Wind zupfte ihm den Zylinder vom Kopf,Wasser trug ihn davon, kleiner und kleiner. Julius blickte dem Hut melancholisch nach.
»Hey, tu’s nicht!«, hatte auf einmal eine Stimme hinter ihm gerufen, und Julius war vor Schreck ausgerutscht und insWasser gefallen.
Noch im Fall war ihm die Sache peinlich gewesen. Ein Unfall, ein dämlicher Unfall, aber so schlimm nun auch wieder nicht. Schließlich konnte er schwimmen …
DasWasser war so kalt, dass Julius dann erst einmal gar nichts konnte, nicht einmal paddeln. Er sank mit offenen Augen, umschwirrt von Luftblasen, liebkost von schlängelnden grünenWasserpflanzen. Eine Plastiktüte schwebte vorbei, seltsam schön.
Als er dann endlich mit dem Schwimmen anfing, war es gar nicht mehr so einfach zu sagen, wo oben war und wo unten. Sein Mantel zerrte an ihm, seine Lunge brannte, etwas hatte sich um seinen Hals gewickelt, und die ganze Zeit über versuchte er verzweifelt, irgendjemandem zu erklären, dass dies alles nur ein Missverständnis war, dass er gar nicht sterben wollte.
Doch niemand hörte ihm zu, und Julius war dabei zu ertrinken, Missverständnis oder nicht.
Aber dann …Wasserpflanzenhaar, ein plätscherndes Lachen, ein fließender Kuss. Er hatte sich Nixen immer blau vorgestellt, karibikblau und glitzernd, aber sie war dunkel wie ein Fluss im Winter, moorig, moosig und tief, unendlich glatt und schön. Dunkel die Haut, dunkler die Augen und obsidianschwarz ihr Lächeln.
Es war auf eine seltsame Art schlimmer gewesen, als wirklich zu ertrinken, ein Ertrinken an Küssen, jeder tiefer und trauriger als der vorherige, und jeder mit einem bitteren kleinen Luftbläschen Hoffnung, das ihn schwindelig werden ließ vor Sehnsucht nach dem Leben.
Und zwischen Küssen und schlängelnden Umarmungen und perlendem Lachen hatte die Flussjungfrau ihm einen Handel vorgeschlagen.
Und Julius Birdwell, halbtot und halbverliebt, hatte zugestimmt.
Doch was für einen Handel? Daran erinnerte er sich nun kein bisschen mehr.
2. Unter Brücken
Nur ein paarTage später machte sich in London endlich der Frühling breit – etwas blass und hysterisch zwar, aber unerbittlich. Vögel sangen erfolgreich gegen den Straßenlärm an, Unkraut blühte zwischen Pflastersteinen, Fliegen sonnten sich auf parkenden Autos. Die Leute vergaßen ihre Mäntel zuhause und bereuten es erst gegen Abend, wenn die Stadt wieder den Schatten gehörte. Die Sonne walzteTag fürTag pompös über den Himmel, schien und ließ sich Zeit.
Unter den Brücken nisteten Schwalben und Enten und sogar das eine oder andere schmutzige Schwanenpaar. Wicken rankten. Mücken summten. JungeTriebe schoben den Asphalt zur Seite, Käfer krochen, Vögel raschelten in Sträuchern – oder waren das etwa Ratten?
Julius Birdwell guckte gar nicht erst hin. Das ganze Gekreuche, Gekrieche und Gefleuche berührte ihn peinlich, so als ob er London unter den Rock geguckt und dort etwas gesehen hätte, was er gar nicht suchte. Er verbrachte neuerdings zu viel Zeit unter Brücken, in Gummistiefeln und schlechter Gesellschaft, so viel war klar.
Julius wartete einen Moment, bis sich seine Augen an die tanzenden Schatten im Brückenhalbdunkel gewöhnt hatten, dann sah er sich mit inzwischen geschultem Blick um. Da hinten, wo der Boden am trockensten war, lag wurstförmig und einigermaßen obszön ein Schlafsack und schnarchte. Nur einer? Ja. Julius wollte kein Risiko eingehen. In sicherem Abstand von dem Sack ging er in die Hocke, stellte eine Flasche billigenWodka auf den Boden und rief halblaut in die Schatten hinein.
»Hey!«
Heyheyhey
hey hey hey hey
heyheyhey
heyheyheyhey
Unter den meisten Brücken hallte es.
Das Schnarchen wurde lauter.
»He du!«, rief Julius. »Wach auf!«
Nichts.
Julius seufzte, wählte sorgfältig einen größeren Kiesel aus, nicht zu schwer und nicht zu leicht, zielte, warf und traf. Die meisten Unterbrückenleute erwachten mit einem Schrei, einem Stöhnen, einem Stein oder Messer in der Hand, aber dieser hier saß einfach auf einmal aufrecht da und fixierte Julius mit überraschend wachem Blick.
Zottiger brauner Bart. Helle Augen. Kräftiger Kiefer.
»Entschuldigung«, sagte Julius nervös.
Der Penner blieb still.
Julius hatte es anfangs mit Diplomatie versucht, Schmeicheleien, Euphemismen, aber die Menschen unter Brücken schienen dafür vollkommen unempfänglich. Seinen in Seide, feine Lederstiefel und Universitätsabschlüsse gehüllten Kundinnen konnte er so gut wie alles erzählen, aber hier funktionierten nicht einmal die einfachstenTricks. Inzwischen hatte er einiges gelernt. Keine Namen. Keine Floskeln. Keine eleganten kleinen Witze. Julius kam einfach zur Sache.
»Ich suche Flöhe«, sagte er. »Hast du Flöhe?«
Der Penner glotzte.
»Sie springen«, sagte Julius. »Sie sind sehr klein und springen. Sie beißen, meistens nachts. Es gibt dann kleine juckende Punkte. Meistens ein paar in einer Reihe. Hast du kleine juckende Punkte?«
Der Penner spuckte erstaunlich präzise in den Staub.Wahrscheinlich hatte er ganz andere Sorgen als kleine juckende Punkte, also kam Julius gleich zumWesentlichen.
»Das ist eine FlascheWodka«, sagte er und deutete übertrieben theatralisch auf die Spirituose. »Ich gebe dir eine FlascheWodka für jeden Floh, den du lebend fängst. Man kann sie einfach vorsichtig zwischen zwei Finger nehmen, das macht ihnen gar nichts. Und wenn du jemand anderen kennst, der Flöhe hat, gebe ich dir zwei Flaschen.«
Noch immer keine Reaktion. Das war untypisch. Normalerweise kam spätestens an diesem Punkt Leben in dieVerhandlungen. Konnte der Typ nicht sprechen?Verstand er ihn etwa nicht? Das hatte Julius gerade noch gefehlt!
»Pro Floh eine Flasche«, wiederholte er. »Das ist ein guter Deal!«
»Ich trinke nicht.«
Das war nun allerdings eine überraschendeWendung.
»Ich zahle auch Geld«, sagte Julius ein wenig verdutzt.
»Ach was«, antwortete der Penner. »Brauche ich nicht.«
»Jeder braucht Geld.«
Der Penner schüttelte grinsend den Kopf.
»Hier nicht.«
»Irgendetwas musst du doch brauchen«, sagte Julius stur.
»Schlaf«, grollte der Penner und sank wieder zurück in seinen Sack.
Damit war die Sache wohl erledigt. Julius packte die FlascheWodka zurück in seineTasche und richtete sich vorsichtig auf.Wahrscheinlich hätte der Typ sowieso nichts zu bieten gehabt. Bisher war Julius noch auf keinen einzigen Floh gestoßen. Läuse ja. Flöhe nein. Es war zumVerzweifeln.
Er wandte sich zum Gehen.
»Was willst du denn mit Flöhen?«, fragte es aus dem Sack.
»Flohzirkus«, sagte Julius.
Im Schlafsack kicherte es. »Versuchs doch mal auf dem Flohmarkt!«
Julius ging dann doch nicht auf den Flohmarkt, sondern zurück in sein Atelier, zog die Gummistiefel aus und genoss einen Moment lang die helle Strenge seines Arbeitsraums. Keine dunklen Ecken. Keine lauernden Schatten. Gebannt vom Glanz seiner Schmuckstücke ließ dieWelt ihn hier in Ruhe. SeineWerkzeuge lagen schlank und blank aufgereiht, geordnet nach Funktion und dann nach Größe. Das Licht fiel geschmackvoll auf Glas, weiß gelackte Flächen und Gold, glitzerte dort ein wenig und wurde vom matten Steinfußboden verschluckt. Hier kroch und wuchs nichts, nicht einmal die Orchidee auf dem Sofatisch. Die Orchidee beschränkte sich höflich aufs Überleben.
Julius seufzte zufrieden, schlüpfte in feine Lederslipper, füllte denTeekessel und trat an seineWerkbank, wo Ringrohlinge auf die Politur warteten und geschliffene Edelsteine ihres Schicksals harrten.
Er liebte seinen Beruf. Er liebte den Glanz, dieTextur und die träge Schwere des Goldes. Die Farbe. Das Detail. Die endlose, unermüdliche magische Variation einer Form. Das fiebrige Funkeln in den Augen seiner Kunden – Kundinnen meistens. Die Bewunderung. Die Feinheit und Kleinheit seiner Stücke, die Art, wie sein Schmuck Ordnung in dieWelt brachte.
Und all das hatte er seinen Flöhen zu verdanken.
Es hatte damit angefangen, dass sich Julius mit Zwiebelringen und Fingerhüten nicht mehr zufriedengab. Seine Flöhe, inzwischen acht an der Zahl, Filo, Fluff, Captain Kirk, Barbarella, Mickey,Tarzan, Batman und Superfloh, alles Künstler ersten Ranges, hatten Besseres verdient. Julius probierte mit Kupferdraht und Alufolie herum, später kamen Silberdrähte und Goldplättchen hinzu. Er formte kleine römischeTriumphwagen mit winzigem Löwenrelief, Reifen aus silbernen Flammen, ein kleines schimmerndes Hochseil mit Plattformen aus Kronkorken.
Und dann war da irgendwann ein dunkeläugiges Mädchen gewesen, das seinen silbernen Flammenring an einer Seidenschnur um den Hals tragen wollte. Die Flöhe waren nicht erfreut gewesen, aber Julius richtete seinen Blick zum ersten Mal auf die feine, weise, uralteWelt des Schmuckes. Er hing seine Schlosserlehre an den Haken und begann eine Ausbildung bei einem Goldschmied.
Bald verdiente er mit ehrlichem Handwerk mehr, als er je mit nervenaufreibenden kleinen Einbrüchen und Betrügereien erwirtschaftet hatte, sehr zum Ärger seines Großvaters. »Du hast keinTalent, Junge, du hast einfach keinTalent«, hatte der Großvater wieder und wieder gemurmelt und Julius nach und nach mit seinen Projekten in Ruhe gelassen.
Und er hatte Recht. Julius war als Krimineller denkbar unbegabt, nicht nur der Nerven wegen. Es fehlte nicht an Kreativität, Energie und gutem Willen, trotzdem wollten sich einfach keine rechten Ergebnisse einstellen. Das Hauptproblem war das Lügen. Nicht, dass er es nicht gewollt hätte, oh nein, Julius log mit seinen 15 Jahren so geschickt wie der Großvater. Doch, doch, diese Banknoten waren Falschgeld und mussten sofort konfisziert werden; der Ring war natürlich nicht echt, völlig wertlos eigentlich, und Julius kaufte ihn nur aus Sentimentalität; ja, sicher das war eine echte Stradivari, ein bisschen heruntergekommen zwar, doch Sammler würden dafür selbstverständlich ein Vermögen zahlen.
So weit, so gut, doch später stellte sich heraus, dass Julius tatsächlich Falschgeld konfisziert hatte, der erschwindelte Ring völlig wertlos war und die alte Violine vom Flohmarkt wirklich eine Stradivari. DieWahrheit war ihm immer einen Schritt voraus – kein besonders stolzes Kapitel seines jungen Lebens.
Julius merkte, wie ihm das Blut in den Kopf stieg, und legte sich schnell einigeWerkzeuge zurecht. Schluss mit dem Grübeln! Er musste etwas tun. Etwas schaffen. Ein neues Design. Es war höchste Zeit für ein neues Design. Heute würde es endlich klappen!
Er überlegte kurz und wählte dann einen Ringrohling ausWachs. Ihm schwebte eine ovale Form vor, etwa wie ein Stein im Marquise-Schliff. Nur würde natürlich kein simpler Stein den Ring krönen, sondern eine winzige Skulptur. Ein einzelnes Auge. Kein stilisiertes Auge, sondern ein echtes, ein Menschenauge mit allen Details. Das Auge des Penners, das ihm nun in der Erinnerung seltsam faszinierend und hell und leuchtend vorkam. Ein Unikat, ein Juwel, ein geistreicher kleiner Witz! Besetzt mit Diamanten und Saphiren würde es bald von einem Damenfinger in dieWelt hinausblicken!
Er arbeitete wie ein Besessener. Zuerst das Band, das mit winzigen Fischschuppen besetzt sein sollte, dann das Auge, perfekt mandelförmig.
Dann noch ein Auge.
Wieso denn noch ein Auge?
Haare, wild gelockt wie elegante Aale.
Ein einzelnesTentakel.
Tentakel?
Zuletzt ein geheimnisvolles, trauriges Lächeln und dann, wie immer, sein Markenzeichen, der lebensgroße, naturgetreue Floh.
Wunderschön. Fiebrig goss er die Form, schmolz das Gold, zentrifugierte.
Als er den Ring endlich aus der Form brach, war es draußen schon dunkel. Er merkte gleich, dass schon wieder etwas nicht stimmte. Das Stück sah nicht im Entferntesten wie ein Auge aus, eher wie ein kleiner Oktopus, ausufernd nach allen Richtungen. Julius stöhnte und griff widerwillig zum Polierlappen.
Da war sie wieder, die Frau, die sich seitTagen auf jedes seiner Schmuckstücke drängte!
DieWasserfrau!
Er wusste jetzt schon, was er ihr für Augen geben würde: grün, smaragdgrün, die sattesten grünsten Smaragde, die in seinem Atelier noch zu finden waren.
Julius starrte feindselig hinunter auf das schöne, glatte, traurige Goldlächeln, die wallenden Haare und das einzelne zierlicheTentakel, das sich verspielt über das Gesicht rankte. Handwerklich zweifellos eine schöne Arbeit, vielleicht eine seiner besten, die Leute würden sich darum reißen, aber was half das schon? Julius wollte Dinge formen, nicht geformt werden. Es war so, als hätte sich jemand in seinen Kopf geschlichen und benutzte ihn wie einWerkzeug, um immer wieder obsessiv das gleiche Gesicht zu formen. Immer die gleiche Frau, immer das gleiche schwermütige Lächeln. Auf einmal kam ihm sein Atelier nicht mehr hell und klar vor, sondern bedrückend – nicht länger ein Zufluchtsort, eher eine Falle.
Wer war sie? EineWasserjungfrau, so viel war klar. Nicht die Nixe, der er begegnet war, die hätte er erkannt. Hätte er?War er ihr wirklich begegnet? Einer Flussfrau? Julius hatte die letztenTage damit verbracht sich einzureden, dass er sich alles nur eingebildet hatte. Ein Fiebertraum. Ein Produkt seiner überreizten Phantasie. Doch angesichts seiner jüngsten Schmuckkreationen musste er sich eingestehen, dass an der Sache doch mehr dran sein musste.
Wer war die Frau?Was hatte sie zu bedeuten?
Eine Frage? Eine Bitte? Eine Drohung?
Eine Erinnerung?
Eine Erinnerung an den Handel!
Julius hatte sich anfangs keine besonders großen Sorgen um seinen Handel mit der Flussfrau gemacht – wenn denn da wirklich eine Flussfrau war. Schließlich war er hier auf demTrockenen, weit weg von Londons Gewässern. Und wenn sie wirklich irgendwie hier auftauchen sollte – wie denn? in einem rollenden Aquarium? –, würde er schon irgendwie mit ihr fertigwerden. Mit Frauen war er bisher immer gut fertiggeworden. Aber natürlich war die Nixe ebenso wenig eine einfache Frau, wie einWal ein Fisch war. Sie hatte sich in seinen Kopf geschlichen und benutzte Julius’ eigene Hände, um ihnTag fürTag an ihreVereinbarung zu erinnern. So ging es nicht weiter! Er konnte entweder den Rest seines – vermutlich durchWahnsinn verkürzten - Lebens damit verbringen, goldene Nixenköpfe zu produzieren, oder er musste herausfinden, was die Flussfrau von ihm wollte.
Julius zog eine Schublade auf und blickte vorsichtig hinein. Da lag zwischen Zangen und Drähten und dem einen oder anderen kleinen Halbedelstein eine einzelne Visitenkarte, schwarz und weiß, schlechtes Papier, billiges Design, unspektakulär. Das einzig Interessante an der Karte war, wo Julius sie gefunden hatte.
Unter der Brücke.
In einer derTaschen seines tropfenden Anzugs.
Sie musste von der Nixe kommen.Woher sonst?
Von all den Dingen, die Julius Birdwell vom Grunde des Flusses zurückgebracht hatte, war nur diese Karte vollkommen trocken gewesen.
FRANK GREEN stand darauf.
FRANK GREENPRIVATDETEKTIV
3. Auf dem Sofa
PRIVATDETEKTEI GREENBITTE TRETEN SIE EIN!KLOPFEN ZWECKLOS!
Die Detektei war genauso schäbig, wie Julius es befürchtet hatte. Möglicherweise sogar noch schäbiger. ImWarteraum baumelte eine nackte Glühbirne von der Decke. Staub sammelte sich auf Stühlen und Kissen, derWasserspender beheimatete eine rege Algenfauna, die Illustrierten waren veraltet. Spektakulär veraltet. Herbstfarben jetzt! Das iPhone 2 ist da! Die Weihnachtsdiät! Nur gut, dass hier niemand wartete.
Julius durchschritt den kleinenVorraum und blieb vor einer halbgeöffneten Tür mit Milchglasfenster stehen. Büro stand darauf. Bitte klopfen. Durch das Milchglas war eine Figur am Schreibtisch zu erkennen, ein ausufernder, fleischiger Klops, rosig und reglos, vage bedrohlich.
Julius schluckte. Dann klopfte er an.
»Herein«, sagte eine Stimme.
Jenseits der Milchglasscheibe machte Frank Green eigentlich einen ganz fokussierten Eindruck, ruhig und kräftig, nicht zu alt, nicht zu jung. Unauffällig im besten Sinne. Er deutete wortlos auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. Julius dankte, setzte sich und legte sofort los: der Absturz, dasVersprechen, das Loch in der Erinnerung, das schlechte Gewissen, das ihn nun nicht mehr losließ. Es überraschte ihn selbst, wie gut es tat, sich die ganze Geschichte endlich von der Seele zu reden. Nun ja, vielleicht nicht die ganze Geschichte. Julius verschwieg geschickt dieTatsache, dass sich die betreffende Episode unterWasser zugetragen hatte und die Dame einen Fischschwanz besaß. Ein feuchter Abend. Ein feuchter Abend mit Gedächtnisverlust. Das war schließlich dasWesentliche!
»Ich muss herausfinden, was ich ihr versprochen habe«, sagte er schließlich. »Koste es, was es wolle. Darum bin ich hier.«
Er wartete darauf, dass Green anfing, Fragen zu stellen. Name, Adresse,Telefonnummer, Bankverbindung. Haarfarbe der Dame. Name der Kneipe.
Oder einfach nur den Kopf schüttelte.
Doch Green runzelt nur eineWeile lang stumm, kritisch und ausgesprochen kompetent die Brauen.
»War sie schön?«, fragte er schließlich.
»Ja«, antwortete Julius schaudernd. »Oh ja!«
Green schrieb etwas in ein Notizbuch. Dann stand er plötzlich auf und schritt zur Tür.
»Komm!«, sagte er.
Julius war beeindruckt. Ein Mann derTat! Und offensichtlich hatte er bereits eine Spur.
Sie liefen eineWeile durch die Straßen, im Zickzack, wie es schien, Green voran, Julius hinterher. Zuerst war Julius einfach nur froh, dass sie das staubige kleine Büro hinter sich gelassen hatten und endlich Schritte unternommen wurden.Wortwörtlich. Jede Menge Schritte. Doch nach und nach kamen ihm Zweifel.Was wusste Green schon?Was hatte Julius ihm wirklich erzählt? Wie sollten sie durch bloßes Herumlaufen der Lösung seines Problems näher kommen?
Green musste an einer roten Fußgängerampel halten, und Julius nutzte die Zeit, sich umzusehen. EineWohngegend, und keine der besten. StaubigeVorhänge hinter staubigen Fensterscheiben. Keine Parks. Keine Läden. Gelbes ungepflegtes Gras zwischen den Pflastersteinen.War Green auf demWeg zu einem Kollegen? Einem Informanten? Jemandem, der sich imWassernixenmilieu auskannte?
Julius unterdrückte ein hysterisches Kichern.
»Wohin gehen wir?«, fragte er, um sich zu beruhigen, doch in diesem Moment wurde die Ampel wieder grün, und sie strömten mit anderen Passanten über die Straße, weiter, immer weiter.
Ab und zu drehte Green sich um, wie um sich zu vergewissern, dass Julius ihm noch folgte. Oder wollte er vielleicht sehen, ob ihnen sonst noch jemand folgte? Jetzt, wo er ihn genauer beobachtete, fiel Julius an Green eine kleine Merkwürdigkeit auf: Jedes Mal, wenn er Julius ansah, schien er gleichzeitig auch auf etwas neben ihm zu blicken. Oder vor oder hinter oder über ihm. Greens Blick hat etwas vage Gehetztes, Unstetes, und auf einmal war sich Julius alles andere als sicher, ob er hier wirklich in den richtigen Händen war.
Wieder blieb Green stehen, diesmal in einem Hauseingang. Blicke nach allen Seiten. Auch Julius sah sich um. Nichts. Nur zwei Dohlen, die sich um den Inhalt eines geplatzten Müllsacks stritten, und eine harmlos aussehende ältere Dame mit Pudel. Die Dame hatte grelle rote Fingernägel.
»Wohin gehen wir?«, fragte er zum zweiten Mal, diesmal etwas schriller.
»Nirgendwohin«, antwortete Green. »Wir sind da.«
Er drückte einen Klingelknopf.
»Wo?«, fragte Julius.
»Bei meinem Therapeuten natürlich«, antwortete Green.
Es war zu dunkel für eine richtige Praxis. Es roch komisch.
Julius lag gut gepolstert und teuflisch bequem auf einem Sofa und beobachtete ein Pendel beim Schwingen.
Hin und her.
Hin und her.
Her und hin.
»Ich vermisse meine Flöhe!«, sagte er.
Ein kauzartiges Therapeutengesicht tauchte über ihm auf.
»Sicher, sicher, darüber reden wir später. Entspannen Sie sich!«
Wieder schwang das Pendel.
Hin und her.
Her und hin.
»Lassen Sie sich fallen«, säuselte der Therapeut über ihm in einem seltsamen Singsang. »Beobachten Sie das Pendel, und wenn ich das Licht ausmache, werden Sie sich erinnern!«
Her und hin.
Humbug, dachte Julius. Ich will meine Flöhe!
Das Licht ging aus.
Julius fiel.
Er fiel direkt ins eiskalteWasser, und da war sie wieder, in einerWolke aus dunklem Haar, durch das Schwärme von kleinen silbernen Fischen zogen.
Julius produzierte verzweifelt Luftblasen.
»Einverstanden«, wollte er sagen. »Alles! Alles, was du willst!«
»Rette meine Schwester!«, sagte die Flussfrau, ohne dabei den Mund zu bewegen. Ihr Mund war eine Muschel. Ihr Mund war ein Stein.
»Gerne!«, blubberte Julius. »Wie?Wo?«
Das Gesicht der Nixe wurde noch dunkler, die silbernen Fische flohen. Auf einmal waren schwarze Schlangen in ihrem Haar.
»Fo«, hörte Julius die Schlangen sagen. »Fo. Foe. Faux.«
Dann fühlte er sich gehalten und getragen, hinauf, immer hinauf, in eine Decke gehüllt und auf Schlamm gebettet. Der Schlamm war überraschend bequem.
»Faux!«, murmelte Julius und öffnete die Augen.
Zwei Gesichter guckten ihn von oben an, der Therapeutenkauz animiert, Green mitfühlend.
»Wassernixe, was?«, grinste der Therapeut. »Die menschliche Psyche ist doch etwasWunderbares!«
Julius setzte sich ruckartig auf.
»Ich habe nicht … Ich wollte nur …«
»Alles in Ordnung«, sagte Green beschwichtigend. »Am Anfang ist es immer schwierig. Immerhin wissen wir jetzt, was sie von dir will.«
»Können Sie Französisch?«, fragte der Therapeut.
»Wie bitte?«, fragte Julius.
»Nun ja, es ist für die Analyse nicht unwichtig, ob Ihr Unterbewusstsein Französisch spricht.«
Der Therapeut hatte seine Brille abgesetzt und schwenkte sie vor Julius’ Augen hin und her, als wolle er ihn erneut hypnotisieren.
»Der nächste Schritt ist jetzt natürlich, diesen Foe zu finden«, sagte Green sachlich. »Ich könnte da …«
Julius schüttelte den Kopf. Er hatte genug von dem ganzen Hokuspokus.
»Danke. Ich google ihn einfach.«
»Und die Schreibweise?«, fragte der Therapeut.
»Französisch!«, improvisierte Julius, um die beiden so schnell wie möglich loszuwerden. »Ich brauche keine Therapie!«
»Haben Sie einVerhältnis mit Ihrer Schwester?«, fragte der Therapeut. »Oder mit der Schwester Ihrer Schwester?«
»Ich habe keine Schwester«, sagte Julius entsetzt.
Der Therapeut machte sich eine Notiz.
»Interessant«, sagte er. »Und Sie sind sich sicher, dass Sie keine Therapie …«
»Sehr sicher«, sagte Julius und stand auf. »Ich muss jetzt gehen. Entschuldigen Sie bitte!«
Er trat in den Flur und blickte sich unsicher um.Wo war hier gleich noch mal der Ausgang?
»Einen Moment, bitte schön!«, säuselte der Therapeut.
Ach so, natürlich: Geld.
»Nehmen Sie auch Schecks?«
»Ach, das kann warten!« Der Therapeut lehnte agil im Türrahmen, und auf einmal erinnerte er Julius unangenehm daran, dass auch Käuzchen Raubvögel waren. »Erst die Hypnose!«
»Aber ich hatte doch gerade …«
»Nicht Ihre Hypnose, natürlich! Meine Hypnose!«
Julius starrte ihn entgeistert an. »Wollen Sie sich auch an etwas erinnern?«
»Erinnern!«, kreischte der Therapeut empört. »Was glauben Sie eigentlich, was das hier für ein Betrieb ist? Einer dieser Läden, wo man Ihre Erinnerungen durchforstet und in Ihrer Kindheit herumwühlt? Pah! Dies ist eineVergessens-Praxis! Es geht hier darum, unnütze Erinnerungen loszuwerden.Verdrängen funktioniert nicht, wollen Sie sagen? Irrtum!Verdrängen funktioniert ganz ausgezeichnet, wenn man es richtig macht! Das ist jedenfalls der Grund, warum Mr. Green hierherkommt.«
Green war ebenfalls im Türrahmen aufgetaucht und lächelte freundlich.
»Und wenn Sie bei mir keine Therapie machen wollen, mein Lieber, dann ist diese ganze Psycho-Geschichte mit der Nixe eben genau das: unnütze Erinnerung.Weg damit, sage ich! Es steht auch in meinen Geschäftsbedingungen, Sie können das gerne nachlesen!Wenn ich mich immer an all den Kram erinnern würde, den mir meine Patienten erzählen, wäre ich schon längst nicht mehr bei klaremVerstand!«
Er grinste Julius manisch an.
»Kommen Sie«, sagte er dann sanft. »Gucken Sie nicht so besorgt! Es ist ganz einfach.«
Julius war zurück in dem etwas zu dunklen Raum. Diesmal saß er auf dem Stuhl.Vor ihm auf dem Sofa lag der Therapeut und blickte ihn mit vertrauensvollen Eulenaugen an. Julius schwenkte halbherzig das Pendel.