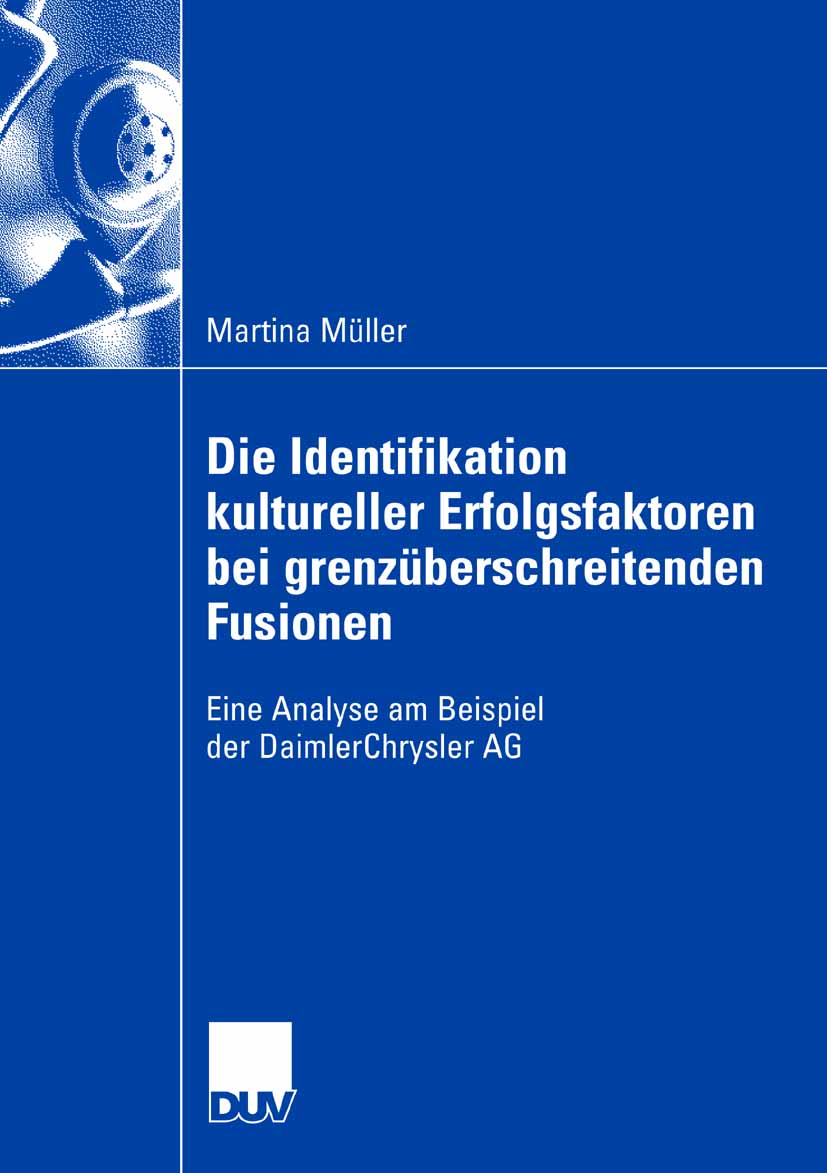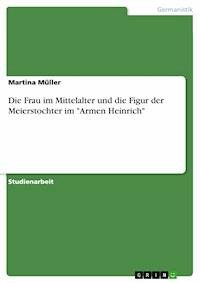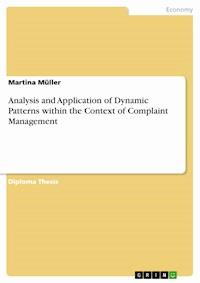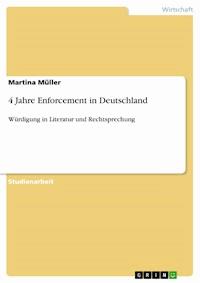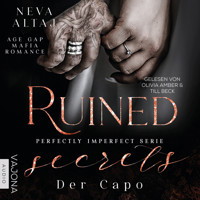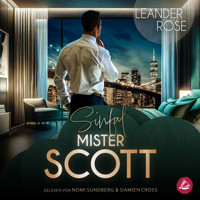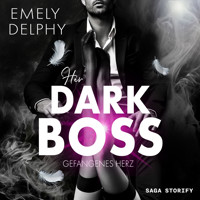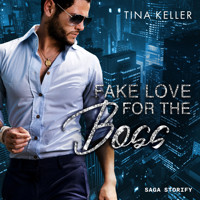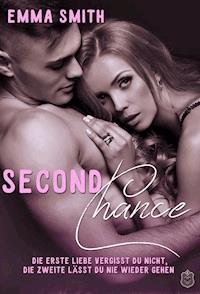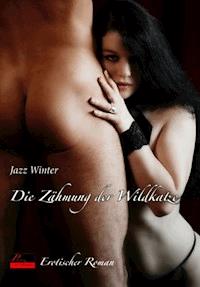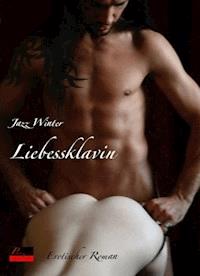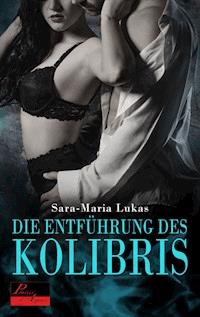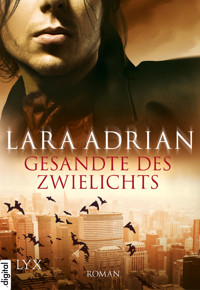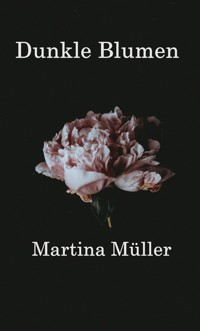
5,49 €
Mehr erfahren.
Drei kleine Geschichten der Littératur du mal, der bösen Literatur. Einsamkeit, Macht, Sex, Exzess - dieses Buch ist nichts für schwache Nerven. Ihre Moral liegt in unserer Empörung und ihre eigentliche Grausamkeit besteht darin, dass sie uns mit dieser Empörung vollkommen alleine lässt. - Dennis Klofta
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 79
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Martina Müller
Dunkle Blumen
mit einem Vorwort von Dennis Klofta
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Laternenlicht
Acéphal
Die Puppe (A dream for the lost)
Impressum neobooks
Vorwort
Welchen Wert besitzt die Littérature du mal, die böse Literatur, in einer moralisch so aufgeladenen Zeit, in der die vermeintliche Fiktion sich als gefährlicher Trugschluss des Realen entpuppt? Einer Zeit, in der die Empörung von der konstanten medialen Überreizung verschluckt wird? Was ist fiktionale Grausamkeit im Angesicht der inszenierten Realität? Woher kommt der Aufschrei über die Kunst, wenn doch ihre Schwester so viel gefährlicher und ohnmächtiger ist?
Ob Maggie Nelson in ihrem großartig Buch Art and Cruelty, Susan Sonntag, in ihrer Auseinandersetzung mit dem Voyeurismus in der Photographie oder Jessica Benjamin in ihrem Essay über die Pornografie, immer ist es ein Aspekt, der deutlich in den Vordergrund tritt: die Diskrepanz zwischen der Emotion und der Vernunft.
Unsere erste Reaktion auf Kunst, egal welcher Art, findet immer auf einer emotionalen Ebene statt. Mein erster Eindruck ist eine Empfindung; er ist immer ein rein subjektiver, ein persönlicher; für einen kurzen Moment werden wir vollkommen auf uns selbst zurückgeworfen, isoliert und allein gelassen mit der Nacktheit des ersten Eindrucks, einem Empfinden, einer Emotion. Das ist beängstigend, treten wir jedoch aus diesem Moment heraus und begreifen, dass wir nicht alleine sind, mit dieser Emotion, gewinnen wir unsere Souveränität zurück und dem ersten Schrecken weicht ein Ausdruck: die Empörung.
Die Geschichte der Literatur ist immer eine Geschichte der Moral. Die Vorstellung, dass die Literatur bloße Unterhaltung sein könnte, basiert auf einem idealisierten Verständnis der Moral. Einer Idee, dass die Moral etwas von uns getrenntes sei, etwas Externes, das von außen, im Nachhinein hinzutritt. Die Moral ist aber immer da, lauert in jedem noch so banalen Urteil, in unserem tiefsten Innern als Vorurteil. Natürlich ist auch das ein rein metaphysischer Gedanke, als hätte die Moral irgendeine reale Existenz, aber wenn wir eine Behauptung über die Moral aufstellen können, dann doch wohl, dass die Moral nie isoliert, An-Sich in der Welt auftritt; sie ist immer gebunden, steht immer in Bezug zu jemanden oder etwas.
Doch so als Vorurteil verstanden, kann mit Moral keine allgemeine Norm, Regel, Gesetz oder Imperativ gemeint sein. Ein solches Moralvermögen würde ein viel komplexeres Urteilsvermögen benötigen als ein aus unserem Bewusstsein herausgeschältes Erschrecken. Eine solche Moral müsste zumindest ihren Anspruch nach die Notwendigkeit besitzen, das Vorurteil als solches zu erkennen, zu hinterfragen und zu revidieren – und an dieser Stelle kommt die Vernunft ins Spiel. Wir treten in eine Distanz zu unserem ersten Eindruck, zu unserem Gefühl, und erst jetzt sind wir bereit, uns dem ersten Schrecken zu stellen und ihn zu beleuchten. Jetzt steht er still, als Teil des Kunstwerks; eingebettet in einen gewaltigen Schatten aus Kontext, Umwelt und Zeit, können wir ihn von außen betrachten und versuchen zu verstehen, was es war, das in uns den Schrecken ausgelöst hat.
Mit diesem Paradox aus Emotion und Vernunft, Vorurteil und Urteil spielt die Literatur. Das Ziel jeder Literatur, sei sie auch noch so trivial, ist es dieses Paradox für sich zu nutzen und das Vorurteil ad absurdum zu führen, durch Einfühlungsvermögen, Empathie, die Fähig sich in das Hineinzuversetzen, was mir fremd, unbekannt und abgründig ist.
Doch nicht jede Form der Literatur stürzt sich selbst in ihren Abgrund, wo die Gefahr lauert, sich selbst und den Verstand zu verlieren. Kein Stil ist schwieriger, als der Stil, der die Lesenden in die Finsternis wirft und sie mit der hässlichen Fratze der Grausamkeit konfrontiert. Sich Urteilsfrei in den Abgrund zu stürzen und sich nicht nur der Unmöglichkeit dieses Unterfangen bewusst zu sein, sondern am anderen Ende auch noch mit einem verständlichen Wort herauszukommen, ist ein wahnsinniges Unterfangen – denn selbst das gefundene Wort ist ein Schweigendes, es besitzt keine Stimme. Das ist es, was Georges Batailles das Böse der Literatur genannt hat: Die Souveränität, seine eigene Sprache beim Sprechen zu verschlucken.
Und genau hier liegt die Gefahr dieser Literatur: Sie entzieht sich einem klaren Urteil. Ihre Moral liegt in unserer Empörung und ihre eigentliche Grausamkeit besteht darin, dass sie uns mit dieser Empörung vollkommen alleine lässt. Sie nimmt uns nicht bei der Hand und leitet uns den Weg, sie lässt uns völlig im Dunkeln, alleine mit unseren Empfindungen. Sie übergibt die Verantwortung an uns, ein Urteil zu fällen, das Vorurteil aufzubrechen und öffnet damit alle Schranken für den größten Feind der Literatur: das Missverständnis.
Warum gerade ich, ein unbekannter Schriftsteller, der schon mehr als einmal an dieser Unmöglichkeit gescheitert ist, in den Wahnsinn dieses kurzen Buches einleiten soll, wird wohl ein Rätsel bleiben – ich, der bereits gezwungen war, sich der Empörung zu stellen und gegen die Ohnmacht des Vorurteils anzukämpfen, ausgerechnet ich, dessen poetische Pathetik, sie, die Autorin, als einen verzweifelten Krampf gegen die Unmöglichkeit der Sprache, bezeichnet hat. Vielleicht ist es das unausgesprochene Vertrauen, dass zwischen unbekannten Dichter*innen besteht, die sich in den Wahnsinn dieser Nacht begeben, vielleicht ist es auch die Sicherheit einer vertrauten Stimme, der unausweichlichen Gefahr des Missverständnisses nicht alleine entgegenzutreten.
Martina Müller, ein Name wie ein Versteckt, unauffällig, alltäglich. Hinter diesem Namen versteck sich keine Person, die sich nach Aufmerksamkeit, Anerkennung oder Rampenlicht sehnt. Vielmehr finden wir, die in ihre Tiefen eintauchen, eine Autorin, die versucht, eine Sprache für das Unaussprechliche zu finden und die Welt, wie sie sich vor unseren Augen verbirgt, in eine Form zu bringen. Ihre Geschichten erzählen nicht von der Alltäglichkeit, auch wenn sie sich nie wirklich von ihr entfernen. Sie richten sich nach innen, in die Abgründe der Figuren, der Personen, der Gesellschaft. Wer meint, dass es hier um einfache obszöne Pornografie geht, hat keine der Geschichten verstanden.
Drei Geschichten, deren Form man erst erkennt, wenn man sie beendet hat. Es ist eine sanfte Steigerung der Intensität mit jedem Wort. Die Lesenden werden nicht einfach ins kalte Wasser geworfen, sondern ganz langsam herangeführt an den Schock der Empörung. Da ist zunächst das Laternenlicht. Eine kleine Geschichte über einen Außenseiter, der im ersten Moment wie ein ekelerregender Perverser wirkt. Doch beim genauen Hinsehen erkennt man die Einsamkeit dieser Figur, die Unfähigkeit zur Sprache und zum Ausdruck und sein tiefes Bedürfnis nach Wärme und Vertrauen. Der eigentliche Trick liegt in der Perspektive: Die Erzählstimme folgt der Figur. Wir erfahren nicht, was wirklich passiert ist, nur was Martin denkt. Es kommt einem fast so vor, als würde er sein tragisches Schicksal selbst heraufbeschwören.
Acéphal, ein Titel, der an die französischen Surrealisten und den kopflosen Gott anspielt. Ein oberflächlicher Thriller, der an Bonnie und Clyde erinnern, hinter dem sich aber eine klaustrophobische Geschichte über Macht und den Wahnsinn der Liebe verbirgt. Im Gegensatz zur einsamen Stimme im Laternenlicht werden wir hier von einer Stimmenvielfalt überrascht. Neben der Stimme der Moral, die uns in Form des Detektivs Harry begegnet, werden wir vor allem mit einem Dialog zwischen Opfer und Täter, zwischen Macht und Ohnmacht konfrontiert – interessant ist, dass gerade die Stimme, die die gesamte Zeit tonangebend zu sein scheint, die wenigsten Präsenz besitzt, schweigend sitzt sie auf einem Stuhl und beobachtet.
Doch das eigentliche Meisterwerk dieses kleinen Büchleins ist die letzte Geschichte: Die Puppe. Die Puppe ist sicherlich die anspruchsvollste der drei Geschichten. Neben ihrem eigentlichen Titel ist sie sowohl als Traum als auch als Parabel betitelt. Als Traum kann sie alles Mögliche sein, zum Beispiel ein Alptraum, der uns aufschrecken soll, doch als Parabel will sie ein Lehrstück sein. Was die Lehre sein soll, bleibt der Interpretation vorbehalten, das Thema der Geschichte hingegen ist eindeutig: das ewige Mehr, der Exzess. Anders, als die Ekstase, die im ewigen Moment verharrt, verlangt der Exzess immer das Übermaß, die Hybris. Verhangen in dieser Hybris steuern wir unausweichlich auf die notwendige Konsequenz zu –
eine Konsequenz, die alle Geschichten gemein haben.
Hier schließt sich der Kreis und wir schließen das Buch. Unser Blick fällt erneut auf den Umschlag: Eine dunkle Blume ist ein romantisches Symbol für das Unheimliche, das Verborgene, das Unbekannte, sie verkörpert alles, was sich in Schatten hüllt. Doch noch stehen wir am Anfang und müssen uns fragen, ob wir wirklich in das zitternde Licht der Laterne treten wollen. Eine offene Hand – nimm sie nicht an, noch kannst du dich umentscheiden
Dennis Klofta
Ein Stück Leben dringt durch einen Türspalt
das Auge starrt – erschrocken, doch fasziniert
still, verharrend im ewigen Moment
ein verstörter Schrecken: der Akt des Voyeurs.