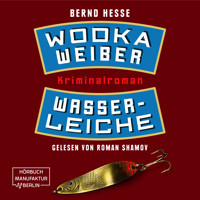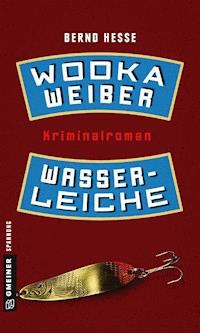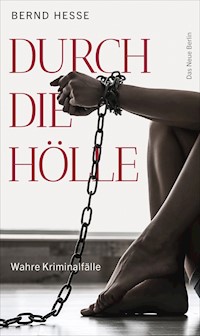
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Das Neue Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drogenschmuggel, Menschenhandel und brutaler Mord – wahre Kriminalfälle Selbst einem Strafverteidiger kann das Blut in den Adern gefrieren, wenn grausame Taten verhandelt werden und, mehr noch, die erschütternden Schicksale der Opfer ans Licht kommen. Was sich im Gerichtssaal abspielt, ist - bestenfalls - das verdiente Ende der Täter. Strafverteidiger Bernd Hesse kennt und erzählt die Geschichten von ihrem Ausgangspunkt an und in allen Verästelungen, wahre Kriminalfälle aus dem Bereich der "Organisierten Kriminalität", Mädchenhandel, Drogenschmuggel; Taten auch, die aus tragischen Verwicklungen "ganz normaler Bürger" resultierten. Ein geständiger Mörder – aber hat er wirklich seine reiche Cousine erschlagen, die Geld verlieh, das Letzte aus ihren Gläubigern herauspresste und vor der eigenen Familie nicht haltmachte? Schützt der Geständige seine Familie? Ohne Sensationslust und versiert von allen Seiten beleuchtet, erzählt Hesse in "Durch die Hölle" wahre Kriminalgeschichten und lässt seine Leser dabei an der packenden Recherche und den teils grausigen Einzelheiten der Verbrechen teilhaben. So auch in dem Fall eines Jurastudenten, der seine Eltern ermordete, sie mit der Kettensäge zerteilte und abschließend verbrannte. Ungeschönt erläutert Hesse in seinem Buch Hergänge brutaler Taten, Täterprofile und deren Verhandlungen vor Gericht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wir danken der Autorin Cornelia Lotter für die Verwendung ihres Titels »Durch die Hölle« (2016). Das Buch ist exklusiv über Amazon erhältlich.
Alle Rechte der Verbreitung vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist nicht gestattet, dieses Werk oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen oder in Datenbanken aufzunehmen.
Verlag Das Neue Berlin – eine Marke der Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage
ISBN E-Book 978-3-360-50159-2
ISBN Print 978-3-360-01345-3
1. Auflage 2019
© Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlinunter Verwendung eines Fotos von Africa Studio, AdobeStock
www.eulenspiegel.com
Über das Buch
Täter vor Gericht: Strafverteidiger Bernd Hesse kennt und erzählt ihre Geschichten vom Ausgangspunkt an und in allen Verästelungen. Wahre Kriminalfälle aus dem Bereich des »Organisierten Verbrechens« und dem Rotlichtmilieu, der Doppelmord eines Jurastudenten an seinen Eltern, die Tat eines geständigen Mörders, die Zweifel aufkommen lässt an der Wahrheit seines Geständnisses. Spannende Lektüre, die in tragische Verwicklungen »ganz normaler Bürger« und in seelische Abgründe blicken lässt.
Über den Autor
Bernd Hesse wurde 1962 in Bad Saarow geboren. Nach Schulzeit, Abitur und Ausbildung arbeitete er als Rohrleitungsmonteur für Erdölanlagen. Er studierte Jura an der Freien Universität Berlin und promovierte zum Dr. iur. Nach einem Studium der Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Literaturwissenschaft/Linguistik promovierte er zum Dr. phil. Er betreibt eine Rechtsanwaltskanzlei in Frankfurt (Oder) sowie in Berlin, ist als Strafverteidiger tätig und Lehrbeauftragter der Juristischen Fakultät der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder). Neben einer Vielzahl juristischer Publikationen veröffentlichte er die Kriminalromane »Rubel, Rotlicht und Raketenwerfer« und »Wodka, Weiber, Wasserleiche«. Im Verlag Das Neue Berlin erschien die Sammlung authentischer Kriminalfälle »Die Hinrichtung«.
Inhalt
Sieben Leben
Der Jurastudent, der seine Eltern zerstückelte
Durch die Hölle
Sieben Leben
Das Testament
Paulina Persokeit saß in einem bequemen, alten Ohrensessel, vor sich auf dem Tisch ein Fläschchen und ein Glas sowie ein paar Dokumente.
Es hätte das mit dem Leben in Einklang stehende Bild einer würdig in die Jahre gekommenen älteren Dame sein können, das sich dem Betrachter bot, wenn da nicht die ohnehin nur noch schlecht sehenden Augen gewesen wären, die zusammengekniffen die vor ihr liegenden »Schuldscheine« fixierten. Paulina rechnete zufrieden die Beträge zusammen, die sie von ihren Schuldnern, auch der angeheirateten Verwandtschaft, eintreiben lassen würde. Mit runzeliger, zittriger Hand schenkte sie sich ein Glas ein, um gleich besser schlafen zu können. Es war kein »guter Tropfen«; für so etwas war sie nicht bereit, extra Geld auszugeben. Ein Goldbrand aus dem kleinen Dorfladen tat es auch. Einen guten Schnaps hatte sie zuletzt getrunken, als sie den alten Architekten eingewickelt hatte, der ihr das Haus herrichten sollte. Aber nachdem er seine Schuldigkeit getan hatte, gab es keinen Grund mehr, für irgendjemanden einen besonderen Tropfen bereitzuhalten.
Natürlich würden diese Schnorrer angekrochen kommen, wenn sie sie einlüde. Aber darauf konnten die lange warten. Sie hatte sogar den großen Tisch wieder aus dem Haus entfernen lassen, damit niemand auch nur auf die Idee käme, sich bei ihr einzuladen. Sie kam nicht auf den Gedanken, dass sich freiwillig niemand zu ihr einladen würde.
Ihre meist abendlichen Gäste wollten unerkannt bleiben und kamen im Schutze der Dunkelheit. Niemand gab öffentlich zu, einer ihrer Schuldner zu sein, und dennoch standen so viele mit ihr im Bunde.
Kurz überlegte die alte Persokeit, ob sie das Auto nicht doch noch in die Garage fahren sollte, bevor es jemand stehlen könnte. Sie entschied sich dagegen. Es war ja nicht ihr erster Schnaps gewesen, und es war schon dunkel. Das fehlte ihr noch, dass sie versehentlich mit dem Auto in den nahen See abrutschte und wie eine Katze aus einem Wurf, den niemand haben wollte, ersaufen würde! Da würden sich viele ihrer Schuldner aber freuen, wenn sie verreckte. Diese Freude würde sie ihnen nicht bereiten.
Als sie nun die Dokumente in dem sehr alten und hübsch anzusehenden Sekretär verschloss, spürte sie, wie die kurze Freude, die sie beim Rechnen empfand, erlosch. Ein verzerrtes Lächeln zeichnete sich auf ihrem Gesicht ab, als sie darüber nachdachte, wie viele von diesen einfältigen Menschen in diesem ungeliebten Dorf von ihr abhängig waren. Die waren alle nicht in der Lage, alleine zu wirtschaften und zu leben. Sie brauchte niemanden weiter, um glücklich zu sein. Bei diesem Gedanken schüttelte sie unmerklich den Kopf. Nein, glücklich, das war auch sie nicht. Aber was war das schon, dieses »Glück«? Ein flüchtiger Moment, ohne den es sich auch leben ließ. Sollten diese anderen Kreaturen sich doch etwas vormachen, ihre Fratzen auf Fotos oder diesen neumodischen Selfies zu einem Lächeln verziehen – sie kannte die wirklichen Gesichter dahinter, wenn sie zu ihr kamen und bettelten. Da lächelte keiner.
Sie sinnierte, dass sie eigentlich nie in dieses idyllisch im Oderbruch gelegene Dorf gehört hatte. Aber wer gehört schon wirklich in ein Dorf, der dort nicht geboren und aufgewachsen ist? Das kann vielleicht eine zweite Generation bewerkstelligen.
Dafür war sie hier im Dorf in aller Munde, und das verschaffte ihr ein wenig Genugtuung. Es freute sie, wenn die Leute im kleinen Dorfladen anfingen zu tuscheln, sobald sie eintrat, sich aber niemand getraute, sie direkt anzusprechen. Das wünschte sie auch nicht. Und die angetrunkenen Bauern am Stehtisch in der Ecke des Ladens, mit denen wollte sie offiziell auch nichts zu tun haben. Wenn sie ihre Wirtschaft mal wieder schlecht geführt hatten, ein weiteres Balg ins Haus stand, etwas am Haus gerichtet werden musste oder nur mal ein Wunsch in Erfüllung gehen sollte, den sie sich nicht leisten konnten, und Geld benötigten, das ihnen keine Bank mehr bereit war zu geben, dann kämen sie schon angekrochen.
Paulines Vater, Ottmar Persokeit, war durch die Kriegswirren nach Brandenburg gelangt und hatte festgestellt, dass man auf dem Land nicht so sehr hungerte wie in der Stadt. Er nahm sich eine junge Frau, deren Mann im Krieg gefallen war, zeugte eine Tochter und faulenzte herum. »Das Land ist viel zu schön, um es zu bearbeiten«, meinte er immer. Als man ihn aus dem Dorf vertrieb, hatte die Mutter Paulina, ein widersetzliches und nur aufs Geld schielendes Kind, dem faulen und genauso dem Hang zum Gelde verfallenen Vater gleich mit an die Hand gegeben. Der Vater schaute sich – gut sechs Jahrzehnte war das her, aber was bedeutet das in einem Dorfe schon! – im nächsten Ort nach einem der größeren Häuser um und wurde fündig: Das Staroski-Haus verhieß eine gute Partie.
Nach einiger Zeit heiratete Ottmar die Tochter eines der reichsten Bauern des Dorfes, Gudrun Staroski. Sie hatte einen spät geborenen Bruder, der zu dieser Zeit noch ein Kind war. Gudruns Vater warnte vor dieser Verbindung mit einem Tagedieb und Taugenichts. Wann je hätten verliebte junge Mädchen auf derlei Warnungen der Eltern gehört?
Der Standesunterschied zwischen Ottmar Persokeit und Gudrun wurde scheinbar aufgehoben, als die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft gegründet wurde. Die Ländereien von Gudruns Vater weckten die Begehrlichkeiten der LPG. Gudruns Vater war mit seinem Eintritt in die LPG zwar nicht enteignet worden, denn er hatte ja einen Genossenschaftsanteil, aber dass jemand sein Land je zurückbekäme, schien ausgeschlossen.
Gudruns Vater verstarb und niemand hielt es für nötig, sie und den viel jüngeren Bruder überhaupt noch als Erben von Land, dessen Gemarkungen kaum einer mehr kannte, in die Grundbücher eintragen zu lassen. Der Grundstücksverkehr selbst war in diesem Teil des Landes nahezu zum Erliegen gekommen. Der alte Staroski blieb auch nach seinem Tode im Grundbuch stehen.
Gudruns und Ottmars Ehe blieb kinderlos, und so schien es Gudrun auch nur recht, in den Achtzigerjahren zusammen mit ihrem Mann ein Testament aufzusetzen, wonach Ottmars Tochter Paulina Persokeit nach dem Letztverstorbenen alles alleine erbe. Von diesem Testament erzählte Gudrun ihrem Bruder, dem sowieso sein Teil vom Land des Vaters zustand, nichts, da sie mit ihrem Erbteil ja machen könne, was sie wollte, und für Paulina hatte es zunächst wenig Bedeutung: Das Land war von der LPG vereinnahmt worden und der wirtschaftliche Wert des zwar großen, aber ebenso alten Bauernhauses tendierte gegen null. In den Orten des Oderbruchs, in denen ebenso große Häuser standen, wurden diese mittlerweile zur Betreibung von Kindergärten, Dorfläden, Klubhäusern und Ähnlichem genutzt. So konnten wenigstens einige Mittel für die Instandsetzung dieser Gebäude gewonnen werden.
Das alte Staroski-Haus, das von den Einheimischen auch heute noch so genannt wird, obwohl die Persokeits einige Jahrzehnte lang darin gewohnt hatten, verfiel nach und nach. Nur die allernotwendigsten Reparaturen wurden durchgeführt. Für mehr waren weder Geld noch Mittel da, geschweige denn Fleiß des neuen Hausherrn.
Das Haus hätte insbesondere wegen der Feuchtigkeitsschäden grundlegend saniert werden müssen. Die Instandsetzung war zu DDR-Zeiten kein leichtes Unterfangen. Um die notwendigen Arbeiten realisieren zu können, brauchte man Verwandte und Freunde. Von den Staroskis wollte Ottmar Persokeit keine Hilfe annehmen. Er schaffte es sowieso sein Lebtag, sich mit allen Menschen zu überwerfen, ausgenommen mit seiner Tochter Paulina, die jedoch ihrerseits wenig von ihrem Vater und noch weniger von der Stiefmutter Gudrun wissen wollte. So gab es für das immer weiter verfallende Haus keine Hilfe; es schien seinem Ende entgegenzugehen.
Paulina hasste das Dorf, das nach Moder riechende Haus, die im Dorfe lebenden Menschen und ihre Lebensweise. Sie strebte nach Höherem, worunter sie Ansehen, eine nicht in körperlicher Arbeit bestehende Beschäftigung, Geld und ein schönes, neues Haus verstand. Weshalb Menschen darauf stolz waren, etwas mit ihrer Hände Arbeit zu schaffen, das blieb ihr ewig ein Rätsel. Wenn die Verwandtschaft ihrer Stiefmutter vom Feld kam, schmutzig, geschafft und müde, dann wusste sie genau, dass das nicht die Arbeit war, die sie machen wollte. Und es war noch mehr: Paulina schaute auf diese Menschen herab. Die konnten getrost hierbleiben; sie jedoch musste weg.
Gudruns Bruder wurde sehr viel später Vater zweier Söhne, Matthias und Uwe Staroski. Sie waren mehr als eine Generation jünger als ihre Cousine Paulina, zu der sie nur selten Kontakt hatten. Matthias, der ein wenig ältere Bruder, schien eher besonnen, legte schon zeitig etwas Ehrgeiz an den Tag und musste seinen jüngeren Bruder Uwe aus vielerlei Situationen retten, in die der immer wieder hineinschlitterte. Hatte Uwe im Dorfe wieder jemanden provoziert und es stand eine Prügelei ins Haus, stand Matthias seinem jüngeren Bruder zur Seite.
Paulina hatte zum Zeitpunkt der Geburt ihrer Cousins Matthias und Uwe das Dorf längst verlassen und war gen Süden nach Frankfurt an der Oder gezogen, wo sie einen Arzt heiratete, mit dem sie einige Jahre später das Land in Richtung Westen verließ und wo Tochter Paula zur Welt kam.
Als Ottmar Persokeit verstarb, reiste Paulina Ende der Achtzigerjahre ohne ihren Mann zur Beerdigung ihres Vaters in den Osten. Sie fuhr ihren Mercedes nicht ohne Stolz auf das, was sie aus ihrer Sicht erreicht hatte, durch das Dorf, welches sich in den Jahren nur wenig verändert hatte. Sie sah sich in ihrem Entschluss, das alles hinter sich zu lassen, nur bestätigt. Mit diesen Menschen hier hatte sie aber auch gar nichts mehr gemein. Die ließen sich vom Schicksal nur treiben, ohne ihr Leben und ihr wirtschaftliches Schicksal wirklich in die Hände zu nehmen. Ihre Verachtung für diese Menschen konnte sie nicht immer verbergen; besondere Mühe gab sie sich damit auch nicht.
Ihre Cousins Matthias und Uwe hatten die Schule bereits abgeschlossen, Matthias lernte den Beruf des Klempners und Installateurs, was ihm aufgrund seines handwerklichen Geschicks und technischen Verständnisses auch lag, und Uwe den des Agrotechnikers, mit dem er sich nicht so recht anfreunden konnte. Die beiden Jungen schlichen, nicht unbemerkt von ihrer alten Cousine, häufig um deren Mercedes C-Klasse-Modell herum, was ihrer Eitelkeit schmeichelte.
Zu Paulinas Verwunderung traf zur Beisetzung das halbe Dorf ein. Nachdem Ottmar unter die Erde gebracht worden war, begriff sie, dass alle Besucher nur ihrer Stiefmutter Gudrun Trost und ein paar nette Worte spenden wollten. Über Paulinas Vater Ottmar verlor selbst bei dieser Gelegenheit kaum einer ein gutes Wort. Nur der Trauerredner sprach von einem liebevollen Ehemann und Vater, von einem Bauern, der geachtet worden sei und seinen Platz in der Dorfgemeinschaft gefunden hatte. Einige der Trauergäste mussten sich bei dieser Rede ein Lächeln verkneifen.
Die engere und weitere Verwandtschaft traf sich nach der Beisetzung in dem unansehnlichen Bauernhaus.
Paulina konnte mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg halten: »Das Klingelschild habt ihr zwar sehr schön beschriftet, aber ansonsten sieht es traurig aus!«
Während der Feier hörte Paulina, wie Gudruns Bruder seiner Schwester anbot, mit seinen beiden Jungen am Haus zu helfen. Matthias könne die Wasserinstallation erneuern.
»Jetzt ist das doch möglich, oder?«, fragte er seine Schwester.
»Das wäre schön. Gerade oben am Giebel, da müsste was gemacht werden. Da kommt der Regen durch. Das Holz darunter ist schon morsch.«
»Das habe ich gesehen. Das bekommen wir schon hin.«
»Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ja, und die Wasser- und Abwasserleitungen müssten auch erneuert werden. Ein paar Jahre möchte ich hier schon noch leben«, sagte Gudrun und blickte dankbar zu ihrem Bruder.
»Ehrensache! Es ist doch unser Vaterhaus.«
Dass dereinst Paulina dieses Haus erben würde, davon ahnten weder er noch seine Jungen etwas. Paulina verfolgte interessiert das Gespräch zwischen den Geschwistern und war nicht abgeneigt, wenn diese etwas zur Wertsteigerung ihres künftigen Erbes beitrügen.
Am Abend zeigte Paulina Fotos von spanischen Stränden und ihrem Ferienhaus an der dortigen Küste. Bewundernd schauten die Gäste die Bilder an und reichten sie weiter.
»Warum ist denn dein Mann auf den Bildern nicht zu sehen?«, erkundigte sich Gudrun. »Der hat wohl immer fotografiert?«
Paulina schüttelte den Kopf. »Die Bilder hat meist Paula gemacht. Mein Mann hat so viel Arbeit in der Klinik und dann hier noch einen Kongress und da noch einen Vortrag, da konnte er nicht mit nach Spanien reisen.«
»Ihr macht getrennt Urlaub?«, stellte Gudruns Bruder mehr fest, als dass er fragte.
»Das ist bei uns völlig üblich«, erklärte Paulina.
»Bei uns auch«, erwiderte Gudruns Bruder grinsend, »wenn man den anderen satt hat.«
Es folgte ein Streit über Urlaub, den man im Westen, und solchen, den man im Osten machte, über zugeteilte Urlaubsplätze in Urlauberheimen der DDR und Reisefreiheit und individuelle Urlaubsgestaltung im Westen.
Das konnte aber nicht verhindern, in Matthias und Uwe beim Anblick der Strände das Fernweh zu wecken. Es blieb Paulina nicht verborgen.
»Wenn ihr rüberkommt«, bot sie ihnen an, »könntet ihr euch um dieses Haus kümmern, nach dem Rechten sehen und in Spanien Urlaub machen.«
Gudruns junger Bruder fuhr dazwischen: »Du spinnst! Die Jungs sollen das Risiko auf sich nehmen, in den Westen abzuhauen, für Jahre in den Knast zu gehen, um bei dir den Hausmeister zu spielen?«
Paulina schüttelte mit dem Kopf. »Wenn ihr Staroskis zu dumm seid, eine Chance zu erkennen und zu ergreifen, dann tut es mir leid.«
Sie blickte ihre Cousins an, sah in Matthias’ blaue, gütig wirkende Augen, und die nach ihrer Meinung verschlagenen kleinen Iltisaugen von Uwe, deutete auf Matthias und erklärte: »Eigentlich brauche ich nur den. Der scheint ja der Tüchtigere von beiden zu sein.«
Erzürnt gab Gudruns Bruder zurück: »Meine Jungs lasse ich nicht auseinanderdividieren. Die Persokeits sind vor fast dreißig Jahren hier nur mit dem, was sie am Leibe trugen, und einem Koffer eingefallen und haben jetzt Land und Haus meiner Eltern.«
Paulina nickte. »Was meine Ansicht nur bestärkt, dass die Persokeits gewiefter sind als die Staroskis. Aber«, meinte sie sich umschauend, »so weit ist’s mit dem Haus ja auch nicht mehr her und das Land, na ja, das hat nun eure LPG.«
Als Paulina am nächsten Morgen in ihren Benz stieg, um abzureisen, musste sie sehen, dass der Stern auf der Motorhaube abgebrochen war und nur noch ein kleiner Stummel emporlugte. Sie stieg aus und fluchte.
»Solche Vandalen!«, schimpfte sie. »Hier im Osten wissen die Eigentum nicht zu schätzen.«
»Im Westen werden auch die Sterne geklaut«, hielt Uwe dagegen.
Paulina schaute ihn giftig an. »Das habt ihr wohl in eurem Schwarzen Kanal über den Westen gehört?«
Nun war es Matthias, der entgegnete: »Bei Böll gelesen, in ›Frauen vor Flusslandschaft‹.«
Es schwang Erstaunen in der Stimme, als sie fragte: »Du liest?«
Die Gruppe blickte zu Matthias, der das mit einer Art entschuldigender Geste und einem »Hm« bestätigte. Ein wenig sonderbar erschien er der Familie schon.
Gudrun, ihr Bruder und die beiden Jungen gingen dichter ans Auto, um das Malheur zu betrachten.
Paulina blickte ihren jungen Cousins abwechselnd in die Augen, entschied sich für Uwe und schrie diesen an: »Du warst das, Staroski! Von dir bekomme ich den Schadensersatz.«
»Lass meinen Jungen aus dem Spiel!«, forderte sein Vater.
Matthias protestierte für beide Brüder: »So was machen wir nicht!«
Und auch Gudrun stand ihnen zur Seite: »Paulina, von der Familie macht doch so was keiner!«
»Das ist mir eine feine Familie. Ich habe jetzt auch noch den ganzen Ärger mit der Versicherung.«
Matthias ging dicht an das Fahrzeug heran und betrachtete den Rest des Sternenfußes. Kenntnisreich gab er zum Besten: »Der das gemacht hat, hat nicht Böll gelesen. Dort wird kräftig gegen den Stern geschlagen und dieser herausgedreht. So bekommt man den ganzen Stern heraus. Hier hat jemand mit Gewalt am Stern gehebelt, bis der an der Sollbruchstelle nachgab.«
Paulina schüttelte den Kopf. »Bedienungsanleitungen für Diebe schreiben und dafür noch den Nobelpreis kassieren! Das ist ja abartig! Wer Böll liest, der kann auch gleich im Osten bleiben. Dafür habe ich keinerlei Verständnis.«
Nachdem Paulina abgefahren war, nahm Uwe seinen Bruder beiseite und zog etwas aus seiner Hosentasche. Stolz präsentierte er den in der Sonne glänzenden Mercedes-Stern.
Als Paulina einige Zeit nach ihrer Reise vom Verhältnis ihres Mannes mit einer jüngeren Arzthelferin erfuhr, ließ sie über ihren Anwalt einen Scheidungsantrag einreichen. Parallel zum Scheidungsverfahren einigten sich die Eheleute durch eine notarielle Scheidungsfolgenvereinbarung darauf, dass Paulina das Haus, in dem sie wohnte, und eines der Ferienhäuser an der spanischen Küste erhielt. Und da gab es noch ein kleines Detail: Die Tochter Paula, die es ja auch noch gab, die durfte der Vater behalten.
Nach dem Fall der Mauer kehrte Paulina ins Oderbruch zurück, kaufte sich in Dorfnähe ein einzeln stehendes Bauernhaus in bester Lage, direkt am See, ließ es mithilfe eines neuen Bekannten, eines pensionierten Architekten, wiederherrichten und trennte sich, als das Haus fertig war, wieder von ihm.
Paulina prahlte nicht mit ihrem Geld und ihren Immobilien. Alle wussten, dass sie es zu einem ansehnlichen Vermögen gebracht hatte. So war sie nicht abgeneigt, dem ein oder anderen Bauern, dem die Banken keine Kredite mehr gewährten, finanziell unter die Arme zu greifen, wenn er Hilfe benötigte. Sie nahm als Sicherheit neben Bürgschaften und Belastungen von Grundstücken auch Familienschmuck, Jagdwaffen, Fahrzeugbriefe mit Zweitschlüsseln und so mancherlei anderes Erlaubtes und auch andere Dinge entgegen. Die Zinsen, die sie sich versprechen ließ, waren überhöht, aber die Bittsteller hatten keine Wahl.
Die von Uwe betriebene Landwirtschaft geriet in Zahlungsschwierigkeiten; auch hier half sie aus. Als er seine erste Rate zurückzahlen wollte, zog die Alte zusätzlich 200 Euro ab. Auf Uwes Frage, was das solle, antwortete sie: »Für den abgebrochenen Mercedes-Stern damals, nebst Zinsen für zwanzig Jahre.«
Uwe hatte immer wieder Probleme, die Pacht für die Ländereien zu zahlen, die er hinzupachten musste, um die Landwirtschaft wirtschaftlich betreiben zu können. Ohne die von seiner Tante Gudrun zu Familienpreisen gepachteten Flächen wäre es sowieso nicht rentabel gewesen.
Matthias und Uwe kümmerten sich weiter um das Haus ihrer Tante Gudrun und um die Tante selbst, als sie ein Pflegefall wurde. Sie änderte aus Dankbarkeit das Testament, welches zunächst nur Paulina bedacht hatte, zugunsten ihrer Neffen. Als sie starb, gab es einen langwierigen und kostspieligen Rechtsstreit um Gudruns Erbe. Sie hätte nach dem Tod ihres Ehemannes das ursprüngliche gemeinschaftliche Testament nicht mehr einseitig zu Paulinas Lasten ändern dürfen.
Paulina erbte Haus, Hof und den Acker ihrer Stiefmutter, wie es im ursprünglichen Testament niedergeschrieben war. Dabei handelte es sich um die Ackerflächen, die Uwe unbedingt benötigte. Die Pachtverträge mit Uwe kündigte Paulina jedoch mit sofortiger Wirkung, und sicherheitshalber sandte sie auch noch ordentliche Kündigungen der Landpachtverträge hinterher, um das Land an eine Agrargesellschaft verkaufen zu können, die einen anderen Pächter auf dem Land nicht duldete. Diese Kündigungen hätten wieder den wirtschaftlichen Untergang des Landwirtschaftsbetriebes bedeutet. Also verklagte diesmal Uwe seine Cousine. In diesem erneuten Rechtsstreit wurde festgestellt, dass Paulina die Pachtverträge nicht ohne Weiteres hätte kündigen dürfen. Die außerordentlichen Kündigungen wurden kassiert, jedoch blieben die Kündigungen rechtens und in der Welt, die mit ordentlicher Kündigungsfrist ausgesprochen worden waren. Folglich war es nur eine Frage der Zeit, wann Uwe das ursprünglich von Tante Gudrun gepachtete Land zurückgeben musste; die Uhr tickte.
Nun musste auch Matthias wegen des Ausfalls mehrerer Zahlungen eines Großkunden bei der Cousine um einen Kredit bitten. Der Ärger mit Uwe war für sie kein Grund, um auf das Geschäft mit Matthias zu verzichten, den sie von den beiden Brüdern ohnehin immer vorgezogen hatte.
Die Alte hatte all die Unterlagen, auch die zu ihren Neffen, wieder im Sekretär verschlossen. Sie erhob sich aus ihrem Sessel. Es war spät geworden. Mit schweren, müden Beinen ging sie eine Etage hinauf in ihr Schlafzimmer. Bevor sie in einen leichten Schlaf hinabtauchte, dachte sie kurz darüber nach, ob es nicht doch besser gewesen wäre, das Fahrzeug in die Garage zu fahren.
Sie wusste nicht, wie spät es war, als sie wieder erwachte. Das Bett war noch nicht warm. Lange konnte sie nicht geschlafen haben.
Was war das? Ein Geräusch, das nicht in das Haus passte. Wach war sie ohnehin. Da konnte sie auch gleich nachschauen, was es da gab. Einbrecher? Das würde hier keiner wagen. Und wenn doch, denen würde sie schon Beine machen. Sicher war es wieder ein Iltis oder so ein komischer Nager, der sich im Dachstuhl des Hauses eingenistet hatte.
Sie stand auf und machte sich auf die Suche. Das konnte es doch nicht geben! Da stand ein großer Mann in Handschuhen und mit einer lächerlich wirkenden Skimaske über dem Kopf.
»Was machen Sie denn hier? Aber raus aus meinem Haus!« Beherzt ging sie auf den Mann zu. »Ich spreche mit Ihnen. Antworten Sie gefälligst! Was soll diese Scharade? Von wegen ›Ihnen‹«, meinte sie, die Augen zusammenkneifend, »ich weiß ganz genau, wer du bist! Du siehst selbst in dieser Verkleidung lächerlich aus.«
Der Einbrecher stand nur wortlos da und wusste nicht, was er nun machen sollte.
Die Alte stellte sich dicht vor den großen Mann und musste sich ziemlich recken, um ihm die Maske vom Kopf zu reißen. »Wusste ich’s doch, der …«
Der Mann griff den Hals der Alten und drückte zu. Drückte immer noch zu, als ihre Beine schon wichen.
Das Beispiel »Jauchegrube-Fall«
Am Ende der bepackten Arbeitswoche in verschiedenen Gerichten des Landes ging es wieder zu unserem Kanzleisitz in Frankfurt an der Oder. Ein Blick auf das Smartphone verriet, dass meine Mandantin Frau Wuschich eigentlich schon seit fünf Minuten einen Beratungstermin bei mir hatte.
Als ich die Tür aufschloss, rief mir unsere Rechtsanwaltsfachangestellte Doreen ein »Guten Morgen!« entgegen, ohne mich schon gesehen zu haben, so als ob wir in einem Wettkampf um das erste Grußwort stünden.
»Guten Morgen!«, entgegnete ich munter und warf vom Flur einen ersten Blick in den Empfangsbereich des Büros. Als ich Doreens Haltung und Gesichtsausdruck sah, ergänzte ich sogleich: »Alles klar?«
Unserer Rechtsanwaltsfachangestellten verschlägt nichts so schnell die Sprache. Jedoch musste sie sich einen kurzen Augenblick sammeln. Sie winkte mich heran und mir war klar, dass sie wie immer strikt darauf achtete, dass nicht ein Mandant Kenntnis von den anderen in der Kanzlei bearbeiteten Fällen bekam.
Fast im Flüsterton teilte sie mir mit: »Du bekommst vielleicht eine neue Mordsache. Gleich nach deinem Termin kommt die Mutter des Beschuldigten vorbei. Da konnte ich was verschieben. Ein junger Mann soll die angeheiratete Tante oder Cousine ermordet haben. Irgendwie gleich mehrfach …« Sie verzog den Mund und zuckte, den Inhalt ihrer Aussage selbst bezweifelnd, mit den Schultern.
»Also erst ein Mordversuch und dann ein Mord?«
»Nein. Mehrere Taten.«
»Ah, wie beim ›Mord im Orient-Express‹. Zwölf Täter und jeder sticht einmal zu?«, forschte ich, angesichts des unverfänglichen Themas in die übliche Stimmlage übergehend, weiter.
»Nein, nur ein Täter.«
»Ich fand das bei Agatha Christies Buch immer sehr interessant, aber auch unglaubwürdig.«
»Wir haben aber nur einen Täter und mehrere Tathandlungen.«
»Da wollte aber jemand auf Nummer sicher gehen. Reizender Neffe.«
»Quatsch. So nicht! Der hat irgendwie geglaubt, dass er die Tante schon umgebracht hatte, und wollte nur die Leiche verschwinden lassen. Dabei ist sie dann aber in Wirklichkeit erst gestorben.«
»Ah, der Jauchegrube-Fall«, schoss es mir über die Lippen.
»Wie?«, erkundigte sich Doreen mit erhobener Stimme. »Das hört sich ja eklig an. Man könnte glauben, da gibt’s einen obersten Rat von Juristen, in dem ausgekungelt wird, wie man einem Fall den fiesesten Namen verpassen kann.«
Ich bekam aus dem Augenwinkel mit, dass sich meine wartende Mandantin weit vorlehnte, um den Anlass der Empörung mitzubekommen.
»Ein Klassiker aus den ersten Semestern des Jurastudiums«, entgegnete ich, »jemand erwürgt eine Frau und beseitigt sie anschließend in der Jauchegrube. Was er nicht weiß, ist, dass sie nur bewusstlos war und er sie erst durch das Hineinwerfen in die Jauchegrube getötet hat.«
»So war’s doch mit einem der Staroski-Jungen«, mischte sich Frau Wuschich ungefragt in unser Gespräch ein. Da wir nicht darauf reagierten, fuhr unsere Mandantin fort: »Na, haben Sie das nicht in der Zeitung gelesen? Der Staroski-Matthias hat doch seine eigene Cousine erst erwürgt, dann erschlagen, erstochen, ersäuft, zerstückelt und verbrannt.«
Wir blickten zu Frau Wuschich, die in unser Schweigen Zweifel an ihrer Schilderung interpretierte und ihren Vortrag nun zu bekräftigen suchte.
»Also die war ja auch wirklich zäh, die Alte. Es ist traurig, und so spricht man nicht über eine Tote, das ist mir klar. Aber gemocht hat die niemand im Dorf. So viel ist erst mal sicher.«
»Kein Grund, jemanden abzuschlachten«, kommentierte Doreen.
»Richtig, richtig«, gab Frau Wuschich zu. »Aber die hat Geld zu Höchstzinsen verliehen und sich das Land zur Sicherheit überschreiben lassen, obwohl sie mit der Landwirtschaft überhaupt nichts am Hut hatte. Wenn man den Staroski-Matthias nicht gleich als Täter ausfindig gemacht hätte, wären es viele Bauern in der Umgebung gewesen, die ein plausibles Motiv gehabt hätten, sie zu ermorden. Den anderen Staroski-Jungen, den Uwe, hätte sie durch die Wegnahme des Landes beinah in die Insolvenz getrieben. Der stand kurz davor, seinen Landwirtschaftsbetrieb dichtmachen zu müssen. Und Vater ist der Uwe jetzt auch noch mal geworden. Die Familie wäre ruiniert gewesen. Und nun hatte sie sich darangemacht, den Matthias plattzumachen.«
Ich hatte kein Motiv, Frau Wuschich zu unterbrechen. Auch wenn die Hälfte der Erzählung ausgedacht war oder der dörflichen Legendenbildung entsprang, war ich für jede Information dankbar, die ich schon vor dem ersten Gespräch mit der Mutter meines Mandanten erhielt.
Frau Wuschich fuhr fort: »Sie können mir glauben, dass keiner um die Cousine eine Träne vergießt.«
»Und wie hatte Uwe seine Landwirtschaft vor der Insolvenz noch retten können?«, wollte ich wissen.
»Na, der hat nun von der Erbin der Paulina, deren einziger Tochter Paula, das Land zur Pacht angeboten bekommen. So hat er es nicht wieder zurück, aber kann es wenigstens bewirtschaften.«
»Bei dem jetzt Inhaftierten war es ähnlich?«, erkundigte ich mich.
»Der hat einen gut gehenden Klempnerbetrieb. Sie wissen schon …«
Nein, ich wusste nicht. Noch nicht. Aber Frau Wuschich würde uns gleich aufklären.
»Der soll durch die Insolvenz eines größeren Bauträgers, für den er schon in Größenordnungen die Sanitärinstallation erledigt hatte, in Schwierigkeiten geraten sein. Hatte sich an die alte Paulina gewandt, und dann kam es zum Streit.«
»Und nun geht der Klempnerbetrieb des Festgenommenen den Bach hinunter?«
»Nein! Da kümmert sich jetzt der Uwe drum; neben seiner Landwirtschaft.«
»Und weshalb«, erkundigte ich mich, »geht man bei den vielen Motiven, die auch andere gehabt haben könnten, davon aus, dass dieser Matthias Staroski der Täter sein soll?«
Frau Wuschich schaute mich an, als ob ich ein wenig begriffsstutzig wäre. »Na, weil die Kripo ihn festgenommen hat und sie es im Dorf erzählen.«
Natürlich! Da hätte ich selber draufkommen können.
Beim Beratungsgespräch mit Frau Wuschich beeilte ich mich, damit sie in der Kanzlei nicht mit der ihr offensichtlich bekannten Mutter des Matthias Staroski zusammentraf.
Gleich nachdem ich Frau Staroski begrüßt hatte, ließ sie mich wissen, dass ihrem Sohn bereits ein Anwalt als Pflichtverteidiger beigeordnet worden war und er daneben auch noch einen »Staranwalt« beauftragt hatte, der ihm aus der BILD-Zeitung bekannt war.
»Da scheint Ihr Sohn anwaltlich doch gut vertreten«, erklärte ich ihr in dem Bemühen, meine Stimme so neutral wie möglich klingen zu lassen.
»Mein Sohn sieht das anders. Da gab es neulich eine wiederholte Befragung durch einen oder mehrere Beamte. Mein Sohn hat das Gefühl, dass er da Sachen gesagt hat, die er gar nicht so meinte … aber irgendwie schon …«
»Aber er hat das Protokoll unterzeichnet?«
»Das weiß ich nicht«, antwortete die Frau.
»Und was sagen die Anwälte dazu?«, forschte ich.
»Das ist es ja. Sein Staranwalt hat sich nach Bezahlung der ersten Rechnung noch nicht blicken lassen, und der Pflichtverteidiger meinte, dass er später die Vernehmungsprotokolle lesen werde. Das sei ausreichend. Aber mir geben sie ja keine Auskunft. Das habe ich alles erst von meinem Sohn erfahren.«
»Bei der Vernehmung war keiner der Anwälte zugegen?«
Die Mutter blickte mich mit blassblauen, wässrigen Augen an. »Müssen sie ja nicht, meinten die Anwälte und auch die vernehmenden Beamten.«
»Ja klar«, nickte ich bestätigend mit dem Kopf. »Aber Sinn hätte es in der gegenwärtigen Situation schon.«
»Sagen die ja selber.«
»Ein Urteil kann ich mir in der Sache überhaupt nicht erlauben. Dazu müsste ich mir die Akte angesehen und Ihren Sohn gehört haben.«
»Dann übernehmen Sie die Verteidigung?«
»So schnell geht das nicht. Ich habe keine Lust, gegen einen anderen Wahlverteidiger zu arbeiten. Zwei Wahlverteidiger können in komplexen Verfahren Sinn haben. Aber hier liegt die Sache anders. Und wenn Ihr Sohn nicht mehr an dem zunächst beauftragten Wahlverteidiger festhalten will …«
»So habe ich’s verstanden. Sie sollen das Mandat übernehmen.«
»Wenn Ihr Sohn den anderen Wahlverteidiger nicht mehr möchte, müsste er jenes Mandatsverhältnis kündigen, bevor er mich beauftragt.«
Sie nickte. »Und der Pflichtverteidiger?«
»Da, glaube ich, wird’s nicht so einfach. Ich kann dem Gericht dann mitteilen, dass ich der neue Wahlverteidiger bin und für den Fall, dass ich als Pflichtverteidiger beigeordnet werde, das Wahlmandat beende, aber darauf muss sich das Gericht nicht einlassen. Irgendetwas, was das Verhältnis zum bisherigen Pflichtverteidiger so erschüttert hat, dass man davon ausgehen kann, dass das notwendige Vertrauen unüberwindbar zerrüttet ist, ist für mich jetzt erst mal nicht ersichtlich.«
»Und dass mein Sohn den Eindruck hat, dass der sich nicht genügend engagiert?«
»Das reicht nicht aus. Woran wollen Sie das festmachen? Nur daran, dass der Pflichverteidiger nicht bei den Vernehmungen dabei war? Wenn man alle Ermittlungsverfahren nimmt, ist es sogar die weitaus größere Masse, in denen Beschuldigtenvernehmungen ohne den Anwalt erfolgen. Das kann man auch im vorliegenden Fall nicht als Grund einer unüberbrückbaren Störung des Vertrauensverhältnisses heranziehen.«
»Also bleibt der alte Pflichtverteidiger?«
»Danach sieht es bisher aus.«
»Und die Kosten für Ihre Inanspruchnahme?«
»Die müsste in der vorliegenden Konstellation Ihr Sohn tragen.«
Eine Woche später stand ich am Besuchereingang der Justizvollzugsanstalt Brandenburg und wurde durch verschiedene Schleusen und Gänge in die Besucherzelle geschickt und geführt. Es ist die größte JVA im gleichnamigen Land; das älteste Gefängnis im Lande, inzwischen komplett modernisiert. Die neuen Besucherzellen sind mit den Möbeln und der Farbe wie kleine Büros gehalten. Für meinen Mandanten machte es die Sache aber nicht besser. Weder war bis zu diesem Zeitpunkt die Strafakte vom Gericht an die Kanzlei geschickt, noch war abgestimmt worden, dass wir sie in einer Geschäftsstelle abholen könnten. So war ich denkbar schlecht vorbereitet. Gleichwohl war es mir wichtig, den Mandanten so schnell wie möglich aufzusuchen.
Als der Untersuchungsgefangene Staroski in die Besucherzelle geführt wurde, war mein erster Gedanke, dass doch so kein Mörder aussehen dürfte. Er war zwar groß und kräftig, sodass er körperlich durchaus in der Lage wäre, ein Opfer zu erwürgen, aber mit seinen auffällig blauen und gütig blickenden Augen mit den Lachfältchen an den Seiten wirkte er völlig friedfertig.
Nach den Haftbedingungen gefragt, antwortete ein äußerlich gelassen wirkender Mensch: »Das geht schon alles in Ordnung.«
Er wollte offensichtlich den Eindruck vermitteln, dass er sich in sein Schicksal füge.
Völlig atypisch waren dann auch seine Angaben zur Tat.
Ja, er habe seine Cousine umbringen wollen. »Nicht ganz zu Beginn, da wollte ich noch … Aber das lief dann alles aus dem Ruder.« Er stockte.
»Hm.« Ich nickte. »Was wollten Sie zu Beginn?«
»Ich wusste doch gar nicht, dass sie so einen leichten Schlaf hat. Ich war mucksmäuschenstill. Eigentlich wollte ich nur die Unterlagen klauen, meine und die all der anderen, die sie auspresste. Zur Sicherheit habe ich mir auch eine Skimaske aufgesetzt. Das hätte ich doch nicht getan, wenn ich sie von Anfang an hätte umbringen wollen.«
»Es sei denn«, widersprach ich, »Sie wollten trotz einer Mordabsicht von Ihrem eigentlichen Willen durch das Tragen einer Maske ablenken. Oder Sie trugen sie, um bei der Verwirklichung Ihres Mordplanes nicht von Dritten erkannt zu werden.«
Er überlegte nur kurz. »Könnte sein. Aber Dritte waren nicht zu befürchten. Freiwillig ist keiner zur Tante gekommen. Aber letztlich habe ich sie umgebracht, und deshalb sitze ich hier und Sie da drüben. Das hat alles seine Richtigkeit.« Mein Mandant blickte zu meiner Seite des Tisches, den Blick gesenkt, die Zähne aufeinanderbeißend.
Das sah so aus, als ob da noch etwas hinaussprudeln wollte aus ihm, was er unterdrückte. Das war nicht üblich. Kein Widerspruch, kein Rechtfertigungsversuch.
»Welche Unterlagen wollten Sie denn stehlen?«
»Die Bürgschaftsurkunde natürlich. Sie hatte mir zur Überbrückung meiner Zahlungsschwierigkeiten ein Privatdarlehen gewährt.« Er blickte sich im Raum um. »Größere Summen Geld hatte sie auch immer im Haus.« Wieder unterbrach er sich. »Letztlich hat das dann alles nicht geklappt. Sie kam dazu, ich bekam Panik und habe sie getötet.« Wieder machte er eine kleine Pause. »Aber dann hätte ich auch noch die anderen Dokumente geklaut, mit denen sie andere Leute auspresste.«
»Ihren Bruder Uwe zum Beispiel?«
Er sah mir direkt in die Augen. In seinen lag immer noch der gütige Ausdruck und auch ein wenig Traurigkeit.
»Uwe lassen Sie da mal schön raus. Dass das klar ist! Mit dem war die Alte doch schon fertig. Mein Bruder steht völlig hinter mir. Der leitet sogar meine Firma für mich weiter, während ich hier sitze.«
Ich versuchte wieder, seinen Blick einzufangen. »Alles aus reiner Bruderliebe? Oder hat er etwas gutzumachen?«
Matthias Staroski blieb ruhig. »Wie ich schon sagte. Meinen Bruder lassen Sie aus dem Spiel … Sonst entziehe ich Ihnen auch gleich wieder das Mandat.«
»Okay. Sie sind mein Auftraggeber. Aber Sie müssen es mir nachsehen, dass ich alle Möglichkeiten erwäge, um der Sache auf den Grund und Zweifeln an Ihrer Schuld nachzugehen.«
»Aber nicht in Richtung meines Bruders. Der hat mit der Sache nichts zu tun! Sie sollen mich so gut wie möglich unter der Bedingung verteidigen, dass ich Frau Paulina Persokeit umgebracht habe.«
Ich machte eine Kopfbewegung, die er als ein Nicken wertete.
»Wenn Sie schon eingebrochen und das Opfer umgebracht haben wollen, weshalb nahmen Sie dann letztlich kein Geld und die Sie betreffenden Unterlagen mit?«
»Nicht ›umgebracht haben wollen‹, sondern ›umgebracht habe‹«, korrigierte er mich. »Ja, wenn ich das wüsste. Das ging alles so schnell, und dann wollte ich nur noch irgendwie die Leiche wegbekommen, egal wie.«
»Und was geschah weiter?«, forschte ich.
»Wie weiter?«
»Na, fangen wir doch vorne an. Sie gingen also hinein ins Haus. War es offen?«
»Quatsch! Mit einem Stemmeisen habe ich eines der Wohnzimmerfenster aufgehebelt.«
»Das ging so einfach?«
»Schon. Die war ja geizig und hat bloß solche Billigdinger vom Baumarkt einbauen lassen.«
»Aber Krach hat das doch schon gemacht, oder? Sie meinten vorhin, dass Sie mucksmäuschenstill gewesen seien.«
Der Anflug eines Lächelns huschte über sein Gesicht. »Da war die Maus dann eben doch ein wenig lauter.«
»Ist Frau Persokeit dadurch wach geworden?«
»Kann schon sein. Sie kam herunter, schrie mich an und riss mir die Maske vom Kopf. Dabei schrie sie so etwas wie ›Wusste ich’s doch, der Staroski‹ oder so ähnlich.«
Ich vergegenwärtigte mir die Größe des Mandanten. »Wie groß war denn das Opfer?«
Er durchschaute sofort meine Frage. »Sie musste sich schon etwas recken, um mir die Maske vom Kopf zu reißen.«
»Ihr Bruder, ist der größer oder kleiner als Sie?«
Sein Blick versteinerte wieder.
»Wie gesagt: Den lassen Sie da mal raus! Der war es ganz gewiss nicht.«
Mich beschlich das Gefühl, dass ich hier nicht weiterkommen würde, und ich beschloss, das Gespräch hinsichtlich des weiteren Tatgeschehens für diesen Tag zu beenden. So erkundigte ich mich, ob es sonst noch etwas gäbe, das ich wissen müsste.
»Bei der Vernehmung neulich, da ist einiges schiefgelaufen, glaube ich. Ich habe die Alte umgebracht. Dafür bin ich zu bestrafen. Aber für mehr als ich wirklich getan habe, möchte ich auch nicht sitzen.«
»Ihre Mutter deutete so etwas an. Was ist denn da schiefgelaufen?«
»Die hatten da bei der Kripo irgend so ein Inhouse-Seminar, da war ein Vernehmer vom BKA der Dozent. Und den haben sie mir da gleich mal vorgesetzt. Geht das denn?«
»Anders als beim Gericht haben Sie während der Ermittlungen keinen Anspruch auf das Tätigwerden bestimmter Ermittler … Wurde Ihnen für den Fall bestimmter Angaben irgendetwas zugesagt oder sonst wie versprochen? Wurde Ihnen gedroht?«
»Nein, das nicht, aber … Es war so, als ob er mir das Wort im Munde umdrehte.«
»Wie das?«
»Na ja, zuerst sagte ich, dass ich Frau Persokeit nicht umbringen wollte, weil ich da ja nur Unterlagen klauen wollte. Als ich sie dann würgte, wollte ich sie schon umbringen. Aber dann dachte ich doch, dass sie schon tot sei. Da wollte ich doch keine Leiche mehr umbringen.«
»Davon gehe ich aus.«
»Aber der Beamte meinte, dass dann, wenn ich sie erst erwürgen wollte und dann die Leiche im Auto verbrennen wollte und sie schließlich mit dem Auto in den See fahren wollte, dass ich sie dann doch die ganze Zeit umbringen wollte, egal durch welche Einzelhandlung. Es sei mir doch letztlich darauf angekommen, dass sie tot sei.«
Mit einem »Und?« animierte ich ihn fortzufahren.
»Und da sagte ich ›Ja‹. Das klang doch so auch plausibel.«