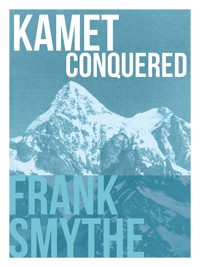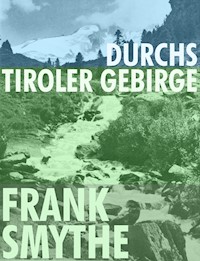
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Frank Smythe war einer der bekanntesten Bergsteiger der 1930er Jahre. Nach einigen Errungenschaften in den Westalpen und der Teilnahme an drei Himalaya-Expeditionen wollte er es im Sommer 1935 etwas ruhiger angehen lassen: mit einer Durchquerung der Tiroler Alpen von der Silvretta bis zu den Hohen Tauern. In diesem Buch nimmt er uns mit auf eine faszinierende Reise in die Vergangenheit: in Bergdörfer, die gerade beginnen, ihr touristisches Potenzial entdecken; zu Tirolern, die sich militärisch durch italienisch Manöver am Alpenhauptkamm und wirtschaftlich durch die deutsche Tausend-Mark-Sperre bedrängt sehen; und an noch unberührte Orte, deren zukünftige Erschließung er sich kaum hätte ausmalen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
TEIL 1: DIE SILVRETTA
TEIL 2: DIE ÖTZTALER ALPEN
TEIL 3: DIE STUBAIER ALPEN
TEIL 4: INNSBRUCK
TEIL 5: DER OLPERER
TEIL 6: DIE ZILLERTALER ALPEN
TEIL 7: DIE REICHENGRUPPE
TEIL 8: DIE HOHEN TAUERN – DIE DREIHERRNSPITZE
TEIL 9: DIE HOHEN TAUERN – DER GROSSVENEDIGER
ABSCHLIESSENDE GEDANKEN EINES REISENDEN
Impressum
Frank Smythe
DURCHS TIROLER GEBIRGE
(Over Tyrolese Hills)
Erstveröffentlichung der Originalausgabe: London 1936
Deutsche Übersetzung:
Copyright © 2021 Peter Ostmann
VORWORT
In diesem Buch beschreibe ich eine Durchquerung der Ostalpen von Bludenz nach Zell am See, durchgeführt im Sommer 1935.
Mein Begleiter war Mr. Campbell Secord, ein kanadischer Ökonom und Alpinist, an dessen Namen man sich erinnern wird im Zusammenhang mit einem entschlossenen und geschickt organisierten Versuch, den bis dato unbestiegenen Mount Waddington zu bezwingen, vielleicht besser bekannt als „Mystery Mountain“, den höchsten Berg in British Columbia. Diese Expedition war eine von denen, die wenig Öffentlichkeit anstreben und auch nicht erhalten. Sie wurde mit Kosten von etwa 15 Pfund pro Kopf durchgeführt und kam einem Erfolg genauso nahe wie andere, weitaus komplexere und teurere Expeditionen. Ihre Teilnehmer trugen ihre Vorräte und Ausrüstung von bis zu 80 Pfund pro Person auf dem Rücken über furchtbar schwieriges Terrain, durch enge, steile Schluchten und nahezu undurchdringliche Wälder. So einer war also mein Begleiter, ein geschickter Kletterer und groß gewachsen, schlank und muskulös gebaut, somit der ideale Alpinist. Es war sein erster Besuch in Europa und in den Alpen; was für eine bessere Einführung könnte es geben als eine Reise über die Gipfel und Pässe des österreichischen Tirol?
Mein erster Besuch in Tirol fand im Dezember 1921 statt, und in den nächsten zwei Jahren verbrachte ich etwa achtzehn Monate dort. Einen Teil des ersten Winters verbrachte ich in Innsbruck. Das Leben war bitter in Österreich in jener Zeit. Tat für Tag sank der Wert der Währung, zunächst um zehn Kronen, später um Tausende, sogar Zehntausende. Händler und Gastwirte mussten mathematisch auf Zack sein, um dabei mithalten zu können. Selbst bei den Banken versagte bisweilen die Koordination; es war möglich, fremde Währung bei der einen Bank in österreichische Kronen zu tauschen und diese bei einer anderen Bank mit Profit zurückzutauschen.
Eine Vielzahl an Touristen fiel über die Stadt her und verließ sie in neuen Pelzmänteln und mit neuen Koffern, vollgestopft mit billig erworbenen Artikeln. Es war nichts anderes als die Plünderung eines wehrlosen Volkes, das rasch im Ruin versank.
Angehörige der Oberschicht und die Selbständigen stellten sich bei der Armenspeisung in die Schlange. Ein gutgestellter Mann bot mir seine Briefmarkensammlung an, eine wertvolle, und zwar zu einem Spottpreis; eine Gräfin, die aus einer reichen Familie stammte und eine versierte Musikerin war, gab Klavierstunden – ihr Klavier war fast das einzige, das sie nicht zu verkaufen bereit war; ein ganzes Schloss kam für weniger als 100 Pfund unter den Hammer. Selbst die Kohle, die von den Eisenbahnen verwendet wurde, war von der billigsten und widerlichsten Sorte, und das Inntal war erfüllt von Rauch, der wie ein Sargtuch über einem toten Innsbruck hing.
Man sah hochrangige Armeeoffiziere bei niederen Tätigkeiten. Die Fahrkarte konnte einem von einem Oberst entwertet und von einem General verkauft werden.
Die Zustände waren reif für eine blutige Revolution, aber es gab keine Revolution. Ein Mann, an den ich mich gut erinnere, versinnbildlichte vielleicht den Grund dafür, wobei er gleichzeitig auch ein Sinnbild für die Not Österreichs war.
Er war ein großer, alter Herr – offenbar ein ehemaliger Armeeoffizier, nach seinem aufrechten Gang, auffälligen, falkenhaften Antlitz und dem breiten, grauen Kavallerieschnurrbart zu urteilen. Er war tadellos gekleidet, aber jeden Tag in demselben Anzug. Er blickte geradeaus und schien doch nichts zu sehen, und er hatte die traurigsten Augen, die ich je gesehen habe.
Ich sah ihn immer langsam die Straße entlangschreiten, die von der Triumphpforte (errichtet im Gedenken an den Einzug des Kaisers Franz I. und der Kaiserin Maria Theresia nach Innsbruck im Zuge der Heirat von Prinz Leopold und der Infantin Maria Ludovica) zum Bahnhof führt. Er war ein Schatten des österreichischen Prunks und des Imperialismus der Vorkriegszeit.
Fast täglich sah ich ihn, und mir unachtsamem Jüngling schien es, dass sein Gesicht immer verkniffener und länger wurde, auch wenn sein Gang immer aufrecht blieb. Eines Tages dann – es war bitterkaltes Wetter, und gefrorener Schnee klebte auf Straße und Bürgersteig – tauchte er nicht auf, und ab dann sah ich ihn nie mehr.
Österreich hat mir etwas beigebracht, wofür ich dankbar bin. Eines Mannes Haus, sein Lebensunterhalt, sein Beruf und sein Vermögen können um ihn herum zerfallen, aber Hoffnung kann die schwersten Schläge des Schicksals überstehen.
Abends herrschte Frohsinn. Die Cafés waren voll, und die von der Armut Getroffenen bemühten sich, ihre Sorgen auf den Tanzflächen zu vergessen. Es gab einen Postlerball, einen Hotelangestelltenball und einen Kaminkehrerball. Exzesse sind verständlich, wenn man wenig hat, für das man lebt, aber ich kann mich nicht an mehr als zwei oder drei Fälle von Trunkenheit erinnern.
Kein einziges Mal hörte ich ein harsches oder unfreundliches Wort gegen England oder gegen mich, einen Engländer. Es war überall dasselbe – die Höflichkeit der alten Welt, eine unerschütterliche Liebenswürdigkeit und Gastfreundschaft.
Täglich wuchs mein Respekt für die Tiroler. Welches andere europäische Volk hätte sich im Ungemach so wacker geschlagen? Doch wenn ich zu den Bergen hinaufblickte, dann glaubte ich zu verstehen. Die Tiroler sind Bergmenschen, und sie haben teil an der Gescheitheit und der Freiheit der Berge. Berge sind das Kühnste und Beste in der Natur. Wer kann zu ihren Füßen leben, ohne ihre Beständigkeit und ihre Kühnheit in sich aufzunehmen? Genau wie die Berge den Sturm und den Blitz ertragen, so ertragen diejenigen, die sie lieben, die flatterhaften Launen des Schicksals.
Von den Straßenecken Innsbrucks aus kann man die Berge sehen. Im Jahr 1921 glühten sie zum Sonnenuntergang oft in einem unirdischen, verlockenden Rot über dem Rauch und Dampf, der Innsbruck umschloss. Die Tiroler suchten Trost für ihr Elend in diesen Bergen. Skispuren durchschnitten den Schnee; in der Sonne und der kalten Luft lösten sich die Sorgen auf wie der Morgennebel.
Ich lernte auf den Hügeln um Innsbruck herum das Skifahren. Jede Expedition war ein Abenteuer. Langsam erlernte ich alpinistische Fähigkeiten.
Ich war verpflichtet, meine Ingenieurausbildung mit einem Jahr praktischer Erfahrung zu vollenden, um mein Diplom zu erlangen. Ich ging in die Schweiz und bezahlte eine beachtliche Summe, um ein Jahr in einem der größten Schweizer Technikkonzerne zu arbeiten. Diese Firma zeigte keinerlei Interesse an mir, man schien dort meine Anwesenheit eher zu missbilligen und zu fürchten, dass ich ihre Geheimnisse entdecken könnte. Also kehrte ich nach Österreich zurück und lernte in Innsbruck einen österreichischen Ingenieur kennen. Ihm berichtete ich von meinen Schwierigkeiten. Sofort stellte er mir ein Empfehlungsschreiben für die Continentale Gesellschaft in Landeck aus, eine Firma, die Karbid herstellt und ein Wasserkraftwerk besitzt, das um die 12.000 Kilowatt erzeugt. Diese Firma stellte mich für ein Jahr als Lehrling in der Stromerzeugung durch Wasserkraft und im Leitungsbau ein und weigerte sich, dafür einen Zuschuss zu verlangen. In dieser Zeit erhielt ich einen tieferen Einblick in die Seele des österreichischen Volkes als ein gewöhnlicher Besucher, und ich sah Großzügigkeit und Freundlichkeit. Die arbeitenden Österreicher – die Arbeiter, Handwerker und Techniker – ähnelten meiner Ansicht nach den arbeitenden Briten, mit denen ich die ersten beiden Jahre meiner praktischen Ausbildung verbracht hatte. Tatsächlich würde ich so weit gehen, zu sagen, dass die Österreicher und die Briten vom Temperament her eng verwandt sind, und dass zwei Völker mit solch übereinstimmenden Sympathien, Idealen und Sportsgeist gegeneinander in den Krieg gezogen waren, war ein großer, trauriger Fehler. Wenn es einen Unterschied zwischen den Österreichern und uns gibt, dann den, dass die Österreicher – dank all der Folgen des Krieges, die einen weiteren Krieg eher begünstigen als ihn unmöglich zu machen – sich selbst und ihre Politik weitaus ernster nehmen als wir. Es war unvermeidbar, dass das wirtschaftliche und soziale Elend, das Österreich nach seiner Kapitulationen gegenüber den Alliierten nun erlebt, solche weitreichenden Folgen hervorbringen würde. Österreich befindet sich in einem politischen und sozialen Schmelztiegel, aber es ist meine feste Überzeugung, dass es durch die angeborene Vernunft seines Volkes – und vor allem der freiheitsliebenden Tiroler – erneuert aus seinen derzeitigen Schwierigkeiten herauskommen wird. Viele glauben, dass eine „kleine Entente“ und eine Wiederherstellung der Monarchie dies begünstigen würden, wenngleich das größte wirtschaftliche Problem Österreichs, die Zollschranken, allen Nationen gemein ist.
Optisch hat Tirol schon immer die Liebhaber von Naturlandschaften begeistert. Weite Teile sind unbeeinträchtigt von kommerziellen Interessen, die mit einer Tourismusindustrie einhergehen. Es gibt hässliche Orte – Hotels, die sich grässlich in Tälern und an Hängen aufrichten, der Natur und der Kunst zum Trotze errichtet; Motorstraßen, noch ungeteert, auf denen der Fußgänger von Staub überflutet wird; Stromleitungen, deren dürre Netze sich über die Hügel ziehen – aber es gibt Dutzende Täler, in denen alle diese Dinge unbekannt sind und wo der Wanderer seinen Geist entspannen kann.
Der gestählte Alpinist mag viele der Berge hier verschmähen, wenn er sie mit den höheren und steileren Bergen der Schweizer und französischen Alpen vergleicht, aber dem, der die Erhabenbeit der Berge allein anhand ihrer Steilheit misst, entgehen die feineren Qualitäten der Hügellandschaft.
Tirol steht in vollster Pracht und Schönheit. Es ist ein Land für den Wanderer. Durch Bergreisen im Himalaya habe ich mich dem Fernwandern verschrieben. Klettere von einem zentralen Ort aus auf Berge, wenn du willst, aber deine Liebe für die Berge zeigst du, indem du sie durchquerst. Überquere ihre Pässe und Gipfel. Klettere im Morgengrauen aus einem Tal hinauf und steige am Abend in ein anderes Tal ab. Dann wirst du die wahre Essenz des Reisens kennenlernen, dieses merkwürdige Verlangen, das einen Mann so weit reisen lässt – und er weiß gar nicht warum. Diese Essenz ist so flüchtig, dass man sie in Worten kaum beschreiben kann. Man schmeckt sie, wenn der letzte Steilhang eines Passes hinter einem liegt und die blaue Ferne in deinen Blick rückt; man schmeckt sie in der Morgendämmerung, wenn man mit dem Rucksack auf den Rücken in die kühle Kiefernluft aufbricht und die den felsigen Hang unter den emsigen Füßen spürt, und man spürt es am Abend, wenn man in Frieden mit einem Glas Wein in irgendeinem kleinen Gasthof sitzt, zufrieden umschlungen von der angenehmen Schläfrigkeit des Erschöpften.
Für mich, und ich hoffe für alle, die dieses Buch lesen, wird das österreichische Tirol ein Land für den Wanderer bleiben und für alle, die sich an der Schönheit und Freiheit der Berge erfreuen.
TEIL 1: DIE SILVRETTA
Es war ausgemacht, dass Campbell Secord und ich uns in Schruns treffen würden, nahe Bludenz am Arlberg. Secord reiste via Deutschland an, ich flog nach Zürich in der Schweiz.
Das englische Wetter war Anfang Juni wolkig und kalt gewesen, aber der Morgen war warm und heiter, als die Maschine der Imperial Airways eine mäßige Geschwindigkeit von 90 Meilen pro Stunde über den Felder und Gehöften von Sussex erreichte.
Wenn ich mit dem Flugzeug in die Alpen reise, dann kommt es mir vor, als beraubte ich die alpine Pilgerreise einer notwendigen Gefahr und einer Umbequemlichkeit, die man überstehen muss, bevor die Berge erreicht sind – der Schrecken einer rauen Überfahrt über den Kanal und die Möglichkeit eines Eisenbahnunglücks in Frankreich. Er war viel zu einfach, dieser Flug durch die Luft.
Über Frankreich standen Gewitterwolken, Zitadellen undurchdringlichen Wasserdampfs, durch deren Lücken sich die Welt in großer Ferne zeigte. Der Höhenmesser kletterte langsam auf 12.000 Fuß. Ein Steward brachte mir ein Mittagessen. Zwischen Happen von Lachs in Mayonnaise blickte ich hinaus auf die von der Sonne erleuchteten Wolken.
Die Wolken wuchsen, während die Maschine nach Süden raste, und unter ihnen wuchs auch die Erde. Ihr Antlitz war nicht mehr geordnet und geprägt von roten Dörfern, langen geraden Straßen und rechtwinkligen Feldern; sie sprang steil nach oben. Die Wolken ruhten nun auf bewaldeten Hügeln. Der Mensch wurde dort lediglich geduldet; seine Dörfer kauerten auf den seltenen flachen Stellen, seine Felder waren karg; seine wenigen Straßen wandten sich auf und nieder in mühseligen Kurven. Dies war der Jura.
Ich versuchte mir die Zeit zu vergegenwärtigen, in der ich als kleiner Junge das erste Mal die Schweiz besucht hatte. Es war früh am Morgen gewesen, und ich hatte die Alpen aus einem Zug heraus gesehen, der bei Pontarlier über den Jura eilte. Es ist nicht leicht, so eine Erinnerung abzurufen, während man über den Wolken Lachs in Mayonnaise isst. Diesmal kam ich leichter in die Alpen. Wenn jeder geheime Ort der Alpen sich ohne Aufwand und Gefahr derart offenbart – wird dann noch ein Funken bleiben, der sich dem mechanischen Erfindungsreichtum widersetzt und das Feuer des persönlichen Abenteuers am Leben hält, oder werden solche Abenteuer verschwinden in einem Nebel aus Geschwindigkeit und Bequemlichkeit?
Abwärts. Abwärts durch die Wolken, durchgeschüttelt von einem Luftwirbel. Abwärts durch zähe Lagen von Nebel, aus dem Sonnenlicht in den Schatten. Abwärts und im Kreis in einem langen Schwung über einen Wald, der langsam anstieg und dann genauso langsam wieder hinab. Abwärts auf die harsche, harte Erde, nach Basel.
Es war heiß in Basel. Der kleine Flugplatz flimmerte in der Hitze. Die Wolken waren jetzt fern, graubraun mit ihren Füßen auf den Hügeln. Auch die Hügel waren fern. Ihre Gipfel waren vom Tal getrennt durch Mühe und Schweiß, nicht bloß durch die Betätigung eines Hebels. Die Welt war wieder echt, und das war gut so.
Ein anderes Flugzeug brachte mich nach Zürich, und von Zürich aus beförderte mich ein Zug südwärts entlang des Ufers des Zürichsees, das penibel ordentlich aussah, in die Berge des Glarus, die überaus unordentlich waren.
Linthal lag trist unter mächtigen Wolken und der Walensee hatte die Farbe von Blei.
Der Sturm brach los in Sargans. Himmel und Erde vereinten sich im Sturzregen. Blitze stachen wieder und wieder brutal zu, und Donner grollte zwischen den Bergen hin und her.
Buchs, der Rhein, Liechtenstein, Österreich – der Arlberg. Ein traurig dreinblickender Mann in einem abgewetzten Anzug stempelte meinen Pass; zwei Zollbeamte in khakifarbenen Uniformen mit silbernen Quasten auf den Schultern betraten mein Abteil, fragten höflich, ob ich etwas zu verzollen hätte, und zogen sich wieder zurück, als ich ihnen versicherte, dass dem nicht so sei.
In Bludenz stieg ich um in eine Schmalspurbahn, die mehrmals täglich zwischen dieser Stadt und Schruns im Montafonertal verkehrt. Sie wird von einem Verbrennungsmotor angetrieben, bis sie den elektrifizierten Streckenabschnitt erreicht. Es gab eine kurze Verzögerung, da der Lokführer es versäumt hatte, sich des Hebels zu ermächtigen, mit dem man die elektrische Schaltanlage bedient. Dieses Missgeschick wurde rasch von einem Beamten behoben, der mit dem vermissten Hebel den Zug entlangeilte.
Dieser triviale Vorfall war typisch für das, was ich nur als die herrliche Planlosigkeit der Österreicher beschreiben kann – herrlich für mich, weil ich selbst planlos bin und mich das Gefühl beschleicht, dass es den menschlichen Intellekt abtöten kann, wenn man ultramethodisch bis zum Exzess durchs Leben geht. Diktatoren wie auch ihre Untertanen leiden an übermäßig methodischem Handeln.
Nach diesem Versäumnis setzte der Zug seine Fahrt fort. Im März 1934 machte ich dieselbe Reise durch das Silvretta-Gebirge in die Schweiz. Damals war vom Frühling noch wenig zu sehen und das Gras war niedergedrückt und durchnässt vom Gewicht des Winterschnees. Jetzt herrschten andere Bedingungen. Es war Ende Juni, und nicht einmal die dunklen Gewitterwolken, welche die Gipfel hinter sich verbargen, konnten das Leuchten der Felder verdunkeln oder die Farben der Blumen, die diese zierten, trauriger wirken lassen.
Es schien fast unmöglich, dass ich nur wenige Stunden zuvor in der Kälte des Morgens am Flughafen von Croydon gebibbert hatte. Die Luft strömte sanft und warm zum Fenster hinein, voll von den flüchtigen Parfums der Blumen, der feuchten Erde und der Latschenkiefern, aber auch getränkt vom Elan und von der Kühnheit der Berge. Und weit hinauf erhoben sich die Berge, ihre Hänge in Wald gehüllt und durchzogen von Tobeln, mit ihren kühnen Klippen und Pfeilern, die nach und nach in einem Getümmel von Sturmwolken verschwanden.
Meine Mitreisenden waren hauptsächlich Bauern, aber mit Einsprengseln von Touristen und Alpinisten. Es schien, dass ihr Besuch in Bludenz, vermutlich geschäftlich oder zum Gütererwerb, in geselliger Weise abgeschlossen wurde. Außerdem war eine Trauergesellschaft anwesend, die nach der Beerdigung nach Hause fuhr. Die Männer waren erstaunlich ausgelassen. Offensichtlich waren sie der Meinung, dass die niedergeschlagenen Blicke der Frauen, die bekleidet waren mit traurigen schwarzen Jacken, eng taillierten Röcken und mit Hüten, die mit langen schwarzen Bändern verziert waren, den Umstände bereits ausreichend Rechnung trugen.
Es gibt ein oder zwei Bahnhöfe zwischen Schruns und Bludenz, und an jedem hielten wir uns eine Weile auf. Aber warum sollten wir uns schließlich auch beeilen? Wenn der Bahnhofsvorsteher oder ein sonstiger Würdenträger einen Kumpan unter den Reisenden ausmachte, warum sollte er dann nicht ein Schwätzchen halten, bevor er die Weiterfahrt erlaubte? Eile und Geschwindigkeit, die Flüche unserer westlichen Zivilisation, waren der Bahnstrecke Bludenz-Schruns nicht anzumerken.
Wir erreichten Schruns in der warmen, ruhigen Dämmerung. Secord erwartete mich, und gemeinsam zogen wir uns zurück in die Pension Edelweiß, wo wir uns ein Zimmer gesichert hatten. Es war ein kleiner Gasthof, erbaut aus Kiefernholz im Chaletstil; sein Besitzer war ein freundlicher, ergrauter kleiner Mann, der uns zwischen Zügen an einer langen, hinab hängenden Pfeife von einer Art, wie sie die Tiroler lieben, herzlich willkommen hieß. Seine Gattin, eine Frau von Gewicht und Lebensfreude, wuselte unterdessen in der Absicht, alle unsere Bedürfnisse zu befriedigen, umher.
Nach einer Minute waren wir „willkommen“; nach fünf Minuten durften wir uns bereits „wie zuhause“ fühlen. Und bei diesem Willkommen handelte es sich nicht um einen wohlüberlegten Teil eines wohlüberlegten Plans, wie es für der Wissenschaft der Hotelbranche typisch wäre; sondern es war ein spontanes, schlichtes und aufrichtiges Willkommen. In den nächsten Wochen sollten wir lernen, dass solch ein Willkommen nichts Besonderes ist. Dem Reisenden wird in Österreich selten das Gefühl vermittelt, er sei nur eine Ziffer, die Zimmernummer; es scheint ihm auch nicht so, als werde er ausgebeutet oder sei ein Opfer. Er muss sich natürlich dem unvermeidbaren Problem der „Extras“ stellen, aber auch diese sind weniger übel als andernorts, wohl weil der Österreicher gerade erst damit begonnen hat, sich zu organisieren und seine Landschaft auszubeuten. Gleichzeitig komme ich nicht umhin, mich zu fragen, wie viel der günstige Wechselkurs und die daraus entstehende Billigkeit eines Österreich-Urlaubs zu diesem glücklichen Zustand beiträgt. Geld, das lange vorhält, hat einen mäßigenden Einfluss auf die Kritikfähigkeit in solchen Angelegenheiten wie Hotelrechnungen und „Extras“.
Wir aßen in einem kleinen Gastzimmer, an dessen Ende der übliche grüne Kachelofen stand. Das Gericht war nicht sehr ausgefeilt und die Zubereitung äußerst schlicht, aber beides war doch gut. Auf Kalbskoteletts folgten Omelettes mit Marmelade und Kaffee. Secord war schon jetzt enthusiastisch, was das österreichische Bier betraf. Kanadisches Bier war abstoßend, englisches schon besser, aber österreichisches Bier! Das war ein Bier, geeignet für den durstigen Bergsteiger – auch wenn er noch gar nicht bergsteigerisch tätig geworden war.
Die Reise hatte uns müde gemacht, und wir waren froh, über die einfache Holztreppe in den ersten Stock zu dem Zimmer hinaufzusteigen, das wir uns teilten. Der Nachmittag hatte Gewitter gebracht, aber der Abend endete ruhig. Wir blickten aus unserem Fenster über das schlafende Dorf hinweg. Der Klang eines Schauers erreichte unsere Ohren mit erstaunlicher Klarheit – und versank dann unmerklich in der Landschaft und in der Juni-Nacht. Nur die hohen Berge beraubten dem Himmel die Sterne. Die Luft war süß und rein und aufgeladen mit der Lebenskraft der Berge.
Als wir aufwachten, war die Sonne aufgegangen, und Schruns regte sich. Das Wetter war gut, und vom gestrigen Gewitter war nichts mehr übrig als winzige Nebelfetzen in den schattigen Mulden der Berge.
Das Frühstück bestand aus Semmeln, noch warm aus der Bäckerei, Butter und Honig – nicht der synthetische Honig vieler Hotels in den Alpen, sondern echter Honig.
Dies war Secords erster Besuch in den Alpen. Es war nur natürlich, dass seine Vorstellungen vom Alpinismus in den Alpen auf seinen alpinistischen Erfahrungen in Kanada beruhen sollten. Er erwartete tatsächlich, dass wir uns mit Proviant für viele Tage würden eindecken müssen, bevor wir ins „Blaue“ aufbrechen konnten, und fand es schwer zu verstehen, dass Alpinismus in den österreichischen Alpen ein luxuriöses Freizeitvergnügen ist. Es überraschte ihn, zu erfahren, dass jede Bergkettte, ja fast jeder Berg von Bedeutung, vor Ort oder in der Nähe eine Hütte aufweist, die eine komfortable Unterkunft und gut zubereitetes Essen anbietet.
Jegliche Nahrung, die ein Kletterer bei sich trägt, dient nur dazu, ihn zwischen den Hütten zu ernähren, und selbst diese Nahrung kann in den Hütten erworben werden, wenngleich sie dort natürlich weder in solcher Vielfalt noch so günstig erstanden werden kann wie in den Dörfern. Diese Hütten, die überwiegend dem D.Ö.A.V. (Deutschen und Österreichischen Alpenverein) gehören, werden äußerst effizient bewirtschaftet und sind sehr günstig, besonders für Vereinsmitglieder.1
Als ich Secord dies erklärte, konnte ich erkennen, dass er solch einen Alpinismus als nicht zu rechtfertigen einstufte, ja fast schon als unmoralisch. Der Verzicht fehlte ihm. Bergsteigen war ein Sport für Männer, nicht für Weichlinge oder Leichtfüße. Er war es nicht wert, wenn er nicht echten Schweiß und Härte erforderte; Secord hatte 80-90 Pfund auf seinem Rücken durch die bewaldeten Täler von British Columbia bis zum Mount Waddington getragen. Andere haben ihre Bergsteigerei in den Ostalpen mit ähnlichen Vorstellungen begonnen; sie haben sich in bemerkenswerter Weise ihrer Umgebung angepasst und sich mit weichen Betten und wohlschmeckendem Essen auf noble Art abgefunden. Ich stellte da keine Ausnahme dar. Die Unbequemlichkeit einer kleinen und überfüllten Hütte in der Schweiz, in Frankreich oder Italien ist eine unbefriedigende Alternative zum romantischen, aber unbequemen Biwak, aber auch auch zur unromantischen, aber bequemen D.Ö.A.V.-Hütte, die ihrem Namen zum Trotz wirklich ein Hotel ist.
Unsere Einkäufe und das Vorschicken unseres Gepäcks wurden dadurch erschwert, dass in Österreich der Feiertag Peter und Paul war. In England verbinden wir die Banken mit unseren Feiertagen, möglicherweise weil wir ein Volk der Ladeninhaber und Kapitalisten sind. In Österreich sind dafür die Heiligen zuständig, nicht die Banken. Und da es eine große Zahl an Heiligen gibt, viele von ihnen von gleicher Bedeutung, so folgt daraus, dass ein konkreter Heiliger oder eine Heilige sich lieber einen Tag mit einem anderen Heiligen teilen sollte als komplett ausgeschlossen zu werden. Viele Frauen in Volkstracht – schwarzer, taillierter Rock, enggeschnürtes Mieder und eine Bluse mit vollen Puffärmeln, allesamt reich dekoriert mit goldener Borte und überschattet von einem schwarzen Hut in der Form eines Männerstrohhuts, mit Schleifen und Federn – marschierten in die hohe, dickwandige, weißgetünchte Kirche, die unterdessen ein Klangbild aus Glockenschlägen über die Häuser des Städtchens aussandte, ohne Rücksicht auf Takt oder Rhythmus.
Schwer von der Arbeit gezeichnet waren manche dieser Frauen; man führt ein gesundes Leben in den Bergen, aber die harte Arbeit von Kindesbeinen an hinterlässt ihre Spuren und lässt sie vorzeitig altern.
Was die Männer anging, so sahen wir keine von ihnen die Kirche betreten, aber viele standen davor und schwatzten in und vor den Gasthöfen und an Straßenecken. Vielleicht hatten sie einen früheren Gottesdienst besucht. Ansonsten würden sie das Missfallen ihres Priesters riskieren, sofern der Katholizismus hier in der Gegend so streng überwacht wird wie in vielen anderen Alpentälern.
Schruns liegt nur 2.260 Fuß über dem Meer, aber es ist im Grunde ein Bergdorf. Second war davon begeistert.
„In den Rockies sieht man nicht viele grüne Felder wie die hier“, sagte er. „Die Täler sind schmaler und stärker bewaldet.“
Vermutlich war die Vegetation der Alpentäler einst derjenigen in den Tälern Kanadas sehr ähnlich. Jahrhunderte der Bewirtschaftung haben die Täler leicht zugänglich und bewohnbar gemacht. Zugleich ist es zweifelhaft, ob die Vegetation, besonders im Unterholz, jemals der in den kanadischen Tälern nahe des Pazifischen Ozeans gleichen konnte, wo das feuchte Klima nahezu undurchdringliche Dschungel hervorgebracht hat.
Jahrhunderte der Bewirtschaftung haben der Schönheit der alpinen Landschaft eher genützt als geschadet. Während seines zähen Ringens mit der Natur bei seinen Versuchen, ihr einen Lebensunterhalt abzuringen, hat der Mensch die Zeit gehabt, sich auf sie einzustellen und fast ein Teil von ihr zu werden. Die Häuser derjenigen, die sich ungezählte Generationen lang geplagt haben, haben die Farben und Formen der Natur angenommen.
Es sind kommerzielle Interessen von außerhalb und ihre pilzartigen Wucherungen, die die Schönheit der Natur verletzen. Die gegenwärtige Armut Österreichs schützt das Land vor der Zerstörung, aber die Zeit wird kommen, wenn seine Täler zur Beute industrieller Spekulanten werden und große Hotels vulgär und hässlich aus den Flanken seiner Berge wachsen werden. Gibt es keinen Kompromiss, keinen Weg, wie die anwachsenden Massen, die ihren Urlaub gern in den Bergen verbringen, dieses tun können, ohne andere dazu zu bewegen, die Landschaft zu stören? Ich glaube doch: dass eine rigorose Aufsicht der Regierung (wobei die Aufseher Naturliebhaber sein müssen und geschult in guter Architektur) über alle Bautätigkeiten und sonstige kommerzielle Vorhaben viel dazu beitragen könnte, die Schönheit der Alpen zu bewahren und gleichzeitig die Täler für diejenigen, die sie besuchen wollen, zugänglich zu machen. Die Verantwortung in dieser Angelegenheit liegt bei der österreichischen Regierung, und es steht zu hoffen, dass, wenn sich die politische Situation beruhigt hat und Österreich seine Erschließungen vorantreiben kann, wie es die Schweiz schon getan hat, dann diejenigen da sein werden, die genug Fantasie haben, um zu verstehen, wie groß ihre Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen von Naturliebhabern ist.
Ein Postauto brachte uns von Schruns nach Parthenen, in das höchstgelegene Dorf im Montafon. Es war eine spaßige Fahrt. Die Sonne schien hell aus einem Himmel, der durch die Gewitter des Vortags von jeglichem Dunst befreit war, und die Luft war klar und kühl. Männer und Frauen arbeiteten schwer in den Feldern. Sie schnitten das erste Heu, und der Geruch des geschnittenen Grases vermischte sich angenehm mit dem Geruch der Blumen, die zahlreich am Straßenrand blühten.
Der Schneefall des vergangenen Winters war phänomenal ergiebig gewesen. Das Ergebnis war eine Vielzahl von Lawinen. So tief lag der Schnee, dass selbst Hänge, die aufgrund ihrer überschaubaren Grundfläche normalerweise harmlos blieben, sich katastrophaler Lawinen entledigten.
Im Montafonertal waren die Lawinen besonders zerstörerisch, sowohl für Menschenleben wie auch für Besitztümer. Zehntausende Kiefern wurden vom abrutschenden Schnee entwurzelt oder von den furchtbaren Luftmassen abgeknickt, die er mit sich brachte. An einer Stelle war eine Kerbe im Wald entstanden, Hunderte von Yards breit, und die abgerissenen Bäume lagen in wirren, Mikado-artigen Haufen durcheinander auf den Wiesen, umgeben von langen Zungen dreckigen Schnees, welcher, auf die Dichte von Granit zusammengedrückt, der Sonne noch viele Wochen lang trotzen würde. Häuser hatten in der Bahn dieser Lawine gestanden. Sie wurden überrollt und mitgerissen, als wenn sie aus Pappe gewesen wären. Ihre Bewohner waren gestorben.
Aus langer, bitterer Erfahrung hat der Bergbauer gelernt, seine Wohnhäuser und Kuhställe dort zu errichten, wo sie normalerweise vor Lawinen sicher sind. Nichts hätte einem sicherer vorkommen können als die Wiesen, die diese Lawine heimgesucht hatte. Ein langer und breiter Kiefernwald bedeckte den Hang darüber; kein junger Wald, sondern einer, der dort seit Generationen stand und immer ein sicherer Schild gewesen war. Aber dann kam eine Zeit im Winter 1935, als sich der Schnee auf den Hängen über dem Wald in bisher unerreichter Menge ansammelte. Steigende Temperaturen lösten dann den Rutsch aus. Die Lawine preschte hinab in den Wald, und der Wald ergab sich. Und nachdem er sich ergeben hatte, trug jeder umgefallene Baum zusätzlich zur Masse und Wucht der Lawine bei. Es muss eine furchtbare Szenerie gewesen sein. Diejenigen unterhalb dürften nur wenig Warnung vor dem bevorstehenden Unheil gehabt haben. Wahrscheinlich hat sie das Grollen der Lawine nur kurz erschreckt. Warum sollten sie sich dort fürchten, wo ihre Vorfahren so lange im Schatten und in der Sicherheit des großen Waldes gelebt hatten? Das Grollen wurde lauter. Vielleicht erblickten sie da die Gefahr – zu spät: sie sahen, wie der Hang Schneewolken hervorbrachte wie Rauch aus der Öffnung einer Kanone; sie sahen die großen Kiefern fallen wie das Getreide beim Mähen und hörten den dämonischen Lärm berstenden Holzes und den schrecklichen Donner der fallenden Massen, wie sie mit unvorstellbarer Geschwindigkeit und Energie hinabrutschten. Hoffen wir, dass sie wenig Zeit hatten, sich ihres bevorstehenden Todes bewusst zu werden, bevor er sie überrollte.
So muss es mit der Natur immer sein. Wir respektieren sie mehr, wenn sie sich mit schnellem und gewaltigem Zorn erhebt. Jetzt, unter der Sommersonne, mit blühenden Blumen direkt am Rand der schmelzenden Trümmer, sah die Lawine lächerlich aus, fast schon mitleiderregend, wie das kaputte Spielzeug eines Kindes.
Die Straße im oberen Teil des Montafons ist eng und chaussiert. Die Staubwolke hinter unserem Fahrzeug erinnerte mich an meine Kindheit, als Motorwagen und Staub untrennbar miteinander verbunden waren. Staubige Straßen gibt es in Großbritannien heutzutage kaum noch, aber im österreichischen Tirol gibt es noch viele.
Das Postauto kam auf eine ordentliche Geschwindigkeit. Wir sausten davon wie ein staubiger Komet und unter der gewagten Annahme unseres Fahrers, dass uns unter keinen denkbaren Umständen ein Auto entgegen kommen könnte. Auf Basis dieser Annahme schossen wir um Kurven mit einer Geschwindigkeit und Selbstvergessenheit, die mich erschauern ließen.
Nach einigen Meilen auf der holperigen Straße löste sich ein Teil des Autos und schlug von nun an mit grässlichem Getöse auf die Straße. Das störte unseren Fahrer kein bisschen, und er demonstrierte seine Verachtung für solch eine Kleinigkeit, indem er sich vehement weigerte, anzuhalten, bis wir einen Gasthof erreicht hatten – seine gewöhnliche Haltestelle. Dort unternahm er einen halbherzigen Versuch, den Defekt zu beheben, aber ohne großen Erfolg, denn nach einer weiteren Meile stellte sich das Problem erneut ein. Die einzige Auswirkung davon auf unseren Fahrer war, dass er umso schneller nach Parthenen kommen wollte, bevor das ganze Postauto auseinanderfiel. Diese Strategie war erfolgreich, und wir erreichten dieses Dorf mehr oder weniger intakt.
Parthenen liegt auf 3435 Fuß Höhe auf den höchsten Weiden des Montafons. Es war unsere Absicht, die Nacht im Madlenerhaus zu verbringen, 6515 Fuß hoch und eine der D.Ö.A.V.-Hütten, zu Fuß etwa zwei bis drei Stunden von Parthenen entfernt.
Es gab keinen Grund zur Eile, und nach einem Mittagessen in einem Gasthof schlenderten wir geruhsam über einen ordentlich ansteigenden Pfad bergwärts. Jetzt, wo er sich von dem Schock erholt hatte, keine fünfzig oder sechzig Pfund den Berg hinaufschleppen zu müssen, strotzte Secord nur so vor Energie, aber mir fehlte ganz entschieden die Übung – so sehr, dass ich eine Pause für eine Erfrischung vorschlug, als nach einer Stunde des Anstiegs ein kleines Chalet auftauchte von der Art, die in England „hausgemachte Limonade“ und „Unterkünfte für Radfahrer“ anpreisen würde. Mein Begleiter begrüßte meinen Vorschlag unerwarteterweise mit selbstloser Begeisterung.
Jenseits der Erfrischungshütte querte der Pfad einen Hang oberhalb eines Sees, der sicher eine halbe Meile lang und durch einen künstlichen Damm erschaffen worden war. Er sollte offensichtlich der Erzeugung elektrischer Energie dienen, wobei nicht klar war, was man mit dieser Energie anfangen wollte. Wir entdeckten außerdem, dass eine Eisenbahn am Hang über uns gebaut wurde. Angesichts der Ausschachtungen und vieler Tausend Tonnen Steine, die zur Einebnung der Spur benutzt wurden, musste es ein kostspieliges Unterfangen sein.
Schon bald verließ der Pfad die Umgebung dieser vernarbten Hänge und läutete einen wunderbaren Anstieg über Hänge ein, die rosa waren vor Rhododendrons – den Alpenrosen – und hier und da dank der silbernen Ebereschen glänzten. Hier fühlten wir uns zum ersten Mal im Hochgebirge.
Vor uns lag eine dunkle Kette felsiger Gipfel mit kleinen Gletschern zwischen ihren Ausläufern, und direkt unter uns ein düsteres, waldloses Tal mit vielen Felsblöcken, in dem ein Bach tobte und im Sonnenlicht glitzerte.
Das Madlenerhaus ist ein Hotel, nicht mehr und nicht weniger. Es gibt dort um die zwanzig Schlafzimmer, in denen man für drei oder vier österreichische Schillinge übernachten kann, und ein „Matratzenlager“ – einen Raum mit Matratzen und Decken, die auf niedrigen Rollbetten platziert wurden –, das nur etwa einen Schilling kostet. Es gibt elektrisches Licht dank einer kleinen Wasserkraftanlage und, wenn ich mich recht erinnere, ein Telefon, das die Hütte mit Parthenen verbindet. Die Hütte steht im Großfermunttal, einem weiten Tal, das sich von Ost nach West absenkt und bisweilen wilden Schneestürmen ausgesetzt sein muss.
Bei meinem letzten Besuch waren kaum ein Bett oder eine Matratze frei gewesen, so voll war das Haus damals von Skifahrern. Aber jetzt war es verwaist mit Ausnahme des rotbäckigen, silberhaarigen Hüttenwarts und seiner häuslichen Bediensteten. Das lag an der Strafe von 1000 Mark, die Deutschen auferlegt wurde, die Österreich besuchen wollten. Tatsächlich waren die ganzen österreichischen Alpen 1935 fast menschenleer, da normalerweise deutsche Touristen und Alpinisten den Großteil der Besucher stellen.
Wir aßen einsam unser Abendbrot. Die Küche war exzellent, wie es auf D.Ö.A.V.-Hütten fast immer der Fall ist. Auf eine Gemüsesuppe folgte ein Wiener Schnitzel, braun und saftig, mit Kartoffeln und einem grünen Salat, großzügig bestreut mit Kümmel, wogegen die meisten Engländer Einspruch einlegen würden. Zuletzt gab es dreieckige Linzertorten, bei denen es sich eigentlich um dicke, waffelartige Kekse handelt. Diese Mahlzeit wurde abgerundet von etwas Rotwein, dem man heißes Wasser und Zucker hinzugefügt hatte – ein Getränk, das man Wanderern und Bergsteigern getrost empfehlen kann.
Es war ein perfekter Abend. Als wir nach draußen gingen, um einen letzten Blick ins Wetter zu werfen, was ein Ritual für den Bergsteiger ist, da stand die Luft absolut still. Weit unten im Westen, wo sich der Glanz des Sonnenuntergangs noch hielt, leuchtete ein großer Stern, und am dunkleren Himmel über uns funkelten und glitzerten eine Reihe kleinerer Sterne mit einem fahlen, frostigen Feuer. Von fern und nah erreichte und der Klang von Bächen, ein Geräusch, das das Ohr nicht dominiert, sondern den Frieden der Berge unterstreicht.
Wir schliefen gut; es war der traumlose Schlaf, der sich nach Anstrengungen im Freien gern einstellt.
Der Hüttenwirt weckte uns um 4.30 Uhr am nächsten Morgen. Wir stärkten uns, nicht unbedingt ausreichend, mit einem „Café complet“ und brachen um 5.45 Uhr in Richtung der Jamtalhütte, 7079 Fuß, auf. Wir hatten die Absicht, den Grat zu überqueren, der von der Ochsenscharte nach Norden verläuft, indem wir durchs Bieltal und über den Bieltalgletscher zur Bieltalspitze, 10150 Fuß, aufstiegen, und von dort zum Jamtalgletscher abstiegen.
Das Wetter hatte nicht zu viel versprochen. Als wir die Hütte verließen, war der Himmel wolkenlos, und die Sonne gewann mit jeder Minute an Kraft. Zunächst spazieren wir das Großfermunttal hinauf bis zur Bielerhöhe, 6630 Fuß, einem Pass zwischen diesem Tal und dem Kleinfermunttal, das nahe des Dorfs Galtür, eines bekannten Wintersportorts, ins Patznauntal mündet.
Eine Weile führte uns der Weg über wellige Rasenhänge, durchzogen von Torfflächen. Beim Erreichen der schwach definierten Bielerhöhe schlugen wir einen rauen engen Pfad ins Bieltal ein, ein steiniges, ödes Tal, in dem ein Gletscherbach das einzig Lebendige ist. Den Talschluss füllen der Bieltalgletscher und der Grat, den wir überqueren wollten und von dem aus sich mehrere Gipfel gemäßigter Höhe erheben.
Auf dem Weg durch das Tal hinauf bewegten wir uns beide bewusst mit größerer Leichtigkeit und weniger schlendernd als beim Aufstieg zum Madlenerhaus. Eine Stunde verging, dann erreichten wir die Ausläufer des Bieltalgletschers. Hier entschieden wir, dass die felsigen Hänge im Westen der monotonen Plackerei auf dem unteren Teil des Gletschers zu bevorzugen waren. Über diese kraxelten wir zum Gipfel eines kleinen Berges, zum Bieltalerkopf, 9180 Fuß.
Es war Zeit fürs Frühstück, und wir breiteten uns so bequem wie möglich auf den Felsen aus. Es war ein herrlicher Ort für ein Frühstück. Die Felsen waren bereits warm und der Morgen voll vom hellen Sonnenlicht. Kein Windhauch regte sich.
Plötzlich erinnerten wir uns an unsere Gesichter. In solcher Hitze würden sie sicher aufplatzen und sich häuten, wenn wir nicht sofortige Maßnahmen trafen, um solch ein Malheur zu verhindern. Wir bestrichen sie dick mit Gletschercreme und streckten uns dann nach dem Verzehr unseres Mahls auf den Felsen aus und ließen mutig die Sonne ihr Schlimmstes versuchen.
Es dauerte lange, bevor wir die notwendige Energie für die Fortsetzung der Kletterei aufbrachten. Schließlich überwandten wir unsere Trägheit und überquerten einen scharfen Grat aus zerrissenem und brüchigem Fels, von wo aus wir den oberen Hang des Bieltalgletschers erreichten. Vor uns am Kamm nördlich der Bieltalspitze waren zwei deutliche Lücken zu sehen, beides vermutlich Pässe, und wir zielten auf den nördlicheren der beiden. Es war ein Aufstieg in großer Hitze. Die Sonne schien mit solch atemloser, erbarmungsloser Intensität, dass der Schweiß schon bald die Gesichtscreme aus unseren Gesichtern gespült hatte. Dies war der Zeitpunkt unseres Sonnenbrandes. Ich weiß noch, wie ich grimmig zu Secord sagte: „Jetzt schwitzen wir die Zivilisation aus“, obwohl ich nicht erklären kann, warum es nötig sein sollte, so drastisch mit der Zivilisation umzuspringen.
Wie viele andere Gletscher in dieser Region auch, hatte dieser Gletscher keine Spalten und wäre auf Skiern angenehmer zu ersteigen gewesen. Er führte uns zu der Lücke, die wir gesehen hatten. Es war natürlich die falsche Lücke: Der Abstieg zum Jamtalgletscher war von der anderen aus leichter. Also trotteten wir zu ihr hinüber, indem wir den Grat zwischen den beiden ohne Schwierigkeiten überquerten, wenngleich an einer Stelle ein kühner Felsturm über eine seitliche Hangquerung umgangen werden musste.
An der anderen Lücke gab es eine Pfütze mit Wasser, und aus ihr tranken wir, wie nur Männer trinken können, die aus der Übung sind und eine hitzige Kletterei überstanden haben.
Die Bieltalspitze war nun nah, und wir entschieden, sie zu besteigen. Man muss es wohl kaum sagen, aber Secord lechzte nach seinem ersten Alpengipfel.
Unsere Route verlief zunächst westlich des Grates, quer über ein steiles Schneefeld zum Ende einer kleinen Felsschlucht. Der Grund der Schlucht bestand aus Eis, aber wird konnten seitlich davon über Schiefer und Felsplatten steigen. Dann stieg das Gelände senkrecht an. Wir mussten zu den Felsen auf der anderen Seite queren. Zwei Stufen im Eis waren für die Querung ausreichend. Diese brachten mich – ich stieg voran – an den Fuß einer Felswand, die wir direkt hinaufklettern wollten, um so der Schlucht zu entkommen, in der sich alle Steine, die von einigen instabil wirkenden Wänden weiter oben hinabfallen mochten, vereinen würden. Diese Wand war steil, aber in keiner Weise schwierig – und doch tat ich mich schwer. Ich war in diesem untrainierten Zustand, in dem nicht nur Glieder und Muskeln die Gelenkigkeit und die Kraft fehlen, sondern in dem auch das Zusammenspiel von Körper und Geist ineffizient ist. Merkwürdigerweise bin ich am Beginn eines Kletterurlaubs selbstbewusst genug auf steilem Schnee oder Eis, aber im steilen Fels bin ich durch und durch unglücklich, bin dieses Zusammenspiel wieder hergestellt ist.
Durch die Ersteigung der Felsschlucht erhielten wir Zugang zum Nordgrat unseres Gipfels. Er war an keiner Stelle schwierig, bot aber unterhaltsames Kraxeln. Der ganze Anstieg war – wie die meisten Klettereien in der Silvretta – weit unten auf der Schwierigkeitsskala, aber vom alpinistischen Standpunkt aus interessant genug, um den Gipfel lohnenswert zu machen.
Einige ordentlich große Platten lagen verstreut um den Gipfel herum, und wir machten es uns auf einer von ihr gemütlich. Die Aussicht war in vielerlei Hinsicht ähnlich wie die, die ich bei zwei vorherigen Besuchen in der Silvretta genossen hatte. Wegen der nah beieinanderliegenden Gipfel und der vergletscherten Landschaft fehlt diesem Gebirge eine dramatische Qualität. Und doch: Wenn es auch keine kühnen Bergformen gibt oder wild zerrissene Gletscher, keine großen Steilhänge, die das Auge hinab in fruchtbare Täler lenken, so gibt es doch eine Qualität der Ruhe, die für sich ansprechend ist, und diese muss man zur Schönheit der Fernsicht hinzuaddieren. Die Silvretta ist ein Land für Vagabunden mit glatten Gletschern zum Überschreiten und leichten Gipfeln zum Ersteigen, ohne Sorgen wegen der Zeit oder des Wetters: ein Gebirgszug fürs hohe Alter, wenn die Kräfte für größere Klettereien in höheren Gebirgen fehlen. Außerdem ist sie eine hervorragende Skigegend. Ich keine kein Gebirge, dass ihre Gletscher und Berge übertreffen würde im Hinblick auf die Schönheit und Vielfalt des Skifahrens, das sie ermöglichen. Kommen Sie von März bis Mai her und lernen Sie, wie entzückend das Skibergsteigen sein kann! Und schließlich ist es auch ein Bezirk des freundlichen Wetters, zumindest meiner Erfahrung nach, und ich erinnere mich dankbar an seine sonnigen, windstillen Tage.
Wir stiegen ohne Eile auf derselben Route ab und rutschten stehend über die sanften Hänge nassen Schnees hinab zum Jamtalgletscher, nachdem wir einen Teil unserer Ausrüstung wieder eingesammelt hatten, den wir für den Aufstieg zurückgelassen hatten.
Stehendes Rutschen – oder „Abfahren“ – sollte man nur mit größter Umsicht, und hier war ein gutes Beispiel dafür, warum. Von oben sah es aus, als zögen sich die Hänge gleichmäßig bis ganz hinab zum Gletscher, aber wir trauten ihnen nicht so ganz und rutschten nur vorsichtig hinunter. Unsere Vorsicht war gerechtfertigt. Plötzlich und ohne Warnung fielen die unschuldig wirkenden Schneehänge steil ab und wurden zu einer Eiswand, die von Spalten durchzogen war, die bereit und willens waren, einen normal großen Alpinisten zu verschlingen. Dies war nicht das einzige Mal, dass ich getäuscht wurde. Vor vielen Jahren erlaubte ich mir, von einem kleinen Gipfel der Glarner Alpen abzufahren. Das Licht war schwach, aber ich war mir sicher, dass es sich um einen durchgängigen Hang handelte. Tat es aber nicht: Der Hang wurde von einem Felsgürtel von etwa 100 Fuß Höhe unterbrochen. Ich werde wohl nie vergessen, wie ich mich auf den Bauch warf und die Spitze meines Pickels in den Schnee trieb. Ich schaffte es anzuhalten – nach einer scheinbar ewig langen Zeit, nur wenige Yards oberhalb des Abgrunds. Wyn Harris berichtet von einem ähnlichen Erlebnis am Nordgrat des Mount Everest. Dabei verlor er auf hartem Schnee die Kontrolle und kam nahe an den Rand eines Abgrunds von fast 3000 Fuß Höhe. Er drehte sich bäuchlings und drückte seinen Pickel nach und nach in den Schnee – nach und nach, weil der Pickel aus seiner Hand gerissen worden wäre, hätte er es abrupt getan. Er sagt, er erinnert sich an die die kleine Fontäne aus Schnee, die der Pickel aufstäuben ließ, und wie er sich fragte, ob er noch rechtzeitig zum Stehen kommen würde. Es war ein Fall, in dem Nerven und Erfahrung in der Waagschale den Ausschlag gaben und die Katastrophe vereitelten.
In unserer aktuellen Situation führte uns ein anderer verschneiter Hang seitlich am Eis entlang, und ein paar Minuten später standen wir auf dem Gletscher.
Es war nur ein kurzer Weg durch weichen Schnee hinab zur Jamtalhütte, aber wir waren froh, als wir ihn bewältigt hatten, denn die Luft auf dem Gletscher war atemlos und gesättigt mit Wasserdampf. In den wenigen Minuten, die wir zum Abstieg brauchten, bekamen wir beide einen Geschmack jener entnervenden Abgeschlagenheit, die der Fluch der Gletscherüberquerungen in der Hitze des Tages ist, besonders im Himalaya, wo die Auswirkungen der Seehöhe sich noch zur Ermattung hinzugesellen.
Freudig begrüßte uns der Hüttenwirt an der Jamtalhütte, ein stämmiger, abgebrühter Mann mit struppigen kurzen Haaren. „Ihr seid die dritte englische Partie, die in den letzten zwei Tagen diese Hütte besucht hat“, erzählte er uns. „Da war eine englische Dame, die das Fluchthorn bestiegen hat, und jetzt ist noch ein weiterer Engländer mit seinem Führer da. Es gibt mehr Engländer als Deutsche oder Österreicher in den Bergen dieses Jahr“, fügte er skeptisch und ein wenig traurig hinzu. „Die Hütten sind leer, weil die Deutschen nicht herkommen können. Kommt doch besser mit in die Küche, da ist es wärmer als im Gastzimmer.“
Es ist ein unschöner Gedanke, dass dieses „aufgeklärte“ zwanzigste Jahrhundert Zeuge eines Regimes werden musste, das die Menschen eines großen Volkes daran hindert, ein Nachbarland zu besuchen. Für den freiheitsliebenden Engländer ist eine Mentalität, die sich solch einem Dekret nicht nur unterwirft, sondern freudig unterwirft, schwer zu verstehen. Im Mittelalter riskierte der Reisende Raub, Mord und Verfolgung, aber es stand ihm weitgehend frei, dorthin zu reisen, wohin er wollte, und ich jedenfalls würde solche Zustände einer Einschränkung meiner Freiheit auch durch die wohlmeinendsten Despoten des zwanzigsten Jahrhunderts vorziehen. Zukünftige Generationen werden mit einer Mischung aus Verwunderung und Hohn auf ein Zeitalter zurückblicken, das den kolossalen Optimismus hatte, sich selbst als „zivilisiert“ zu begreifen. Wenn wir unserer Zeit einen Namen geben müssen, dann wollen wir sie die „Zeit der Angst“ nennen. Kein früheres Zeitalter konnte so viele Menschen aufbieten, die in Angst leben.
Was Second und mich anging, so konnten wir es kaum bereuen, die Hütten für uns zu haben, weil ein Diktator beschlossen hatte, dass ihre Erbauer sie nicht mehr benutzen durften. Aber wir hatten Mitgefühl, zumindest theoretisch, für die Zehntausenden Arbeiter, die davon abgehalten wurden, ihren Urlaub in den österreichischen Bergen zu verbringen. Verbittert waren die Bemerkungen meines Begleiters, der aus einem Land kommt, in dem die Freiheit des einzelnen als die Grundbedingung menschlicher Existenz erachtet wird. Er führte auch einige mächtige ökonomische Theorien ins Feld, um seine Anprangerung der europäischen Verhältnisse zu untermauern. In den Details mag ich eine andere Meinung vertreten, wenn auch nur um die Diskussion zu befördern, aber im Allgemeinen war ich überzeugt, dass er mit seinen Aussagen recht hatte – dass die Rettung der Welt im internationalen Freihandel liegt und dass die sozialen und politischen Barrieren zu Staub zerfallen würden – und mit ihnen viele der absurden Verdächtigungen, Hemmungen und Ängste der Menschheit –, wenn die Welt als fundamentales Prinzip anerkennen würde, dass jeder Mensch ein Recht darauf hat, ungehindert Handel mit jedem anderen Menschen zu treiben, ungeachtet von Staatsangehörigkeiten oder Grenzen.
Es war ein fröhlicher Abend, den wir in Gesellschaft unseres Landsmanns, seines Führers und des Hüttenwirts verbrachten. Ersterer war einer von denen, die dem Kommerz einen vierzehntägigen Urlaub abgerungen hatte von den 52 Wochen, die das Geschäftsjahr (und nur nebenbei auch das Kalenderjahr) ausmachen. Er hatte erst kürzlich die Berge „entdeckt“, war aber bereits ein enthusiastischer Alpinist. Als alpinistischer Anfänger genoss er jede Besteigung als ein neues Abenteuer. Er hatte gutes Wetter gehabt und aus seinen vierzehn Tagen wohl mehr Freude herausgeholt, als mancher erfahrene Bergsteiger aus drei Monaten erstklassiger Besteigungen mitgenommen hätte. Aber nur zwei Wochen von zweiundfünfzig für die Bergsonne und die Bergluft – es ist eine betrübliche Vorstellung.
Der Hüttenwirt erzählte uns von den großen Schneefällen des Winters und dem Unheil, das sie gebracht hatten. Ein Mann war nur wenige Yards von der Hütte entfernt, „fast auf der Schwelle“, von einer Lawine getötet worden. Es war der damalige Hüttenwart. „Jetzt bin ich an seiner Stelle.“ Er blickte uns aus grübelnden Augen an. „Es ist manchmal etwas einsam, wenn es so wenige Besucher gibt, aber ich habe mein Radio.“ Das stimmte, aber es war an jenem Abend voller Pieps- und Knackgeräusche – atmosphärische Störungen durch die Gewitter, die in den Alpen bei solch schönem, heißem Wetter typisch sind. Ich vermute, er war eine Art Philosoph; Frieden lag in seinen Augen.
Am selben Abend trafen noch zwei Männer, Österreicher, ein. Wir sahen sie langsam über den holprigen Pfad zur Hütte kommen. Einer von ihnen stolperte umher und war offensichtlich sehr müde. Sie hatten die vergangene Nacht auf dem Fluchthorn biwakiert; wir fanden nie heraus warum, und der Hüttenwart konnte uns auch nicht aufklären. Vermutlich waren sie unerfahren und hatten sich verlaufen. Falls dem so war, war es nicht das einzige Beispiel alpinistischer Unfähigkeit, dessen wir auf unserer Reise gewahr werden sollten.
Wir erwachten um vier am nächsten Morgen und brachen eine Stunde später mit dem Fluchthorn als Ziel auf. Dieser Gipfel, der 11165 Fuß hoch ist, ist nicht nur der höchste in der Silvretta, sondern auch der mit Abstand schönste. Er erhebt sich westlich des Jamtals und am südöstlichen Ende des langen Fimbertals. Im März 1923 bestieg ich ihn allein während einer Wochentour durch die Silvretta, und ich erinnerte mich an ihn als einen leichten Berg auf der Normalroute, die einer Schneerinne in der Ostwand folgt und zuletzt über leichte Felsen zum Gipfel führt. Wir entschieden, diesmal einer Route zu folgen, die interessanteres Klettern bieten sollte, und planten einen Übergang vom Südgipfel zum Nordgipfel über den dazwischen liegenden gezackten Grat und von letzterem aus den Abstieg ins Fimbertal und zur Heidelberger Hütte. Der Südostgrat, der am Schneejoch, 9711 Fuß, beginnt – einem leichten schneebedeckten Pass, der mit Skiern überschritten werden kann –, könnte eine interessante Aufstiegsroute darstellen, und wir beschlossen, ihn zu durchsteigen.
Vielleicht sollte ich an dieser Stelle erklären, dass wir keine Führerliteratur bei uns hatten und unsere Wege auf die Gipfel einfach im Lichte der Natur suchten. In einer Gegend wie Tirol, wo alle Gipfel auf mindestens einer Route leicht erreichbar und von mäßiger Höhe sind, macht es mehr Spaß, ohne Reiseführer zu klettern und sich nur auf die verfügbaren Landkarten zu verlassen.2 Es stimmt, dass einem durch Unkenntnis durchaus gute Kletterrouten entgehen können, aber das wird mehr als ausgeglichen durch ein vorzügliches Gefühl der Ungewissheit.
Um das Schneejoch zu erreichen, folgten wir dem Breitwassertal für eine kurze Weile, dann stiegen wir ermüdende Gras- und Schutthänge hinauf zum kleinen Kronengletscher, der sich sanft, ohne jede Spalte, zur verschneiten Parabel des Passes aufschwingt.
Auf einer Seitenmoräne hielten wir an, um uns mit Gesichtscreme einzuschmieren. Die Sonne hatte am Tag zuvor Unheil angerichtet. Ich war noch relativ gut davongekommen, obwohl meine Haut wie eine Trommel gespannt war, was das Lächeln schwierig und unangenehm machte. Aber Secord hatte wirklich schweren Schaden genommen, und sein Gesicht zeigte zunehmend Hügel und Gräben wie eine Mondlandschaft.
Nach dieser wichtigen Tätigkeit spazierten wir über die hartgefrorene Oberfläche des Gletschers hinauf zum Pass, wo wir frühstückten.
Es war ein weiterer glorreicher Morgen. Wir fingen an, das gute Wetter als selbstverständlich zu erachten – eine Annahme, die ich in den Alpen nie zuvor getroffen hatte. Kaum eine Wolke war zu sehen, und im Südwesten erhoben sich die großen Gipfel der Bernina, die sich scharf gegen die italienischen Nebel abzeichneten. Nah bei uns waren die brachialen Felszinken der Zahnspitze südlich des Schneejochs, und zu unseren Füßen fielen die Hänge des Fimbergletschers ab bis zu einer fernen Anhäufung von Moränen, unordentlich mit Schneeflecken übersät, und zu den grünen Tiefen des Fimbertals, das sanft nordwärts in Richtung des fernen Patznauntals verlief.
Die höher steigende Sonne, zwar wohltuend wärmend, hatte einen kühlen Wind ausgelöst, und wir begannen gerne unseren Aufstieg über den Grat. Zunächst war dies nichts als eine geröllbedeckte Kante mit gelegentlichen unangenehmen Auswüchsen aus lockerem Schiefer. Die ließen uns meckern, aber unsere Meckerei endete, als wir an Höhe gewannen und festeren Fels entdeckten. Aus einem mühsamen Trott wurde eine Kraxelei, und aus der Kraxelei wurde Felsklettern.
Mit seiner üblichen Energie wählte Second bewusst die steilste und schwierigste Route auf die Türme hinauf, die einer nach dem anderen aus der Kante des Grates herauswuchsen – und erwartete, dass ich ihm mit derselben unbekümmerten Hingabe folgen sollte. Meine lebhafteste Erinnerung an diesen Teil des Grates ist ein Turm, unten klein und oben groß (den man mit Leichtigkeit hätte umgehen können) mit einer kniffligen Stufe, wo die Balance heikel und entscheidend war. Mit seiner phänomenalen Körpergröße brauchte sich Secord hier keine großen Umstände zu machen, aber als ich an der Reihe war, freute ich mich über die moralische Unterstützung des Seils, bevor ein überaus befriedigender Griff erreicht werden konnte und ein kräftiger Armzug mich auf den Kamm beförderte.
Über diesem zerklüfteten Teil des Grates waren die Felsen unerwartet mit Schnee durchsetzt, der sich dann zu einer scharfen dünnen Schneide verengte. Wir wechselten nun – Secord hatte sich bereits an den Zinnen überfressen –, und ich stieg vor. Ein herrlicher Grat war das, wunderschön vom Wind ziseliert. Man konnte ihn nicht umgehen; hier hatten wir endlich ein echtes alpinistisches Problem. Es war nicht schwierig, aber das minderte nicht den Spaß, es zu lösen. Die Abhänge zu beiden Seiten waren steil. Nach links senkten sie sich in eine tiefe Rinne und nach rechts formten sie eine glatte Fläche mit Furchen und Rillen, wo der von der Sonne gelockerte Schnee in kleinen Lawinen abgegangen war.
Der Schneegrat endete an einem Felsturm, einem überhängenden Gesellen, der unmöglich direkt bestiegen werden konnte. Aber es gab einen Weg nach links zum oberen Ende der erwähnten Rinne. Wir kehrten zur Schneide zurück, aber nach ein paar Yards endete sie an einer Felswand, die gesäumt war von neuen Rinnen. Wir suchten uns eine von ihnen aus und kletterten verhalten ein steiles Schneebett hinauf, das auf Felsplatten zu ruhen schien. Es wurde so steil, dass Handgriffe wie auch Fußtritte nötig wurden, und wir zögerten nicht, vom Schnee in die Felswand zur Linken zu wechseln. Es folgte eine steile und ausgesetzte Kletterei von vielleicht 100 Fuß, die uns zu einem weiteren Grat führte. Dieser war angenehmer geneigt, und wir kraxelten schnell hinauf, beide gleichzeitig. Schon sahen wir einen hölzernen Vermessungsdreifuß in Silhouette vor dem leuchtend blauen Himmel. Ein paar Minuten später standen wir auf dem Gipfel des Fluchthorns.
Eine schöne Kletterei; ein glorreicher Tag; wir waren zufrieden. Wir drängten uns zwischen die verstreuten Felsblöcke im Gipfelbereich und aßen zu Mittag. Die Sonne brannte unerbittlich; kein Windhauch regte sich; die Erde und die Atmosphäre waren zutiefst still.
Nach dem Essen suchten wir Schutz vor der Sonne, die mit der kompletten Zerstörung unserer Gesichter drohte. Es ist eine selten gemachte Erfahrung, auf einem Alpengipfel von mehr als 11000 Fuß Schatten suchen zu müssen. Es war einer der heißesten Tage in den Alpen, an die ich mich erinnern kann, und selbst im Schatten war es angenehmer, unsere Jacken auszuziehen und hemdsärmelig dazusitzen.
Das Fluchthorn ist ein schöner Aussichtspunkt. Keine Häuser oder Dörfer sind sichtbar, nichts als Berge und einsame oder vergletscherte Täler. Wir hätten gut die einzigen Bewohner einer menschenleeren und vergessen Welt sein können. Die Stille und der Frieden des sonnenerfüllten Tages verstärkten diesen Gedanken. Es war ein Tag für Ruhe und Träumerei. Frieden zog sich über den Horizont, den man mit den Augen so schnell abschreiten konnte.
Im Westen formte sich eine Wolke. In der gesamten riesigen blauen Arena wurde nur diese eine Wolke geboren. Zunächst nicht als ein Gespenst aus Dampf, wuchs und wuchs sie und baute sich aus der fieberhaften Wärme der Erde auf. Sie wuchs wie ein Dschinn aus der Flasche eines Magiers, auf wundersame Weise, nahm langsam die Energie des Universums in sich auf, Schicht für Schicht, Ebene für Ebene, lockte das Sonnenlicht auf ihre sich türmende Oberfläche, sammelte die Schatten in immer tieferen Abgründen.
Dann, als sie sich aufgetürmt und aufgetürmt hatte, kam ein Wind, der sie packte und auseinanderzog, bis sie zu einer langen Fahne wurde.
Andere Wolken bildeten sich und wuchsen. Im Westen füllte sich der Himmel mit schieferblauem Dunst, der die fernen Gipfel des Glarus und des Berner Oberlands verhüllte, und wie zur Antwort quoll im Süden eine große Masse an Dampf aus den italienischen Tälern heraus nach oben. Die Luft verlor etwas von ihrer belebenden Frische; die Sonne brannte mit zunehmender Kraft. Ein Gewitter zog auf.
Während Secord mit einem Taschentuch über seinem Gesicht seelenruhig schlief, kraxelte ich ein kleines Stück den Grat entlang, der die zwei Gipfel des Fluchthorns verbindet. Wir hatten beabsichtigt, diesen Grat zu überschreiten, aber die Faulheit hatte uns übermannt. Es muss eine schöne Kletterei sein, möglicherweise die beste in der Silvretta: Der Kletterer muss eine Reihe von Felstürmen immer wieder hinauf und hinab klettern. Aber es war ein zu schöner Tag, um ihn mit Klettern zu verbringen. Es gibt Zeiten, wenn es besser ist, sich zu entspannen und sich mit einem einzelnen Gipfel zufrieden zu geben. Wenn man das Bergsteigen wirklich genießen will, muss es eine Mischung aus körperlicher Aktivität und mentaler Rast geben. Während der Rast flüstern uns die Berge die Botschaften zu, an die wir uns am meisten erinnern werden.
Schon kehrte ich zurück, machte es mir bequem wie mein Kamerad und schlief ein wenig. Auf dem Gipfel eines Berges zu schlafen, ist eines der großartigsten Erlebnisse des Bergsteigens.
Schließen stiegen wir wieder ab – auf dem Normalweg. Die Gewitterwolken wuchsen rasch an, und ein grelles Licht lag auf dem Schnee der Bernina und des Palü.
Ein kurzes Stück turnten wir über leichte Felsen hinab, zwischendurch auch über steinige Terrassen. Der Tag war nun schon weit fortgeschritten, und wir erwarteten, den Schnee in der 1500-Fuß-Rinne in einem unangenehmen und sogar gefährlichen Zustand vorzufinden. Aber das gute Wetter der letzten paar Wochen hatte gründliche Arbeit geleistet, und der Schnee war kompakt und überraschend hart – so hart, dass wir für eine Weile Stufen schlagen mussten. Manchmal findet man am Fuß einer Rinne einen respektablen Bergschrund vor, aber hier war keine Spur von einem zu sehen, zweifellos aufgrund des außergewöhnlichen Schneefalls im Winter. Sobald wir es ohne Gefahr tun konnten, rutschten und hüpften wir die letzten 500 Fuß hinab zum Kronengletscher.
Eine Wanderung von wenigen Minuten brachte uns zurück zum Schneejoch. Der Tag verschlechterte sich rasch. Das unschöne Licht verbreitete sich immer weiter, und die Berge hatten die Vitalität vom Morgen verloren und standen mürrisch inmitten eines ockerfarbenen Donnernebels. Wir trödelten nicht mehr, sondern sprangen über die verschneiten Hänge hinab zum Fimbergletscher. Wenige Minuten später suchten wir uns den Weg durch die Endmoränen dieses kleinen Gletschers, und noch einige Minuten später stapften wir zwischen länglichen Schneeverwehungen aus dem letzten Winter über den feuchten Torf des Fimbertals.
Noch weiter unten trafen wir auf Blumen, einen Teppich aus Enzianen und Glockenblumen. Eine wunderschöne Erfahrung: so schnell von einem hohen Berg in ein Blumental zu gelangen. Die Luft war hier nicht trocken und fiebrig wie in der Höhe, sondern feucht und matt. Die Sonnenstrahlen waren auch etwas anders; nicht länger sengend, sondern sanft und gemäßigt.
Die Heidelberger Hütte, 7415 Fuß, liegt zwar nördlich des Kamms und der Wasserscheide, aber doch auf Schweizer Gebiet. Die Grenze macht in dieser Gegend einen kuriosen und völlig unlogischen Schwenk nach Norden. Da die Hütte von der Schweiz aus nicht leicht erreichbar ist, wird sie von Ischgl im Patznauntal aus versorgt und ist im Besitz der Heidelberger Sektion des D.Ö.A.V.
Wir waren die einzigen Besucher, und der Hüttenwirt, ein Österreicher aus dem Patznauntal, freute sich, uns zu sehen, denn das Leben war langweilig, erklärte er uns. Er war ein gutaussehender Kerl, groß und gut gebaut, mit dunklem, drahtigem, lockigem Haar und Schnurrbart und der rötlich-gebräunten Gesichtsfarbe, die beim Leben im Freien entsteht.
Er erzählte uns, dass er sich an keinen so warmen Sommertag erinnern konnte. Das Hüttenthermometer hatte umgerechnet 75 Grad Fahrenheit im Schatten verzeichnet, eine erstaunliche Temperatur in den Alpen auf einer Höhe von über 7000 Fuß.
Das unvermeidliche Gewitter entwickelte sich am Abend. Es war ein halbherziges Unwetter. Wir hörten, wie es dumpf in der Ferne grollte, dann entlud es seinen Zorn mit langgezogenem Knistern am Fluchthorn und murmelte und grummelte um die Gipfel im Talschluss des Fimbertals herum. Regen fiel, aber nicht stark, sondern sanft und warm wie bei einer Segnung. Es lag keine Böswilligkeit in diesem Unwetter – es war lediglich ein Produkt der Hitze. Am Morgen würde das Wetter wieder gut sein.
Erneut leistetem wir dem Hüttenwirt in der Küche Gesellschaft. Die Hütte war ausgestattet mi einem Radioempfänger, der Elektrizität benötigte, die ein kleiner Turbogenerator am Ufer des Bachs erzeugte, aber atmosphärische Störungen verdarben uns das abendliche Programm aus Wiener Musik.
Genau wie der Wirt der Jamtalhütte war auch hier der Hüttenwirt froh über ein Publikum. Zunächst gab es die örtlichen Nachrichten. Vor zwei Wochen war die Leiche eines jungen Mannes aus Wien im Fimbertal entdeckt worden, eine halbe Stunde zu Fuß von der Hütte entfernt. Er hatte im Winter Selbstmord begangen – wie genau, das erfuhren wir nicht – und hatte seinem Bruder seine Absicht schriftlich mitgeteilt, bevor er zu Hause aufgebrochen war. Seine Leiche war erst nach der Schneeschmelze entdeckt worden.
Danach drehte sich das Gespräch um die Tiefen internationaler Politik, offenkundig ein Lieblingsthema des Hüttenwirts.
Politik nimmt viel Platz in den Köpfen der Österreicher ein – zu viel. Zu einem gewissen Grad ist das verständlich in einem Land, das von innerer Zwietracht zerrissen und Opfer nach Außen gerichteter Ängste ist. Trotzdem, wenn die Österreicher – und, was das betrifft, alle europäischen Völker – weniger über Politik nachdächten, dann wäre Europa ein glücklicherer und friedlicherer Kontinent, als es das heute ist.
Auf die Gefahr hin, als „Inselbewohner“ abgestempelt zu werden, bin ich der Meinung, dass die britische Tendenz, Sport noch vor der Politik an die erste Stelle zu reihen, gesünder ist. Wenn man in Österreich die Schlagzeile „Österreich in Gefahr“ in der Zeitung liest, dann weiß man, dass eine ernste nationale Krise eingetreten ist, höchstwahrscheinlich zunächst einmal im Kopf des Chefredakteurs der fraglichen Zeitung. Wenn man andererseits eine englische Morgenzeitung in die Hand nimmt und in großen Buchstaben die Schlagzeile „England in Gefahr“ sieht, dann weiß man, dass sich etwas wahrhaft Katastrophales in der nahen Zukunft ereignen wird, etwas, das den Seelenfrieden eines jeden Engländers zerschmettern wird – beispielsweise ein Rückstand gegen die Australier beim Cricket.