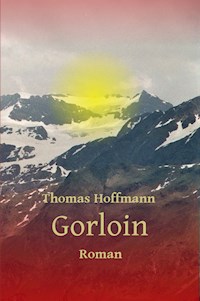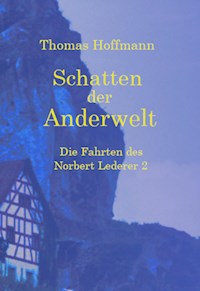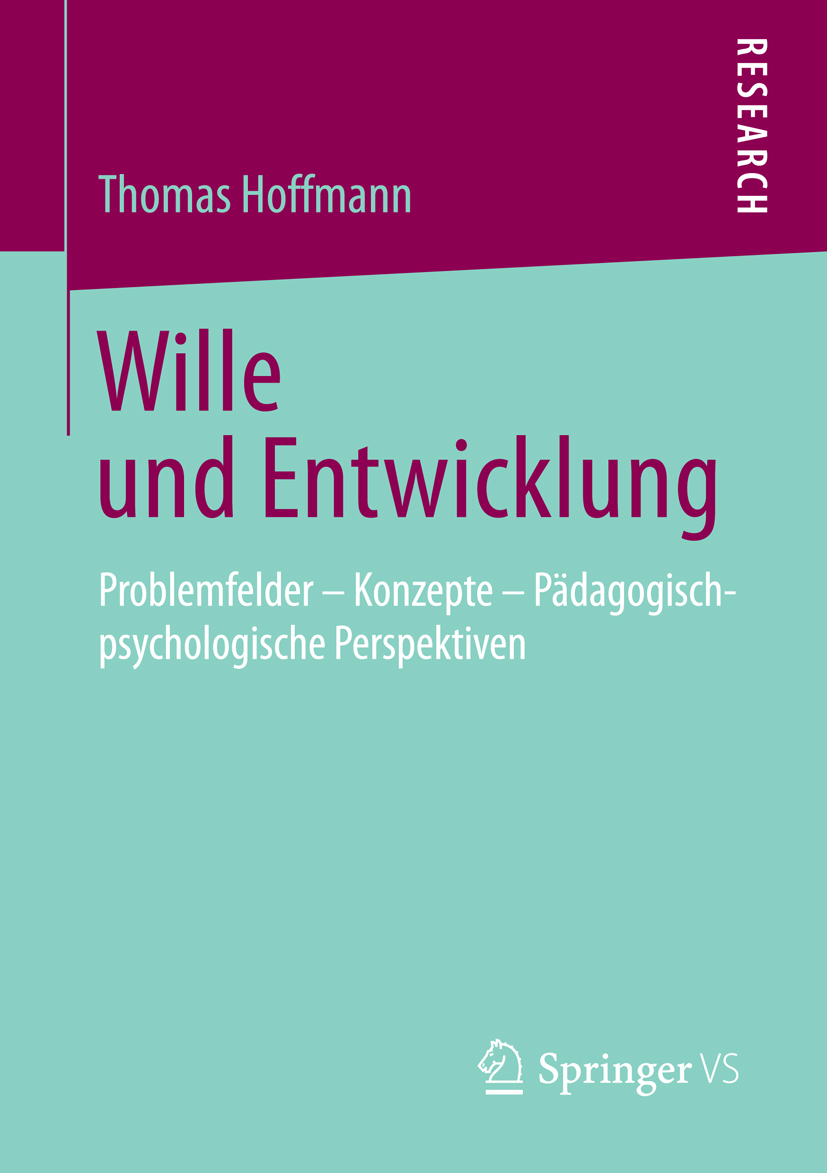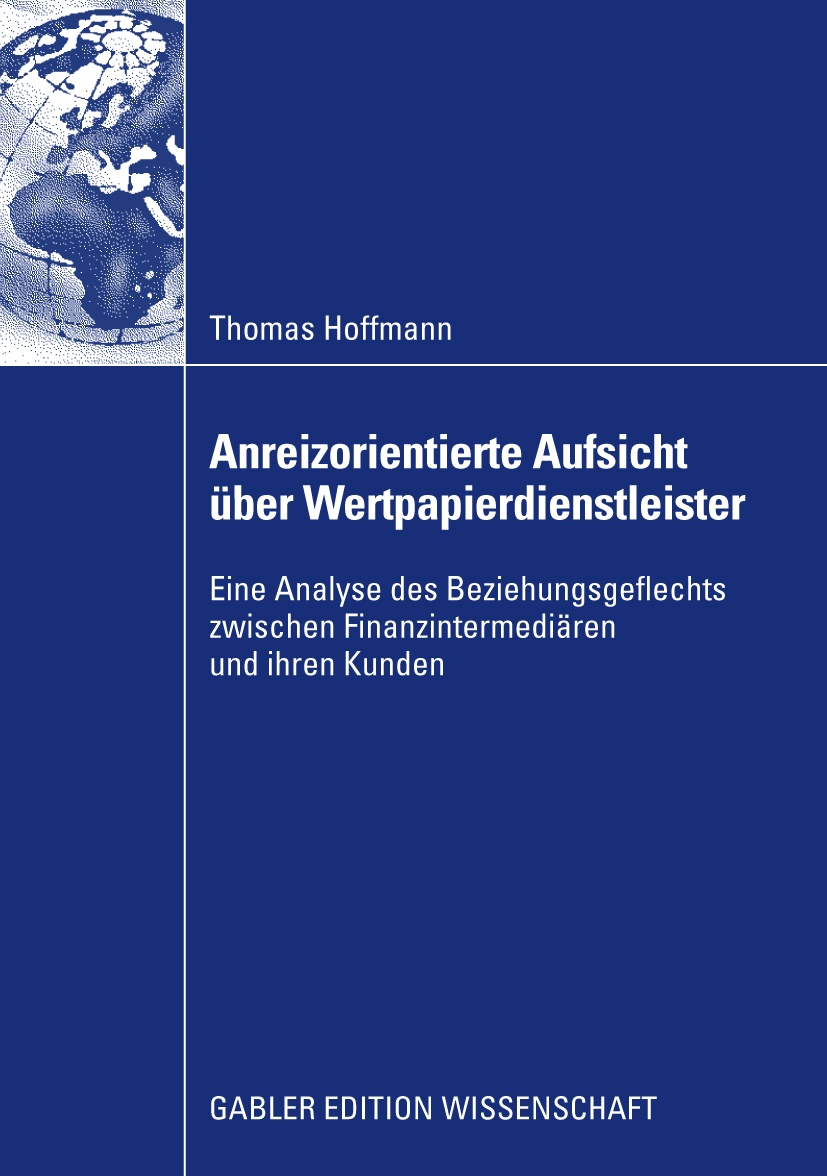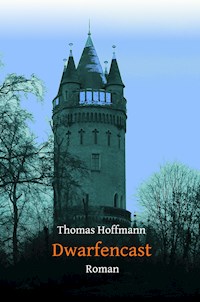
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Leif Brogsohn
- Sprache: Deutsch
Schon als Kind träumt Leif Brogsohn von einem fernen, geheimnisvollen Land menschenmordender Hexen, magischer Kulte und versunkener Königreiche. Als er und sein Freund Sven mit der jungen Feldscherin Katrina Rodewald aufbrechen, um fern der Zivilisation an der Küste der Wetterberge in die Dienste eines Raubritters zu treten, ahnen die Gefährten noch nicht, dass sie in ein Netz dunkler Prophezeiungen, blutiger Hexerei und mörderischer Kämpfe geraten, das sich mit jedem Schritt, zu dem sie sich entscheiden, enger um sie zieht. Schon bald konkurrieren Leif und Sven um die Liebe Katrinas. Leif gerät in den Bann einer Schwarzmagierin, die vermeintliche Abenteuerfahrt wird zum Überlebenskampf. Als der Burgherr die Gefährten aussendet, um aus dem entlegenen Bergkloster eines mysteriösen, militanten Mönchsordens ein Buch zu stehlen, nimmt die Katastrophe ihren Lauf. . . . Katrina sah mich verzweifelt an. In ihren Augen schwammen Tränen. "Das ist ein Labyrinth - wir sind in einem elenden, verdammten Labyrinth!" "Ja, scheint fast so." "Wer hätte denn damit gerechnet, dass sich unter der Burg ein götterverdammtes, beschissenes Labyrinth befindet!" Und dann schrie sie: "Und warum bei allen Sternen hat uns niemand gewarnt?" Tränen rannen über ihr Gesicht. "Das ist alles meine Schuld, Leif. Immer verrenne ich mich irgendwo, verlaufe mich und finde mich nicht mehr zurecht. Alles, was ich anfange, endet im Chaos! Ich dachte, diesmal würde es anders, wir würden Abenteuer erleben und alles würde gut - und jetzt bringe ich euch in Lebensgefahr und wieder bricht alles zusammen!" "Wirf nicht alles hin, Kat, lauf nicht davon," flüsterte ich. "Oder wenn - dann lass mich mitkommen!" "Bist du nicht eifersüchtig wegen Sven?" fragte sie leise. Ja, sicher bin ich das! Es ist so schlimm, dass es mir fast die Eingeweide zerreißt. "Sprich nicht darüber, Kat. Manche Sachen werden nur schlimmer, wenn man darüber redet." Das Leben ist ein Dickicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 840
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Hoffmann
Dwarfencast
Roman
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
____________________
Impressum neobooks
1.
Die meisten Abenteuer fangen in einem Wirtshaus an. Ich habe keine Ahnung, warum. In Wirklichkeit fangen sie wohl zu gar keinem bestimmten Zeitpunkt an. Dinge geschehen, man begegnet Leuten und irgendwann findet man sich in einem Strudel von Ereignissen wieder, die unweigerlich ihren eigenen Lauf nehmen. Doch woran man sich im Nachhinein erinnert, ist die eine folgenschwere Begegnung in irgendeinem Wirtshaus.
Erst, als es zu spät war, wurde mir klar, dass es Abenteuer nur im Märchen gibt. Was anfangs wie ein Abenteuer anmutete, wurde ein Kampf ums nackte Leben, ein verzweifelter Versuch, noch zu retten, was mir geblieben war von allem, wofür ich lebte.
Dem Mann, dessen Visionen mein Leben verändert haben, begegnete ich zum ersten Mal im Landgasthof „Zum einäugigen Piraten“. Die aus Feldsteinen errichtete, schindelgedeckte Schänke stand nicht weit von meinem Heimatdorf an der Steilküste bei der Landstraße nach Torglund. Brögesand hatte damals vielleicht fünfzig oder sechzig Einwohner. Zwischen den gedrungenen Hütten und zum Trocknen aufgespannten Fischernetzen tobten magere Kinder umher. Sie hatten nur wenige Kleidungsfetzen auf dem Leib. Die Alten saßen im Schatten der niedrigen Reetdächer, rauchten ihre Pfeifen oder flickten an den Netzen.
Die Fischerhütten drängten sich in den hinteren Teil einer sandigen Bucht. Ein wenig abseits lag Bredurs Dorfschmiede. Aus dem gemauerten Schornstein der Schmiede stieg von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Rauch und den ganzen Tag über war Bredurs Schmiedehammer zu hören. Im Süden wie im Norden erstreckte sich hohe Steilküste. Am Südrand der Bucht ragte eine schmale Landzunge ins Meer. Bei Ebbe wurden zwei oder drei Steinwürfe vor der Landzunge die Felsen sichtbar, die dort unter der Wasseroberfläche lagen - eine ständige Gefahr für die zerbrechlichen Kähne, in denen wir mit unseren Vätern Tag für Tag durch die Brandung auf die See zum Fischen hinausruderten.
Die Landstraße, die an unserem Dorf entlangführte, war kaum mehr als eine sandige, von Händlerkarren in den Lehmboden gegrabene Spurrinne durch die grasbewachsene Küstenlandschaft, in der nur hier und da ein gedrungener Busch dem Wetter trotzte. Die Fahrrinne zweigte östlich von Brögesand von der Überlandstraße ab, welche die Kaiserstadt Klagenfurt mit der Hafenstadt Torglund im Norden verband. Die Händler, die diese Fahrrinne entlang kamen, waren raubeinige Leute auf von Eseln oder Schindmähren gezogenen Karren. Viele trugen schartige Schwerter und wurden von Männern begleitet, denen anzusehen war, dass sie für wenige Kreuzer jeden Auftrag annahmen. Die Karawanen der Tuchhändler und der reichen Kaufleute zogen mit ihren Söldnertruppen auf der Überlandstraße von Torglund nach Klagenfurt. Doch unser Dorf lebte vom Handel mit Krämern und armen Handelsleuten. Und sie lebten von dem, was sie in Brögesand erhandelten.
Die Händler kamen im Frühjahr, wenn die ersten Stürme vorüber waren und noch einmal im Herbst wenn das Wetter umschlug und der Wind kalte Regenschauer über die Küste peitschte. Sie kamen in den Tagen nach Neumond. Wenn die Händlerkarren heranzuckelten, wurde das Dorf lebendig. Kinder liefen jubelnd umher. Die Frauen legten Bretter über Böcke und stellten Bänke auf. Sie brachten getrockneten Fisch, Bier und Met in Tonkrügen. Die Männer standen schweigend dabei. Sie würden den Handel führen. Dabei ging es laut und derb zu. Es wurde viel getrunken. Oft dauerte der Handel bis in die Nacht. Die Kinder bekamen Zuckerbrötchen, Rosinen und Obst. In meiner Kindheit waren die wenigen Tage, die unser Dorf im Frühjahr und im Herbst von den Händlern besucht wurde, die großen Festtage im Jahr. Waren die Händler abgezogen, hatten wir Weizen, Öl, Tabak und Fässer voller Pökelfleisch. Neue Kleider und Gerätschaften waren eingetauscht worden. Der Wohlstand und der Reichtum, den die Händler uns brachten, war das Großartigste, was ich mir damals vorstellen konnte.
Später jedoch, als ich größer wurde, konnte ich keine Freude an diesen Festtagen mehr empfinden. Eine Zeit lang versteckte ich mich sogar und kam erst wieder aus der Ecke unserer Hütte hervorgekrochen, wenn der Festlärm vorbei und die Händler abgezogen waren.
Ich erinnere mich deutlich an den grauen Morgen, an dem ich den ertrunkenen Seemann am Strand fand. Ich muss sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein. Es war im Frühjahr in den Tagen nach Neumond. Ich war in aller Frühe aus dem Haus gerannt. Mutter hatte den Wasserkessel aufs Feuer gesetzt. Tante Lines Kinder und ich sollten der Reihe nach in dem großen Waschzuber mit Kernseife und Bürste abgeschrubbt werden. An diesem Morgen ergriff ich die Flucht vor der verhassten Prozedur. Und da fand ich ihn zwischen zerbrochenen Schiffsplanken, Fässern und Kisten an den Strand gespült, mit seltsam verrenkten Gliedern. Sein Haar und seine Kleider waren klatschnass. Die glasigen, gebrochenen Augen blickten zu den Wolken, die über den grauen Himmel jagten. Der Mund war aufgerissen und entblößte die gelben, schiefen Zähne.
Ich konnte es lange Zeit nicht fassen. Ich krallte mich in den Rock meiner Mutter, versteckte mein Gesicht in ihrem Schoß und heulte und schrie. Sie fuhr mir mit ihren rauen Händen durchs Haar, sagte kein Wort. Ich prügelte mit meinen kleinen Fäusten auf Vater ein.
„Warum?“ - „warum?“ schrie ich immer wieder.
Er fasste mich an den Schultern, biss auf seine Pfeife und blickte mir fest in die Augen. Sein wettergegerbtes Gesicht war in Tabakrauch gehüllt.
Zwischen den Zähnen hindurch erwiderte er mir: „Von getrocknetem Fisch allein kann man an dieser Küste nicht leben, Leif. Davon kann man nur ein Bettlerdasein fristen. Später wirst du es verstehen. Wenn du größer bist, nehmen wir dich in den Neumondnächten mit auf die Klippe.“
Mit der Zeit legte sich das Entsetzen. In dem Jahr, in dem ich zwölf wurde, war ich zum ersten Mal dabei, als die Männer in einer stürmischen Neumondnacht zu Beginn der Schifffahrtssaison nach Einbruch der Dunkelheit auf der Spitze der Landzunge ein großes, weithin sichtbares Feuer entfachten. In dieser Nacht geschah nichts. Die Männer waren missmutig. Die ganze Nacht hindurch bis zum Einbrechen der Morgendämmerung schlug mir das Herz bis zum Hals. Der tote Seemann stand mir vor Augen.
In den folgenden Nächten weigerte ich mich, hinauszugehen. Ich lag mit klopfendem Herzen auf meiner Schlafstelle und starrte in die Dunkelheit. Jeden Moment glaubte ich, das Splittern von Planken hören, glaubte durch den stürmischen Wind die Hilfeschreie und Stoßgebete Ertrinkender zu erahnen. Doch als die Männer am dritten Morgen durchnässt und erschöpft mit Kisten und Fässern, mit Segelbahnen voller Beutegut zu den Hütten zurückkamen, hatte ich in der Nacht überhaupt nichts gehört. Nur der immerwährende Wind hatte an Fensterläden und am Türriegel gerüttelt.
***
Ich bin Leif Brogsohn. Das Handwerk, das ich von meinem Vater erlernt habe, ist das Seeräuberhandwerk. Wenn zu Beginn und zum Ende der schiffbaren Zeit Sturmböen von der See her landeinwärts wehten und die Handelsschiffe hart am Wind segeln mussten, um nicht gegen die Küste getrieben zu werden, dann entfachten die Männer unseres Dorfs draußen auf der Landzunge in den mondlosen Nächten ein großes Richtfeuer. Die Kapitäne, die sich zu diesen Jahreszeiten von den höheren Frachtgewinnen verleiten ließen, die Fahrt von den Häfen im Süden nach Torglund zu riskieren, mussten in der Nachtschwärze glauben, es handle sich um das Richtfeuer von Zwiesund, wo die Küste steil nach Osten abknickt und die Schiffe zwischen einer wenige Meilen im Meer liegenden Felsengruppe und der Küste hindurchsteuern mussten, um den letzten Küstenabschnitt vor Torglund zu erreichen. Die Schiffe steuerten vom Feuer geleitet nah ans Ufer heran, wo sie den unter der Wasseroberfläche liegenden Felsen kaum je entkommen konnten. Der Sturm tat sein übriges, die gegen die Felsen geschleuderten Schiffe zu zerbrechen. Unsere Männer hatten lediglich das treibende Frachtgut aufzufischen und in ihren wendigen Kähnen an Land zu schaffen. Häufig begaben sie sich dabei selbst in Lebensgefahr. Doch das Leben an der Küste war hart, und mein Vater brachte mir bei: Wer Wohlstand will, muss bereit sein, unter Einsatz des Lebens dafür zu kämpfen.
Darum, dass unsere Überfälle von Seeleuten verraten werden könnten, machten die Dorfbewohner sich wenig Sorgen. Die Steilküste bot den Schiffbrüchigen kaum eine Möglichkeit, das rettende Ufer zu erreichen - und wer hätte die Hilfeschreie eines Schiffbrüchigen hören sollen, der sich trotz Sturm und Nacht mit letzter Kraft an Land geschleppt hatte? In jedem Dorfhaushalt gab es eine solide Zimmermannsaxt aus Bredurs Dorfschmiede. Und in den Nächten, in denen sie gingen, das falsche Richtfeuer zu entzünden, hatten die Männer ihre Äxte dabei.
Und sollte ein Steuermann seinen Irrtum früh genug erkennen und sein Schiff gegen den landeinwärts drückenden Wind aufs Meer hinaus in Sicherheit bringen, was tat es, wenn er später in Torglund oder sonst einem Hafen erzählte, er habe an irgendeinem Küstenabschnitt in der schwarzen Nacht ein Irrfeuer gesehen? Die Gespräche in den Hafentavernen drehten sich immerfort um Dämonen, Seeungeheuer und Irrlichter, denen die Seeleute sich auf ihren Fahrten ausgesetzt sahen. Wer hätte aus diesem Seemannsgarn einen glaubwürdigen Hinweis heraushören sollen? Schiffe gingen verloren, gingen in die Irre oder kamen irgendwo an, manchmal endlich auch da, wohin sie unterwegs waren. Das war das Los der Seeschifffahrt. Es war das Risiko der Kaufleute, für die Reichtum und Verlust stets nah beieinander lagen. Und es war die Lebensader der armen Küstenbewohner, die einzige Möglichkeit, unser Dasein am Rande des Hungers und der Not lebenswert zu machen.
***
Hin und wieder kam ein Trupp Soldaten ins Dorf mit dem Befehl, Beutegut zu suchen und Piraten dingfest zu machen. Dann ging mein Vater zu ihnen hinaus, die Pfeife zwischen den zusammengebissenen Zähnen, und ließ sich vom Offizier das Befehlsschreiben zeigen. Er las es sorgfältig und stellte dem Obristen Fragen.
Mein Vater konnte lesen.
„Übe dich im Lesen, Leif,“ forderte er mich wieder und wieder auf. „Wer nicht lesen kann, wird in dieser Welt von Händlern, Grundherren und Richtern, von allen Mächtigen bis aufs Blut betrogen. Du hast keine Rechte, wenn du nicht lesen kannst.“
Während mein Vater mit dem Obristen sprach, bauten die Frauen Tische und Bänke auf. Bier und Met kamen auf den Tisch und auch vom zurückbehaltenen Beutewein wurde aufgetragen. Die Soldaten lachten und setzten sich zum Trinken. Sie hatten einen anstrengenden Marsch hinter sich. Dann verhandelte mein Vater mit dem Befehlshaber über den Preis. Schließlich wurde die Kiste mit den erbeuteten Goldtalern aufgeschlossen und dem Befehlshaber die geforderte Summe herausgebracht. Er teilte die Goldmünzen mit seinen Männern. Man grinste, klopfte sich auf die Schultern und nach wenigen Stunden zogen die Soldaten ab, schwankend die meisten, aber alle hoch zufrieden.
„Bis zum nächsten Mal,“ riefen sie uns zu. „Ist ja bald wieder Saison!“
Oft zogen sie zum Gasthof „Zum einäugigen Piraten“, wo sie die Nacht durch mit den Mägden des Gastwirts feierten und zechten, um sich erst spät am nächsten Tag auf den Rückweg zu machen.
***
Im Alter von fünfzehn, sechzehn Jahren waren die Jungen unseres Dorfs, ich unter ihnen, mit der Küste, den Gewässern vor der Bucht und den häufig umschlagenden Winden vertraut. Wir konnten einen leichten Kahn zwischen den Unterwasserfelsen durch die nach allen Seiten brechende Gischt rudern und waren in der Lage, einen großen Kutter bei jedem Wetter aufs Meer hinauszusegeln. Wir kannten uns mit Netzen und Reusen aus und mit den günstigen Zeiten für den Fischfang. Wir wussten mit Enterhaken umzugehen und alle von uns hatten Erfahrung mit der dreckigen Arbeit mit den Zimmermannsbeilen.
Und noch etwas hatte ich gelernt: das Lesen. Unter dem Beutegut, das mein Vater in der Hütte zurückhielt, befanden sich mehrere nur stellenweise vom Wasser beschädigte Bücher. Den Leseunterricht meines Vaters ließ ich anfangs nur unter Zwang über mich ergehen. Aber nachdem ich die ersten Fortschritte gemacht hatte, begann ich zwischen den brüchigen, angeschimmelten Buchdeckeln ungeahnte Welten zu entdecken. Nicht alles, was ich in den Büchern meines Vaters las, faszinierte mich. Da gab es eine Grammatik der alten Hochsprache, ein nautisches Werk über Meeresströmungen, Winde und den Verlauf der Westküste von den Mangrovensümpfen im Süden bis zu den bergigen Küsten hoch im Norden und einen Band mit Tabellen über Maße und Gewichte, der einmal einem Kaufmann gehört haben musste. Aber in der Büchertruhe meines Vaters fand ich auch eine Reisebeschreibung über Wanderungen an der Nordgrenze des Reichs. Über den "Reisen in die nordwestlichen Wetterberge", geschrieben von einem Leonhard Knobloch, verbrachte ich Stunden über Stunden. Manchen Tag saß ich bis in die Dämmerung über die verblichene Schrift gebeugt und war blind und taub für alles, was um mich her vorging.
Das Buch weckte mir zum ersten Mal den Wunsch, auf Abenteuerfahrt zu gehen. Knobloch berichtete von Hexen und Zauberern, von wilden Küsten, an denen Menschen auf geheimnisvolle Weise verschwanden. Wo sich die Ausläufer der Wetterberge ans Meer erstrecken, würden die Klippen vor der Küste von Geistern heimgesucht. Ich las von Urwäldern, bevölkert mit seltsamen Wesen und von ungesunden, giftigen Sümpfen. Vor anderthalb Jahrtausenden, zur Zeit der ersten Königreiche, habe dort an der Küste ein großes Reich bestanden, Barhut mit Namen. Die Barhuter eroberten in aufeinanderfolgenden Kriegen die von Zwergen besiedelten Südhänge des Gebirges. Sie setzten sich gegen kriegerische Stämme zur Wehr, die in schnellen Schiffen von der See her kamen. Auch diese wurden besiegt und vertrieben. Nach vielen Jahrhunderten zerfiel das Reich Barhut. Heute fehle jede Spur dieses mächtigen Königreichs aus der Frühzeit der Menschheit.
Die Sagen in den „Reisen in die Wetterberge“ wirkten so viel farbiger und ruhmreicher als unser ärmliches Dasein als Fischer und Küstenpiraten, dass ich, sinnend über meinem Buch, bald den Ruf eines Tagträumers weg hatte.
„Bücherwurm!“ riefen die Dorfjungen. „Bücherwurm, komm raus, wir fahren mit dem Kutter auf See!“
Sie ließen mir keine Ruhe, bis ich blinzelnd und mit zerrauften Haaren vor die Hütte kam und mit ihnen zum Strand hinunterlief, wo zwischen den flachen Kähnen die großen Kutter lagen. Wenn die Männer, und wir mit ihnen, nicht in aller Frühe zum Fischen hinausgefahren waren, schoben wir häufig einen der Kutter in die Brandung, um vor der Küste zu segeln.
Oft segelten Sven Bredursohn und ich allein hinaus. Sven war der Sohn des Schmieds, ein kräftiger Bursche mit wilder Haarmähne und Fäusten, die nicht nur mit Schmiedewerkzeug umgehen, sondern wenn es sein musste, auch einen Schädel einschlagen konnten. Obwohl wir uns in vielem voneinander unterschieden, waren der ein Jahr ältere Sven und ich gute Freunde. Manchen späten Nachmittag saßen wir oben auf der Steilküste, schauten aufs Meer hinaus und sannen nach über die Länder und Häfen, aus denen die Handelsschiffe Güter und Reichtum an unserer vom Wind und Salzwasser ausgezehrten Küste vorbeitrugen.
***
An einem kalten Frühjahrsmorgen saßen wir beide hinter der Schmiede, abseits von den Dorfleuten, die Kisten und Fässer aus der Brandung holten und auf Segelplanen am Stand stapelten. Die Rückwand der Schmiede und das tiefe Strohdach schützten uns halbwegs vor dem nassen, schneidenden Wind und der Beuterum, den wir becherweise hinunterkippten, wärmte uns, so dass wir unsere klamme Kleidung nicht mehr spürten. Wir sagten kein Wort. Die gellenden Schreie des Seemanns verfolgten mich in Gedanken, sein blutüberströmtes Gesicht, das dumpfe Geräusch von Svens Beil, wenn er wieder und wieder zuschlug.
Der Seemann hing außen an unserem Ruderkahn. Er klammerte sich mit einem Arm ans Dollbord, mit der anderen Hand versuchte er, Svens Beilhiebe abzuwehren. Sein von Wasser und Blut nasses Haar hing in Strähnen über sein schreiendes Gesicht. Er wollte nicht loslassen, er brüllte, brüllte um sein Leben. Ich nahm die Enterstange, setzte ihm den Spitzhaken zwischen Hals und Schlüsselbein auf die Brust und drückte ihn mit aller Kraft vom Boot weg. Als seine blutige Hand sich endlich vom Bootsrand löste, merkte ich, dass auch ich schrie. Ich stieß mit dem Enterhaken nach, zweimal, dreimal in das schäumende Wasser, bis ich keinen Widerstand mehr fand.
Ich schrie noch immer, als Sven mir den Enterhaken aus der Hand riss und brüllte: „Hör auf jetzt! Er ist weg! Er ist weg!“
Ich sank auf die Ruderbank und heulte.
„Verdammte Scheiße,“ schrie Sven. „Hilf mir, die Ladung zu bergen. Hör auf mit dem Geplärr, verdammte Scheiße nochmal!“
An diesem Morgen entstand eine Übereinkunft zwischen uns.
Mitten in das Schweigen hinein sagte Sven: „Man müsste weggehen. Man kann es doch auch als Abenteurer zu etwas bringen. Das hier ist doch ekelhaft.“
Ich antwortete nicht und auch Sven sprach kein Wort mehr. Wir tranken, bis unsere Gedanken ausgelöscht waren. Aber wir hatten einen Bund miteinander geschlossen.
***
Mit sechzehn besaß ich als einziger in Brögesand ein Schwert. Das kam so:
Hin und wieder kamen zwei oder drei Söldner ins Dorf, traten auf die Alten zu, die im Schatten eines Hüttendachs ihre Pfeifen rauchten, und murmelten etwas von einem Vorschuss auf die nächste Patrouille. Mein Vater sorgte dafür, dass sie immer ein paar Silberlinge bekamen, mit denen sie in den „Einäugigen Piraten“ zogen.
„Das sind arme Teufel,“ sagte er. „Die leben auch nur von dem, was sie sich holen. Wenn wir ihnen Geld geben, versuchen sie nicht, mit ihren Waffen an unsere Vorräte zu kommen.“
Damals verbrachte ich die Nachmittage häufig im Schankraum des „Einäugigen Piraten“. Ich saß auf der Bank am Fenster, vor mir ein Honigmet oder ein Gerstenkaffee und las in Knoblochs „Reisen in die Wetterberge“. Im „Einäugigen Piraten“ war es dank des großen Herdfeuers, das an der Stirnseite des Schankraums in einer rechteckigen Steineinfassung brannte, stets warm und trocken und dicht bei den kleinen, mit Pergamenthaut bespannten Fenstern war es im Sommer hell genug zum Lesen, heller und weniger verraucht als in unserer engen Hütte.
Der „Einäugige Pirat“ hatte selten viele Gäste, abgesehen von der kurzen Zeit zu Beginn und zum Ende der Schifffahrtssaison. Hin und wieder kamen ein paar Söldner, deren Truppe in Grünau stationiert war, einem an die zehn Meilen im Landesinneren gelegenen Flecken. Zuweilen kehrte ein staubiger Reisender ein, der es aus Gründen, die er selbst wissen würde, vorzog, nicht auf der großen Überlandstraße zu reisen, sondern stattdessen die wenig begangenen Nebenwege durch die Einöde der Küstenlandschaft entlangzuziehen. An den Abenden trafen sich ein paar Alte aus dem Dorf am Herdfeuer der Schenke. Ansonsten war es ruhig. Auch die Mägde im „Einäugigen Piraten“ ließen mich in Ruhe, nachdem sie begriffen hatten, dass ich tatsächlich kam, um zu lesen, und nicht, um mein Geld mit ihnen zu teilen, damit sie mich auf das Lager in ihrer Kammer mitnahmen.
Nicht, dass sie es nicht versucht hätten.
„Das muss ja spannend sein, was du da liest, wenn dich das mehr interessiert, als ich?“
“Lass mich in Ruhe, Sella. Ich will wirklich lesen. Da stehen Dinge über fremde Länder drin, von denen du keine Ahnung hast. Versunkene Königreiche und so.“
„Schon gut. Kommst du Sterntagabend?“
„Vielleicht.“
***
Narun war ein alter Söldner, an dem die Jahrzehnte des Soldatendienstes ihre Spuren hinterlassen hatten. In seiner speckigen Lederrüstung und mit seinem sonnenverbrannten Gesicht unterschied er sich in nichts von anderen Soldaten, die zuweilen im Gasthof aufkreuzten. Er war mit zwei ebenso abgerissenen Kameraden hereingepoltert, nachdem sie sich aus dem Dorf einen „Vorschuss“ geholt hatten. Über seinen Bierkrug hinweg musterte er mich misstrauisch, während die beiden anderen lautstark mit zwei Mägden verhandelten. Als sie mit den Mädchen nach hinten abgezogen waren, rief er mich an. Seine Stimme ähnelte dem reibenden Geräusch eines über den Strand geschobenen Kahns.
„Du, liest du das wirklich, oder guckst du dir nur die Bilder an?“
„Hier sind überhaupt keine Bilder drin. Ich lese in dem Buch. Es gehört meinem Vater.“
Mit einem Blick auf ihn und einem Blick zur Tür versuchte ich, meine Chancen für eine Flucht abzuschätzen. Bücher waren kostbar. Wenn der Söldner vorhatte, das Buch zu plündern, würde ich ihn kaum daran hindern können. Er stand umständlich auf, nahm seinen Bierkrug und stiefelte zu mir herüber. Schweigend schaute er über meine Schulter auf die aufgeschlagene Buchseite. Der Geruch von altem Schweiß, ranzigem Leder und Bier umgab ihn. Mehrere Atemzüge lang sagte er gar nichts und ich überlegte fieberhaft, wie ich entkommen könnte. Dann nahm er einen kräftigen Schluck aus seinem Bierhumpen und legte mir seine Pranke auf die Schulter.
„Lies vor!“ polterte er.
Geistesabwesend und stockend begann ich zu lesen. Ich musste die ganze Zeit daran denken, was mein Vater sagen würde, wenn er erfuhr, dass ich mir eins seiner Bücher in der Schänke von einem Soldaten abnehmen lassen hatte. Narun hörte mir eine Weile lang zu. Schließlich ließ er meine Schulter los, setzte sich rittlings neben mich auf die Bank, stellte seinen Bierhumpen auf den Tisch und wischte sich den Bierschaum aus dem Bart. Er sah mich aufmerksam an. Ich versuchte, seinen Blick fest zu erwidern, obwohl ich zu zittern begonnen hatte. Von hinten war Juchzen aus den Kammern der Mägde zu hören.
„Kannst du mir das beibringen?“ fragte Narun mit seltsam leiser Stimme.
„Was?“
„Kannst du mir das beibringen? Das Lesen?“ Zweifelnd schaute er mich aus seinen wässrigen Augen an.
Ich starrte mit offenem Mund zurück.
„Hier - “ er zog sein schartiges Schwert und hielt es mir entgegen.
Ich zuckte zurück.
„Kannst du mit so was kämpfen?“
Ich starrte abwechselnd auf ihn und auf die vor mir tanzende Schwertspitze. „Ich kann mit der Axt umgehen und mit dem Enterhaken.“
Er schnaubte. „Eure Zimmermannsbeile, das sind doch keine Waffen. Die reichen doch gerade mal hin, 'nen Halbertrunkenen zu erschlagen. Damit kann man doch nicht kämpfen.“
„Wir sind Fischer, wovon redest du eigentlich?“
Er lachte dröhnend. „Ja, ja, ihr seid Fischer. Und ich bin der Steuereintreiber des Kaisers. Deshalb bin ich auch hergekommen. Um die Fischsteuer einzutreiben.“
Er wollte überhaupt nicht mehr aufhören zu lachen. Ich schwieg. Bei aller Angst begann ich wütend zu werden. Der alte Soldat wischte sich Lachtränen aus den Augen.
„Hör zu,“ sagte er, immer noch glucksend. „Ich bring dir bei, wie man mit 'nem Schwert kämpft und du bringst mir bei, wie man liest. Wenn ich in einem Monat was gelernt habe, kannst du das ausgediente Schwert hier behalten. Als Bezahlung für den Unterricht.“
„Aber ich kann dir das Buch nicht geben, es gehört meinem Vater. Er wird es niemals verkaufen.“
Narun zuckte mit den Schultern. „Ich will dein beklopptes Buch nicht haben. Ich will bei der nächsten Soldauszahlung lesen können, wie hoch die Summe ist, verstehst du? Ich hab's satt, Jahr um Jahr für den dreckigen Dienst übers Ohr gehauen zu werden. Wenn ich meinen Abschiedsbrief bekomme, will ich wissen, was da drinsteht, was mir vom Kaiser für all die Jahre Söldnerdienst vermacht wird.“
Er musterte mich mit einem langen Blick. „Du bekommst nichts, wenn du nicht lesen kannst, was dir zusteht. Wenn du nicht lesen kannst, bist du gar nichts. Alle Welt haut dich übers Ohr.“
„Das sagt mein Vater auch,“ murmelte ich.
„Na, siehst du! Da hat er Recht, dein Alter. Also - “ er streckte mir seine dreckige Pranke entgegen, „ - abgemacht? Du bringst mir lesen bei und ich zeig' dir, wie man mit dem Schwert kämpft. Und wenn ich in einem Monat was gelernt habe, dann bekommst du das Schwert hier. Nicht mein richtiges, das hab ich in Grünau bei meinen anderen Waffen. Ich geb' dir dieses hier. Eigentlich hat's ausgedient, aber für einen wie dich ist es allemal gut genug. Also? Was sagst du?“
Zögernd sah ich ihn an. Er hielt die Hand ausgestreckt. Sein Atem ging schwer. In den trüben Augen des alten Soldaten lag hinter aller Müdigkeit, Kampfverdrossenheit und Härte etwas, was mich dazu brachte, Vertrauen zu fassen. Langsam ergriff ich seine schwielige Hand.
„Na also,“ grollte er. „Ich bin Narun.“
„Leif. Leif Brogsohn.“
***
So kam es, dass ich in den folgenden Wochen jeden Nachmittag mehrere Stunden im „Einäugigen Piraten“ verbrachte. Dicht am Fenster saß ich neben dem ungeschlachten Narun, Knoblochs „Reisen in die Wetterberge“ vor uns auf dem Tisch. Narun stützte den Kopf in beide Hände, ließ sein fettiges Haar wirr hängen. Der riesige Soldat blinzelte, rutschte auf der Bank hin und her, fluchte und stöhnte, während er auf die Buchstaben starrte.
„Das sieht ja wieder ganz anders aus als da oben, du hast gesagt, das da ist ein G.“
„Dies hier ist ein kleines g, oben ist es als Großbuchstabe geschrieben.“
„Klein, groß, Mensch, was für einen Scheiß haben sich die Schreiberlinge ausgedacht? Das ist doch nur, damit unsereiner es nicht verstehen soll!“
Er fluchte und wetterte, aber jeden Tag setzte er sich wieder neben mich auf die Bank. Wenn seine Kameraden uns in der Ecke am Fenster entdeckten, machten sie sich über ihn lustig, aber er drohte nur, ihnen den Bierkrug ins Gesicht zu werfen. Was er auch tat, wenn das Gelächter nicht aufhörte.
Im Anschluss an die quälenden Stunden in der Gaststube standen wir einander auf dem freien Feld zwischen dem Gasthof und der Klippe gegenüber und übten Schwertkampf.
Nach einem Monat konnte er sich durch einen Abschnitt, den er noch nie zuvor gelesen hatte, hindurchstottern, ohne hinterher völlig vergessen zu haben, was er las. Und draußen auf der Klippe maß er mich mit den Augen, wie ich mit dem Schwert in der Hand dastand, und brummte: „Na, immerhin kannst du's jetzt so in der Hand halten, dass du weder dich noch jemand anders aus Versehen damit verletzt. Das ist schon mal viel wert, glaub mir.“
So kam ich zu meinem Schwert.
Ein paar Wochen später nahm ein von weither gekommener Reisender im „Einäugigen Piraten“ Quartier. An der Begegnung mit diesem Fremden lag es, dass ich zwei Jahre später Brögesand verließ, um auf Abenteuerfahrt zu gehen.
2.
An einem windigen Spätsommernachmittag gingen Sven und ich die regennasse Landstraße hinauf zum Gasthof. Das Wasser stand in Pfützen in den Fahrrinnen und spiegelte die über den Himmel ziehenden Wolken. Unsere Kleider waren klamm vor Nässe und wir achteten nicht darauf, ob wir mit unseren Segeltuchschuhen in Pfützen traten. Wir trugen zerschlissene Hemden und Hosen aus grobem Leinen. Svens Hose wurde von einem Ledergürtel gehalten, ich hatte mir einen Strick um die Hüften geknotet. Unsere Bootsmesser trugen wir an der Seite. Ohne die nassen Sachen zu wechseln hatten wir uns zum Wirtshaus aufgemacht, nachdem wir den im Sturm vollgelaufenen Kutter zurück in die Bucht und auf den Strand gesegelt hatten.
Das Unwetter hatte uns auf hoher See überrascht. In aller Frühe waren wir mit unseren Vätern und einigen Männern zum Fischfang hinausgesegelt.
Wir waren vollauf mit dem Auslegen der Netze beschäftigt, als Vater rief: „Das Großsegel runter, schnell!“
Ich richtete mich auf und da sah ich die Sturmbö heranrasen. Innerhalb weniger Augenblicke wurde der Himmel im Westen schwarz. Die Bö flachte die Wellenkämme ab und trieb fliegende Gischt auf das Boot zu. Olas hieb mit der Axt das Großfall durch, zum Lösen war keine Zeit mehr. Vater zog am Ruder. Schwerfällig begann der Kutter, vor den Wind zu drehen.
Im selben Moment war der Sturm da. Die Bö ergriff das Großsegel und die losgeschlagene Gaffel schwang mit Wucht übers Deck. Ich konnte mich gerade noch rechtzeitig ducken. Sven neben mir taumelte und klammerte sich am Bordrand fest. Die Gaffel hatte ihn am Kopf erwischt. Das Deck bäumte sich auf, schäumendes Wasser spülte übers Deck und die offene Ladeluke hinunter. Das Focksegel blähte sich im Sturm. Unter der Last des Winddrucks krängte der Kutter hart über Lee und tauchte mit der Nase in die See. Ich klammerte mich mit aller Kraft irgendwo fest.
Bei allen Sternen, wir kentern!
Wasser überall. Kisten und Taue spülten um meine Beine, gingen rechts und links von mir über Bord. Ich erwischte Sven am Hemd, bevor ihn die Flut von den Füßen reißen und über Bord schwemmen konnte. Ich schrie irgendwas in jäher Panik.
Der Wind drückte den Kutter in immer stärkere Schräglage, bis der Bordrand auf Höhe der hereindrückenden Wellenkämme lag. Die Schreie der Männer gingen unter im Tosen des Windes, im Knattern des frei im Wind schwingenden Großsegels. Das Focksegel zerriss mit einem explosionsartigen Knall, der Bug stieg aus den Fluten, der Kutter richtete sich auf und drehte vor den Wind. Keuchend und triefend vor Nässe starrte ich Sven an, der versuchte, auf dem schwankenden Deck auf die Beine zu kommen, mit rudernden Armen nach einer Festhaltemöglichkeit suchend. Ich hielt ihn am Hemd gepackt.
„Das Boot ist vollgelaufen, wir sinken!“ brüllte er.
Haushohe Wellen türmten sich auf, schlugen von Achtern in den Kutter. Für einen Moment ließ die Sturmbö nach. Das Großsegel donnerte herab. Die Leinwand klatschte in die Wellen und wieder neigte das Deck sich gefährlich zur Seite. Eine Flut eisigen Wassers brach über mich herein. Mit meiner freien Hand suchte ich verzweifelt nach einem Tau, um nicht mitsamt Sven, den ich immer noch hielt, über Bord gespült zu werden.
Stern meiner Geburt! Es ist aus!
Harte Fäuste griffen nach dem freischwingenden Gaffelbaum und holten ihn ein.
Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis der Kutter sich aufrichtete, um schwer vom hereingeschlagenen Wasser in den Sturmwellen in Richtung Küste zu stampfen. Eisige Regenströme ergossen sich über die See. Vater stand im Heck und hielt mit beiden Händen die Ruderpinne. Die Pfeife war ihm ausgegangen, aber er hielt sie weiter zwischen den Zähnen. Wasser rann ihm aus den Haaren und übers Gesicht. Noch immer kamen Wellen von achtern über. Alle freien Hände lenzten das Wasser in Eimern, Fischkisten, allem, was sich fand, aus dem Schiffsraum außenbords. Ich warf einen flüchtigen Blick übers Deck - niemand schien über Bord gegangen zu sein.
Den Sternen sei dank!
Als sich abzeichnete, dass wir den Wettlauf mit den Regengüssen und den hereinschlagendden Wellen gewinnen würden, tanzten mir farbige Kreise vor den Augen. Einen Moment lang hielt ich inne und rang nach Luft, dann packte ich mit schmerzenden Händen den Eimer und lenzte weiter.
Olas und Lonne setzen ein Sturmsegel. Eine halbe Stunde später passierten wir die Klippen vor der Bucht. Der Sturm hatte nachgelassen. Der Regen war bis auf einen feinen, im Wind sprühenden Nieselschleier versiegt. Die Klippen waren nur an den schäumenden, hochschlagenden Wellen erkennbar, doch Vater steuerte den Kutter sicher in die Bucht. Wir sprangen ins Wasser und zerrten das Schiff auf den Strand, wo wir in den Sand fielen und atemlos liegenblieben. Vater setzte sich auf eine am Strand liegende Taurolle und blickte mit unbewegter Miene aufs Meer hinaus.
Sven und ich lagen nebeneinander im Sand und blinzelten nach den dahinjagenden Wolken. Wir hatten ein und denselben Gedanken.
Wir leben.
Wäre der Kutter in der ersten Sturmbö gekentert, hätte keiner von uns lebend das Ufer erreicht.
Nach einer Weile richtete Sven sich auf.
„Im „Piraten“ ist es warm und trocken. Geh'n wir rauf ins Wirtshaus.“
Wir standen auf, nass wir wir waren, ließen die Männer am Strand mit den herbeilaufenden Frauen diskutieren und gingen hinauf zum Gasthaus.
***
Als wir auf dem gewundenen Karrenpfad auf die Steilküste kamen, blieb Sven blinzelnd stehen.
„So was! Wie kommt denn da ein Pferd hin?“
Ich hatte den Blick auf die Pfützen vor meinen Füßen gesenkt. Jetzt schaute ich auf. Auf der Wiese vor der Schenke war ein schwarzes Pony angepflockt. Sein Fell dampfte in der feuchten Luft. Eine Filzdecke war über seinen Rücken gebreitet. Das Pony wanderte langsam grasend über die Wiese. Außer den abgemagerten Schindmähren und den kleinen, schäbigen Ponys, welche die Karren der Händler zogen, hatte ich in meinem Leben kein Pferd gesehen. Dieses hier war groß und kräftig. Mit seinem schwarz glänzenden Fell schien es aus einer anderen Welt hierher gelangt zu sein.
„Muss wohl ein Reisender im „Piraten“ abgestiegen sein,“ meinte ich.
„Was für Reisende reiten auf so 'nem Ross?“ überlegte Sven.
„Es ist ein Pony.“
„Meinetwegen 'n Pony oder 'n Maultier. Sieht jedenfalls aus wie das Tier von 'nem fahrenden Ritter. Schau, wie sein Fell glänzt.“
„Ich glaub', Ritter haben größere Pferde. Und kostbare Pferdedecken. Das Pony hat ja nur 'ne Filzdecke übergeworfen. Ich weiß nicht... Händler reisen so nicht.“
Wir dachten beide das gleiche.
Sven sprach es aus: „'n Abenteurer?“
„Gehen wir rein. Vielleicht kriegen wir ihn zu sehen.“
Der Schankraum des „Einäugigen Piraten“ war ein niedriger, langgestreckter Raum. Die kleinen Pergamentfenster gingen zur Landseite. Bei diesem Wetter drang nur trübes Dämmerlicht in den Raum. Der Holzfußboden war mit feinem Sand bestreut, die Deckenbalken rußgeschwärzt. Die weißgetünchten Wände hatten mit den Jahren eine gelblich-graue Färbung angenommen. Im vorderen Teil des Raums, rings um die Herdeinfassung, waren Steinfliesen in den Boden eingelassen. Über der Herdstelle öffnete sich ein gemauerter Kamin, jedoch bei drückendem Wetter wie heute zog der Rauch unter der Decke durch den ganzen Raum. Über der Glut hing zu jeder Zeit ein großer Kessel. Töpfe und Gerätschaften hingen am Kaminrand rings um die Feuerstelle, an der stets die Wirtin oder eine Magd beschäftigt waren. Auf Regalen an der Rückwand standen Tonkrüge, Teller, Becher und Vorratsgefäße. An drei Seiten waren Bänke um die Herdstelle aufgestellt. Weitere Bänke standen an langen Tischen.
Nach dem Eintreten mussten unsere Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnen. Der Schankraum war fast leer. In einer Ecke hantierte der Wirt. Eine Magd rührte im Kochkessel auf der Feuerstelle. Verlockender Essengeruch drang durch den Rauch zu uns. An einem Tisch nahe beim Herdfeuer, mit dem Rücken zu uns, saß ein breitschultriger Mann in einem rostigen Kettenhemd. Er hatte eine von grauem Haar umrahmte Halbglatze. Ein mit verrosteten Metallstreifen verstärkter, spitz zulaufender Lederhelm lag neben ihm auf dem Tisch. Rings um die Stiefel des Fremden bildete sich eine Pfütze. Seine Kleidung troff vor Nässe. Ein riesiges Schwert lehnte neben ihm an der Bank. Es steckte in einer vom Regenwasser dunklen Lederscheide. Der verzierte Griff glänzte silbrig. Das Schwert mochte dreieinhalb Ellen oder noch länger sein. Nie in meinem Leben hatte ich eine solche Waffe gesehen. Der Fremde schlürfte Suppe mit einem Holzlöffel und schien auf nichts sonst in der Schankstube zu achten.
Wir gingen nach vorn, setzten uns in einigem Abstand von dem Fremden auf die Bank an der Herdstelle und musterten ihn mit verstohlenen Blicken. Mattis, der Wirt, kam uns entgegen.
„Na Jungs, hat's euch bei dem Sauwetter hierher ins Warme verschlagen? Was wollt ihr haben?“
In seinem schweißglänzenden Gesicht lag fast etwas wie Erleichterung.
„Wir waren auf See,“ sagte ich. „Der Sturm hat uns erwischt, als wir die Netze ausbrachten. Völlig unverhofft. Fast hätte es den Kutter umgeworfen.“
Der Fremde schaute von seiner Suppe auf. Ein verfilzter, grauer Bart reichte ihm bis auf die Brust. In seinem breiten, roten Gesicht saß eine gewaltige Nase. Die kleinen Augen verschwanden fast unter borstigen Augenbrauen. Quer über sein Gesicht verlief eine breite Narbe.
Mattis erschrak. „Bei dem Wetter wart ihr auf See! Ordurin sei Dank, dass ihr heil zurück seid. Sind alle wohlbehalten?“
„Vater hat den Kutter gesteuert. Wir sind mit einem Sturmsegel zurück in die Bucht. Die Fock hat‘s zerrissen und die Netze haben wir verloren.“
„Bei Ordurins heiliger Flamme, dein Vater ist ein Pfundskerl, Junge. Nun wärmt euch erst mal. Später müsst ihr erzählen. Was wollt ihr? Heißen Grog?“
„Ja, und von deiner Suppe auch was. Ich hab einen Mordshunger.“
„Bekommt ihr. Wir haben Rübeneintopf. Ich kann euch auch Schweinespeck reinschneiden.“
„Gib nur her.“
Ich deutete mit den Augen auf den Fremden und sah den Wirt fragend an. Er machte ein ängstliches Gesicht und zuckte kaum merklich mit den Schultern. Dore, die Magd, gab uns Tonschalen mit Suppe und hölzerne Löffel. Als der Wirt uns die Tonbecher mit dem dampfenden Grog hinstellte, hob der Fremde seinen Becher und nickte dem Wirt zu. Ich sah überrascht, dass er einen Zinnbecher in der Hand hielt. Zinnbecher rückte der Wirt sonst nur zu besonderen Feiern heraus.
„Noch Wein, der Herr?“ Mattis‘ Stimme zitterte leicht.
„Von dem roten. Das ist ein Südwein, Tamoliner, wenn mich nicht alles täuscht. Guter Jahrgang. Wo hast du den her?“
Der Fremde sprach mit knurrigem, hartem Akzent.
Mattis wischte sich verlegen die Hände an seiner speckigen Schürze ab. „Man hat so seine Verbindungen, Herr. Es ist nicht gar so weit bis Klagenfurt. Ich bringe Euch den Wein sofort.“
Er verschwand nach hinten.
„Aus Klagenfurt eingehandelt? In diesem Kaff?“ knurrte der Fremde.
Er musterte uns mit einem langen, aufmerksamen Blick. Ich blickte fest zurück, aber ihn anzusprechen traute ich mich nicht. Der Fremde wandte sich wieder seiner Suppe zu. Er schlürfte geräuschvoll den Rest, dann schob er die Schale in Richtung Herd.
„Gib noch,“ knurrte er Dore an. „Und Brot.“
Dore beeilte sich, seinem Wunsch nachzukommen. Sven und ich löffelten unsere Suppe über die Schalen gebeugt.
An anderen Tagen herrschte im „Einäugigen Piraten“ eine ungezwungene, fröhliche Stimmung, egal, welche Gäste gerade anwesend waren. Heute war es anders. Weder Dore noch wir trauten uns zu scherzen oder auch nur laut zu reden. Seiner Ausrüstung nach zu urteilen schien der Fremde ein Söldner oder Freischärler zu sein. Nach einer Zeit unangenehmen Schweigens, in der nur das Schmatzen und Schlürfen des Fremden zu hören war, kam Mattis mit einem Krug Wein. Er füllte den Becher des Fremden. Als er gehen wollte, hielt der Fremde ihn an Arm fest. Er zog den Arm des Wirts zum Tisch herab, so dass Mattis nichts übrig blieb, als den Weinkrug auf dem Tisch abzusetzen.
„Lass mal hier stehen, wird schon alle werden,“ brummte der Fremde, ohne den Wirt anzusehen.
Mattis murmelte etwas Unverständliches. Er rieb sich den Arm. Als er einen erneuten Versuch startete, sich zurückzuziehen, winkte der Krieger ihn zu sich heran.
„Hör mal, Wirt, ich habe vorhin, als ich an dem kleinen Dorf vorbeigeritten bin, eine Steinhütte gesehen, die wie eine Schmiede aussah. Habe ich recht?“
„Ja, Herr, das ist Bredurs Schmiede. Wenn der Herr Bedarf an einem Schmied hat, kann Bredur Euch sicher zu Diensten sein.“
„Ich habe keinen Bedarf an einem Schmied, sondern an einer Schmiede. Mein Pony hat sich ein Hufeisen gebrochen. Das muss ich richten. Der Dorfschmied wird sicher nichts dagegen haben, wenn ich seine Esse benutze?“
Mattis machte große Augen. Sven und ich lauschten mit immer größerem Interesse.
„Ihr seid ein Schmied?“
Der Fremde verzog das Gesicht. „Das Schmiedehandwerk gehört zu meiner Profession. Hör zu, schick deine Magd zu diesem Dorfschmied und sag ihn, dass ich heute Abend seine Esse miete.“
„Das wird gar nicht nötig sein, Herr, hier sitzt ja Bredurs junger Sohn. Der kann seinem Vater Euren Wunsch ausrichten.“
Der Fremde starrte herüber.
Sven räusperte sich mit rotem Kopf. „Ich kann meinen Vater ja fragen. Und...“ er schluckte und holte Luft, „wenn mein Vater wissen will, wer Ihr seid, was soll ich ihm sagen?“
Eine Weile lang maß der fremde Kämpfer Sven mit den Augen. Sven hielt seinem Blick stand. Dennoch merkte ich, dass ihm das Herz bis zum Hals schlug.
„Sag ihm, der Forschungsreisende Zosimo Trismegisto möchte seine Esse mieten,“ bellte der Fremde schließlich.
Ich riss die Augen auf. Ein Forschungsreisender? Jemand wie der Autor der „Reisen in die Wetterberge“? Forschungsreisende stellte ich mir als reiche Männer vor, die in wetterfeste Roben gekleidet mit einem Gefolge von Dienern durch die Lande zogen. Dieser dreckstarrende, breitgesichtige Mann mit dem wilden Bart und der Narbe quer übers Gesicht wirkte in seinem verrosteten Kettenhemd so gar nicht wie ein studierter Gelehrter. Er sah nicht einmal so aus, als ob er lesen konnte.
Das ließe sich ja feststellen, durchfuhr mich ein boshafter Gedanke.
„Das werde ich tun, Herr Tris - Trismeg - “ stotterte Sven.
„Trismegisto!“ knurrte der angebliche Forschungsreisende. „Ein altes Adelsgeschlecht, du Grünschnabel. Kannst du nicht kennen. Unser Adelsgeschlecht lebt hoch im Norden.“
Er setzte den Becher an den Mund und trank ihn in einem Zug leer.
„In den Wetterbergen?“ platzte ich heraus, bevor ich nachdenken konnte.
Am liebsten hätte ich mir sofort die Zunge abgebissen. Heißes Blut stieg mir in den Kopf. Der Fremde durchbohrte mich mit seinen Knopfaugen.
„Was weißt du Küken von den Wetterbergen?“ Es klang drohend.
Ich hatte keine Lust, mich von einem aus dem Unwetter in unser Wirtshaus hereingeschneiten Wegelagerer einschüchtern zu lassen. Ich hatte gerade einen Sturm auf See überlebt. Und ich hatte schon mehr Sterbende gesehen, als dieser Raubritter ahnte. Der Grog begann seine Wirkung zu zeigen und ich war nicht mehr Herr meiner Gedanken.
„Davon hab ich bei Knoblauch gelesen,“ rief ich trotzig.
Der Fremde goss seinen Becher voll, setzte ihn an die Lippen und trank ihn ein weiteres Mal in einem Zug aus. Zufrieden wischte er sich den Bart mit dem Ärmel ab.
„Aus einer Knoblauchzehe gelesen oder aus dem Handballen oder den Märchen einer alten Dorfhexe gelauscht, keine Ahnung von der Welt, aber vorlaut daher reden,“ murmelte er.
Ich wollte etwas erwidern, aber Sven packte mich am Arm und schüttelte den Kopf. Ich schloss meinen Mund wieder. Jedenfalls hatte ich erfahren, was ich wollte. Von Leonhard Knoblauch - oder hieß er Knobloch? - hatte dieser selbsternannte Forschungsreisende noch nie gehört. Vermutlich konnte er überhaupt nicht lesen. Dass Knoblochs „Reisen in die Wetterberge“ das wertvollste Hauptstück in der Bibliothek jedes Forschers sein musste, davon war ich damals felsenfest überzeugt.
Der Fremde stand umständlich auf. Stehend reichte er trotz seiner kräftigen Gestalt dem Wirt kaum bis zur Schulter, obwohl Mattis kein besonders großer Mann war. Der Krieger goss sich den Rest aus dem Weinkrug ein und schlürfte den Becher aus. Sein Gesicht war rot geworden, aber weder seinen Körperbewegungen noch seiner Sprache war anzumerken, dass er innerhalb einer Viertelstunde einen Krug schweren Wein ausgetrunken hatte.
„Zeig mir das Zimmer, Wirt,“ schnauzte er durch den Raum.
„Ich bin müde, bin die Nacht durchgeritten. Und dann dieses verdammte Unwetter. Und du,“ fuhr er Sven an, „sag deinem Vater, dass ich heute Abend komme. Vorbereiten braucht er nichts. Nur den Platz an der Esse muss ich haben.“
Sven setzte zu einer Antwort an, doch der Kämpfer drehte ihm den Rücken zu, warf sich den Schwertgurt mit dem riesigen Zweihänder über die Schulter und zerrte zwei nasse Satteltaschen unter dem Tisch hervor, denen ein gewaltiger Packen aufgebunden war. Mühelos nahm er das Gepäck, das Sven und ich kaum hätten zu zweit tragen können, über die Schulter und stiefelte dem Wirt hinterher, der ihm unter ständigen Verbeugungen vorausging.
Als die Tür hinter den beiden zugefallen war, blickten Sven und ich uns mit einer Mischung aus Empörung und Faszination an.
„Ein adliger Forschungsreisender aus dem hohen Norden?“ höhnte ich.
Sven verzog das Gesicht. „Da oben wohnen nur Zwerge und Trolle, soviel ist mal klar.“
„Das mit den Zwergen und Trollen sind Märchen, aber dass der ein Forscher ist, halte ich auch für ein Märchen.“
„Das ist ein Abenteurer, das sag' ich dir. Genau so sieht der aus.“
„Oder ein Wegelagerer, ein Freischärler auf der Suche nach einem Schlachtzug, bei dem er auf eigene Faust Beute machen kann. So stell' ich mir das vor.“
Dore setzte sich zu uns und füllte unsere Becher mit Grog.
„Er kam mitten aus dem Sturm herein,“ erzählte sie, „brüllte nach was zu essen, einem Zimmer und einem Stall für sein Pony. Dabei haben wir doch gar keinen Stall. Und als Mattis ihm sagte, eine Übernachtung mit Versorgung des Pferds koste vier Kreuzer, da tobte er und schimpfte, in einer Wiesenspelunke wie unserer seien Kost und Logis höchstens zwei Kreuzer wert und das sei von ihm noch großzügig. Und dann bestellte er Wein, und den Landwein wollte er nicht trinken, das sei Essig, sagte er. Und als Mattis den Tamoliner brachte und sagte, der koste dann aber extra, hat er nur böse geguckt.“
Grimmig murmelte ich: „Der gehört zu den armen Schweinen, von denen mein Vater immer redet - die nirgendwo zu bezahlen brauchen, weil sie sich mit Gewalt nehmen, was sie haben wollen.“
„Hoffentlich zieht der morgen wieder ab,“ sagte Dore. „Ich werd' kein Auge zutun, solange der im Wirtshaus ist.“
Ich wandte mich an Sven. „Heute Abend habt ihr ihn an der Backe.“
Sven setzte sein Draufgängerlächeln auf, das ich bei ihm gut kannte, wenn es an eine gefährliche Unternehmung ging.
„Bin gespannt,“ sagte er. „Möcht' gern wissen, was für ein Mensch das ist. Ich werd' versuchen, ihm in der Schmiede zur Hand zu gehen. Vielleicht krieg' ich was über ihn raus.“
„Das ist gar kein Mensch, das ist ein Ungeheuer,“ schimpfte Dore. „So jemand ist mir in meinem Leben noch nicht begegnet. Die Söldner aus Grünaue sind Engel dagegen!“
Ich grinste sie an. „Das sagst du, weil du dir die um den Finger wickeln und ihnen das Geld aus der Tasche ziehen kannst. Aber zum Feind möcht' ich den nicht haben. Morgen musst du mir erzählen, wie es gelaufen ist, Sven. Ich geh runter zum Schrein. Die anderen sind sicher schon beim Dankopfer für die Rettung aus dem Sturm.“
Wir sagten Dore, sie solle Essen und Grog anschreiben und traten hinaus in die frische, feuchte Luft.
***
Den Rest Tages verbrachte ich mit den Dorfleuten beim Opferschrein. Wir saßen zusammen und feierten bei Bier und Fischsuppe mit Brot unsere Rückkehr aus dem Sturm.
Gleich bei Sonnenaufgang am nächsten Morgen ging ich zu Bredurs Hütte. Vor der Hütte saß Svens jüngere Schwester Galina. Sie hatte ein Huhn geschlachtet und rupfte es. Ich fragte sie nach Sven.
„Er ist noch gar nicht wach,“ erzählte sie. „Vater schläft auch noch. Es dämmerte schon, als sie von der Schmiede hereingekommen sind.“
Ich setzte mich neben sie. „Und? Haben sie was gesagt?“
Galina machte ein geheimnisvolles Gesicht.
„Die ganze Nacht waren sie in der Schmiede. Sie dachten, ich schlafe, aber ich hab alles mitbekommen, was sie sagten. Ich hatte doch so gewartet, dass sie endlich kommen sollten. Aber zwischendurch muss ich doch geschlafen haben.“
Gedankenversunken legte sie die Hände auf das Huhn in ihrem Schoß.
„Als ich den Türriegel hörte, war ich gleich hellwach. Sie sind sofort ins Bett gefallen. Vater murmelte: „Ein Teufelskerl ist das!“ Und Sven sagte: „Das is' 'n brutaler Grobklotz! Und mit dem Bezahlen hat er's auch nicht ernst gemeint. Aber lernen kann man was von ihm.“ Und Vater meinte: „Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, dass jemand so mit Eisen und Feuer umgehen kann.“ Sven hat noch gesagt, es wär' unheimlich gewesen. Dann sind sie eingeschlafen. Jetzt schlafen sie immer noch.“
Ich ging zum Strand hinunter und half beim Ausbessern der Boote. Kurz vor Mittag kam Sven mit übernächtigtem Gesicht an den Strand geschlichen. Ich legte das Werkzeug in den Kahn und kletterte aus dem Boot. Wir gingen ein Stück den Stand hinauf und setzten uns ins Ufergras. Sven blickte mich wild an.
„Der kann nicht nur schmieden. Gesprochen hat er mit dem Feuer. Und das Feuer hat geantwortet!“
Ich blickte Sven aufmerksam an, aber er machte nicht den Eindruck, als wollte er mir einen Bären aufbinden.
„Mein Alter sagte, das wär' echte Magie gewesen. Alchimie hat er es genannt, obwohl er vorher noch nie einen Alchimisten bei der Arbeit gesehen hat.“
In trockenen Worten schilderte Sven, was sich in der Nacht zugetragen hatte.
In der Abenddämmerung war der stämmige Krieger in der Schmiede erschienen. Sven und sein Vater waren gerade dabei, die Werkzeuge aufzuräumen und hatten schon gedacht, der Fremde hätte es sich anders überlegt, als er in seinen regennassen Stiefeln hereinpolterte. Er hatte das Kettenhemd abgelegt und war mit einem fleckigen Leinenwams bekleidet. Den Zweihänder trug er auf dem Rücken. Svens Vater meinte vorsichtig, auf dem kurzen Weg vom Gasthof zum Dorf gäbe es keine Diebe, hier lebten nur friedliche Menschen, aber der Krieger knurrte, auf Reisen solle man niemals irgendwohin gehen, ohne seine Waffe mitzunehmen.
Rasch blickte er sich in der Schmiede um, griff sich das Werkzeug und begann, das Feuer in der Esse zu schüren. Als er Roheisen für ein neues Hufeisen forderte, wagte Bredur, ihm einen Preis zu nennen. Der Fremde erwiderte nichts darauf. Er sah Svens Vater mit böse funkelnden Augen an. Das Hufeisen hatte er in wenigen Minuten geschmiedet, nicht ohne über die miserable Qualität des Eisens zu fluchen. Sven hatte angeboten, ihm zur Hand zu gehen und nach einem langen, misstrauischen Blick hatte der Kämpfer ihm erlaubt, auf sein Kommando hin den Blasebalg zu betätigen und das Werkzeug anzureichen.
Der Fremde ging unglaublich geschickt vor. Nach kürzester Zeit hatte er das vor der Schmiede angebundene Pony beschlagen. Er wollte bereits gehen, als Sven seinen Mut zusammen nahm und ihn fragte, ob er sich nicht noch kurz ein Beil ansehen könne, das Sven selbst geschmiedet hatte, und ob er ihm nicht zeigen könne, wie es vielleicht noch verbessert werden könne. Als Bezahlung sozusagen, fügte er hinzu.
Der Fremde sah ihn wütend an, aber dann band er sein Pony wieder an und knurrte: "Na, dann zeig mal, was du da verbrochen hast."
Sven zeigte ihm sein vor kurzem angefertigtes Erstlingsstück, auf das er ungeheuer stolz war.
Der Fremde drehte es zwischen den Händen und murrte: „Für ein Zimmermannsbeil ist es zu leicht und für eine Streitaxt zu plump. Was soll das sein?“
Sven stotterte vor Schreck irgendetwas. Bredur bemerkte leise, dass sie für die Fahrten auf die See leichte Beile bräuchten. Der Krieger blinzelte spöttisch.
„Ist mir doch egal, wofür ihr eure Äxte braucht,“ brummte er. „Ich will auch gar nicht wissen woher der Gastwirt da oben den Tamoliner Südwein hat. Wird wohl als Strandgut angespült worden sein. Aber als Streitaxt taugt das hier nichts. Fach mal das Feuer an!“
Mit klopfendem Herzen bediente Sven den Blasebalg, während sein Vater verstohlen aus dem Hintergrund zuschaute. Doch der stämmige, untersetzte Reisende war nicht zufrieden.
„Heißer, so wird das nichts,“ fauchte er Sven an.
Schließlich riss er ihm den Blasebalg aus der Hand und blies selbst die Glut an, bis die Kohle weiß glühte und Funken von der Esse stoben.
„Nun mach!“
Er gab Sven den Blasebalg zurück.
Sven arbeitete unter den gebellten Anweisungen des Fremden, bis ihm der Schweiß von der Stirn troff, aber erst eine halbe Stunde später nahm der Krieger die Beilklinge mit der Schmiedezange und grollte: „So kann's gehen. Nicht nachlassen, nur weiter, weiter!“
Die Glut beleuchtete von unten das breite Gesicht des fremden Schmieds. Funken sengten seine Augenbrauen an. Sein Bart begann zu schwelen. Er schien es nicht zu bemerken. Als er das rotglühende Metall mit dem Hammer zu bearbeiten begann, schüttelte er missmutig den Kopf.
„Das Eisen ist zu spröde. Es taugt nicht zum Waffenstahl. Schau her, siehst du?“
Sven sah gar nichts. Er konnte vor Erschöpfung kaum die Augen offen halten.
Jenseits des Feuerscheins war es stockdunkel. In der Finsternis glühte rot das Eisen auf dem Amboss, von den Schlägen des Kämpfers bearbeitet. Von seiner gedrungenen Gestalt waren nur schattenhafte Umrisse zu erahnen. Nur wenn er an die Esse trat, leuchtete sein Gesicht mit den blitzenden Augen im Dunkel auf. Sven wusste nicht mehr, ob er wach war oder ob er die Szene bereits im Traum erlebte.
Wieder und wieder wanderte die Beilklinge in die Esse. Stunden vergingen. Der Krieger bearbeitete das Eisen mit dem Hammer, drehte, wendete es, brachte es erneut zum Glühen, beim geringsten Nachlassen von Sven grobe Flüche hinausschreiend. Und dann kam der Moment, in welchem er, die Augen auf das leuchtende Eisen gerichtet, fremde Worte murmelte. Mit durchdringender Stimme wiederholte er wieder und wieder dieselben Worte in einer hart klingenden fremden Sprache. Seine Stimme klang hohl und mit einem Mal war es, als ob seine Stimme lauter würde, als ob aus dem Dunkel ein Echo widerhallte. Die Glut flammte auf und in dem Moment erschien in der lodernden Flamme das Gesicht. Es war kein menschliches Gesicht. Seine Furcht einflößende Fremdartigkeit erinnerte an kein lebendes Wesen. Das Feuer schien selber lebendig geworden. Das Gesicht antwortete dem Schmied in derselben fremden Sprache. Unverwandt auf das Metall starrend riss der Krieger die Klinge aus dem Feuer und bearbeitete sie unter gleichmäßigen Schlägen auf dem Amboss, wieder und wieder die gleichen Worte murmelnd, als wolle er dem Eisen befehlen. Seine Stimme jagte Sven Schauer über den Rücken.
In den Fenstern dämmerte das erste Blau des nahen Morgens, als der Krieger die Beilklinge ins Wasser tauchte und zischender Dampf die Schmiede füllte. Feierlich nahm er die Klinge aus dem Wasser und hielt sie Sven entgegen. Ein kaltes blaues Glühen ging von dem Metall aus.
„Da hast du deine Waffe!“
Sven konnte kein Wort erwidern. Der Schreck saß ihm in den Knochen. Trotz der Hitze in der Schmiede zitterte er am ganzen Leib. Höhnisch blickte der Fremde ihn an. Svens Vater verneigte sich fast bis zum Boden, nannte den Krieger einen „hohen Herrn“ und „wahren Meister“ und überschüttete ihn mit Ehrerbietungen. Der Krieger meinte nur trocken, die Klinge sei ein Vielfaches des erbärmlichen Hufeisens wert und dass man nun wohl quitt sei.
„Hat gut getan, mal wieder an der Esse zu arbeiten. Unterwegs komme ich selten dazu,“ knurrte er.
Es schien Sven, als wäre der Ansatz eines Schmunzelns in seinem narbenversehrten Gesicht zu sehen. Bredur murmelte unter ständigen Verbeugungen, man stünde hoch in der Schuld des Herrn. Ob er sich dennoch erlauben dürfe, den Herrn zu fragen, ob er nicht noch ein wenig bleiben könne, um Bredurs Sohn für ein paar Tage in die Lehre zu nehmen? Der Fremde kniff die Augen zusammen. Vielleicht wäre es sowieso besser, wenn er für einige Zeit untertauchen würde, murmelte er. Er grinste listig und meinte, wenn Bredur für Kost und Logis im Gasthof „Zum einäugigen Piraten“ für ihn aufkäme, könne man sich einigen.
„Ich werd' in den nächsten Tagen wohl jede Nacht bis zur letzten Nachtstunde in der Schmiede stehen,“ stöhnte Sven.
Er hatte sich im Sand ausgestreckt und schaute in den wolkenverhangenen Himmel.
„Aber mein Alter meint, bei diesem Krieger-Alchimisten kann ich mehr lernen, als er mir in seinem ganzen Leben beibringen kann. Die Streitaxt musst du dir ansehen, die er geschmiedet hat. Die Klinge glüht im Dunkeln, verstehst du? Obwohl sowas eigentlich nicht möglich ist. Dieser Zosimo meint, wir sollen einen Eschenholzschaft besorgen. Dabei gibt es an der ganzen Küste kein Eschenholz.“
„Zosimo nennst du ihn?“
„Zum Schluss hat er mir die Hand gegeben und nach meinem Namen gefragt. Und sagte, ich soll Zosimo zu ihm sagen. Auf Ehrenbezeigungen lege er keinen Wert. Mein Alter scharwänzelte trotzdem um ihn herum und nannte ihn den „hochwohlgeborenen Herrn Trismegisto“. Beim Gehen hat er mir fast die Hand zerquetscht mit seinem Händedruck.“
Mir kam eine Idee.
„Hör mal, Sven. Wenn du jetzt sowieso jede Nacht in der Schmiede bist - könnt ihr da nicht mein Schwert auch ein bisschen ausbessern? Du weißt doch, das schartige Ding von dem Söldner.“
„Weiß nicht. Er meinte, so was wie heute Nacht kann er mir nicht beibringen. Er will mir zeigen, wie man Waffenstahl herstellt und wenn ich mich geschickt anstelle und nicht jedes Mal zwei Stunden brauche um die Glut anzufachen, könne ich ihm am Ende vielleicht beim Schmieden einer Dolchklinge zur Hand gehen. Hörte sich nicht so spannend an.“
Ich blieb hartnäckig. „Aber könnt ihr nicht vielleicht trotzdem ein bisschen an meinem Schwert arbeiten?“
„Frag ihn doch selbst. Wirst ja sehen, was er dir antwortet,“ brummte Sven.
***
Am Nachmittag gürtete ich mein Schwert um und ging zum Gasthof. Wenn Sven eine magische Waffe hatte wie im Märchen, dann wollte ich auch eine haben. Eigentlich glaubte ich ihm nicht, von wegen Glühen im Dunkeln und so. Aber der alte Narun meinte, das Schwert, das er mir gegeben hatte, tauge nichts mehr. Möglicherweise konnte dieser reisende Waffenschmied die Klinge ausbessern.
Zosimo Trismegisto war der einzige Gast in der Wirtsstube. Er saß auf der Bank am Fenster mit einem Zinnbecher und einem Krug Wein neben sich. Der Zweihänder lehnte neben ihm am Tisch. Der Schwertgriff glänzte im Nachmittagslicht. Sella war am Herd beschäftigt. Ich nickte ihr zu und sie lächelte zurück. Als ich mich dem Fremden näherte, stutzte ich. Vor ihm lag ein großes, aufgeschlagenes Buch.
Ich trat an den Tisch. „Lest Ihr in dem Buch?“
Der rotgesichtige Fremde schaute auf. Er schien sich an mich zu erinnern.
„Nee,“ grollte er drohend. „Ich schnüffle nur den Papierstaub, du Seeräuberbengel! Das kitzelt so schön in der Nase.“
Ich spürte, wie mir das Blut ins Gesicht schoss.
„Ich... ich kann nämlich auch lesen.“
Ich kam mir entsetzlich dumm vor. Zosimo musterte mich mit zusammengekniffenen Augen. Ich hasste diese Art des Fremden, einen mit den Augen Maß zu nehmen, als sei man eine zum Verkauf stehende Ziege.
„So?“ knurrte er. „Lies mal vor!“
Er hielt den Ledereinband hoch, so dass ich den Titel sehen konnte. Das brüchige Leder roch alt. „Kommentar der Runentafelfragmente des Wettergebirges - niedergeschrieben von Eusebius Multhaupt im Jahre Vierzehnhundertfünfunddreißig“ war in altmodischen, vergoldeten Lettern auf den Einband geprägt. Das Buch war über fünfhundert Jahre alt! Ich las den Titel laut vor. Der „Forschungsreisende“ sagte vor Verblüffung gar nichts. Offenbar war es mir gelungen, ihm die Sprache zu verschlagen.
Mich für einen Dorftölpel halten! Dir werde ich es zeigen.
„Das Wettergebirge,“ sagte ich gelangweilt, „sind das nicht die nordwestlichen Wetterberge, von denen Leonhard Knoblauch schreibt?“
Der Mund des reisenden Gelehrten wurde zu einem Strich.
„Der Verfasser heißt Knobloch, du Grünschnabel. Hast du von seinen „Reisen in die Wetterberge“ nur gehört, oder hast du darin gelesen?“
„Ich hab das ganze Buch gelesen. Mehrmals!“
„Aha? Was schreibt er denn, der Leonhardt Knobloch?“
„Er beschreibt die Westküste im Norden, alte Königreiche und so, das Reich Barhut...“
Der Reisende fixierte mich. Sein Gesichtsausdruck hatte etwas Räuberisches.
„Natürlich schreibt er auch viel Sagenhaftes. Von Zauberern, Zwergen und Hexen...“
„Man muss nicht alles, was man nicht kennt, als Märchen abtun, Junge.“
„Na ja schon, aber glaubt Ihr etwa an Zwerge?“
Das ohnehin rote Gesicht des Fremden verfärbte sich ins Dunkelrot.
„Ob ich an Zwerge glaube?“ brüllte er.
Er beugte sich über den Tisch, als wollte er auf mich losgehen. Ich dachte, gleich würde er mich mit den Fäusten traktieren, aber stattdessen nahm er einen großen Schluck aus seinem Weinbecher, goss sich den Rest aus dem Krug ein und kippte ihn in einem Zug herunter. Sein Gesicht glühte.
„Na, wenn schon,“ murmelte er. „Noch nie in seinem Leben aus dem Heimatkaff rausgekommen, gerade mal ein paar Meilen auf See hinaus. Da kann man nichts anderes erwarten.“
Wie zur Besinnung gekommen fixierte er mich. „Wo hast du das Buch gelesen?“
Mir wurde mulmig. „Ich... das Buch gehört meinem Vater.“
„Soo - deinem Vater! Dein Vater ist Fischer, nicht wahr?“
„Mein Vater hat mir Lesen beigebracht. Wenn man lesen kann, wird man nicht ständig übers Ohr gehauen. Nur, weil wir Fischer sind, sind wir noch lange keine Dummköpfe! Mein Vater hat mehrere Bücher.“
„Was hat er denn noch für Bücher, dein Vater?“
„Ach, ganz Verschiedenes. Eine „Grammatik der Alten Hochsprache“ oder so ähnlich, eine Beschreibung der Westküste für Seefahrer...“ ich stockte.
Was ging das diesen Fremden überhaupt an?
„Die Grammatik der alten Hochsprache, die solltest du lesen, wenn du ein Gelehrter sein willst. In der alten Hochsprache eures Reichs sind viele wissenschaftliche Werke verfasst. Aber hör mal, ich kaufe deinem Vater den Knobloch ab. Er soll mir den Preis nennen. Sag ihm das!“
„Ich... ich glaube nicht, dass er seine Bücher verkaufen will. Wir haben genug Geld, uns fehlt nichts, und...“
„Außer ein paar vernünftigen Waffen fehlt euch hier nichts, was? Wo hat dein Vater seine Bücher überhaupt her, du Rotzlümmel?“
Mein Puls hämmerte, aber ich ließ mich nicht einschüchtern. „Und wo habt Ihr das Buch da her?“
Zosimo blickte mich an, schaute auf das vor ihm liegende Buch, blickte wieder mich an. Plötzlich lachte er los, ein kehliges, hässliches Lachen.
„In der Universität zu Klagenfurt gibt es einen buckligen, gichtkranken Bibliothekar, der würde mich gerne auf dem Marktplatz gevierteilt sehen, wenn er wüsste, wo dieses Buch jetzt ist. Ein schräger Kauz war das. Es hat mich all meine Überredungskunst und Unmengen an Bestechungsgeldern gekostet, in diese Bibliothek hineinzugelangen. Fast meine ganze Reisekasse ist dabei draufgegangen. Ein komisches Verhältnis hatte der zu seinen Büchern. Hat mit ihnen geredet, sie gestreichelt... War nicht ganz leicht, da weg zu kommen, hätte mich um ein Haar meinen Kopf gekostet. Deshalb muss ich mich jetzt ein paar Tage in eurem Kaff verstecken, bevor ich auf den Reichsstraßen wieder halbwegs sicher reisen kann.“
Er lehnte sich zurück. „Für Wissenschaft und Forschung muss man manchmal unangenehme Dinge in Kauf nehmen, Junge. Frag deinen Vater, was er für das Buch haben will. Ein vernünftiges Enterbeil, zum Beispiel?“
Er beugte sich wieder vor, gieriges Leuchten in den Augen. „Ich brauche das Buch für meine Nachforschungen, verstehst du? Ich bin verschollenen Geheimnissen meines Volks auf der Spur, oben in den Wetterbergen. Ich brauche jeden Hinweis, den ich bekommen kann.“
Mir kam eine Idee. „Ich kann ja mit meinem Vater sprechen...“
Er sah mich drohend an. „Das solltest du tun, Junge. Ich reise nicht ohne dieses Buch ab!“
Ich schluckte. „Ich meine, ich hab nämlich ein Schwert...“
Er sah an mir herab. „Seh' ich. Pass auf, dass du nicht drüber stolperst, wenn du losläufst.“
Wütend fuhr ich diesen Raubritter an. „Ihr habt doch angeboten, eine Waffe für das Buch zu schmieden. Wenn Ihr dieses Schwert ausbessert - so wie das Beil, das Ihr heute Nacht für Sven Bredursohn geschmiedet habt - dann lässt mein Vater ja vielleicht mit sich reden.“
„Er täte besser, mit sich reden zu lassen. Aber zeig das Ding mal her.“