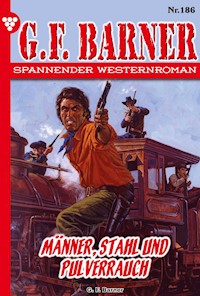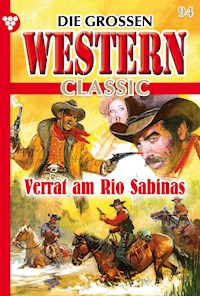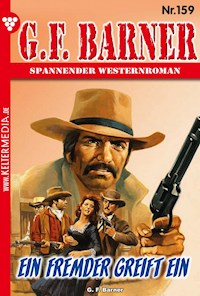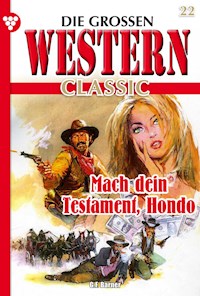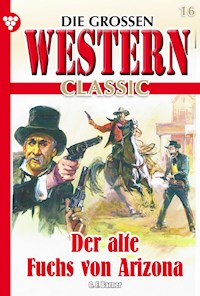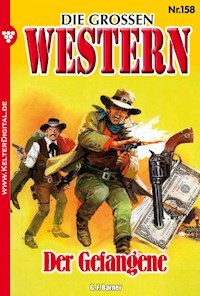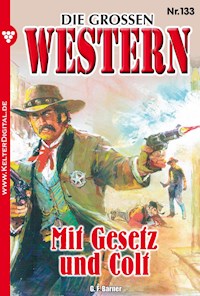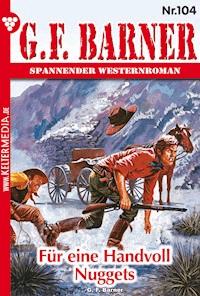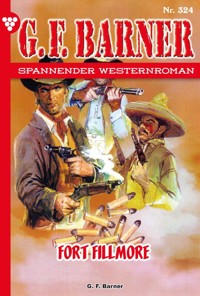25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: G.F. Barner
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Begleiten Sie die Helden bei ihrem rauen Kampf gegen Outlaws und Revolverhelden oder auf staubigen Rindertrails. G. F. Barner ist legendär wie kaum ein anderer. Seine Vita zeichnet einen imposanten Erfolgsweg, wie er nur selten beschritten wurde. Als Western-Autor wurde er eine Institution. G. F. Barner wurde als Naturtalent entdeckt und dann als Schriftsteller berühmt. Seine Leser schwärmen von Romanen wie "Torlans letzter Ritt", "Sturm über Montana" und ganz besonders "Revolver-Jane". Der Western war für ihn ein Lebenselixier, und doch besitzt er auch in anderen Genres bemerkenswerte Popularität. E-Book 1: Stunk in Fort Grant E-Book 2: Wächter der Weide E-Book 3: Die Fährte des Mörders E-Book 4: Blutgeld E-Book 5: 2000 Dollar auf den Kopf E-Book 6: Ed Bensons Partner E-Book 7: Cantrill blufft alle E-Book 8: …die im Staub sterben E-Book 9: Mündungsfeuer über dem Oregon-Trail E-Book 10: Eine Kugel für Logan
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1495
Ähnliche
Inhalt
Stunk in Fort Grant
Wächter der Weide
Die Fährte des Mörders
Blutgeld
2000 Dollar auf den Kopf
Ed Bensons Partner
Cantrill blufft alle
…die im Staub sterben
Mündungsfeuer über dem Oregon-Trail
Eine Kugel für Logan
G.F. Barner – Staffel 10 –
E-Book 91 - 100
G.F. Barner
Stunk in Fort Grant
Roman von Barner, G.F.
Ein Messer fiel klirrend auf einen Blechteller. Jemand hustete bellend, weil er sich verschluckt hatte. Drüben starrten ihr der Sergeant, zwei Corporals und ein Private mit Augen nach, die ihre Gedanken nur allzu offen verrieten.
Diana Markham lächelte dünn. Sie ging mit federnden Schritten und stolz zurückgeworfenem Kopf mitten durch den Schankraum von Soldiers Farewell, der Wechselstation kurz vor der Grenze von New Mexico nach Arizona, und spürte die Blicke der Männer fast körperlich.
Mit fünfzehn Jahren war sie schon eine kleine Schönheit gewesen, mit achtzehn hatten Männer bei ihrem Anblick den Atem angehalten. Inzwischen war sie vierundzwanzig, und ihre Ausstrahlung war eher noch größer geworden.
Diana trug im Moment einen Reitrock mit Schlitz, dazu eine hellgrüne Bluse und braune Stiefel. Bei jedem Schritt wippten ihre prallen Brüste unter der Bluse, ihre Hüften schwangen, und ihre Haare hatte sie gekämmt, gebürstet und offen gelassen. Rötlichblondes Haar, blaugrüne Augen, dazu die Figur, die eine einzige Verlockung darstellte.
Vielleicht sahen einige der Männer in der Station auch den breiten Waffengurt und das schwere Messer in der Scheide am Gürtel, aber die meisten starrten auf ihren Busen.
»Mann, o Mann!« entfuhr es einem der zwölf Kavalleristen. »Ich werde verrückt!«
Diana hatte das so oft gehört, daß es nichts Besonderes mehr war. Sie wußte, daß sie schön war, und sie verstand es auch, ihre Schönheit einzusetzen, wenn es sein mußte.
Sie war zum Haupteingang hereingekommen und blieb nun vor dem Tisch stehen, an dem der Mann saß, der ihr Leben gewesen war und bleiben sollte: ihr Vater.
William Markham – Old Bill, wie man ihn nannte – grinste. Er war alt und ergraut, aber innerlich jung geblieben und immer zu Streichen aufgelegt.
Da saß er, den Löffel in der schwieligen Faust aufrecht haltend, ein Bein auf der Tischplatte liegend und in den grauen Augen ein Funkeln. Stolz, Freude? Wer konnte es wissen.
»Aha«, sagte er nur. »Siehst gut aus, Tochter.«
Er verlor kein Wort darüber, daß sie sich umgezogen hatte. Solange sie fuhren, trug sie den derben Cordrock, ein kariertes Hemd, eine alte Weste und einen verbeulten Männerhut. Dazu oft Handschuhe. Ihr machte es nichts aus, sich bei notwendigen Reparaturen unter einen Wagen zu legen, Buchsen zu schmieren. Wenn sie dann dreckig und lächelnd wieder hervorgekrochen kam, ahnte kaum einer, daß sich unter Wagenschmiere und Erde, Staub und Schlamm das verbarg, was Diana wirklich war: eine bildhübsche Frau von vierundzwanzig Jahren.
»Die Wagen stehen, alles ist in Ordnung«, sagte Diana. »Ich gehe dann, Dad.«
»In Ordnung, Tochter.«
Sie blinzelte ihm zu, legte ihm kurz die linke Hand auf die Schulter.
»Dad, du bist der beste…«
»Ja«, unterbrach er sie. »Geh nur, viel Spaß!«
Das sagte er, obwohl er wußte, daß sie wahrscheinlich in fünf Minuten in den Armen des First Lieutenant George Coldrey liegen würde. Wie lange sie bei Coldrey blieb, wann sie wiederkam und was sie in der Zeit anstellte, schien Old Bill nicht zu kümmern. Sie war – das hatte er ihr einmal gesagt – alt genug, selbst zu bestimmen, was sie tun wollte. Bill war der Meinung, daß der Mensch nun mal brauchte, was er nötig habe. Darunter fiel gewiß auch die Liebe.
Für Bill war Diana erwachsen genug, sich ihr Leben so einzurichten, wie sie es für richtig hielt. Obwohl er sechzig Jahre geworden war, rechnete er sich nicht zum alten Eisen und besuchte regelmäßig Madam Duncan in Tucson. Aber es gab zwischen ihm und Diana eine stillschweigende Übereinkunft, daß keiner dem anderen irgendwelche Vorhaltungen machte. Zudem war Diana so gut wie verlobt.
Daß ein First Lieutenant ein Kommando von zwölf Mann führte, war absolut ungewöhnlich. Ein Sergeant hätte auch genügt. Doch immerhin war Coldreys Vater Colonel und der Kommandant der Südostregion von Arizona mit Sitz in Fort Grant. Darum konnte es sich George auch leisten, mit einem Kommando den Wagen entgegenzureiten und die Transportsicherung zu übernehmen. Eines Tages, das wußte Diana, würde George zum Major oder Colonel avancieren und sie als seine Frau eine Menge Verpflichtungen haben.
»Ja«, sagte Diana, »ich denke, er wartet. Also, ich gehe.«
Bill nickte nur. Dann blickte er ihr nach und studierte mit innerem Grinsen die Gesichter der Männer, die jeden Schritt Dianas verfolgten, bis sich die Tür hinter ihr schloß. Der Alte hörte die Seufzer der Männer, nahm seinen Löffel wieder anständig in die Hand und aß seine Bohnensuppe.
Draußen atmete Diana tief durch. Manchmal, wenn ihr Vater sie so seltsam ansah, fragte sie sich, ob er nicht doch etwas gegen George hatte. Irgend jemand mußte schließlich die über zwanzig Wagen führen, wenn Bill nicht mehr fahren konnte oder starb. Vor sechs Jahren war absolut klargewesen, daß Harry, Dianas Bruder, der Nachfolger Bills werden sollte. Dann war auch Harry von Comanchen umgebracht worden, wie vorher William, ihr ältester Bruder. Das lag nun elf Jahre zurück. Und vor genau elf Jahren war auch Dianas Mutter gestorben, Jennifer Markham, geborene O’Maily. Irin von Geburt.
Jennifer Markham war nur eine Woche nach Esther, der damals neunjährigen Schwester Dianas, am Sweetwaterfieber in Texas gestorben. Vielleicht auch, weil sie die Nachricht von Williams Tod erreicht hatte, während sie mit dem Fieber kämpfte.
Das Leben und die Arbeit gingen weiter. Man kam nicht dazu, sich lange über Schicksalsschläge den Kopf zu zerbrechen und seiner Trauer nachzuhängen. Obwohl Old Bill Grund gehabt hätte, zu verzweifeln. Aber dieser Klotz von Mann biß die Zähne zusammen. Immerhin hatte er für fünfundzwanzig Leute zu sorgen. Vielleicht fraß er auch alle Sorgen in sich hinein.
Diana war auf dem Weg, als es links von ihr knirschte und sie instinktiv reagierte. Dianas Rechte schwebte über dem Revolverkolben, während sie angestrengt lauschte und ihre Augen die Dunkelheit zu durchdringen suchten.
Und dann sah sie den Schatten des großen Mannes an der Ecke der Fenz, zehn Yards vor sich.
»Wer ist da?« fragte sie lauernd. Ihre Hand lüftete den Achtunddreißiger. »Antworte, Mann! Wer bist du, und warum stehst du da in der Dunkelheit herum?«
»Tut mir leid«, kam es zurück. »Ich bin es, McLintock. Verzeihen Sie, wenn ich Sie erschreckt haben sollte, Miß Markham.«
Chess McLintock! Irgendwie war ihr dieser baumlange, sehnige Mann unheimlich. Diana erinnerte sich, daß sie nur ein einziges Mal ein paar Worte mit ihm in Tucson gewechselt hatte.
Chess McLintock, der als Vierzehnjähriger den Vater, einen Indianerhändler, bei einem Überfall der Ute-Indianer in der Nähe der sogenannten Salt River-Rio Colorado Chiquito-Route verloren hatte. McLintock, der Mann mit der schrecklichen Nackennarbe, die ein Ute-Tomahawk hinterlassen hatte und nicht zu übersehen war. Er war damals vom Wagen gestürzt und von den Utes nicht beachtet worden, weil sie ihn für tot gehalten hatten.
Chess McLintock, der Fremden als Führer durch diese Wildnis diente, war schweigsam, kühl und abweisend. Ein undurchschaubarer Typ.
»Sie sind das?« Diana seufzte erleichtert. »Warum stehen Sie denn dort, McLintock?«
»Nur so, es gibt keinen besonderen Grund.«
»So? Dieser Doc und dessen drei Begleiter – gehören die Leute zu Ihnen, McLintock?«
»Ja, Miß, der Doc ist ein Mineraloge, er sucht nach Erzen und will über die San Pedro-Linie in die Berge drüben.«
McLintock trat aus dem Schatten in das spärliche Licht der noch brennenden Stallaterne. Er bewegte sich stets so geschmeidig wie eine Raubkatze. Sein Haar war lang, blauschwarz und leicht gewellt. Wahrscheinlich trug er es so lang, um die schreckliche Narbe an seinem Nacken zu verdecken.
Sie sah in seine hellen Augen und erinnerte sich an Phoenix. Vor zwei Jahren war die neue Stadthalle eingeweiht worden. Alle hatten gefeiert, besonders im Creston-House, dem schönsten und größten Saloon der Stadt. Paola del Ria hatte dort gesungen und getanzt, eine Mexikanerin, berühmt von Tucson bis Yuma, von Phoenix bis zum Golconda. Sie war schlank, schön, wild und feurig.
In vorgerückter Stunde hatte sie auf dem großen runden Tisch zum hackenden Rhythmus der Gitarren getanzt, war schließlich heruntergesprungen und lachend in den Armen dieses Mannes gelandet: Chess McLintock.
Chess McLintock, der Schweigsame, der Stille, der Unheimliche und Geliebte dieser bezaubernd schönen Frau, der Hunderte zu Füßen gelegen hatten. Er hatte sie fortgetragen und war nicht wiedergekommen. Dieser seltsame Mann, dieser Wilde und jene Frau – unglaublich!
Und doch ging etwas von ihm aus, das Menschen, besonders aber Frauen, in seinen Bann zu zwingen schien. War es dieser Hauch von Einsamkeit und Wildnis, der Frauen schwach machte?
McLintock kam heran und tat das, was man bei Männern in diesem Land sonst selten erlebte. Er nahm den flachkronigen, breitrandigen Hut mit dem Band aus Klapperschlangenhaut ab. Er sagte nichts, als er vier Yards vor Diana Markham stehenblieb und sie mit seinen hellen Augen, die zu flimmern schienen, ruhig ansah.
Diana fühlte sich unter diesem Blick völlig verwirrt und hilflos. »Ja, dann – dann passen Sie nur auf den Doc auf, McLintock.«
Zum Teufel, was ist denn mit mir los? Warum rühre ich mich nicht von der Stelle?
»Also, dann – gute Nacht, McLintock.«
»Ja«, sagte der Seltsame, der Wilde, der Unheimliche. »Ja, Sie sind wirklich schön.«
Es war, als hätte er sich etwas bestätigen wollen. Es war wie eine Feststellung, etwas, worauf er neugierig gewesen sein mochte, ob es auch wirklich stimmte. Eine flammende Röte überzog plötzlich Dianas Gesicht, als sie sich abrupt abwandte. Dieser Mann, das wurde ihr mit aller Deutlichkeit klar, staunte sie weder an, noch raspelte er Süßholz wie andere.
Diana ging auf die Hausecke zu und sah sich nicht um. Sie wußte, Chess McLintock blickte ihr nach. Es war, als spürte sie seine Blicke im Rücken. Dieser Halbwilde, dieses Ungeheuer, von dem man sich die schlimmsten Dinge erzählte, blickte ihr nach.
Oh, dachte sie zornig, er regt mich auf. Jedesmal, wenn ich diesen Wilden sehe, werde ich wütend. Ich weiß nicht, warum das so ist, er tut mir doch nichts. McLintock – was für ein Name. Wie ihn wohl die del Rio genannt hat, als sie in seinen Armen lag? Vielleicht Chessie-Darling? Der Teufel soll den Kerl holen!
Diana schritt um den Anbau zur Hoftür. Obwohl der Anbau mit dem Hausflur eine Verbindung hatte, war sie nicht durch den Flur gegangen. Schließlich brauchte sich niemand das Maul darüber zu zerreißen, daß sie den First Lieutenant George Coldrey besuchte und so schnell nicht wiederkam.
Die Hölle, dieser McLintock, der hatte etwas in den Augen…
Durch eine Ritze neben der Tür fiel Licht. Als Diana klopfte, räusperte sich George.
»Ja«, sagte er, »komm herein!«
George machte die Tür auf und trat zur Seite. Er war schlank, blond und blauäugig. Er trug die dunkelblaue Kavalleriehose ohne Hosenträger und war der Typ des Offiziers, wie ihn sich jedes kleine Mädchen vorstellte.
»Da bist du ja endlich«, seufzte George und zog Diana sofort an sich, die Tür mit dem Fuß zustoßend. »Mit wem hast du denn da noch geredet?«
»Es war nur McLintock, Georgie.«
Nur McLintock?
*
Es war wie ein Feuer, das in ihrem Körper zu brennen schien, als George ihr den Rock abstreifte und achtlos zur Seite warf. Dann machte er sich an den anderen Kleidungsstücken zu schaffen.
Hatte George heiße Hände!
Sie glitten über Dianas Schenkel, rauf und runter. Die Bewegungen wurden immer fordernder. Dann beugte er sich jäh vor und küßte sie mit der ihm eigenen Wildheit.
Dianas Körper vibrierte im wohligen Schauer, als sich seine Hände unter ihre Bluse schoben und am Mieder zerrten. Neun Wochen hatten sie sich nicht gesehen. In dieser Zeit hatte George nach etwas gehungert, das tief in seiner Brust genagt, gebohrt, gebrannt hatte.
»O Gott, sei doch nicht so wild, George.«
»Ich werde verrückt«, keuchte er und bekam den Hakenverschluß endlich zu fassen. »Jede Nacht habe ich an dich gedacht, jede Stunde, die ich im Sattel saß. Ah, deine Brüste…«
Die Lampe mit dem braunen Schirm warf einen so warmen Ton auf ihren nackten Leib, daß ihre Haut beinahe braun und das Tiefbraun ihrer Brusthöfe fast schwarz wirkte. Nun sah er sie, die beiden Hügel, nach denen er sich in seinen Gedanken und Träumen verzehrt hatte – prall, weich, verlockend.
»Wie schön sie sind«, flüsterte George voller Verlangen und warf sich über sie, ließ seinen Mund um die Warzen kreisen. »Du, du, mein Liebling!«
Das innere Feuer schien sie nun völlig zu verzehren. Diana spreizte wie in Trance ihre Beine, spürte die Hitze seines Leibes auf ihrer nackten Haut, die doch während dieser Nachtstunde kühl geworden war.
George verschaffte sich in leidenschaftlicher Aufwallung Eingang in ihren Schoß, drängte sich rhythmisch dagegen.
Heißes Blut, keuchender Atem, Begehren, das zueinander finden mußte und wollte. Es war, als hätte Diana zu lange gefastet, und vielleicht genoß sie es darum so tief, daß er zu ihr kam und sein Körper sich an ihren preßte. Sie umschlang den geliebten Mann und genoß dieses Zusammensein
Georg küßte sie mit einem Verlangen, daß ihr die Sinne zu schwinden drohten. Sie erstickte um ein Haar unter seinen wilden Küssen. Ein Mann und eine Frau – und die Sehnsucht vieler Tage und Nächte, die sich nun erfüllte.
Eines Tages, dachte Diana, bin ich Mrs. Coldrey, und George ist vielleicht Major oder Colonel. Aber was wird aus den Wagen und Dads Leuten? Herrgott, muß mir das denn ausgerechnet jetzt einfallen? Wie kann ich nur an solche Dinge denken, wenn ich doch will, daß er…
»Ach«, stöhnte Diana und umklammerte seine Schultern. »Ja, ja, Liebling, ja, so ist es gut!«
Und dann war der Gedanke an ihren Vater und die Wagen wie ausgelöscht. Diana glitt auf einer Woge des Glücks dahin. Nach einer Weile wölbte sie ihren Leib, als sie gemeinsam mit George den Höhepunkt erreichte.
*
Es war wie bei jeder Leidenschaft: War sie verrauscht, dachte man an ganz andere Dinge.
»Komm doch noch ein bißchen zu mir«, sagte George vom Bett aus. Er lag auf der Seite und hatte sich zugedeckt, weil er immer so leicht fror. Denn warm war es hier im Anbau nicht. »Nun komm schon!«
»Hör mal, anderthalb Stunden«, gab Diana zurück. »Was soll Dad denken, wo ich bleibe?«
»Ach, dein Vater weiß doch Bescheid«, murmelte George. »In drei Monaten verloben wir uns. Der Colonel meint, ich hätte eine gute Chance, befördert zu werden. Als Captain kann man sich schon mal verloben, auch heiraten, wenn man muß.«
»Wenn man muß«, wiederholte Diana und lächelte verschmitzt. »Nur keine Sorge. Ich habe das Buch von Doc Brewster ganz genau studiert.«
»Ach«, sagte George wegwerfend, »die Weisheit liegt nicht in solchen Büchern. Daß es überhaupt jemand wagt, über so etwas zu schreiben. Wenn wir nur erst heiraten könnten.«
»Willst du damit wirklich warten, bis du Major bist, George?«
»Der Colonel meint…«
Es regte sie auf, dieses verdammte ›der Colonel meint‹. Er hätte ja auch Vater sagen können.
»George, bis du Major bist, bin ich dreißig. Und dann Kinder? Bis dahin kann Dad krank werden oder so das Reißen bekommen, daß er nicht mehr fahren kann. Als Major hast du im Monat höchstens hundertsechzig Dollar. Wenn du aber bei uns Dads Arbeit übernimmst, hast du das Vier- oder fünffache davon. Wir hätten genug für zehn Kinder.«
»Ich habe dir doch schon gesagt, daß der Colonel bestimmt hat, was ich zu tun habe. Wir sind nun mal seit George Washington immer Soldaten gewesen.«
»Seit George Washington«, echote Diana zornig und wußte selbst nicht, warum sie sich so gehenließ. Sie zog den rechten Stiefel an und trat hart auf. »Seit George Washington, dessen Vornamen du trägst, redet man den Vater bei euch wohl immer als Colonel oder General an – oder als Sir, was? Zum Teufel, willst du deinen Vater oder mich heiraten? Diese Linie, die wir von Südtexas nach El Paso und Tucson verlegt haben, bringt mehr ein als das, was ein General jemals verdienen könnte.«
»Diana, das ist kein Vergleich.«
»Nein«, fuhr sie auf und rammte ihr linkes Bein in den anderen Stiefel. »Natürlich nicht. Ein General ist ja mehr als ein Frachtwagenboß. Nur,
Georgie, ohne Frachtwagenbosse müßte auch ein General Sand fressen, Wasser saufen oder nackt herumrennen.
Oder glaubst du nicht? Wer soll denn die Bevölkerung versorgen, wenn es nicht Leute wie meinen Vater gibt?«
»Also, nun hör doch mal, Diana, wie du redest. Wie – wie eine…«
»Wie eine was?« fauchte sie ihn an. Sie wußte genau, daß er diese Vergleiche nicht liebte, aber schließlich beschrieben sie nichts als die Wahrheit. »Ich bin die Tochter eines Frachtwagenmannes, die von Kindheit an mit rauhen Männern umgegangen ist. Die drücken sich nicht anders aus, und ich, wenn ich es nicht will, auch nicht besser. Du hast absolut keinen Grund, mein Lieber, verächtlich auf uns herabzusehen. Wenn wir nicht wären, müßten viele Menschen in diesem Land verhungern, ihr könntet nicht schießen, geschweige denn lange Ritte ohne Vorräte unternehmen. Was, zum Teufel, ist der Grund, daß du so verächtlich über unseren Beruf denkst?«
»Liebling, ich denke wirklich nicht verächtlich, aber es gibt doch Unterschiede. Der Colonel hat mir klargemacht, daß ich die Tradition…«
Als sie plötzlich herumwirbelte, dachte er, sie würde auf ihn losgehen. Bei aller Leidenschaft, die sie verband, war es doch dieser verdammte Punkt, der immer wieder Grund zum Streit lieferte. Diana gab nicht nach, das war das Fatale.
»Was ist denn?«
»Ruhig!« fuhr sie ihn an, als spräche sie nicht mit dem First Lieutenant Coldrey, sondern mit einem ihrer Fahrer. »Sei still! Ich höre Räderrollen, Wagen nähern sich, oder?«
Sie hatte die Bluse noch nicht an, trat dennoch an das Fenster und öffnete den inneren Blendladen so weit, daß sie hinausblicken konnte.
»Diana, wenn dich jemand sieht!« rief George. »Du hast ja oben herum nicht viel an. Diana!«
»Ach, mach das Licht aus, schnell!«
Kommandieren konnte sie wie ein Mann, es war schrecklich mit ihr. Er löschte die Lampe und sah dann im Dunkel das heller werdende Rechteck. Diana machte den Blendladen ganz auf.
»Tatsächlich, es sind Wagen«, sagte sie dann. »Vier, fünf, sieben! Wo kommen die denn jetzt noch nach Mitternacht her? Moment mal…«
Diana streifte sich die Bluse über und knöpfte sie zu, brachte ihr Haar einigermaßen in Ordnung.
»Ich werde verrückt, das sind ja Sturgis-Wagen. He, verdammt, Sturgis sitzt auf dem Bock des ersten Wagens.«
George wußte sofort Bescheid. Niemand brauchte ihm zu sagen, wie sich Lloyd Sturgis und Bill Markham verstanden. Sturgis hatte sich seit etwa zwei Jahren in Arizona niedergelassen und besaß über ein Dutzend Wagen. Er machte Old Bill Konkurrenz, wo er nur konnte. Zwischen seinen Leuten und Bill Markhams Fahrern hatte es bereits etliche Zusammenstöße gegeben. Sturgis fuhr immer etwas billiger für die Armee. Er war ein knapp fünfunddreißig-jähriger Mann mit glatten schwarzen Haaren und dunklen Augen. Er wirkte zwar farblos, aber das täuschte.
»Das fehlte gerade noch«, sagte Diana am Fenster. Ihre Augen hatten sich nun an die draußen herrschende Dunkelheit gewöhnt, und sie sah, wie einige ihrer Männer, die unter oder auf den Wagen geschlafen hatten, neugierig wurden. »Hoffentlich gibt das keinen Ärger. Sturgis hat neulich erst die Frachtraten für den Mexikohandel unterboten, und Dad war ziemlich wütend. Ich muß hinaus und sehen…«
Sie sagte nichts mehr, dafür sah sie etwas aus den Augenwinkeln.
An der Fenz bewegte sich ein Schatten. Der Mann dort hatte an der Ecke gestanden und wich nun in die nachtschwarze Finsternis zurück.
Chess McLintock.
McLintock hatte auf diese Wagen gewartet. Woher er gewußt hatte, daß sie kommen würden, war Diana unbegreiflich. Chess hatte jedenfalls dort gestanden und in Richtung Florida Mountains und Tres Hermanos Ausschau gehalten. Er verschmolz jetzt vollkommen mit dem Schatten der Stallwand.
»He, seht mal, wer da kommt!« schrie draußen jemand an Markhams Wagen. »Es stinkt hier plötzlich nach Aasgeiern, findet ihr nicht?«
»Allmächtiger, es geht schon los!« entfuhr es Diana. »Wo ist mein Waffengurt? Ich muß hinaus, oder sie fangen noch eine Prügelei an.«
Es gab keine Prügelei. Während sie den Waffengurt in der Dunkelheit suchte, fand und schnallte, erscholl die rauhe Stimme ihres Vaters.
»Ich will hier Ruhe haben! Jeder bleibt auf seinem Platz und schläft weiter! Morgen wird es ein heißer Tag. Verstanden? Ruhe, zum Satan!«
»Der Alte gibt klein bei«, sagte jemand spitzzüngig. »He, Boß, hast du schon mal einen Wolf gesehen, der den Schwanz einkneift?«
»Quincy, halt’s Maul! Ihr geht in den Schankraum! Hier herrscht Friede, oder ihr erlebt etwas! Fahrt die Wagen zur anderen Seite!«
»Na, wer sagt es denn?« meldete sich George aus der Dunkelheit. »Es passiert nichts. Darling du kannst ruhig noch etwas herkommen.«
»Bist du sicher, daß der Colonel das genehmigen würde?« spottete Diana, die es aufregte, daß ihr Vater so respektlos von den Männern behandelt wurde. »Bleib du nur schön allein. Träumen darfst du von mir. Ich hoffe nur, du siehst dich im Traum nicht ohne deine prächtige Uniform auf einem Kutschbock sitzen. Das müßte für dich ja ein Alptraum werden, mein Lieber.«
Drüben fuhren die Männer von Sturgis die Wagen in Doppelreihe auf. Dann kamen sie in die Schankstube, nur zwei blieben als Wache zurück. Dianas Blick wanderte zur Fenz am Stall. Dort löste sich der Schatten McLintocks aus der Dunkelheit. Der baumlange Mann glitt am Stall entlang. Und plötzlich wußte Diana, daß er nur ein Ziel hatte: die Hintertür des Hauses.
McLintock, der Unheimliche, wollte in die Schankstube. Der Geruch nach Streit, Blut und Tod lag in der Luft. Diana Markham kannte dieses Gefühl, und sie wußte, daß sie sich nicht täuschte.
Gefahr lauerte in allen Ecken.
*
»Sturgis, halten Sie sich heraus, oder ich muß annehmen, daß Sie hinter der verdammten Sache stecken!«
Die Stimme klang so schneidend, daß Diana zusammenzuckte. Sie war, nachdem sie George verlassen und den Hausflur auf dem gleichen Weg wie McLintock betreten hatte, hinter der halb-offenen Tür. Da es im Flur dunkel war, sah man sie nicht vom Schankraum aus, aber sie sah alles und jeden.
Sturgis hatte sich rechts an den langen Tisch gesetzt. Vier seiner Fahrer saßen neben ihm, aber Johnson, der gefürchtetste Mann unter seinen Leuten, hatte sich erhoben. Larry Stevenson, ein hagerer Typ mit einem Pferdegebiß, lehnte links an der Wand. Am Tresen stand Harold Morgan, der sicherlich Schnellste mit dem Colt in der Mannschaft.
Die Sache mit Sturgis und Johnson war nicht ganz einfach zu erklären. Johnson besaß zwei eigene Wagen, die von ihm, Stevenson oder Morgan gefahren wurden. Er stand bei Sturgis unter Vertrag, das schloß jedoch nicht aus, daß er dann und wann auf eigene Rechnung Transporte machte.
»Sturgis, er ist ein Lügner!« fuhr Johnson zornig auf. »Ich habe zwar mal mit den beiden Castillos gesprochen, aber ich nahm nie einen Auftrag an, Geld erst recht nicht.«
»Wenn du mich noch einmal Lügner nennst, passiert dir was, du Goliath!« drohte McLintock. Er hatte sich vor den Männern am Tisch aufgebaut, etwa sechs Schritt von der Flurtür entfernt. »Sturgis, was wissen Sie von der Geschichte?«
»Bei Gott«, antwortete Sturgis, der beide Hände flach auf die Tischplatte gelegt hatte. »Ich weiß nur das, was mir erzählt worden ist, und danach hat Ramon Castillo unter die Jacke gegriffen und gesagt, er würde es Johnson zeigen. Es war Notwehr, das hat der Marshal in Rillito festgestellt.«
Diana blieb klopfenden Herzens stehen. In diesem Augenblick fürchtete sie sich vor dem, was sie ahnte. McLintock blickte in ihre Richtung. Sein Gesicht hatte einen grimmigen Ausdruck, und in seinen Augen lag eiserne Entschlossenheit. Dieser Mann war nicht bereit, jemals ein selbst gestecktes Ziel aufzugeben.
»Es war nicht Notwehr, sondern kaltblütiger Mord!« fauchte McLintock. »Sturgis, so wahr ich hier stehe, weder Ramon Castillo noch dessen Bruder Pablo haben jemals einen Menschen betrogen. Es gibt vielleicht mehr ehrliche Mexikaner als Yankees. Ich kenne sie seit meinem vierzehnten Lebensjahr, Sturgis, als sie mich halbtot in den Ute Mountains fanden, mich pflegten und bei sich behielten, für die Reste einer von Indianern geplünderten und verbrannten Ladung. Ich habe selten ehrlichere, anständigere Menschen gefunden, Sturgis. Und wenn Pablo behauptet, sein Bruder Ramon hätte nur in die Tasche gegriffen, um diesem Schurken Johnson die Geldquittung mit seiner Unterschrift zu zeigen, dann ist das absolut wahr, Mister. Ramon Castillo war gebürtiger Mexikaner, er sprach schlecht amerikanisch, und wahrscheinlich drückte er sich nicht deutlich genug aus.«
Diana hätte nie erwartet, daß dieser schweigsame Mann so viel reden konnte, und jedes Wort war eine bittere Anklage.
Die Kavalleristen, die nur Wachen draußen bei den Pferden hatten und an einer Seite des Raumes geschlafen hatten, waren aufgestanden. Jeder kannte McLintock. Er war oft genug für die Armee geritten, und jeder schien zu glauben, was er sagte.
»Sturgis!« schnitt McLintocks Stimme wie ein Messer durch den Raum. »Wenn Ramon Castillo ein Yankee gewesen wäre, hätte man seinen Mörder eingelocht, aber er war ja nur ein naturalisierter Amerikaner, nur ein halber Mensch, wie? Ein Stück Papier fiel aus seiner Hand, als ihn die Kugel niederstreckte, und als sich die Aufregung legte, war es weg. Einer dieser drei Halunken hat es genommen – wer, Johnson? Du, Stevenson oder Morgan? Wer hat sie verschwinden lassen?«
Deshalb hatte er also gewartet. Diana erinnerte sich mit Unbehagen an die Geschichte, die vor Wochen die Runde gemacht hatte. Angeblich hatten die Castillos, die früher mit einem Handelswagen unterwegs gewesen waren und nun schon seit Jahren einen Store in Rillito, südlich von Tucson, besaßen, bei Johnson Ware bestellt. Die Bestellung sollte unter Druck erfolgt sein, und sie hatten sich von Johnson eine Quittung über einen Teil der Summe geben lassen, die sie ihm in bar vorgestreckt hatten. Die Ware war nie eingetroffen, und Johnson hatte auf keine Mahnung reagiert, statt dessen behauptet, er hätte den Castillos das Geld zurückgegeben, jedoch vergessen, die Quittung zu verlangen.
Einige Zeit später war es dann im Saloon von Rillito zum Streit zwischen den Castillos, Johnson und dessen Burschen gekommen. Ramon Castillo, der ältere der beiden Brüder, hatte sein Geld verlangt, und fünf Minuten darauf war er tot und die Quittung verschwunden.
»Geh zum Teufel!« zischelte Johnson. Der riesige Mann stieß sich vom Tisch ab, wandte sich um und machte einen Schritt auf McLintock zu. »Wenn du nicht sofort die Kurve kratzt, Greaserfreund, fliegst du im Bogen hinaus, aber mit gebrochenen Knochen! Ich weiß von keiner Quittung, ich habe den Castillos nie etwas geschuldet. Diese dreckigen Mexikaner lügen doch alle.«
»Du Lump hast ihn geschlagen – einen alten, kleinen Mann!« entgegnete McLintock grimmig. »Du bist ein Stück Dreck, Johnson, ein widerlicher, durchtriebener und hinterlistiger Lump, den man…«
Weiter kam er nicht.
Der gut zweihundertdreißig Pfund schwere und über sechs Fuß und vier Zoll große Clement Johnson, dessen Fäuste in ganz Südarizona gefürchtet waren, schnellte mit einer Behendigkeit vor, die ihm niemand zugetraut hätte.
»Dich schlage ich tot!« brüllte er. »Jetzt hast du lange genug gestänkert!«
*
Chess McLintock reagierte in letzter Sekunde. Der breitschultrige, sehnige Pfadfinder duckte sich unter der auf ihn zuschießenden Faust des Riesen seitlich ab, wirbelte dann auf dem linken Absatz herum und ließ seine Rechte steil nach oben zucken.
Diana, die schon das Schlimmste für Chess McLintock befürchtet hatte, konnte dessen schnelle Bewegung kaum verfolgen.
Die Faust traf.
Die steinharten Knöchel von McLintocks rechter Hand krachten unter Johnsons Nase. Sie schrammten über seine Lippen, warfen seinen Kopf förmlich zurück, und der Riese stieß einen tiefen, gurgelnden Laut aus. Er nahm den Treffer und steckte ihn ein, aber er kam ins Taumeln – und war an McLintock vorbei.
Sofort stieß sich der Pfadfinder ab. Was dann geschah, hatte niemand erwartet.
McLintock schlug nicht etwa zu, sondern packte den Riesen an den Hosenriemen und am Genick. Und dann begann McLintock zu laufen, hielt den Mann jedoch fest und stieß ihn vor sich her.
Johnson hatte keine Möglichkeit zur Gegenwehr. Zwar versuchte der Riese noch nach hinten zu schlagen, doch er streifte McLintocks Arm nur. Dann prallte Johnson links vom Tresen mit voller Wucht gegen die Wand. Sein kurzhaariger runder Schädel krachte an die Lehmmauer, als wäre er ein Rammbock. Es war Johnson nicht einmal gelungen, sich mit den Händen abzufangen, und plötzlich gaben seine Knie nach. Da erst suchte er nach einem Halt. Seine Hände glitten über die Mauer, und während er laut schnaufte, ließ ihn McLintock los.
Der Pfadfinder sprang zur Seite, wirbelte herum, sah Johnsons lahme Bewegung und feuerte erneut die Rechte ab, direkt auf Johnsons Kinn.
Der verheerende Hieb riß den zweihundertdreißig Pfund schweren Mann um die Achse. Seine Arme ruckten hoch. Es sah aus, als wäre er schon durch den Anprall gegen die Wand halb betäubt worden. Der schwere Treffer ließ ihn wanken.
Er wandte sich McLintock zu, und der setzte zum erstenmal seine Linke ein. Als sie auf Johnsons Rippen landete, sperrte der Riese den Mund weit auf, verdrehte die Augen und knickte im Zeitlupentempo ein.
Diana, die ihren Augen nicht trauen wollte, blickte in diesem Moment nach rechts, weil sie irgendeine Bewegung ablenkte. Und dann sah sie, daß Harold Morgan, jener Mann, der den alten Ramon Castillo erschossen hatte, die Waffe zog. Da er sich hinter McLintock befand, bekam der nichts davon mit.
*
Diana reagierte aus einem Impuls heraus, als sie den Pfadfinder warnte.
»McLintock, Morgan!«
Was dann kam, erschien ihr wie der Beginn des höllischen Infernos. Sie sah Chess aus dem Stand nach links fliegen, dabei die Rechte bewegend.
Der Schuß peitschte, während McLintock im Sprung war, und die Kugel bohrte sich dort, wo er gerade noch gestanden hatte, in die Mauer. Chess McLintock schlug lang hin, landete auf der rechten Schulterpartie, drehte sich auf den Rücken und stieß den rechten Arm hoch. Er hatte im Bruchteil eines Augenblicks seinen Colt gezogen und feuerte.
Der Doppelknall hallte durch den Schankraum. Morgans Kugel drang knapp über McLintock in die Mauer, doch er traf. Morgan wurde am Tresen entlanggeschleudert. Der schwarzhaarige stämmige Kerl knickte ein, gleichzeitig hatte Stevenson an der Wand nach dem Colt gegriffen.
Wie das Messer in Dianas Hand geriet, wußte sie später nicht zu sagen. Sie sah nur, daß Stevenson den Colt herausreißen wollte, holte aus und ließ dann das Messer durch die Luft wirbeln.
Die blinkende Klinge traf Stevensons Oberarm, drang durch den Stoff in die Haut und hätte Stevenson an die Wand genagelt, wenn diese nicht aus Lehm gewesen wäre.
Larry Stevenson schrie seinen Schmerz hinaus. Seine Finger spreizten sich zuckend, und der Colt fiel polternd zu Boden.
Erst in diesem Augenblick schnellte McLintock vom Boden hoch. Und wenn er etwas mit Sicherheit wußte, dann war es die Tatsache, daß er Stevensons Kugel bekommen hätte, wäre das Messer nicht gewesen.
Der Pfadfinder war kaum auf den Beinen, als er sich abstieß und auf den auf allen vieren am Boden kauernden Johnson zustürmte. Gleichzeitig fiel Morgan mit einem lallenden Laut vom Tresen aus hintenüber und blieb zuckend liegen.
McLintock packte Johnson von hinten mit dem linken Unterarm am Hals und zerrte ihn in die Höhe. Dann stieß er die Rechte unter Johnsons rechter Achsel durch, beugte den Arm, drückte dem Gegner die Coltmündung an die Kinnlade und hatte auch schon die Linke wieder frei.
»Und nun«, sagte er eisig und mit einer unheimlichen Ruhe, »wollen wir sehen, was dieser Lump in den Taschen hat. Sturgis, sitz still, oder meine nächste Kugel reißt dir ein Ohr ab! Stevenson, bewegst du dich, mache ich den Finger krumm, dann hat Johnson die längste Zeit gelebt!«
Dies war keine leere Drohung. Der Pfadfinder meinte es so, wie er es sagte, das begriff jeder. Seine Linke glitt tastend in Johnsons Rocktasche, dann in die Innentasche und kam dann mit einer Art Lederfalttasche wieder zum Vorschein. Chess McLintock schleuderte sie bis zum Tresen, hinter dem der leichenblasse Stationer Amos Howard stand.
»Amos, aufmachen und jedes Schriftstück entfalten! Nachsehen, wo da der Name der Castillo-Brüder steht und Johnson unterschrieben hat!«
»Ja, Chess«, sagte Amos mit zitternder Stimme. »Sofort, Chess.«
Der Stationer bückte sich, öffnete die Falttasche, legte jedes Papier nach einem prüfenden Blick zur Seite und hielt plötzlich inne.
»Nun, Amos?«
»Das – das muß es sein, Chess«, stammelte er.
»Lies laut vor! Ganz ruhig, ihr Burschen, sonst…«
Amos Howard schluckte ein paarmal, dann sagte er laut:
»Quittung! Hiermit bestätige ich, daß ich von den Brüdern Ramon und Pablo Castillo einhundertsechzig Dollar Anzahlung auf einzukaufende und zu liefernde Ware bekommen habe. Clement Johnson. Rillito.«
Lloyd Sturgis saß kreideweiß am Tisch. Seine Männer sahen sich bestürzt an, nur Stevenson biß sich auf die zitternden Lippen. Anscheinend hatte keiner der anderen Männer von Sturgis eine Ahnung von dem gehabt, was wirklich geschehen war. Sturgis jedoch, dessen war sich McLintock sicher, hatte Bescheid gewußt. Beweisen würde er es jedoch nicht können.
Morgan lag nun still. Er war tot.
»Sturgis«, sagte McLintock ganz ruhig, »wenn ich jemals beweisen kann, daß du hinter dem Mord an Ramon Castillo gesteckt hast, geht es dir an den Kragen! Morgan, der ihn hinbrachte, ist tot. Johnson und Stevenson haben nach dem Gesetz höchstens einen Betrug begangen, und ein Richter würde entscheiden, daß sie lediglich wegen dieses Deliktes eingesperrt werden könnten. Wahrscheinlich ließe er sie laufen, wenn sie die hundertsechzig Dollar zahlten. Johnson, willst du zahlen, oder…«
»Ich – ich habe nicht so viel Geld, Sturgis…«
»Okay«, flüsterte Lloyd Sturgis, »McLintock, ich bezahle für ihn. Johnson, du verdammter Narr, in was hast du mich da hineingeritten? Wie stehe ich nun da?«
»Sehr gut«, sagte plötzlich Bill Markham grimmig an der Tür. »Die Sache spricht sich bald herum, Sturgis, und dann fragt es sich, ob du weiter gute Geschäfte machen kannst. – He, Chess, ich passe ein wenig auf.«
»Na gut, aber du mußt es nicht«, sagte McLintock unwirsch. »Wenn einer aus dem Markham-Clan mir hilft, reicht das schon. Danke, Miß Diana. Ich komme irgendwann darauf zurück. Und jetzt, Johnson…«
Er gab dem schweren Mann einen derartigen Stoß, daß der bis an den Tisch von Sturgis segelte und dort hinschlug. Aus dem Schlafhaus nebenan kamen Doc Hallstroem, der Mineraloge, den McLintock zu führen hatte, samt den drei Begleitern hereingestürmt. Auch Bills Mannschaft drängte sich vollzählig an der Tür.
McLintock ging zu Stevenson, zog dem das Messer aus dem Arm und sah den Mann durchbohrend an. Aus Stevensons Wunde sickerte nun das Blut.
»Eines Tages bezahlst du vielleicht, Stevenson«, sagte Chess McLintock düster. »Es war Mord, und du weißt es genau. Ein Mord für hundertsechzig lumpige Dollar an einem alten Mann.«
Er wandte sich ab, ging zu Diana Markham und gab ihr das Messer mit dem Heft voran zurück.
»Du großer Gott, McLintock«, seufzte Doc Hallstroem, »der Mann ist tot. Sie haben ihn so einfach erschossen? Was ist das für ein Land?«
»Ein wildes«, erwiderte McLintock achselzuckend. »Es wird aber einmal ein friedliches Land sein, Doc. Ehe ich’s vergesse – um sechs Uhr brechen wir auf.«
Er warf der blassen Diana einen flüchtigen Blick zu, und es kam ihr vor, als lächelte Chess.
»Und noch eins«, sagte der Unheimliche, und das Flimmern war wieder in seinen Augen, »McLintock vergißt nie etwas, Sie werden es sehen.«
Dann ging er zur Tür. Sein kühler Blick streifte den hereinstürmenden George Coldrey, und da Chess wußte, daß überall dort, wo es kein Gesetz gab, die Armee für Recht und Ordnung zu sorgen hatte, sagte er mürrisch:
»Ich bin draußen am Stall, Sir, sollten Sie Fragen haben. Vergessen Sie’s nicht, Doc: sechs Uhr!«
Er verschwand und ließ eine Welle des Schweigens zurück. Diana aber hielt das blutige Messer in der Hand, und sie fragte sich, ob sie McLintock wiedersehen würde, wenn die Wagen an den Tortilla Mountains vorbei in Richtung Phoenix rollten. Dort wollte Doc Hallstroem im Auftrag der Regierung nach Bodenschätzen suchen. Vielleicht begegnete sie McLintock in jener Gegend. Vielleicht aber sah sie ihn nie wieder…
*
Der Knall war so trocken, daß Diana sofort das Pferd herumriß und zum ersten Wagen blickte. Es war das typische Geräusch, das ein platzender Radreifen verursacht. Diana hatte es schon ein paarmal gehört. Zumeist war das Rad dann heil geblieben, wenn der Boden nicht zu schroff oder felsig gewesen war. »Dad!«
Was dann geschah, kam ihr wie ein Alptraum vor. Ehe sie ihre Stute nur halb herumbringen konnte, wußte sie bereits, was passieren würde. Das Gelände hier am Pinaleno Stripe, wo der Weg die Ausläufer der Pinaleno
Mountains schnitt, war wie ein Waschbrett mit kurzen Wellen aus hartem Gestein. Diana sah, wie der Reifen zusammen mit dem aufplatzenden Federring von der Felge sprang. Nägel flogen umher, dann fiel die Felge in die nächste Wellenrinne und zerbrach. Der Wagen sackte nach rechts ab, Old Bill Markham rutschte vom Bock und stieß einen Schrei aus.
Sofort trieb Butch Dale, der nächste Fahrer, seine Pferde an. Lieutenant
George Coldrey jagte – er hatte die Eskorte geteilt und ritt an ihrer Spitze zurück, während der dritte Wagen mit Pete Carson links neben Bills Wagen rollte. Gleichzeitig traf auch Diana neben dem Gefährt ein, sprang ab und blieb dann wie gelähmt stehen.
Ihr Vater war ganz bleich geworden. Und es machte sie stutzig, daß er sich nicht wieder erhob. Es sprach für seine Selbstbeherrschung, daß er nur die Lider zusammenkniff und die Lippen aufeinanderpreßte. Entsetzt sah Diana die abgesplitterte Spitze einer Radspeiche an seiner rechten Leiste aus seinem Schenkel ragen. Die speerähnliche Spitze hatte den Stoff seiner derben Hose mühelos durchstoßen, und die Stelle färbte sich dunkelrot.
»Du großer Gott, Dad!« schrie Diana auf. »Dad, steh auf!«
»Erst können«, sagte er zähneknirschend. »Das verfluchte Biest sitzt in der Radnabe, und ich sitze darauf. Zum Teufel, steht nicht herum, hebt den Wagen an! Ihr müßt die Nabe abziehen. Daß mir das passieren mußte. Irgendwann erzählte mir mal jemand von einem ähnlichen Vorfall, aber der Mann, den es erwischte, fiel mit der Brust durch eine Speiche und war tot. Sieht aus, als hätte ich noch Glück gehabt.«
»O Gott, o Gott«, stöhnte Diana »Dad, hast du Schmerzen?«
»Jetzt weiß ich, wie es ist, wenn einem ein Pfahl im Fleisch steckt«, sagte er mit grimmigem Humor. »Es ist nichts, was ich nicht aushalten könnte, denke ich. Pete, Butch, hebt ihn vorsichtig an. Ich werde versuchen, auf die Beine zu kommen.«
George Coldrey sah besorgt seinen zukünftigen Schwiegervater an. Er dachte an den Staub und Dreck, der wie Pech und Schwefel an jeder Speiche zu kleben pflegte. Sich vorzustellen, wie dick die Speiche dort war, wo sie in die Nabe überging, wagte Coldrey erst gar nicht. Das Loch, das der Alte im Oberschenkel hatte – es führte von seinem Gesäß aus schräg nach vorn –, war sicher so groß, daß man drei Finger hineinstecken konnte.
»Mr. Markham«, brachte George Coldrey stockend hervor, »es sind noch fünfzehn Meilen bis Fort Grant und zum Doc. Nach allem, was ich von Wunden verstehe, müßte die Speiche vorher heraus und die Wunde ausbluten.«
»Ich weiß, daß Sie an Wundbrand denken«, sagte Old Bill und verzog das Gesicht. »Keine Sorge, Mr. Coldrey. Mit Wunden hatte ich etwas früher als Sie zu tun. Hoch mit dem verdammten Wagen!«
Bill hatte George Coldrey noch nie anders als mit Mister oder First Lieutenant angesprochen. Er blieb die nächsten fünf Minuten stumm, und nur er wußte, was er in dieser Zeit aushielt, bis der Wagen hochgebockt war, so daß er waagerecht stehen konnte. Danach lösten sie die Radmutter, und er blickte seine um ihn versammelten Männer kurz an.
»Die Handsäge!« befahl er scharf. »Ich ziehe jetzt, indem ich das verdammte Nabenstück festhalte, die Nabe langsam ab. Butch, geht die Speiche nicht heraus, schneidest du sie an der Nabe ab, verstanden? Dann bleibt sie im Bein sitzen, egal, was die Folgen sein werden. Jack, bring Verbandszeug her und halte ein Messer
bereit, mir die Hose aufzutrennen, falls die Speiche herausgeht! Butch, du wirst versuchen, wenn ich auf dem Bauch liege, das verdammte Ding samt Nabe herauszuziehen. Also, fangt schon an.«
Sie wußten, daß er ungeheuer hart war, aber es gehörte doch mehr als Härte dazu, sich so von der Achswelle zu schieben, daß die Nabe sich nicht kantete und die Speiche in der Wunde drehte. Sie konnten nun sehen, daß die Speiche in sein Gesäß eingedrungen war, und der junge Price, der schon bleich war, taumelte hinter den Wagen, um sich zu übergeben.
Der Alte schob sich langsam vor. Er mußte es in gebückter Haltung tun, und sie hörten, wie seine Zähne aufeinandermahlten, ehe er die Nabe vom Wellenende herunter hatte.
»Dad, was soll ich nur tun?« fragte Diana. »Was…«
»Dreh dich um und sieh weg!« sagte er barsch. Er kroch wie eine Schildkröte, indem er sich immer tiefer bückte, über den Boden, bis er lag. Butch war bleich bis in die Lippen, als er nach der Nabe griff.
»Zieh mit einem Ruck, Junge!«
»Ja, Boß«, ächzte Butch Dale. Er riß die Speiche heraus, während Blut nachdrang. »Jack, los!«
Erst als die Speiche heraus war, verdrehte Old Bill die Augen und fiel flach hin. Der Schmerz kam mit solcher Gewalt, daß er die Besinnung verlor.
»Laßt es bluten!« sagte Jack Norris. »Der Dreck muß raus. Sieht aus, als hätte es keine Ader erwischt. Mann, was für ein Loch!«
Diana konnte nicht anders, sie stieg zitternd auf den Wagen, nahm die Gallonenflasche Whisky herunter, trank einen Schluck und schüttelte sich, während sie die Flasche Pete Carson reichte.
»Gebt ihm etwas davon, wenn er verbunden ist«, flüsterte Diana. »Laßt mich sehen.«
»Miß Diana!« stieß Butch hervor. »Das ist kein Anblick für Sie.«
»Zum Teufel, ich bin seine Tochter«, fuhr sie ihn an. Der Whisky tat seine Wirkung. »Butch, jetzt muß ich führen, denn er wird liegen müssen und sicher vor zwei Wochen kaum sitzen können, wenn es nicht ärger kommt. Wie sieht es aus?«
Ihr wurde es fast schlecht, doch sie nahm sich eisern zusammen, ließ zwei handtellergroße Lappen falten und preßte sie auf jedes Loch. Dann verband sie ihren Vater, der auch ohne Whisky erwachte, stöhnte und sich verwirrt umsah.
»So schwach war ich früher nicht«, stellte er verbittert fest. »Tochter, ab zum Fort und zum Doc. Und dann gibst du die Befehle. Seit achtundvierzig Jahren fahre ich jetzt schon und nun so etwas, ich fasse es nicht. Gebt mir mal die Flasche und einen Becher. Hier hat jeder, glaube ich, einen Schluck nötig. Price, Junge, da siehst du mal, was einem alles passieren kann. Man schaukelt niemals dösend durch die Gegend, merke dir das! Na, nun macht mir ein Lager auf dem Wagen und dann zum Fort!«
Vom Wagen bekommt ihn niemand. dachte Diana, er wird auf dem Bauch liegen und die ganze Reise mitmachen, aber wenn er Fieber bekommt, bleibt er im Fort.
Sie hatte keine Ahnung, daß die Armee seit 24 Stunden niemanden mehr nach Westen fahren ließ, weil eine Horde Apachen aus der Reservation ausgebrochen war. Die Rothäute hatten die Stagecoach nach Tucson überfallen und waren verschwunden. Ehe die Armee sie nicht hatte, mußte alles im Fort bleiben. Dort war jemand, der Diana Markham unheimlich erschienen war. Außerdem aber saß die gesamte Mannschaft von Lloyd Sturgis in Fort Grant fest. Noch ahnte Diana nicht, was auf sie zukam. Es sollten Dinge sein, die ihr Leben völlig veränderten.
*
Diese Nacht war so lau, das Gras raschelte unter ihr, und seine Hand glitt zwischen die Knöpfe der Bluse. In der Dunkelheit wirkte Georges Gesicht wie ein Fleck, sein offener Mund wie ein dunkles Etwas, das sich ihren Lippen näherte. Dann umschloß seine Hand ihre linke Brust und drückte sie. Diana genoß den wohligen Schauer zwar, aber irgend etwas war anders als sonst.
»Wenn jemand kommt«, flüsterte sie unruhig. »George, hier könnte…«
»Ach was.«
Es war so still hier draußen vor Fort Grant am Heuschuppen, der bis unter das Dach gefüllt war. Aus der Ferne drang der Ruf eines Wachtpostens zu ihr herüber, Kommandos erschallten, vermischten sich mit dem Gelächter aus Owen Millands Handelsstation und dem Saloon. Der laue Nachtwind trug diese Geräusche an ihre Ohren.
Einen Moment dachte Diana an ihren Vater, an die schreckliche Wunde, die der Doc behandelt hatte, ehe er mit einer Schwadron zur Apachensuche davongeritten war. Old Bill lag nun schon seit drei Tagen auf seinem Wagen. Gott sei Dank hatte er kein Fieber bekommen, aber sie konnten nicht weiter, die Armee ließ sie nicht fahren.
»Komm«, keuchte George. Er zog Diana hoch, wollte sie auf die Anne nehmen und zum Heu tragen. »Nun komm doch, was hast du denn?«
»Es ist so still geworden im Saloon, George«, raunte Diana. »Es ist nichts mehr zu hören.«
Das verdammte Gefühl war plötzlich wieder in ihr, dieses bedrückende Etwas, das sie immer gespürt hatte, bevor es Ärger gegeben hatte.
»Na und? Ich bitte dich, sie können doch nicht ewig im Saloon lachen und…«
Und dann wehte ein Schrei durch die Flucht zum Heuschuppen herüber.
»Werft sie hinaus, die verdammten Markham-Burschen!«
Du großer Geist, dachte Diana und riß sich von George los. Der Rausch war verflogen. Das ist es, ich habe es gewußt. Sturgis und unsere Leute – es konnte nicht gutgehen. Gerechter, jetzt ist es passiert.
»Diana, was willst du denn? Diana, warte…«
Im Saloon schien die Hölle ihre Pforten geöffnet zu haben. Männer brüllten, Frauen kreischten, Girls – das sah sie, als sie um den Schuppen rannte und die Bluse schloß – flohen aus dem Saloon gleich davonflatternden Vögeln. Es waren die Mädchen, die zu einer Tanzgruppe gehörten und quer durch Arizona zu den Silberminen Nevadas gewollt hatten – hatten! Denn nun hingen sie hier genauso herum wie alle anderen Westwanderer.
Im Laufen sah Diana, wie sich auf Old Bills Wagen etwas bewegte. Er zog sich am Bock hoch, entdeckte sie und rief:
»Hilf mir herunter, Tochter!«
Sie war heran und rannte weiter.
»Bleib du oben, verdammt noch mal. Das ist doch nichts für einen kranken Mann. Bleibst du wohl auf dem Wagen!«
»Tochter, he!«
Ruf nur, dachte sie, du kommst doch nicht schnell genug herunter. Mein Gott, dort drüben ist der Teufel los.
In Millands Saloon krachte es, als bräche eine Wand zusammen. Dann flog jemand – sie war nur noch zehn Yards von der Tür und den Girls und einigen Soldaten entfernt, die sich vor dem Eingang rechts und links drängten – jemand aus der Tür.
Es war Walter Price, der Junge.
Er überschlug sich, landete auf dem Hintern, blieb sitzen, hob den Kopf, sah Diana grinsend an und streckte die Zunge heraus. Dann kippte er um.
Vielleicht hätte sie unter anderen Umständen gelacht, doch es gab diesmal nichts zum Lachen. Im Saloon übertönte Johnsons Stimme das Gebrüll aus zwanzig, dreißig Kehlen:
»Hinaus mit dem Packzeug, werft es vor die Tür!«
»Diana – Diana!«
Da ist George, dachte sie. Du hältst mich nicht zurück. Ich bin der Boß meiner Männer, ich kämpfe mit.
Und dann stürmte sie in den Saloon.
*
Erst als sie fiel und am Boden lag, sah sie den zerbrochenen Stuhl. Irgend jemand war ihr in die Quere gekommen, hatte sie umgerissen. Der Mann richtete sich schwankend auf. Es war einer aus der Sturgis-Horde, und er glotzte sie so lange an, bis sie nach dem Vorderstollen des zerbrochenen Stuhls griff. Das Ding lag so handgerecht vor ihr, daß sie es kurz entschlossen packte, ausholte und als Keule benutzte.
»Ouuh, der rothaarige Drachen…«
»Drachen?« fauchte Diana. »Dir werde ich’s zeigen!«
Sie schlug dem Kerl das Stuhlbein auf den Kopf. Er verdrehte die Augen und kippte um. Erstaunt betrachtete sie einen Augenblick das Stuhlbein. Wie denn, ein Hieb hat genügt, den Mann auf die Bretter zu legen?
Vor ihr wälzten sich Pete Carson und Jack Norris, ihre Männer, am Boden. Norris kroch unter der Traube von Sturgis-Burschen hervor, doch einer der Kerle entdeckte ihn und umklammerte seinen Hals, wollte ihn mit dem Kopf auf die Dielen drücken. In dem Wirrwarr rollender Leiber, schwingender Arme und fliegender Fäuste kämpfte jeder gegen jeden.
»Hört auf, hört auf!« schrie Owen Milland. Der dicke Glatzkopf lugte wie ein Seehund mit Schnauzbart über den Tresen. Sein Fettleib befand sich in Deckung, und sein Kopf verschwand, sobald etwas geflogen kam. »Schlagt euch doch draußen, Leute!«
Nicht mal die Posaunen von Jericho hätten die Tobenden daran gehindert, nun erst richtig loszulegen. Sie hatten hier tagelang untätig herumgelungert, über Langeweile geklagt und sich über die Armee geärgert, die sie stur festhielt. Die Prügelei war wie eine Befreiung für alle.
Irgendwie kam Diana an zwei, drei kämpfenden Burschen vorbei, die gar nichts mit dem Streit zwischen den beiden Frachtwagenmannschaften zu tun hatten. Dann erreichte sie die Traube, die über Jack und Pete klebte. Der Kerl, der Jack am Hals hatte, sah sich, als ihm das Stuhlbein auf den Kopf donnerte, augenrollend um. Dann erwischte ihn der zweite Hieb. Er ließ Jacks Hals los, blieb liegen, doch schon waren wieder zwei Hände da. Eine erwischte Jacks linkes Ohr, die andere dessen lange Haare.
Herr im Himmel, Sturgis hat seine ganze Mannschaft hier, dachte Diana entsetzt. Die ist doppelt so stark und wird meine Leute hinauswerfen.
Sie schwang das Stuhlbein, knallte es dem Burschen, der Jack die Haare ausreißen wollte, über den Oberarm. Er ließ los, drehte sich um, wollte sie anspringen, erkannte, daß er keinen Mann vor sich hatte und erstarrte. In derselben Sekunde ließ sie ihre »Keule« auf seinen Kopf sausen.
Diana wütete wie eine Furie und bekam Pete und Jack frei. Dafür kamen andere, bis sie jemand an den Beinen packte und niederriß. Ein anderer schrie hinter ihr, daß ihr die Trommelfelle schmerzten: »Werft das verdammte Weib hinaus!«
Clement Johnson war plötzlich bei ihr, riß sie hoch, preßte ihr die Arme an den Körper und wollte sie, die strampelnd freizukommen suchte, zur Tür tragen. An der Tür stand, die Augen aufgesperrt und nichts als Verwunderung und Unglauben im Blick, Lieutenant George Coldrey. Obwohl er sah, daß Johnson sie umklammert hatte, unternahm er nichts, um ihr zu helfen. Statt dessen wandte er sich an den Sergeant an seiner Seite, hinter dem sich ein halbes Dutzend Soldaten drängte. Es mußte die Wache vom Tor des Forts sein.
»Sergeant, schaffen Sie Ruhe und Ordnung!«
Er rührte doch tatsächlich keinen Finger für Diana. Es war unter seiner Würde, sich an einer Prügelei zu beteiligen oder sich ins Gewühl zu stürzen und sie aus dem Klammergriff Johnsons zu befreien.
»Johnson!« – sagte jemand irgendwo hinter Diana. »He, laß deine schmutzigen Finger von ihr!«
Im gleichen Moment ließ Johnson sie fallen. Diana erinnerte sich, daß sie Chess McLintock zwei Tage zuvor gesehen hatte, als er mit einer Armeepatrouille in Richtung Camp Thomas geritten war. Er mußte wohl vorhin, als sie am Heuschuppen den Hufschlag und die Kommandos am Tor gehört hatte, zurückgekehrt sein.
Diana stürzte zu Boden, und dann sah sie McLintock. Er war über und über mit Staub bedeckt. Sein langer, kräftiger Arm schoß über Johnsons linke Schulter hinweg und preßte sich wie eine Klammer um Johnsons Hals. Der Mann ächzte und stöhnte, bekam kaum noch Luft. Verzweifelt trat Johnson nach hinten aus, doch da drehte sich McLintock auch schon mit ihm. Seine Rechte riß ihn am Hosenbund vom Boden hoch. Er drehte sich immer schneller, und beim größten Schwung ließ er den Riesen los.
Clement Johnson, der allein mit fünf, sechs der Markham-Fahrer fertig geworden war, flog wie eine abgefeuerte Riesenpuppe der Tür und dem Lieutenant entgegen. Er streifte zuerst den Sergeant, riß drei Männer von den Beinen, rammte schließlich Coldrey, und der Eingang war plötzlich frei. Die Schwingtürflügel pendelten hin und her.
»McLintock, hinter Ihnen!«
Es war Rudger, einer aus der Sturgis-Mannschaft, der McLintock von hinten ansprang. Chess bückte sich so blitzartig, daß Rudger über ihn hinwegschoß und lang hinschlug. McLintock umfaßte einen Stiefel des Mannes und knurrte:
»Nur zur Wand, Lady, gleich lernt er fliegen!«
Wie er es schaffte, Rudger nach einer Drehung zielgenau aus der Tür zu feuern, blieb ihr ein Rätsel. Sie nahm das Stuhlbein auf, und während sie losstürmte, um Pete und Jack zu helfen, hörte sie McLintocks tiefes, wildes Lachen.
»Kämpft, kämpft!« rief Diana mit ihrer hellen Stimme durch das Gebrüll. »Wir schaffen es, werft Sturgis’ Burschen vor die Tür! Butch, her zu mir, wir werfen sie hinaus!«
Aus den Augenwinkeln sah sie, wie McLintock losrannte, den Kopf senkte und mitten durch einen Pulk Männer brach. Dann erkannte sie, welches Ziel er sich gesetzt hatte. Lloyd Sturgis hatte Marshall, einen ihrer Fahrer, zu Boden geworfen, hockte auf ihm und bearbeitete ihn mit den Fäusten.
»Ah«, zischelte McLintock, als er hinter Sturgis auf die Beine kam, »dich wollte ich schon immer haben.«
Er packte ihn am Kragen, wollte ihn herumwirbeln, doch da war Diana schon heran.
»Nicht, nicht, McLintock, der gehört mir!«
Sturgis sah das Stuhlbein, und während er zappelnd freikommen wollte, lachte McLintock schallend, als Diana ausholte und zuschlug.
Keine Sekunde später peitschte der erste Schuß durch den Saloon, dem zwei weitere folgten. An der Tür, die Uniform beschmutzt und an der linken Wange einen Dreckfleck, stand George, den rauchenden Colt in der Faust. Das Krachen der Schüsse schaffte Ruhe. Diana wirbelte mit dem Stuhlbein in der Rechten herum. Links, wo sich einige Soldaten mit irgendwelchen Zivilisten geprügelt hatten, sprangen die Kavalleristen auf.
Sie blickten wie gelähmt zur Tür. Dort war Lieutenant Coldrey zur Seite getreten, und zur Tür kam nun, die Lider wie immer zusammengekniffen, das hagere Gesicht zur Maske erstarrt, Colonel Frederick Coldrey herein.
Der große, schlanke und immer etwas steif wirkende Kommandant von Fort Grant und Befehlshaber des Armeebereichs Südostarizona blieb vor einigen am Boden hockenden Männern stehen. Sein Blick flog zu seinen Kavalleristen, während die gesamte Fortwache mit aufgepflanzten Bajonetten in zwei Reihen links und rechts von ihm Aufstellung nahm.
Dann musterte Coldrey Diana mit unbeweglichem Gesicht, aber in seinen Augen glomm es düster, als McLintock Sturgis freigab. Coldrey fixierte das Stuhlbein, dann betrachtete er die Schwellung an Sturgis’ Kopf. Sturgis war an McLintocks Beinen herabgerutscht und saß auf dessen Stiefelspitzen.
»Mr. Milland!« fauchte Coldrey. »Die Region steht unter Kriegsrecht, und Sie dulden hier eine Prügelei – unter Kriegsrecht? Lieutenant der Wache!«
Der angesprochene Offizier, kaum älter als dreiundzwanzig Jahre, salutierte mit hochrotem Kopf neben seinem Colonel.
»Sir?«
»Stellen Sie fest, wer angefangen hat, Lieutenant! Wer immer es ist, er wird mit hundert Dollar Strafe belegt. – Mr. Milland, Ihr Saloon bleibt eine Woche geschlossen. Unmöglich, unmöglich!«
Der Kommandant drehte sich um und warf Diana dabei einen vernichtenden Blick zu.
»First Lieutenant, folgen!«
Das war alles, was er seinem Sohn zuzischte, als er aus dem Saloon stampfte. An das verhängte Kriegsrecht und das damit verbundene Verbot von Zusammenrottungen jeder Art hatte niemand gedacht.
Unmöglich, unmöglich.
Diana begriff nun, wen und was er damit gemeint hatte. In seinen Augen bin ich also unmöglich. Nun, und was wird George jetzt zu hören bekommen?
Es sollte nicht lange dauern, bis sie es erfuhr.
*
Um die Nase herum, so kam es ihr vor, war er immer noch blaß, der First Lieutenant George Coldrey. Und in den Augen hatte er so etwas wie ein Flackern, als er nun neben ihr herging und die Scheune mit dem Heu hinter ihnen zurückblieb.
Eine Stunde war er bei seinem Vater gewesen, während Diana ihren Vater beruhigt hatte, der die Welt und alle verdammten Radnaben und Speichen in die Hölle verdammt hatte. Neun Männer waren angeschlagen, dreien die Augen geschwollen, wie der Alte fluchend festgestellt hatte. Was tat es, daß nicht sie, sondern die Sturgis-Burschen den Krach begonnen hatten und Sturgis zahlen mußte. Mit zerschlagenen Männern fahren – welche Aussicht, verdammt noch mal!
Da war der Schweigsame wieder gewesen, Chess McLintock, nachdem sich der Saloon geleert und die Wachsoldaten ihn einfach vernagelt hatten. Geschlossen auf Befehl des Kommandanten – Mahlzeit!
Wo sollten die Leute nun ihren Whisky trinken, wo ihr Bier, wo mit den Girls schäkern?
McLintock hatte dagestanden und gelächelt und wieder dieses seltsame Flimmern in seinen hellen Augen gehabt.
›Schon gut, Lady, das war doch nichts, oder? Hat mächtig Spaß gemacht‹.
Er hatte sie stehenlassen und war davongeglitten, dieser Halbwilde. Und dann hatte sie auf George gewartet, dem sein Vater eine Standpauke gehalten hatte.
Nun ging sie neben ihm her und schwieg, weil er auch nichts sagte. Das Schweigen schien ihm auf die Nerven zu gehen.
»Was hast du dir bloß gedacht?« platzte er endlich heraus. »Eine Frau schlägt doch nicht mit einem Stuhlbein auf Männer ein. Weißt du überhaupt, wie viele von Sturgis’ Leuten du niedergeschlagen hast? Genau sieben!«
»Was, mehr nicht?« entfuhr es Diana lächelnd. »Kam mir vor, als hätte ich ein Dutzend erwischt.«
»Und da lachst du noch?« empörte George sich. »Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Jeder weiß, daß wir uns verloben wollen. Hast du denn keine Sekunde an mich gedacht?«
»An dich?«
Diana blieb stehen und sah ihn groß an. Er begriff gar nichts.
»Hör mal«, gab sie ihm wütend zu verstehen. »Wenn jemand meine Mannschaft angreift, dann greift er mich an.«
»Dich?« fragte George ungläubig. »Du bist eine Frau.«
»Na und? Als Boß einer Frachtwagenmannschaft habe ich meine Pflicht zu tun – auch als Frau. Ich habe meinen Männern beizustehen, wenn sie angegriffen werden. Kapierst du das nicht?«
»Du bist unmöglich«, sagte George. »Was meinst du, wie die Geschichte die Runde macht? Jeder Offizier in jedem Fort wird sie hören und sich später sagen – augenzwinkernd, verstehst du? Aha, das ist also Mrs. Coldrey. Seht euch vor, sie schlägt mit einem Stuhlbein zu, wenn ihr sie reizt. Eine Mrs. Coldrey kann es sich nicht erlauben, wie eine – eine Saloonlady mit einem Holz auf Männerköpfe einzuschlagen. Gott, welche Blamage! Der Colonel ist außer sich.«
Diana war plötzlich ganz ruhig geworden. Kälte breitete sich in ihr aus.
»So«, sagte sie. »Der Colonel ist außer sich? Hat er den Vergleich mit der Saloonlady gebraucht?«
»Nun, nun…«, stotterte George.
»Er hat also«, stellte sie fest. Sie blieb ganz kühl, hatte sich absolut in der Gewalt. »Wahrscheinlich hat er dir gesagt, daß sich die zukünftige Mrs. Coldrey so nicht zu benehmen hätte, daß ich nicht verleugnen könne, unter Männern aufgewachsen zu sein, daß ich nicht zu dir passe, oder? Hat er das gesagt?«
»Nun, weißt du, so direkt…«
»Das ist aber seine Meinung, oder?« fuhr sie fort. »Ich bin untragbar für die ehrenwerte Familie der Coldreys. Nach dieser Sache mußt du dir zehnmal reiflich überlegen, ob ich es wert bin, von dir als Frau auserkoren zu werden, stimmt’s? Georgie, wir passen wirklich nicht zusammen. Ich gehöre nicht in euren Kreis von eingebildeten und bornierten Affen. Ich bin nur die Tochter eines Fuhrmannes, wie? Georgie Coldrey, weißt du, was du dem ehrenwerten Colonel nachher sagen kannst, weißt du das?«
»Bitte, Diana, so sehe ich die Dinge…«
»Du siehst sie genauso!« zischelte sie. »Und weil du sie so siehst und ihr eine besondere Sorte Mensch seid, kannst du deinem Colonel sagen, daß ich mir zu gut bin, unter solchen eingebildeten Affen zu leben. So schön bist du nun auch nicht. Als Zivilist würde es bei deinem Colonel nicht mal zu dem reichen, was mein Vater geworden ist. Ich bin, wie ich bin. Und ich bin verdammt stolz darauf, die Tochter eines einfachen Frachtwagenmannes zu sein. Und jetzt scher dich zum Teufel, Georgie Coldrey. Zum Teufel mit dir und deiner Familie aus dressierten Zinnsoldaten. Ich habe die Nase voll von dir und euch allen. Von deiner Sorte könnte ich zehn haben.«
»Was? Wie redest du denn über meine Familie?«
»Nicht anders, als ihr über meine redet«, erwiderte sie zornbebend. »Es ist aus, Georgie, ich will einen Mann und keinen Affen. Geh nur, wir sind fertig miteinander!«
»Ich bin ein…«
»Ja, das bist du!« fuhr sie ihn fuchs-teufelswild an. »Und ich bin mir zu schade, an deiner Seite in irgendeinem Fort unter irgendwelchen Narren leben zu müssen, die sich wie Marionetten benehmen. Ich will tun können, was mir paßt. Und ich will niemals das aufgeben, was mein Vater in dreißig Jahren aufgebaut hat. Das kannst du deinem sehr ehrenwerten Colonel sagen. Und jetzt… Weißt du, was du mich kannst?«
George war derart verdutzt, daß er sich nicht von der Stelle rührte, als sie ihn stehenließ und davonging. Erst hinter dem Heuschuppen sah sie sich um, doch da stand er immer noch am selben Fleck, und wahrscheinlich schien er es immer noch nicht zu begreifen.
Als sie auflachend den Kopf wandte, jähe Erleichterung verspürte, weil sie sicher war, die einzig richtige Entscheidung getroffen zu haben, sah sie die Gestalt an der Scheune stehen.
Diana lachte nicht mehr, ihre Lippen preßten sich zusammen. Dort stand Chess McLintock, jener Mann, der sich immer im Schatten aufzuhalten schien; der immer dort war, wo man ihn nicht vermutete. Er mußte jedes Wort gehört haben.
»Zum Teufel!« entfuhr es Diana. »Zum Teufel mit allen Männern!«
Dann lief sie davon und hielt erst am Wagen an. Die Laterne brannte unter der Plane. Old Bill lag auf dem Bauch, den Kneifer auf der Nase und ein Buch vor sich. Er hob den Kopf und sah sie an. Er erkannte den Zorn in ihren Augen und wußte, daß sie mit Georgie, der sie abgeholt hatte, davongegangen war.
Als er den Kneifer umständlich abnahm und zwinkerte, verspürte Diana den Drang, zu ihm zu steigen und sich wie früher als Kind an ihn schmiegen zu müssen.