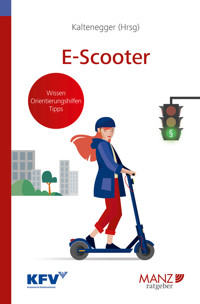
E-Scooter E-Book
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MANZ Verlag Wien
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Manz Ratgeber
- Sprache: Deutsch
E-Scooter stehen wie kein anderes Fortbewegungsmittel für eine sich wandelnde Mobilitätskultur. Gleichzeitig stellt uns der Aufstieg der E-Scooter vor neue Herausforderungen und verlangt eine Einbettung in das bestehende Rechts- und Mobilitätssystem.
Ein breit gefächertes Autor:innenteam beleuchtet in diesem Ratgeber die Bereiche Rechtliche Grundlagen und Verkehrsregeln, Fahrzeugtechnik, (Verkehrs-)Sicherheit, Versicherungen sowie Shared E-Scooter-Systeme.
Auf häufige Stolperfallen und typische Gefahren wird hingewiesen und es werden häufig gestellte Fragen beantwortet, wie etwa:
- Welche Verkehrsregeln gelten für E-Scooter?
- Welche Alkoholgrenzen gelten?
- Darf ich zu zweit auf dem E-Scooter fahren?
- Wo darf ich parken, wo nicht?
- Was gilt es beim Ausleihen eines E-Scooters zu beachten?
- Was sind die häufigsten Unfallursachen?
- Wie kann ich das Risiko eines Akkubrandes minimieren?
- Wie sichere ich den E-Scooter gegen Diebstahl?
Mit zahlreichen Praxistipps sowie Entscheidungshilfen zu den Themen Kaufen und Leihen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
MANZ RATGEBER
E-Scooter
E-Scooter
herausgegeben von
Dr. Armin Kaltenegger
Zitiervorschlag:Autorinnen, [Titel], in Kaltenegger (Hrsg), E-Scooter (2024) [Seite]
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Sämtliche Angaben in diesem Ratgeber erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr; eine Haftung der Autorinnen, des Herausgebers, der Redakteurin sowie des Verlages ist ausgeschlossen.
In diesem Ratgeber wurde zur besseren Lesbarkeit darauf verzichtet, weibliche und männliche Personenbezeichnungen gleichzeitig zu verwenden. Stattdessen wird das generische Femininum verwendet. Die verwendeten personenbezogenen Ausdrücke umfassen alle Geschlechter gleichermaßen.
ISBN 978-3-214-25660-9
ISBN E-Book 978-3-214-25662-3
© 2024 MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, Wien Telefon: (01) 531 61-0
E-Mail: [email protected]
www.manz.at
Covernachweis: © Nicolas Aznarez
Grafiknachweis: © Mela Diamant
Fotonachweise Abbildungen: Seiten 37, 47, 55, 87: Claudia Riccabona-Zecha, Seite 60: Georgi Mesalev, Seite 96: Florian Supe, Seite 9: Martin Potocnik, Seite 68: Markus Huber, Seiten 33, 96, 98: Magdalena Leithner Fotonachweise Autorinnenfotos: Armin Kaltenegger (© KFV); Magdalena Leithner (© Elisabeth Mandl); Claudia Riccabona-Zecha (© Privat); Ernestine Mayer (© KFV/Michael Sabotha); Birgit Salamon (© KFV/Michael Sabotha); Martin Potocnik (© Privat); Florian Supe (© AustriaTech/Huger); Andrea Stickler (© AustriaTech/Huger); Maria Althuber-Griesmayr (© VVO/K. Patzak); Ida Kapetanovic (© Privat); Druck: FINIDR, s.r.o., Český Těšín
Vorwort
Die Mobilität verändert sich. Vor allem in den ständig wachsenden urbanen Ballungsräumen. Treiber für diesen Wandel sind u.a. Dekarbonisierung, Digitalisierung, Sharing-Trends, sich verändernde gesellschaftliche Werte und völlig neue Interpretationen der Work-Life-Balance. Die Mikromobilität mit Protagonistinnen wie Scooter, E-Scooter, Segways, Hoverboards, Mono-Wheels und vielen anderen Fahrzeugen und fahrzeugähnlichen Fortbewegungsmitteln hat längst Fuß gefasst in der modernen Mobilitätsvielfalt. Der E-Scooter als der Shooting-Star dieser Geräte verdient hier aber besondere Aufmerksamkeit. Er beschäftigt gleichermaßen Nutzerinnen, Herstellerinnen, private Unternehmen und die öffentliche Verwaltung. Das vorliegende Buch wendet sich an alle diese Partnerinnen im System, soll ein gemeinsames Verständnis schaffen und alle Aspekte der gelebten Praxis erläutern und mit hilfreichen Tipps ergänzen, mit dem Ziel, die Vorteile dieser Mobilitätsform optimal zu erschließen und die Nachteile tunlichst zu vermeiden.
Sicher ist Ihnen bereits aufgefallen, dass dieses Buch in rein weiblicher Form geschrieben ist. Das ist weder eine feministische Kampfansage noch eine soziologisch notwendige Ableitung. Es ist ein lesbares Zeichen für Veränderungen, denn auch das Buch handelt von Veränderungen. Genießen Sie die kleinen semantischen Überraschungen und inversen Formulierungen, die zwar ungewohnt, aber letztlich inhaltlich ident eine bunte Welt der Bewegungen beschreiben.
Wien, Jänner 2024
Dr. Armin Kaltenegger
Autorinnen
Dr. Claudia Riccabona-Zecha, Kuratorium für Verkehrssicherheit (Abteilung Recht und Normen), Innsbruck
Mag. (FH) Ernestine Mayer, Kuratorium für Verkehrssicherheit (Abteilung Verkehrssicherheit), Wien
Mag. Birgit Salamon, BA, Kuratorium für Verkehrssicherheit (Abteilung Recht und Normen), Wien
Martin Potocnik, BSc, TÜV Austria Automotive GmbH (Abteilung Engineering & Expert Services), Wien
Florian Supe, BA BA MA MA, AustriaTech (Team Innovating Mobility), Wien
DI Dr. Andrea Stickler, MA, AustriaTech (Team Innovating Mobility), Wien
Mag. Maria Althuber-Griesmayr, Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO), Wien
Dr. Ida Kapetanovic, Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO), Wien
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Autorinnen
Fortbewegungsmittel E-Scooter
I. Navigieren durch die E-Scooter-Welt
II. Was ist ein E-Scooter?
A. Der Name und seine Bedeutung
B. Der E-Scooter in der Straßenverkehrsordnung (StVO)
C. Kein E-Scooter
D. Abgrenzungskriterium: Höchste zulässige Leistung versus Nenndauerleistung
E. Micro-Scooter, Tritt- und Tretroller, Segways, Mopeds
III. Wie ist ein E-Scooter aufgebaut?
A. Merkmale und wichtige Funktionen
B. Bremsanlage
C. Akku
D. Räder und Reifen
E. Fahrwerk
Sicher unterwegs mit dem E-Scooter
I. Ein schneller Überblick: Rechte und Pflichten für E-Scooter-Fahrerinnen
II. Welche rechtlichen Anforderungen muss ein E-Scooter erfüllen?
A. Wie stark und schnell darf ein E-Scooter sein?
B. Wie muss ein straßentauglicher E-Scooter ausgestattet sein?
C. Wann gelten Kennzeichen- oder Führerscheinpflicht?
III. Welche Verkehrs- und Verhaltensregeln sind beim Fahren mit dem E-Scooter zu beachten?
A. Grundsatz: Anwendung der für Radfahrerinnen geltenden Verhaltensregeln
B. Gibt es körperliche Einschränkungen, die das Lenken eines E-Scooters verhindern?
C. Wie alt muss ich sein, um mit dem E-Scooter zu fahren?
D. Ist eine besondere Ausbildung erforderlich, um E-Scooter zu fahren?
E. Muss ich einen Helm tragen?
F. Ist die Handynutzung gestattet? Darf ich beim Fahren Musik hören und Kopfhörer tragen?
G. Alkohollimit: Welche Promillegrenze gilt? Was gilt für Drogen am Steuer? Mit welchen Konsequenzen muss ich rechnen?
H. Wo und wie schnell darf ich mit dem E-Scooter fahren?
I. Wichtige und neuere Verkehrszeichen
J. Wie verhalte ich mich richtig an Kreuzungen?
K. Darf ich neben einem anderen E-Scooter fahren?
L. Darf ich an einem Bus oder einer Straßenbahn in der Haltestelle vorbeifahren?
M. Kann ich mich an angehaltenen Fahrzeugen vorbeischlängeln?
N. Warum muss ich beim Vorbeifahren an haltenden und parkenden Fahrzeugen auf den Abstand achten?
O. Überholen von E-Scooter-Fahrerinnen
P. Darf ich Gegenstände transportieren?
Q. Zu zweit auf dem E-Scooter?
R. Wo und wie darf ich meinen E-Scooter abstellen (parken)?
S. Welche Verhaltensweisen sind sonst noch ausdrücklich verboten?
T. Wie verhalte ich mich richtig bei einem Unfall?
U. Sind E-Scooter in Öffentlichen Verkehrsmitteln und Bahnhöfen erlaubt?
V. Welche Regeln gelten für E-Scooter in anderen Staaten?
IV. Praktische Anleitungen für sicheres Fahren und Handling
A. Vor der ersten Fahrt im Straßenverkehr
B. Die Bedienung: Starten, Anfahren, Ausschalten
C. Fahrdynamik von E-Scootern
D. Bremstechnik
E. Akku: Handhabung, Brandgefahren
F. Komme ich auch ans Ziel?
G. Absperren von E-Scootern
H. Wartung, Pflege, Instandhaltung, Reinigung
I. Kann man E-Scooter auch bei Kälte, Schnee und Eis nutzen?
J. Mögliches Zubehör
K. Sicherheitstipps für jede Fahrt
V. Faktoren bei der Kaufentscheidung
A. Orientierungshilfen
B. Akku und Reichweite
C. Größe, Gewicht und Traglast
D. Transport
E. Fahrkomfort
F. Bedienungsfreundlichkeit
G. Anbauteile und Zubehör
H. E-Scooter-Import
I. Steuerliche Vergünstigungen für E-Scooter .
VI. Aktuelle Situation hinsichtlich E-Scooter-Unfällen in Österreich
A. Überblick Unfallzahlen
B. Unfallgegner und Unfallort
C. Hauptunfallursachen
D. Verletzungen von E-Scooter-Fahrerinnen
Versicherung beim Einsatz von E-Scootern
Chancen und Risiken von geteilten E-Scootern im Öffentlichen Straßenverkehr
I. Einleitung
II. Nutzen statt Besitzen: E-Scooter als geteilte Mobilitätsform
A. Aktuelle Entwicklungen in Österreich
B. Übersicht über Angebote
C. Schritt für Schritt: So leiht man sich einen E-Scooter aus
D. Verhaltensregeln & Vertragsstrafen
III. Die Perspektive der Nutzerinnen
A. Optimale Zielgruppen und Routen für E-Scooter-Sharing
B. Kostenvergleich
C. Bedeutung von Kenntnissen, Training und Altersbeschränkungen
D. Entscheidungshilfe: Kaufen oder Leihen?
IV. Aktuelle Herausforderungen geteilter E-Scooter aus Sicht von Gemeinden und Anbieterinnen
A. Sicht der Städte und Gemeinden
B. Parkverhalten & Barrierefreiheit
C. Sicht der Anbieterinnen
D. Ökoeffekte
E. Sicherheit
F. Mobilitätschancen und Inklusion
V. Resümee und Ausblick
Weiterführende Informationen
I. Weblinks
II. Spezialliteratur
III. Auszüge relevanter Rechtsquellen
A. Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO)
1. BGBl. 1960/159 i.d.F. BGBl. I 2023/129
B. Kraftfahrgesetz 1967 (KFG)
1. BGBl. 1967/267 i.d.F. BGBl. I 2023/129
C. Verordnung des Magistrats der Stadt Wien betreffend stationslose elektrisch betriebene Klein- und Miniroller und stationslose Mietfahrräder
1. W500/400/2023-4
D. Verordnung (EU) 2013/168 über die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen
E. UN-ECE-Regelung Nr. 85
F. Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung Deutschland
Abkürzungsverzeichnis
Autorinnenteam
Stichwortverzeichnis
Fortbewegungsmittel E-Scooter
Claudia Riccabona-ZechaErnestine MayerBirgit SalamonMartin Potocnik
I. Navigieren durch die E-Scooter-Welt
Im Getümmel unserer pulsierenden Städte und Gemeinden hat sich eine kleine Revolution vollzogen, die sowohl das urbane als auch das ländliche Verkehrsbild stark beeinflusst: der Aufstieg der E-Scooter. Diese kompakten, elektrisch angetriebenen Roller sind nicht nur ein bequemes Mittel der Fortbewegung, sondern auch ein Ausdruck unserer sich wandelnden Mobilitätskultur. In dieser Umwälzung, die oft von einem Gefühl der Freiheit begleitet wird, gibt es jedoch mehr zu bedenken als nur den Wind in den Haaren und die Einfachheit der Fortbewegung.
Um das volle Potenzial dieser Mobilitätsform zu erschließen, ist es wichtig, nicht nur die technischen Aspekte zu verstehen, sondern auch die Verkehrsregeln zu beherrschen sowie sonstige rechtliche Aspekte und Hintergründe zu kennen, darunter auch Unfallstatistiken und den Trend des E-Scooter-Sharings.
Ziel dieses Ratgebers ist es, Ihnen die notwendigen Informationen in die Hand zu geben, damit Sie nicht nur die Vorzüge des E-Scooter-Fahrens genießen können, sondern auch verantwortungsbewusst und sicher unterwegs sind. Bereit für eine aufschlussreiche Fahrt durch die folgenden Kapitel?
II. Was ist ein E-Scooter?
A. Der Name und seine Bedeutung
E-Scooter dienen hauptsächlich als effizientes Verkehrsmittel für die schnelle und unkomplizierte Beförderung einer (auf dem Trittbrett stehenden) Person. Sie sind leicht, kompakt und einfach zu handhaben und besonders beliebt für die Kurzstreckenmobilität. Der Begriff „erste/letzte Meile“ („first/last mile“) wird oft verwendet, um den Einsatz von E-Scootern für die Verbindung vom Wohnort zum nächsten Bahnhof oder vom Parkplatz nach Hause zu beschreiben, wenn es vor der Haustür keine Parkmöglichkeit gibt.
B. Der E-Scooter in der Straßenverkehrsordnung (StVO)
Rechtsgrundlage: § 88b Abs. 1 StVO, § 2 Abs. 1 Z. 19 StVO
Judikatur: VwGH Ra 2022/02/0043 (E-Scooter ist ein Fahrzeug)
Abbildung 1: Symbolfoto E-Scooter (Quelle: deutsches Verkehrsschild: E-Scooter frei)
Wie werden E-Scooter rechtlich eingestuft, und welche Regeln gelten für ihre Nutzung auf Straßen mit öffentlichem Verkehr?
Die StVO definiert E-Scooter als Klein- und Miniroller mit elektrischem Antrieb
mit einer höchstzulässigen Leistung von nicht mehr als 600 Watt und
einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h.
Darüber hinaus haben E-Scooter folgende äußere Gestaltung aufzuweisen:
keine Sitzvorrichtung,
jedoch eine Lenkstange,
ein Trittbrett sowie
kleine Räder, nämlich mit einem äußeren Felgendurchmesser von höchstens 300 mm.
Die Fahrerinnen von E-Scootern, die die obgenannten Voraussetzungen erfüllen, lenken – wie der Verwaltungsgerichtshof 2022 ausgelegt hat – Fahrzeuge (i.S.d. § 2 Abs. 1 Z. 19 StVO) und haben (gemäß § 88b Abs. 2 StVO) die Verhaltensvorschriften der Radfahrerinnen zu beachten. Gleichzeitig sind E-Scooter jedoch keine Fahrräder und unterliegen nicht den Ausrüstungsbestimmungen der Fahrradverordnung. Es ist typisch für das neue Auftreten von Trendgeräten, dass zunächst passende rechtliche Rahmenbedingungen gefunden werden müssen; dies ging auch beim E-Scooter bereits mit einer Adaptierung seitens der Gesetzgeberin einher, begleitet von Zweifeln und kontroversen Diskussionen in der Rechtsprechung und einschlägigen Literatur sowie Unstimmigkeiten in der Vollzugspraxis.
In Deutschland sind E-Scooter als „Elektrokleinstfahrzeuge“ Kraftfahrzeuge mit elektrischem Antrieb und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h; sie dürfen eine Nenndauerleistung von bis zu 500 Watt aufweisen. Ein E-Scooter darf zudem max. 70 cm breit, 140 cm hoch sowie 2m lang sein. Das erlaubte Maximalgewicht eines E-Scooters ist auf 55 kg begrenzt. Details sind der deutschen Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung zu entnehmen.
In der Schweiz sind sog. Elektrotrottinett(e) als Leicht-Motorfahrräder kategorisiert. Es handelt sich um Fahrzeuge mit höchstens 500 Watt Motorleistung (i.S.d. Nenndauerleistung) und einer Höchstgeschwindigkeit bis 20 km/h.
C. Kein E-Scooter
Rechtsgrundlage: insb. § 88b Abs. 1 StVO, § 2 Z. 1 und Z. 37a KFG
Judikatur: VwGH Ro 2023/02/0010 (E-Scooter über 25 km/h Bauartgeschwindigkeit ist Kfz), LVwG Tirol-2022/23/0215-8 (getunter E-Scooter ist Sonder-Kfz gemäß § 3 Abs 1 Z. 3.2. KFG)
Unter welchen Umständen wird ein E-Scooter rechtlich nicht mehr als E-Scooter betrachtet? Was hat dies für rechtliche Konsequenzen?
Werden die genannten Leistungs- (höchstzulässige Leistung: 600 Watt) und Geschwindigkeitsschwellen (Bauartgeschwindigkeit: 25 km/h) überschritten, so handelt es sich nicht mehr um einen E-Scooter im Sinne der StVO. Mit der Begründung, dass in diesem Fall weder ein Ausnahmetatbestand des KFG noch die Definition des Fahrrades (gemäß § 2 Abs. 1 Z. 22 StVO i.V.m. § 1 Abs. 2a KFG) erfüllt sind, stuft der Verwaltungsgerichtshof – nachvollziehbar auch im Hinblick auf das erhöhte Gefährdungspotenzial – derartige Fahrzeuge als Kraftfahrzeuge i.S.d. § 2 Z. 1 KFG ein.
Hinweis
Für Kraftfahrzeuge gelten andere Regelungen als für E-Scooter nach der StVO, bspw. eine strengere Promillegrenze von 0,5 Promille, Benützungsverbote für Fußgängerflächen und Radfahranlagen, Zulassungs-, Haftpflichtversicherungs- und Kennzeichenpflichten nach dem Kraftfahrgesetz sowie eine Mitführungspflicht von Verbandzeug etc. Anzumerken ist, dass E-Scooter, die die festgelegten Grenzen überschreiten, aktuell wahrscheinlich gar nicht genehmigungs- bzw. zulassungsfähig sind.
D. Abgrenzungskriterium: Höchste zulässige Leistung versus Nenndauerleistung
Rechtsgrundlage: § 88b Abs. 1 StVO, § 2 Abs. 1 Z. 19 und Z. 22 StVO, § 1 Abs. 2a KFG (i.d.F. 41. KFG-Nov.), ErläutRV 1954 BlgNR 27. GP (2023), S. 1, Erlass BMVIT-179.345/0003-II/ST4/2009, Art. 2 Abs. 2 lit. h und Art. 3 Z. 35 VO (EU) 2013/168, UN-ECE-Regelung Nr. 85
Eine Änderung im Kraftfahrgesetz im Jahr 2023 hinsichtlich der Leistungsabgrenzung zu Kraftfahrzeugen bei Fahrrädern hat die soeben gefundene Kategorisierung von E-Scootern erneut in Frage gestellt.
Gilt für E-Scooter weiterhin die höchste zulässige Leistung von 600 Watt (StVO) als Leistungsgrenze oder ist nunmehr die Nenndauerleistung von max. 250 Watt (KFG) wie bei elektrisch angetriebenen Fahrrädern zu beachten?
Für elektrisch angetriebene Fahrräder stellt das Kraftfahrgesetz (KFG) bei der Abgrenzung Fahrzeug – Kraftfahrzeug neuerdings – aufgrund einer Harmonisierung mit den EU-Vorschriften für die Fahrzeugtypisierung hinsichtlich der Definition von Pedelecs (Elektrofahrräder mit Tretunterstützung) – nicht mehr wie bisher auf die „höchste zulässige Leistung“, sondern auf die „Nenndauerleistung“ ab und hat diese wiederum mit 250 Watt limitiert. Diese Neuformulierung löste verständlicherweise Rechtsunsicherheit und Diskussionen aus, welches Leistungskriterium nun für den E-Scooter herangezogen werden solle.
Hinweis
Die Begriffe „höchste zulässige Leistung“ (auch „Peak-Leistung“ genannt) und „Nenndauerleistung“ (auch „30-Minuten-Leistung“ genannt) sind sehr ähnlich, resultieren aber aus zwei unterschiedlichen Messmethoden. Während bei ersterer die tatsächlich kurzfristig maximal mögliche Leistung am Motor gemessen wird, definiert die Nenndauerleistung einen Durchschnittswert bei der Motorleistungsmessung in einem Dauerbetrieb von 30 Minuten, ohne dass der Motor überhitzt, und ist damit in der Regel deutlich geringer als die maximale Motorleistung.
In den Erläuterungen zur 41. KFG-Novelle wurde – wohlgemerkt im Hinblick auf elektrisch angetriebene Fahrräder – davon ausgegangen, dass bei Fahrzeugen mit einer Nenndauerleistung von nicht mehr als 250 Watt die am Hinterrad (Antriebsrad) abgegebene Leistung nicht mehr als 600 Watt beträgt und diese Gesetzesänderung somit keine Auswirkung habe. Umgekehrt ist der Schluss zulässig, dass Fahrzeuge mit einer höchst zulässigen Leistung von nicht mehr als 600 Watt unter diese Ausnahme fallen (zumindest solange keine Nenndauerleistung von mehr als 250 Watt für ein solches Fahrzeug angegeben ist).
Händlerinnen weisen darauf hin, dass E-Scooter aufgrund des unterschiedlichen Antriebssystems, deutlich kleineren Rädern und dem Fehlen von Tretunterstützung nicht mit Elektrofahrrädern vergleichbar seien. E-Scooter mit einer sehr geringen Leistung würden im Alltag nur eingeschränkt verwendbar sein (z.B. in Steigungen, beim Anfahren/zur Beschleunigung). Eine derartige Limitierung würde beinahe alle in Verkauf und Einsatz befindlichen E-Scooter, darunter auch jene der Leihanbieterinnen ausschließen. Der Vergleich mit Deutschland und der Schweiz verdeutlicht, dass in diesen beiden Nachbarstaaten eine Nenndauerleistung von 500 Watt vorgesehen ist, was dem doppelten Wert entspricht.
So gesehen erscheint es treffend, dass die österreichische Gesetzgeberin für E-Scooter eine Sonderregelung normiert, indem sie diese nicht als Fahrräder definiert, gleichzeitig eine unterschiedliche Ausrüstung vorschreibt und zudem am Kriterium der höchsten zulässigen Leistung von 600 Watt festhält (so in § 88b StVO als vorrangige lex specialis). Bekanntlich sind die Begriffsbestimmungen der StVO auch bei der Auslegung des KFG zu beachten und umgekehrt.
Im Übrigen können in der Praxis diese Leistungskriterien behördlicherseits bis dato kaum überprüft werden; schlussendlich bringen oft auch Angaben der Herstellerinnen nicht die nötige Klarheit.
Tipp
Häufig ist bereits beim Kauf des Produkts gar nicht ersichtlich, um welche der beiden Leistungsangaben es sich handelt; es gibt auch keine „verpflichtenden“ Angaben am E-Scooter oder in der Betriebsanleitung. In der Regel handelt es sich jedoch um die Angabe der Nenndauerleistung bzw. um Konformitätsangaben zur deutschen Rechtslage durch deutsche Herstellerinnen oder Händlerinnen. In derWerbung ist es hingegen – ohne nähere Bezeichnung – attraktiver, die Maximalleistung mit dem höheren Wert anzugeben. Daher empfiehlt es sich, zur Klarstellung vor dem Kauf jedenfalls die Herstellerin oder die Händlerin zu kontaktieren. Eine Feststellung der tatsächlichen Leistung ist nur durch spezielle Messgeräte möglich.
In Anbetracht all dieser Aspekte wäre es angebracht, dass sämtliche privaten und öffentlichen Beteiligten betreffend E-Scooter – im Gegensatz zu Elektrofahrrädern – weiterhin das Kriterium der höchsten zulässigen Leistung von 600 Watt gemäß StVO heranziehen.
Nichtsdestotrotz kann hier eine endgültige Klarstellung nur durch die Gesetzgeberin oder eine höchstgerichtliche Abklärung erfolgen, so z.B., ob es sich unter Umständen nachteilig auf die Haftung (Mitverschulden) für Schäden oder Verletzungen auswirken könnte, wenn mit einem E-Scooter, dessen Nenndauerleistung über 250 Watt beträgt, ein Unfall verursacht wird.
E. Micro-Scooter, Tritt- und Tretroller, Segways, Mopeds
Es gibt zahlreiche andere Fortbewegungsmittel, die in eine andere Kategorie als E-Scooter fallen – so z.B.:
Micro-Scooter sind muskelkraftbetriebene, zweirädrige Mini- und Kleinroller ohne Sitzvorrichtung, mit Lenkstange, Trittbrett und einem äußeren Felgendurchmesser von höchstens 300 mm. Sie werden rechtlich als fahrzeugähnliche Spielzeuge bzw. als für außerhalb der Fahrbahn bestimmte Kleinfahrzeuge eingestuft. Es gelten somit ähnliche Verhaltensregeln wie für Fußgängerinnen. Das Mindestalter zum Alleinfahren beträgt acht Jahre.
Von Micro-Scootern zu unterscheiden sind Tritt- und Tretroller mit bodennahem Trittbrett, die im Gegensatz zu den kleinen, meist harten Reifen der Micro-Scooter im Allgemeinen größere Luftreifen besitzen. Derartige Roller sind rechtlich als Fahrräder eingestuft.
Bei einem Segway





























