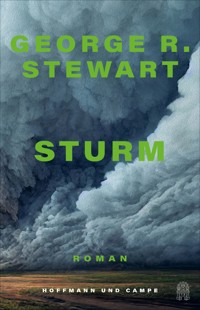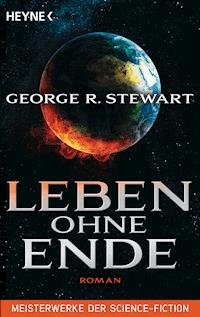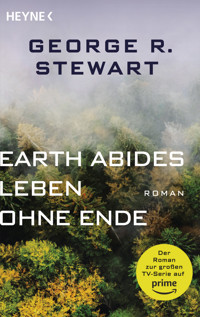
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Der Roman zum großen TV-Serienevent!
Ein rätselhaftes Virus greift um sich wie ein Steppenbrand und fordert weltweit Milliarden Todesopfer. Die Ordnung bricht zusammen, es gibt keine Regierungen, keine Kommunikation, keine Infrastruktur mehr. Nur ein Prozent der Weltbevölkerung überlebt die verheerende Seuche. Die Zivilisation wird ausgelöscht. Die Überlebenden, darunter der junge Student Isherwood Williams, müssen neue Wege des menschlichen Zusammenlebens suchen …
Der große Science-Fiction-Klassiker aus dem Jahr 1949 wird mit Alexander Ludwig (»Vikings«) in der Hauptrolle als TV-Serie verfilmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 694
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Wie ein Steppenbrand greift ein rätselhaftes Virus um sich und löscht in kürzester Zeit den größten Teil der Menschheit aus. Nur wenige überleben die Seuche, darunter der junge Student Isherwood Williams, Ish genannt. Er wandert durch die leeren Städte der USA – auf der Suche nach anderen Menschen, mit denen er die Zivilisation wieder aufbauen kann. Doch das Leben nach der Katastrophe geht zwar weiter, aber es ist nicht mehr dasselbe: Die Übriggebliebenen müssen völlig neue Formen des Zusammenlebens finden.
George R. Stewarts Earth Abides – Leben ohne Ende, erstmals 1949 erschienen, ist einer der großen Klassiker der Science-Fiction und einer der berühmtesten Romane in der Tradition der »Doomsday Novels«. Er zeigt auf eindrückliche Weise, wie nach dem Zusammenbruch unserer Zivilisation eine neue, andere Ordnung entsteht. 2024 wurde Earth Abides als große TV-Serie für MGM+ mit Alexander Ludwig in der Hauptrolle verfilmt.
Der Autor
George R. Stewart (1895–1980) studierte an der University of California und war dort viele Jahre als Professor für Englische Literatur tätig. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher, Romane ebenso wie Sachbücher, in denen er sich, lange vor dem Aufkommen der Umweltbewegung, insbesondere mit ökologischen Themen befasste. Earth Abides – Leben ohne Ende ist sein bedeutendster Roman und wurde 1951 mit dem International Fantasy Award ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung, die damals auf dem Gebiet der phantastischen Literatur vergeben wurde.
GEORGE R. STEWART
EARTH ABIDESLEBENOHNE ENDE
ROMAN
Mit einem Vorwort vonKim Stanley Robinson
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe EARTHABIDES erschienerstmals 1949 bei Random HouseAus dem Amerikanischen von Ernst SanderNeu durchgesehen und vollständig überarbeitet von Alexander Martin
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Dataminings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
1. Auflage 2025
Copyright © 1949 by George R. Stewart
Copyright des Vorworts © 2020/2025 by Kim Stanley Robinson
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München,unter Verwendung eines Motivs von Shutterstock.com(Bohdan Mahdych)
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-32952-5V001
www.heyne.de
Vorwort
von Kim Stanley Robinson
Dieser Roman, George R. Stewarts Meisterwerk, ist ambitioniert, vielschichtig, anmutig und weise. Er ist einer der bedeutendsten Romane jener Spielart der Science-Fiction, die man heute »postapokalyptisch« nennt (zu Stewarts Zeiten hätte man ihn wohl als Nach-dem-Untergang-Roman bezeichnet), und er hat einen festen Platz in der amerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Nach vielen Jahrzehnten wird Earth Abides – Leben ohne Ende immer noch gelesen und diskutiert, 2020, im Jahr der Pandemie, war das Buch sogar beliebter denn je, und eine Biografie über Stewart von Donald Scott hat Leben und Werk des Autors wieder ins Gespräch gebracht. Seine Zeit ist also gekommen.
Earth Abides wurde 1949 erstmals veröffentlicht. Es war nicht Stewarts erster Roman und zu dieser Zeit auch nicht sein einziges herausragendes Buch. Es war eher der Kulminationspunkt all seiner Interessen und Erfahrungen bis zu diesem Zeitpunkt seines Lebens. Der 1895 geborene Stewart studierte in Princeton, an der University of California in Berkeley und an der Columbia University. Von 1923 an lehrte er Englische Literatur in Berkeley und lebte oberhalb des Campus in den Berkeley Hills, ganz in der Nähe des Ortes, wo ein Großteil von Earth Abides spielt. Neben anderen Büchern, die für Earth Abides von Bedeutung sind, hatte er eine Trilogie – oder ein Triptychon – von Romanen geschrieben, in denen nicht menschliche Akteure im Mittelpunkt standen: Doctor‘s Oral (1939), Storm (1941) und Fire (1948). Das war ein kühner formaler Schritt, der dem literarischen Denken seiner Zeit weit voraus war, auch wenn er an die It-Narratives des 18. Jahrhunderts erinnerte.
Storm erzählt die Geschichte eines Pazifiksturms, der Kalifornien heimsucht. Stewart gibt dem Sturm die zentrale Rolle in dem Roman, beschreibt aber auch seine Auswirkungen auf das Land, die technische Infrastruktur, die Tiere und die Menschen – insbesondere die Menschen, die mit den Sturmschäden zu tun haben. Die Figuren sind meist nach ihren Funktionen benannt, wie »Junior-Meteorologe« oder »Ladungsdisponent«, was womöglich eine Anspielung auf ein ähnliches Vorgehen in H. G. Wells‘ The Time Machine war. Der Sinn dieser Namen-nach-Funktionen liegt auf der Hand: Auch wenn Individuen Rollen spielen, geht es in Storm um die Rollen, nicht um die Individuen. Der Sturm ist derjenige, der einen Namen hat (er lautet Maria – ein frühes Beispiel für die Praxis, großen Stürmen Namen zu geben), und die Schäden, die er anrichtet, zeigen, woraus die Zivilisation auf materieller Ebene besteht und was an menschlichen Anstrengungen nötig ist, um diese materielle Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Fire verfolgt eine ganz ähnliche narrative Strategie. Das gleichnamige Feuer, wie Stürme ein festes Merkmal des amerikanischen Westens, dient als Protagonist und Organisationsprinzip des Romans. Es hat etwas Skurriles, jedenfalls für mich und womöglich auch für Stewart, dass der dritte nicht menschliche Akteur – oder Prozess – in diesem Triptychon eine akademische Prüfung ist, wie er sie in Doctor‘s Oral beschreibt.
Und noch ein anderes Buch diente Stewart zur Vorbereitung auf Earth Abides: Man – An Autobiography von 1946. Auch das ein formales Experiment. Hier ist der Protagonist die menschliche Spezies in ihrer Gesamtheit, die erst von ihrer physischen und dann von ihrer kulturellen Evolution erzählt. Man – An Autobiography ähnelt Olaf Stapledons berühmten Zukunftsepen Last and First Men und Star Maker, nur dass Stewart die Vergangenheit der Menschheit in den Blick nimmt. Wie bei Stapledon liegt der Schwerpunkt auf der menschlichen Zivilisation, nicht auf den einzelnen Individuen. Ein solches Vorgehen lässt einen Text eher wie ein Prosagedicht oder wie einen spekulativen Essay erscheinen, nicht wie einen Roman im üblichen Sinne, aber der Roman ist eben eine ausgesprochen flexible und offene Form, die mit vielen Arten von Experimenten zurechtkommt.
Stewarts Hang zu erzählerischen Experimenten setzte sich in den Büchern fort, die er nach Earth Abides veröffentlichte. Sheep Rock (1951) fokussiert sich auf einen einzigen Ort. U.S. 40 (1953) folgt einer Linie quer über den Kontinent. Pickett‘s Charge (1959) konzentriert die Geschichte des Amerikanischen Bürgerkriegs in eine einzige Stunde dieses Krieges. Das Jugendbuch To California by Covered Wagon (1954) folgt wieder einer Linie, indem es von einer Begebenheit erzählt, auf die Stewart bei seinen historischen Recherchen gestoßen war: 1844 war ein junger Mann von seiner Reisegruppe zurückgelassen worden und musste allein in der Sierra Nevada überwintern. Sollte Stewart die Geschichte von Mose Schallenberger gekannt haben, bevor er Earth Abides schrieb, hat sie seinen Roman zweifellos beeinflusst. Der siebzehnjährige Schallenberger überlebte den harten Sierra-Winter in einer Blockhütte mit nicht viel mehr als einem Gewehr, Streichhölzern und einem Buch mit Gedichten von Lord Byron – was stark an Ishs Erlebnis am Anfang von Earth Abides erinnert.
Mit seinem späteren Buch Not So Rich as You Think von 1968 schließlich beteiligte sich Stewart an einer damals in Kalifornien lebhaft geführten umweltpolitischen Debatte und blieb gleichzeitig den Themen verbunden, die schon in Earth Abides eine große Rolle spielten. Der Ort beeinflusst den Menschen, das war eines seiner Credos, und es scheint mir unvermeidlich, dass er über die Projekte des Sierra Clubs, die Arbeit von David Brower und die Zeitungskolumnen und Radiofeatures von Kenneth Rexroth informiert war. Sie und viele andere kalifornische Intellektuelle jener Zeit prägten an der Westküste eine dezidiert ökologische Debattenkultur, die in vielerlei Hinsicht fortschrittlicher und weltlicher war als die literarische Kultur der Ostküste.
All das machte George R. Stewart zu einem Romanautor, dessen Interessen weit gefächert waren, der aber immer wieder zu einem Kernthema zurückkehrte: die Natur der Zivilisation – wie Individuen durch Gesellschaften geformt werden und wie sich diese Gesellschaften in ihre natürliche Umgebung einfügen. Wenn ein solcher Wechsel zu einer größeren Perspektive stattfindet, wird das Resultat oft als Science-Fiction verstanden und manchmal auch so bezeichnet, und da Stewart noch dazu die Angewohnheit hatte, allerlei wissenschaftliche Erkenntnisse aus Meteorologie, Ingenieurswissenschaft, Geschichte, Geografie und Anthropologie in seine Romane einfließen zu lassen, könnte man sagen, dass er sein Leben lang Science-Fiction schrieb. Ob er sich dabei des kommerziellen Genres Science-Fiction bewusst war, wie es in den 1930er- und 1940er-Jahren in den USA existierte, ist mir nicht bekannt, und Earth Abides selbst gibt auch keine Hinweise darauf. Aber das spielt keine Rolle. Künstlerinnen und Künstler erfinden die Science-Fiction immer wieder neu, um sie für ihre Zwecke zu nutzen, unabhängig davon, ob sie sich des Genres bewusst sind. Wenn man über Geschichte nachdenkt, wandern die Gedanken in einer Art Was-wäre-wenn-Spekulation unvermeidlich in die Zukunft, wo sich die Science-Fiction als literarischer Raum öffnet. Und wenn es darum geht, die Beziehung zwischen Mensch und Planet Erde zu erörtern, wird die Science-Fiction sogar zum notwendigen Genre.
Earth Abides war für Stewart ein weiteres formales Experiment. Diesmal siedelte er die Geschichte in der Zukunft an, und in dieser Zukunft durchläuft die menschliche Zivilisation eine Art Crashtest. Der Roman ist Stewarts Meisterwerk, weil es ihm die Science-Fiction ermöglichte, seine Interessen und Anliegen mit einem ikonischen und zeitlosen Szenario zu verbinden: die Beinahe-Auslöschung der Menschheit. Der Untergang. Dieses Szenario erinnert an die biblische Geschichte von der Vertreibung Adams und Evas aus dem Garten Eden, und tatsächlich gibt es heute wissenschaftliche Beweise dafür, dass die Menschheit vor etwa siebzigtausend Jahren als Spezies fast ausgerottet wurde, vermutlich infolge eines Vulkanausbruchs, der einen jahrzehntelangen planetaren Winter verursachte. Zu jener Zeit lebten womöglich nur noch etwa zweitausend Menschen auf der Erde, und die Erinnerungen daran könnten sich bis heute in unseren Mythen erhalten haben. Mary Shelleys The Last Man von 1826 ist einer der bekanntesten Romane dieser Art, und in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war es naheliegend, dass man sich dem Thema wieder zuwandte. Damals war das typische Mittel zur Auslöschung der Zivilisation ein weltweiter Atomkrieg; indem er sich für eine Pandemie entschied, beschwor Stewart eine Gefahr herauf, die der atomaren Bedrohung weit vorausging – und sie vermutlich auch überdauern wird.
Vielleicht weil es für Stewart in Earth Abides das Experiment war, die Geschichte in der Zukunft anzusiedeln und den größten Teil der menschlichen Spezies sterben zu lassen, war die Wahl der Hauptfigur für ihn ungewöhnlich konventionell. Der Roman konzentriert sich auf einen Protagonisten, hinzu kommt eine Ansammlung recht typischer Nebenfiguren. Das heißt nicht, dass die Figuren konturlos sind. Isherwood Williams – Ish – mag eine Art Jedermann sein, aber sein Denken und seine Gefühle werden klar und eindringlich beschrieben. Er kann sich als Charakter behaupten, selbst wenn man ihn mit den Hauptfiguren in den Mainstream-Romanen der 1940er vergleicht, in denen es üblich war, ein singuläres Bewusstsein zu erforschen. Ishs Innenleben ist ganz und gar nachvollziehbar. Seine Angst, eine Person of Color zu heiraten, wirkt zwar aus heutiger Sicht antiquiert, aber sie entspricht der Kultur, in der er aufgewachsen ist, und ist ein Hinweis darauf, wie sehr er sich verändern muss. Seine Trauer über den Verlust eines Kindes ist absolut glaubwürdig (und erinnert an Ralph Waldo Emersons Verlust eines Sohnes in einem ähnlichen Alter). Und sein geistiger Verfall wird auf sehr berührende Weise vermittelt.
In dieser Frage – wie man eine Figur zum Leben erweckt – erinnert Stewart stark an Daniel Defoe. Die beiden Schriftsteller haben auch sonst viel gemeinsam: eine umfassende Bildung, das Interesse an der Funktionsweise von Gesellschaften und einen klaren, anschaulichen Stil. Defoe schrieb 1704 sogar ein Buch mit dem Titel The Storm, in dem ein Wirbelsturm im Mittelpunkt steht, der ein Jahr zuvor England heimgesucht hatte. Man kann davon ausgehen, dass Stewart als Professor für Englische Literatur mit Defoes Werk vertraut war. Bücher wie Robinson Crusoe (1719) und Journal of the Plague Year (1722) könnten ihn bei der Konzeption seiner Science-Fiction-Geschichte über Seuche, Einsamkeit, Überleben und Erneuerung inspiriert haben. Und so wie Defoe eine Krise im Gefühlsleben von Crusoe, Moll Flanders oder Roxana beschreibt, macht Stewart dasselbe mit Ish. Den Titel des Romans und das Epigraph nahm er aus dem Buch Kohelet, und sein Stil hat etwas von der Einfachheit und Eloquenz der King-James-Bibel. Die Form passt perfekt zum Inhalt, und vor dem Hintergrund des Themas hat Stewarts Stil den Test der Zeit außerordentlich gut bestanden.
Wenn wir Earth Abides heute lesen, denken wir natürlich an die Covid-19-Pandemie. Schon zu Stewarts Zeiten war eine solche Art von globaler Epidemie eine denkbare Möglichkeit, wie gleich zu Beginn des Buches deutlich wird. Der nukleare Untergang wurde in der amerikanischen Nachkriegsliteratur zwar häufiger thematisiert, aber Romane wie Nevil Shutes On the Beach (1957), Pat Franks Alas, Babylon (1959) oder Walter M. Millers A Canticle for Leibowitz (1959) kamen alle nach Earth Abides. Stewarts Roman fügt den Warnungen vor dem Ende der Welt also schon sehr früh einen ökologischen Aspekt hinzu. Er erinnert uns daran, dass wir Menschen Teil eines Netzwerks aus lebendigen (oder halb lebendigen) Geschöpfen sind – ein Netzwerk, das wir so weit aus dem Gleichgewicht bringen können, dass uns andere Teile davon auf verheerende Weise attackieren. Diese Botschaft ist im 21. Jahrhundert relevanter denn je.
Einige Passagen gegen Ende von Earth Abides beeindrucken mich besonders. An einem seiner emotionalen Tiefpunkte heißt es über Ish: »Zeit verging, und er vermochte, klarer zu denken, und erkannte mehr und mehr die Ironie in all diesen Dingen. Gegen was man sich auch immer wappnete – es geschah nie. Alle noch so guten Pläne konnten nicht dem Unheil vorbeugen, für das keine Pläne gemacht worden waren.« Das ist eine zeitlose Wahrheit.
Später, als er aus der Trübheit des hohen Alters heraus jüngere Menschen wahrnimmt, bemerkt Ish: »Obwohl sich die Sprache selbst gar nicht oder nur wenig veränderte, veränderten sich die Vorstellungen der Menschen. Vielleicht unterschieden sie jetzt nicht mehr so deutlich zwischen Lust und Schmerz, wie es die Menschen im Zeitalter der Zivilisation getan hatten. Vielleicht waren auch andere Unterschiede verblasst.« Das erinnert an Raymond Williams‘ Konzept der »Gefühlsstrukturen« einer Kultur: soziale Arrangements, die unsere grundlegenden Emotionen in verschiedenen Formen und zu verschiedenen Zeiten organisieren und definieren. Williams beschrieb das Konzept in den 1960er-Jahren – Stewart dachte lange vorher in diesen Kategorien. Hier, wie auch in der Beschreibung der Entwicklung staatlicher Macht aus früheren Formen und der Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Gesetzen und der Etablierung von Religionen, war Stewart verblüffend hellsichtig.
Eine andere Veränderung in der Gefühlsstruktur der Menschheit wird in einer der allerletzten Szenen von Earth Abides beschrieben, fast beiläufig, aber doch seltsam bewegend. Die kleine Gruppe von Menschen, die Ish zu seiner letzten Ruhestätte begleitet, begegnet einem Berglöwen. Sie diskutieren, was sie machen sollen, und wählen dann eine alternative Route zu ihrem Ziel – als hätten sie es mit jemandem zu tun, der ihnen gleichwertig ist. Ein weiteres Beispiel dafür, dass Stewart seiner Zeit voraus war.
Und so ist dieses Buch noch immer sehr lebendig und wird es noch für lange Zeit sein. Ish selbst würde über diesen Gedanken vermutlich lachen, angesichts dessen, was er in der verlassenen Bibliothek in Berkeley, jenem Mausoleum für die menschliche Zivilisation und ihre Ideen, sieht und denkt. So wenig Literatur überlebt, selbst wenn die Zivilisation weitergeht, und noch viel weniger, wenn sie zusammenbricht. Und auch wenn die Literatur fortbesteht, was hat sie jenen zu sagen, die nach uns kommen? Wie werden die Menschen der Zukunft einen Text der Vergangenheit verstehen? Für Ish ist das ein existenzielles Thema, eine Art Kampf gegen die Verzweiflung, der auch für Stewart relevant war, schließlich schrieb er nach dem Schock und dem Trauma eines globalen Krieges. Die Zivilisation war gerade zerrissen worden, und es stellte sich die Frage, ob die Literatur Bestand haben würde und ob sie auf lange Frist überhaupt von Bedeutung sein würde.
Aber wir lesen heute immer noch Daniel Defoe, und wir lesen immer noch George R. Stewart. Im Pandemie-Jahr 2020 flogen die Exemplare von Earth Abides nur so aus den digitalen Regalen, und anlässlich der Verfilmung als TV-Serie erscheint der Roman gerade weltweit in etlichen neuen Ausgaben. Über siebzig Jahre nach seiner Erstveröffentlichung ist Earth Abides ein Klassiker geworden, ein Science-Fiction-Roman, der sich einen festen Platz im Kanon gesichert hat. Und wenn er neugierige Leserinnen und Leser zu Stewarts anderen Büchern führt, werden sie dafür reichlich belohnt. George R. Stewart war ein Geschichtsphilosoph des 20. Jahrhunderts wie Arnold Toynbee oder Fernand Braudel, und er fügte seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen das Vergnügen eines verdammt gut erzählten Romans hinzu. Genießen Sie ihn.
Der in Kalifornien lebende Kim Stanley Robinson ist einer der bedeutendsten Science-Fiction-Autoren der Gegenwart. Zuletzt ist von ihm bei Heyne der Roman »Das Ministerium für die Zukunft« erschienen.
Earth Abides Leben ohne Ende
»Ein Geschlecht geht und ein Geschlecht kommt, die Erde aber steht in Ewigkeit.«
Ecclesiastes 1:4
Erster Teil
DAS GROSSE UNHEIL
»Wenn plötzlich durch Mutation ein todbringender Virus-Typ entstehen sollte, könnte er infolge der schnellen Übertragungsmöglichkeiten, wie sie die heutige Zeit mit sich bringt, in die fernsten Winkel der Erde gelangen und den Tod von Millionen von Menschen verursachen.«
W. M. Stanley in: Chemical and Engineering News vom 22. Dezember 1947
1
… und die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika wird hiermit ihres Amtes enthoben. Ausgenommen ist der District of Columbia. Die Bundesbeamten, einschließlich derjenigen der bewaffneten Streitkräfte, unterstellen sich der Befehlsgewalt der einzelnen Staaten oder den noch amtierenden örtlichen Regierungs- und Verwaltungsstellen. Auf Anordnung des Regierenden Präsidenten. Gott schütze die Bevölkerung der Vereinigten Staaten …
Hier eine soeben vom Bay Area Emergency Council eingetroffene Nachricht: Das Lazarettlager West-Oakland wurde aufgegeben. Seine Funktionen, einschließlich der Seebestattungen, werden ab sofort vom Berkeley-Lager übernommen und durchgeführt. Das ist alles …
Lassen Sie diesen Sender eingeschaltet. Er ist der einzige noch in Betrieb befindliche im nördlichen Kalifornien. Wir werden Sie so lange wie möglich über die weitere Entwicklung informieren.
Gerade als er den Felsrand erklomm, hörte er ein plötzliches Rascheln und leises Klappern und spürte den scharfen Stich der Giftzähne. Mechanisch riss er die rechte Hand zurück; als er den Kopf wandte, erblickte er die Schlange, die zusammengerollt und drohend dalag. Sie war nur klein, stellte er im gleichen Augenblick fest, als er die Hand an die Lippen hob und heftig am unteren Teil des Zeigefingers sog, wo ein winziger Blutstropfen hervorquoll.
Nur keine Zeit mit dem Totschlagen der Schlange verlieren, dachte er.
Am Finger saugend, glitt er vom Felsen herunter. Unten sah er den Hammer an der Stelle, wo er ihn hingelegt hatte. Einen Moment lang dachte er, er könne ihn da liegen lassen und weitergehen. Doch das kam ihm übertrieben ängstlich vor; so hielt er inne, hob den Hammer mit der linken Hand auf und stieg dann den schmalen, holprigen Pfad hinab.
Er hastete nicht. Dabei kam nichts heraus. Hast beschleunigte lediglich den Herzschlag, und das Gift zirkulierte schneller. Aber sein Herz pochte so schnell, sei es der Aufregung wegen oder aus Angst, dass es, so meinte er, ganz gleich war, ob er schneller ging oder nicht. Als er bei einer Baumgruppe angelangt war, nahm er sein Taschentuch und knotete es sich um das rechte Handgelenk. Mit einem Stück Zweig drehte er das Tuch so fest, dass der Blutkreislauf gestaut wurde.
Im Weitergehen spürte er, wie Schock und Bestürzung von ihm wichen. Allmählich schlug sein Herz wieder langsamer. Und er empfand kaum Furcht. Er war jung, kräftig und gesund. So ein Biss war selten tödlich, auch wenn er allein war und keine richtigen Gegenmittel hatte.
Jetzt sah er die Hütte. Seine Hand fühlte sich steif an. Bevor er in die Hütte ging, blieb er stehen und lockerte den Knebel an seinem Handgelenk; er hatte irgendwo gelesen, dass man das tun solle, damit das Blut kurz zirkulieren könne. Dann drehte er ihn wieder fest.
Er stieß die Tür auf und ließ dabei den Hammer zu Boden fallen. Das Werkzeug landete mit dem Stiel nach oben auf dem schweren Ende, wackelte einen Augenblick und blieb dann stehen, den Stiel in der Luft.
Er sah in der Tischschublade nach und fand die Schlangenbiss-Ausrüstung, die er an diesem vertrackten Tag eigentlich hätte bei sich haben müssen. Schnell befolgte er die Gebrauchsanweisung – ritzte mit der Rasierklinge ein sauberes kleines Kreuz über die Bissstelle und setzte die Saugpumpe an. Dann legte er sich auf die Pritsche und sah zu, wie sich die Gummibirne langsam ausdehnte und das Blut aufsog.
Er hatte keine Angst. Die ganze Sache erschien ihm lediglich wie ein lästiger Zwischenfall. Ständig war ihm gesagt worden, er solle nicht ohne Begleitung in die Berge gehen – »und ja nicht ohne Hund!«, hatte man gewöhnlich hinzugefügt. Aber er hatte die Warner stets ausgelacht. Ein Hund machte einem unausgesetzt Schwierigkeiten und spürte Stachelschweinen oder Stinktieren nach; und außerdem machte er sich nichts aus Hunden, im Gegenteil. Nun würde es natürlich heißen: »Na ja, wir hatten Sie ja gewarnt.«
Im leichten Fieber warf er sich herum; ihm war, als baue er sich eine Verteidigungsrede zusammen. »Vielleicht«, so könnte er sagen, »hat mich gerade das Gefährliche dabei gelockt.« (Das klang ein bisschen nach Heldentum.) Es würde der Wahrheit allerdings näherkommen, wenn er sagte: »Ich bin eben manchmal gerne allein. Ich muss einfach ab und an dem Fragwürdigen den Rücken kehren, das der Umgang mit anderen Menschen mit sich bringt.« Aber natürlich würde es seine beste Verteidigung sein, wenn er einfach sagte, er sei, zumindest während des letzten Jahres, aus beruflichen Gründen allein in die Berge gegangen, schließlich war er Doktorand und schrieb an seiner Dissertation mit dem Titel »Die Ökologie der Black Creek Area«. Er erforschte die vergangenen und gegenwärtigen Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Menschen, Pflanzen und Tieren in diesem Gebiet; da war es doch klar, dass er nicht warten konnte, bis ihm ein geeigneter Kamerad über den Weg lief. Außerdem war es ihm nie in den Sinn gekommen, dass er sich irgendwie einer ernstlichen Gefahr aussetzte. Obwohl im Umkreis von fünf Meilen um seine Hütte kein Mensch wohnte, war während des Sommers kaum ein Tag vergangen, ohne dass ein Angler vorbeigekommen war, der in seinem Wagen die felsige Straße entlangfuhr oder einfach dem Bachlauf folgte.
Als ihm das einfiel, überlegte er, wann er eigentlich den letzten Angler gesehen hatte. Bestimmt nicht in der letzten Woche. Tatsächlich konnte er sich nicht erinnern, ob er während der beiden Wochen, die er allein in der Hütte verbracht hatte, überhaupt einen gesehen hatte. Eines Abends war nach Einbruch der Dunkelheit ein Wagen vorbeigefahren. Es war ihm seltsam vorgekommen, dass bei Dunkelheit ein Auto gerade diese Straße entlangfuhr; für gewöhnlich zelteten die Leute unten, ehe die Nacht hereinbrach, und kamen erst morgens herauf. Aber vielleicht, dachte er, hatten sie zu ihrem Lieblingsbach hinauffahren wollen, um bei Tagesanbruch zu fischen.
Nein, während der letzten beiden Wochen hatte er mit keiner Menschenseele ein Wort gewechselt. Er konnte sich nicht einmal erinnern, überhaupt jemanden gesehen zu haben.
Ein zuckender Schmerz machte ihm wieder bewusst, was gegenwärtig geschah. Die Hand begann zu schwellen. Er lockerte den Knebel, damit das Blut zirkulieren konnte.
Dann wandte er sich wieder seinen Gedanken zu – und ihm wurde bewusst, dass er ganz und gar von der Außenwelt abgeschnitten war. Er hatte kein Radio. Vielleicht hatte es einen Börsenkrach oder ein zweites Pearl Harbour gegeben; das hätte das Ausbleiben der Angler erklärt. Jedenfalls bestand allem Anschein nach nur eine geringe Aussicht, dass jemand kommen und ihm helfen würde. Er musste eben sehen, wie er auf eigene Faust zurechtkam.
Aber auch diese Aussicht beunruhigte ihn nicht sonderlich. Schlimmstenfalls, so dachte er, würde er mit einem Haufen Nahrungsmittel und Trinkwasser für zwei oder drei Tage hier oben in seiner Hütte liegen, bis die Schwellung zurückgegangen war und er in seinem Wagen hinunter zu Johnsons fahren konnte, der nächstgelegenen Ranch.
Der Nachmittag schleppte sich hin. Er hatte nicht den geringsten Appetit, als es Zeit zum Abendessen war, aber er bereitete sich auf dem Benzinkocher eine Kanne Kaffee und trank mehrere Tassen. Er hatte heftige Schmerzen; doch trotz der Schmerzen und trotz des Kaffees wurde er müde …
Plötzlich wachte er im Zwielicht auf und sah, dass jemand die Hüttentür aufgestoßen hatte. Er empfand Erleichterung – er hatte jetzt Hilfe. Zwei Männer in Stadtkleidung standen in der Tür, sehr anständig wirkende Männer, obwohl sie auf eine befremdliche Weise hierhin und dorthin starrten, als hätten sie vor irgendetwas Angst. »Ich bin krank«, sagte er auf seiner Pritsche, und dann sah er, wie sich die Furcht auf den Gesichtern der Männer in wildes Entsetzen verwandelte. Sie drehten sich abrupt um und rannten, ohne auch nur die Tür zu schließen, davon. Einen Augenblick später erklang das Geräusch eines anspringenden Motors. Es wurde schwächer und schwächer, als sich der Wagen auf der Straße entfernte.
Nun erschrak er zum ersten Mal, richtete sich auf der Pritsche auf und blickte aus dem Fenster. Das Auto war bereits hinter der Kurve verschwunden. Er begriff nichts von alldem. Warum waren die beiden so plötzlich weggelaufen, ohne ihm wenigstens ihre Hilfe anzubieten?
Er stand auf. Im Osten dämmerte es; er hatte also bis zum Morgen geschlafen. Seine rechte Hand war geschwollen und schmerzte stechend. Abgesehen davon fühlte er sich recht gut. Er wärmte den Kaffee auf, machte sich einen Haferbrei und legte sich wieder auf die Pritsche – in der Hoffnung, dass er sich früher oder später kräftig genug fühlen würde, um die Fahrt zu Johnsons wagen zu können. Aber natürlich nur dann, wenn in der Zwischenzeit niemand vorbeikommen, anhalten, ihm helfen und nicht wie die beiden anderen, die verrückt gewesen sein mussten, beim Anblick eines Kranken davonlaufen würde.
Bald jedoch fühlte er sich sehr viel schlechter. Offenbar eine Art Rückfall. Er lag auf der Pritsche und schrieb ein paar Zeilen – er meinte, einen kurzen Bericht über das Geschehene hinterlassen zu müssen. Vermutlich würde es nicht allzu lange dauern, bis ihn jemand fand; bestimmt würden seine Eltern in ein paar Tagen bei Johnsons anrufen, wenn sie nichts von ihm hörten. Er brachte es fertig, mit der linken Hand die Worte auf das Papier zu kritzeln, und unterschrieb lediglich mit Ish – es war zu beschwerlich, seinen ganzen Namen, Isherwood Williams, hinzuschreiben, und ohnehin kannte ihn jeder unter seinem Spitznamen.
Am Nachmittag fühlte er sich wie ein schiffbrüchiger Seemann, der von seinem Rettungsfloss aus einen Dampfer am Horizont entlanggleiten sieht: Er hörte die Geräusche von Autos – von zwei Autos, die die steile Straße hinauffuhren. Sie kamen näher, und dann fuhren sie vorüber, ohne anzuhalten. Er rief, aber er war geschwächt; seine Stimme reichte nicht bis zur Straßenbiegung, wo die Wagen vorbeifuhren.
Obwohl er sich nicht besser fühlte, stand er strauchelnd und taumelnd auf, ehe es dunkel wurde, und zündete die Kerosinlampe an. Er wollte nicht im Dunkeln liegen.
Den Kopf voll schlimmer Befürchtungen, beugte er seinen schmächtigen Körper und warf einen Blick in den kleinen Spiegel, der wegen dem schrägen Hüttendach unter der Höhe seiner Augen angebracht war. Sein längliches Gesicht war stets hager gewesen und kam ihm jetzt kaum hagerer vor, aber durch die Sonnenbräune seiner Backen glühte es rötlich. Seine großen blauen Augen waren blutunterlaufen und starrten ihn wild und fieberglänzend an. Sein immer wirres hellbraunes Haar stand ihm in allen Richtungen vom Kopf ab und vervollständigte das Bild eines schwerkranken jungen Mannes.
Er legte sich wieder auf die Pritsche. Obwohl er jetzt fast überzeugt war, dass er sterben müsse, empfand er nicht allzu viel Angst. Plötzlich überfiel ihn ein heftiger Schüttelfrost, dann glitt er ins Fieber hinein. Auf dem Tisch brannte die Lampe ruhig weiter, und der Hammer, den er zu Boden hatte fallen lassen, stand nach wie vor dort, mit dem Stiel nach oben, sicher ausbalanciert. Da er ihn die ganze Zeit vor Augen hatte, beanspruchte der Hammer einen ziemlich großen Teil seines Bewusstseins; es war, als würde er sein Testament machen, ein altmodisches Testament, in dem er genau das Hab und Gut beschrieb, das er hinterließ: »Ein Hammer, ein Single-Jack, Eisengewicht vier Pfund, Stiel ein Fuß lang, leicht angekratzt, etwas verwittert, der Hammerkopf leicht angerostet, aber noch verwendbar.« Es hatte ihn ziemlich gefreut, als er den Hammer gefunden hatte, dieses Verbindungsglied zur Vergangenheit. Ein Bergmann hatte ihn wohl in jenen vergangenen Zeiten benutzt, als man mit Hämmern Steinbohrer in niedrige Erdgänge getrieben hatte; vier Pfund waren ungefähr das Gewicht, das ein einzelner Mann auf solche Weise handhaben konnte, und das Werkzeug wurde Single-Jack genannt, weil es nur mit einer Hand geschwungen wurde. Im Fieber dachte er, dass er seiner Dissertation vielleicht ein Bild des Hammers beifügen sollte.
Die meisten dieser umdunkelten Stunden verbrachte er in einer Art leichtem Albtraum. Husten plagte ihn, manchmal glaubte er zu ersticken. Es überkam ihn Schüttelfrost, und dann glühte er wieder im Fieber. Ein hellroter Ausschlag, wie Masern, begann sich zu zeigen.
Bei Tagesanbruch spürte er, wie er abermals in einen tiefen Schlaf sank.
»Es hat sich nie ereignet« kann keinesfalls bedeuten: »Es kann sich nie ereignen!« Das käme der Behauptung gleich: »Da ich mir nie das Bein gebrochen habe, ist mein Bein unzerbrechlich.« Oder: »Da ich nie gestorben bin, bin ich unsterblich.« Zunächst denkt man an eine große Insektenplage, an Heuschrecken, wenn die Art sich urplötzlich über alle Maßen vermehrt und dann genauso unvermittelt wieder zu der geringen Zahl wie kurz zuvor absinkt. Doch genauso fluktuieren auch die höheren Tiere. Die Lemminge vermehren sich und schwinden wieder dahin. Die Schneeschuhkaninchen nehmen eine Reihe von Jahren hindurch zahlenmäßig so zu, bis sie überall zu sein scheinen; dann überfällt sie mit dramatischer Plötzlichkeit ihre Pest. Einige Zoologen vermuten darin sogar ein biologisches Gesetz: Die Zahl der Individuen innerhalb einer Spezies bleibt danach nie konstant, sondern ist in stetem Steigen und Fallen begriffen – je höher das Tier steht und je länger die Aufzucht seiner Nachkommen dauert, desto länger die Fluktuierungsperiode.
Während des größten Teils des neunzehnten Jahrhunderts kam der afrikanische Büffel in der Steppe häufig vor. Er war ein mächtiges Tier und hatte nur wenige natürliche Feinde, und wenn man seinen Bestand alle zehn Jahre aufgenommen hätte, so wäre festgestellt worden, dass er sich stetig vermehrte. Dann erreichte er gegen Ende des Jahrhunderts seine Klimax, und plötzlich überfiel ihn eine Seuche: die Rinderpest. Bald war der Büffel beinahe eine Seltenheit, und in einigen Teilen seines ehemaligen Verbreitungsgebietes so gut wie ausgestorben. Erst während der letzten Jahrzehnte hat sich seine Zahl allmählich wieder vergrößert.
Was nun den Menschen betrifft, so besteht wenig Grund zu der Annahme, dass er auf Dauer dem Schicksal der übrigen Geschöpfe entgehen kann, und wenn es tatsächlich ein biologisches Gesetz von Ebbe und Flut gibt, so ist seine gegenwärtige Situation recht gefährlich. Zehntausend Jahre lang war seine Zahl in stetem Ansteigen begriffen, trotz aller Kriege, Seuchen und Hungersnöte. Immer schneller hat sich das Anwachsen der Bevölkerung vollzogen. Biologisch betrachtet hat der Mensch bereits viel zu lange eine ununterbrochene Folge von »sieben guten Jahren« durchlebt.
Als er gegen Mittag erwachte, empfand er ein überraschend angenehmes Gefühl. Er hatte gedacht, es würde ihm viel schlechter gehen, aber tatsächlich fühlte er sich besser. Die Erstickungsanfälle suchten ihn nicht mehr heim, und seine Hand brannte nicht mehr so stark. Die Schwellung war zurückgegangen. Am zurückliegenden Tag war es ihm so übel gegangen, nicht zuletzt durch all das Verwirrende, das auf ihn eingestürzt war, dass er kaum Zeit gehabt hatte, an seine Hand zu denken. Jetzt schien es sowohl um die Hand als auch um sein Allgemeinbefinden besser zu stehen – als hätte sich beides gegenseitig Einhalt geboten und zurückgedrängt. Am Nachmittag war sein Kopf klar, und er fühlte sich noch nicht einmal besonders schwach.
Er aß etwas und beschloss dann, die Fahrt hinunter zu Johnsons zu wagen. Er hielt sich nicht damit auf, alles einzupacken; er nahm lediglich seine kostbaren Notizbücher und den Fotoapparat mit. Doch im letzten Moment hob er, wie aus einer Art Instinkt heraus, den Hammer auf, ging zum Wagen und legte ihn auf den Boden vor dem Fahrersitz. Dann fuhr er langsam los, wobei er die rechte Hand so weit wie möglich schonte.
Bei Johnsons war alles still. Er ließ den Wagen bis zur Benzinpumpe rollen und hielt an. Niemand kam heraus, um seinen Tank zu füllen; das war nicht ungewöhnlich, da Johnsons Pumpe wie in den Bergen üblich jedermann frei zur Verfügung stand. Er hupte und wartete eine Weile. Dann stieg er aus und ging die wackeligen Stufen zu dem Raum hinauf, der als Laden diente, in dem die Camper Zigaretten und Konserven aller Art erstehen konnten. Er ging hinein; es war niemand da.
Er war an Überraschungen dieser Art gewöhnt. Wie so oft, wenn er eine Weile sich selbst überlassen gewesen war, wusste er nicht genau, welcher Wochentag es war. Mittwoch, dachte er. Aber es konnte ebenso gut Dienstag oder Donnerstag sein. Jedenfalls war er sich sicher, dass es irgendwann in der Mitte der Woche, also nicht Sonntag war. Am Sonntag, hin und wieder auch über das ganze Wochenende, schlossen die Johnsons schon mal ihren Laden und machten einen Ausflug. Sie waren in dieser Hinsicht recht locker und machten gerne mal eine Pause vom Geschäft. Dabei waren sie in hohem Maße von dem Umsatz abhängig, den der Laden während der Angelsaison erzielte; sie konnten es sich kaum erlauben, allzu lange weg zu sein. Und wenn sie verreist wären, hätten sie doch bestimmt die Tür abgeschlossen. Aber man kannte sich bei diesen Bergbewohnern nie richtig aus; ja, vielleicht verdiente dieser Zwischenfall sogar eine Erwähnung in seiner Dissertation. Jedenfalls war sein Tank nahezu leer. Die Pumpe war ebenfalls nicht abgeschlossen, und so griff er zur Selbsthilfe und tankte vierzig Liter. Mühsam kritzelte er mit der linken Hand einen Scheck, den er auf dem Tresen hinterließ, zusammen mit der Notiz »Ihr wart alle weg. Habe vierzig Liter getankt. Ish«.
Als er die Straße weiter hinabfuhr, fühlte er sich plötzlich unbehaglich. Die Johnsons an einem Wochentag auf und davon, die Tür unverschlossen, weit und breit kein Angler, das in der Nacht vorüberfahrende Auto und – vor allem – die beiden Männer, die davongerannt waren, als sie einen anderen Mann krank auf der Pritsche einer einsamen Gebirgshütte hatten liegen sehen. Doch das Wetter war prächtig, und seine Hand schmerzte nicht allzu sehr; außerdem schien er jene zweite seltsame Infektion überstanden zu haben, wenn es sich überhaupt um dergleichen und nicht lediglich um den Schlangenbiss gehandelt hatte. Sein körperliches Befinden war jetzt beinahe wieder normal. Die Straße wand sich geruhsam zwischen lichten Fichtenhainen neben einem schmalen, schnell fließenden Fluss dahin, und als er beim Black-Creek-Kraftwerk ankam, fühlte er sich auch geistig und seelisch wieder völlig normal.
Das Kraftwerk sah aus wie immer. Er hörte das Summen der großen Generatoren und sah Ströme dampfenden Wassers unten heraustosen. Auf der Brücke brannte eine Lampe. Er dachte: Vermutlich macht sich niemand jemals die Mühe, das Licht auszuschalten. Sie haben so viel Strom, dass sie nicht damit zu sparen brauchen.
Er spielte mit dem Gedanken, in das Kraftwerk hineinzugehen, einfach nur um jemand zu sehen und die sonderbaren Ängste zurückzudrängen, die in ihm aufzusteigen begonnen hatten. Doch der Anblick und die Geräusche waren beruhigende Hinweise darauf, dass das Kraftwerk arbeitete wie immer, auch wenn er keine Menschenseele sah. Und selbst daran war nichts Auffälliges. Der Arbeitsvorgang verlief weitgehend automatisch, sodass dort nur ein paar Leute beschäftigt waren, und die hielten sich zumeist drinnen auf.
Gerade als er an dem Kraftwerk vorüber war, kam ein großer Collie aus einem der hinteren Gebäude gelaufen. Vom anderen Ufer des Flusses bellte er Ish laut und ungestüm an und rannte aufgeregt hin und her.
Verrückter Köter, dachte Ish. Warum ist er wohl so aufgeregt? Versucht er mir zu sagen, dass ich das Kraftwerk nicht stehlen darf? Die Menschen neigen dazu, die Intelligenz der Hunde zu überschätzen.
Er fuhr um die Kurve, und das Bellen blieb hinter ihm zurück. Doch der Anblick des Hundes hatte ihn abermals davon überzeugt, dass sich alles im Normalzustand befand. Er begann, zufrieden vor sich hin zu pfeifen. Jetzt hatte er nur noch zehn Meilen zurückzulegen, bis er zur nächsten kleineren Stadt kam, einem Ort namens Hutsonville.
Man vergegenwärtige sich den Fall der Captain-Maclear-Ratte. Dieses interessante Nagetier lebte auf Christmas Island, einem winzigen Fleck tropischen Grüns etwa zweihundert Meilen südlich von Java. Die Art war 1887 zum ersten Mal wissenschaftlich beschrieben worden: Sie sei groß und kräftig, habe höckrige Jochbögen, und das Vorderende der Jochbeinplatte trete auffällig hervor.
Ein Wissenschaftler beobachtete, dass die Ratten die Insel »in Schwärmen« bewohnten und sich von Früchten und jungen Sprossen ernährten. Für die Ratten bedeutete die Insel eine ganze Welt, ein irdisches Paradies. Der Beobachter notierte: »Sie scheinen sich das ganze Jahr hindurch zu vermehren.« Das Übermaß an tropischem Wachstum war derart, dass die Ratten nicht so zahlreich geworden wären, wenn sie in ständigem Wettbewerb mit anderen Angehörigen der Spezies gestanden hätten. Die einzelnen Ratten waren außerordentlich gut genährt, ja unmäßig fett.
Im Jahre 1903 brach eine neuartige Seuche aus. Infolge der hohen Populationsdichte und vermutlich auch wegen der verweichlichten Konstitution der Einzeltiere erkrankten die Ratten sämtlich und starben bald zu Tausenden. Trotz ihrer großen Zahl, trotz einer verschwenderischen Fülle an Nahrung, trotz ihrer schnellen Vermehrung ist die Spezies ausgestorben.
Er fuhr einen Hügel hinauf und sah in etwa einer Meile Entfernung Hutsonville vor sich liegen. Dann, gerade als er sich anschickte, den Hügel hinunterzufahren, bemerkte er seitlich etwas, das ihm einen Schauer über den Rücken jagte. Instinktiv trat er auf die Bremse, stieg aus und ging zurück; er konnte kaum glauben, dass er es tatsächlich gesehen hatte. Am Straßenrand lag, deutlich sichtbar, der bekleidete Körper eines Mannes, über dessen Gesicht Ameisen krochen. Die Leiche musste mindestens ein oder zwei Tage dort gelegen haben. Warum hatte man sie noch nicht entdeckt? Er beugte sich nicht hinunter und stellte keine großen Nachforschungen an; jetzt kam es darauf an, nach Hutsonville zu fahren und den Fund so schnell wie möglich der Polizei zu melden. Also lief er zu seinem Wagen zurück.
Doch als er wieder den Motor startete, hatte er tief im Inneren die sonderbare Empfindung, dass dies kein Fall für die Polizei war, ja dass es womöglich gar keine Polizei mehr gab. Weder bei Johnsons noch beim Kraftwerk hatte er jemanden gesehen, und auf der Straße war ihm kein einziger Wagen begegnet. Das Einzige, was ihm von früher als normal erschienen war, waren die brennende Lampe beim Kraftwerk und das ruhige Summen der großen Generatoren gewesen, die weiter arbeiteten.
Er fuhr auf die Stadt zu, und als die ersten Häuser kamen, atmete er plötzlich leichter – auf einer freien Stelle scharrte eine Henne, ein halbes Dutzend Küken um sich herum, in aller Ruhe im Staub, und etwas weiter vorn überquerte eine schwarz-weiße Katze so unbeteiligt den Bürgersteig, wie sie es an jedem anderen Junitag getan hätte.
Die Nachmittagshitze lag schwer über dem Ort, und er sah niemanden. »Faul wie eine mexikanische Stadt«, dachte er. »Alles hält Siesta.« Da plötzlich merkte er, dass er es laut gesagt hatte – wie jemand, der pfeift, um sich Mut zu machen. Er fuhr ins Ortszentrum, hielt am Bordstein an und stieg aus. Es war niemand hier.
Er drückte auf die Klinke der Tür eines kleinen Restaurants. Die Tür war offen. Er ging hinein.
»Hallo«, rief er.
Niemand kam. Nicht einmal ein Echo antwortete.
Die Tür der Bank war verschlossen, obwohl noch längst nicht Geschäftsschluss war, und je länger er nachdachte, desto mehr war er überzeugt, dass es Dienstag oder Mittwoch oder allerhöchstens Donnerstag war. Was ist mit mir geschehen?, dachte er. Bin ich Rip van Winkle? Genauso war Rip van Winkle, nachdem er zwanzig Jahre geschlafen hatte, in ein Dorf gekommen – doch das war voller Menschen gewesen.
Die Tür der Eisenwarenhandlung hinter der Bank war offen. Er ging hinein. Wieder rief er, und wieder erklang nicht einmal ein Echo als Antwort. Er sah in eine Bäckerei; dort hörte er nur ein winziges Geräusch, wie von einer flüchtenden Maus.
Waren die Leute alle zum Baseballspiel gegangen? Aber dann hätten sie doch bestimmt ihre Läden geschlossen. Er ging zurück zum Wagen, setzte sich ans Steuer und blickte sich um. War das der Fieberwahn? Lag er in Wirklichkeit noch auf seiner Pritsche? Ein Teil von ihm neigte dazu, hier so schnell wie möglich wegzukommen. Panik begann sich in ihm breitzumachen. Da sah er, dass längs der Straße mehrere Wagen parkten, ganz so wie sie es an einem nicht allzu geschäftigen Nachmittag getan hätten. Nein, er konnte nicht einfach davonfahren – er musste den Toten am Straßenrand melden. Also betätigte er die Hupe, und das Geräusch hallte fast schon unanständig laut durch die menschenleere Straße und die Nachmittagsstille. Er hupte zweimal, wartete und hupte wieder zweimal. Nichts. Wieder und wieder, in wachsendem Entsetzen, drückte er auf die Hupe. Dabei blickte er sich um, in der Hoffnung, dass irgendjemand aus einer Tür herauskam oder dass sich wenigstens ein Gesicht an einem Fenster zeigte. Er nahm die Hand von der Hupe, und abermals war da nichts als Stille, nur dass er jetzt irgendwo in der Ferne das grelle Gackern einer Henne hörte. Die muss gerade ein Ei gelegt haben, dachte er.
Ein dicker Hund bog schwanzwedelnd um die Ecke und trottete den Bürgersteig entlang; jene Art von Hund, wie man sie in jeder Kleinstadt auf der Hauptstraße sehen konnte. Ish stieg aus dem Wagen und ging dem Hund entgegen. »Du hast jedenfalls nicht an Nahrungsmangel gelitten«, sagte er (und hatte plötzlich ein würgendes Gefühl im Hals, als er daran dachte, was der Hund gefressen haben könnte). Der Hund war nicht sehr freundlich. Er knurrte Ish an und hielt Abstand; dann lief er die Straße hinunter. Ish machte sich nicht die Mühe, ihn anzulocken oder ihm nachzugehen, schließlich konnte ihm der Hund ja nichts erzählen.
Eigentlich könnte ich Detektiv spielen, in ein paar von diesen Läden gehen und mich umsehen, dachte er. Doch dann kam ihm ein besserer Gedanke.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite war eine kleine Billardstube, wo er früher oft angehalten und sich eine Zeitung gekauft hatte. Er ging hinüber. Die Tür war verschlossen. Er blickte durch das Fenster und sah die Zeitungen auf dem Gestell. Die Schlagzeilen waren so groß wie damals bei Pearl Harbour. Er starrte durch den Widerschein der Scheibe hindurch und las:
AKUTEKRISE
Was für eine Krise? Schnell ging er zurück zum Wagen und griff nach dem Hammer. Einen Augenblick später stand er mit dem schweren Werkzeug wieder vor der Tür.
Doch die Hemmungen des Anstands ließen ihn innehalten. Die Zivilisation hielt ihn beinahe körperlich am Arm fest. So etwas durfte man nicht tun – als gesetzestreuer Bürger konnte man nicht einfach in ein Haus einbrechen. Er spähte die Straße hinauf und hinunter, als könne sich jeden Augenblick ein Polizist oder ein Hilfssheriff auf ihn stürzen.
Aber die Leere der Straße sprach ihre eigene Sprache, und das Entsetzen schwemmte alle Hemmungen hinweg. Zum Teufel, dachte er. Wenn es sein muss, kann ich die Tür ja bezahlen.
Mit der Empfindung, alle Brücken hinter sich zu verbrennen, schwang er den schweren Hammer mit aller Kraft gegen das Türschloss. Das Holz splitterte, die Tür flog auf, er stolperte hinein.
Der erste Schreck durchfuhr ihn, als er nach der Zeitung griff. Der Chronicle, an den er sich erinnerte, war dick – mindestens zwanzig oder dreißig Seiten stark. Die Zeitung, die er jetzt in der Hand hielt, war ein kleines Dorfblatt, eine einzige zusammengefaltete Seite. Sie trug das Datum des Mittwochs der vergangenen Woche.
Die Schlagzeilen sagten ihm das Wesentliche. Von Ozean zu Ozean wurden die USA von einer bisher unbekannten Seuche heimgesucht, eine Seuche von beispielloser Schnelligkeit und tödlicher Wirkung. In verschiedenen Städten angestellte Schätzungen, die kaum mehr als Vermutungen waren, ergaben, dass zwischen fünfundzwanzig und fünfunddreißig Prozent der Bevölkerung bereits gestorben waren. Aus Boston, Atlanta und New Orleans kamen keine Berichte mehr, was darauf schließen ließ, dass die öffentliche Ordnung in diesen Städten zusammengebrochen war. Während er hastig den Inhalt der Zeitung überflog, hatte er eine Fülle von Eindrücken – ein Durcheinander, in das er kaum einen logischen Zusammenhang zu bringen vermochte. Die Symptome der Seuche waren denen einer Art »Super-Masern« vergleichbar. Niemand konnte mit Sicherheit sagen, in welchem Teil der Welt sie zuerst ausgebrochen war; durch Flugzeugreisende verbreitet, war sie fast gleichzeitig in jedem Zentrum der Zivilisation aufgetreten und hatte dadurch alle Versuche einer Quarantäne zunichtegemacht.
Ein namhafter Bakteriologe erklärte in einem Interview, dass der Ausbruch einer neuen Seuche seit Langem eine Möglichkeit gewesen sei, gegen die vorausschauende Epidemiologen angekämpft hätten. Er erwähnte aus der Vergangenheit so sonderbare, wenn auch geringfügige Ausbrüche wie die Englische Grippe und das Q-Fieber. Was den Ursprung betraf, wies er auf drei Möglichkeiten hin: Die Seuche könne sich von einem tierischen Krankheitsherd aus verbreitet haben; sie könne durch irgendeinen neuen Mikroorganismus verursacht worden sein, womöglich ein durch Mutation entstandenes Virus; und sie könne einem Labor entstammen, in dem für den »Bakterienkrieg« geforscht worden war und aus dem der Erreger ausgebrochen oder vielleicht sogar absichtlich verbreitet worden sei. Offenbar hatte sich die öffentliche Meinung für letztere Annahme entschieden. Es hieß, die Seuche werde durch die Luft übertragen, wahrscheinlich auf Staubpartikeln, doch es war ein seltsamer Umstand, dass die Isolation der Infizierten keinerlei Abhilfe zu schaffen schien.
In einem per Telefon geführten Interview sagte ein bärbeißiger, alter englischer Gelehrter: »Der Mensch hat sich ein paar Jahrtausende lang auf die blödsinnigste Art und Weise vermehrt. Ich weine ihm keine Träne nach, wenn er jetzt verschwindet.« Einem ebenso alten amerikanischen Forscher wurde hingegen eine religiöse Erleuchtung zuteil: »Jetzt kann uns nur noch der Glaube retten. Ich bete stündlich.«
Es wurde über eine steigende Zahl von Plünderungen berichtet, insbesondere von Spirituosenhandlungen. Im Großen und Ganzen war jedoch die Ordnung bewahrt worden, möglicherweise aus Angst. Louisville und Spokane meldeten Feuersbrünste, die wegen der verminderten Zahl an Feuerwehrleuten nicht hatten eingedämmt werden können.
Die Journalisten hatten nicht versäumt, selbst in die, wie sie vermutlich wussten, letzte Ausgabe ein paar von ihren geliebten Sensationsberichten einzustreuen. In Omaha war ein religiöser Fanatiker nackt durch die Straßen gelaufen und hatte schallend das Ende der Welt und die Öffnung des Siebenten Siegels verkündet. In Sacramento hatte eine hysterische Frau die Käfige eines Zirkus geöffnet, aus Furcht, die Tiere könnten verhungern, und war von einer Löwin zerrissen worden. Von größerem wissenschaftlichem Interesse war die Aussage des Zoodirektors von San Diego, dass seine Menschenaffen einer nach dem anderen eingingen, während die übrigen Tiere frei von Ansteckung seien.
Während er las, fühlte sich Ish angesichts dieser geballten Anhäufung von Schrecken immer schwächer – und zugleich immer einsamer. Dennoch las er wie gebannt weiter.
Zumindest war die Zivilisation, die menschliche Spezies, wie es schien, tapfer zugrunde gegangen. Aus manchen Ländern wurde berichtet, dass die Menschen aus den Städten geflohen seien, doch die Zurückgebliebenen waren, soweit man das der eine Woche alten Zeitung entnehmen konnte, nicht der Panik verfallen. Die Zivilisation war zurückgewichen – aber sie hatte ihre Verwundeten mit sich genommen und dem Feind die Stirn geboten. Ärzte und Krankenpflegerinnen waren auf ihren Posten geblieben, und Tausende hatten sich als Helfer zur Verfügung gestellt. Ganze Stadtgebiete waren zu Lazarettlagern und Sammelstellen erklärt worden. Das gesamte Geschäftsleben hatte aufgehört, aber Lebensmittel wurden auf Grund von Notstandsmaßnahmen weiterverkauft. Obwohl ein Drittel der Bevölkerung tot war, blieben die Telefonverbindungen und die Versorgung mit Wasser, Licht und Strom in den meisten Städten in Betrieb. Um unerträgliche Zustände zu vermeiden, die zu einem völligen Zusammenbruch der Moral geführt hätten, setzten die Behörden strenge Verordnungen für Massenbestattungen durch.
Er las die Zeitung, und dann las er sie ein zweites Mal. Was blieb ihm sonst zu tun? Als er mit dem zweiten Lesen fertig war, ging er hinaus, setzte sich in seinen Wagen und dachte, dass keinerlei Veranlassung bestand, sich in seinen Wagen und nicht in einen beliebigen anderen zu setzen. Es ging jetzt nicht mehr um Besitzrechte. Dennoch fühlte er sich dort wohler, wo er zuvor gewesen war. (Wieder trottete der dicke Hund die Straße hinunter, aber er rief ihm nicht nach.) So saß er längere Zeit da und dachte nach; nein, dachte eigentlich nicht, sondern ließ seinen Geist ziellos über die Dinge dahingleiten.
Die Sonne ging bereits unter, als er sich endlich aufraffte. Er startete den Motor und fuhr die Straße entlang; ab und an stoppte er kurz und hupte. So fuhr er durch die ganze Stadt, in unregelmäßigen Abständen hupend. Hutsonville war nicht sonderlich groß, und so kam er nach einer Viertelstunde an seinen Ausgangspunkt zurück. Er hatte keinen Menschen gesehen und keine Antwort erhalten. Er hatte vier Hunde, mehrere Katzen, eine beträchtliche Zahl ratlos herumlaufender Hühner und auf einem Stück Wiese eine weidende Kuh gesehen, an deren Hals ein abgerissenes Strickende gebaumelt war. Am Eingangstor zu einem sehr gepflegt aussehenden Haus hatte eine dicke Ratte herumgeschnuppert.
Diesmal hielt er nicht noch mal im Zentrum an, sondern fuhr weiter zu dem Haus, das er als das Beste der Stadt ausgemacht hatte. Er griff nach dem Hammer und stieg aus dem Wagen. Diesmal brach er die Tür ohne Zögern und Hemmungen auf; er musste dreimal kräftig zuschlagen, dann flog sie nach innen. Wie er vermutet hatte, stand im Wohnzimmer ein großes Radio.
Treppauf und treppab unternahm er einen schnellen Erkundungsgang. Niemand da, dachte er. Dann traf ihn der unerbittliche Sinn dieser Worte wie ein Keulenschlag. Keine Menschen. Keine Lebenden. Keine Toten.
Er ging wieder ins Wohnzimmer und schaltete das Radio ein. Das Elektrizitätswerk arbeitete offenbar noch. Er ließ das Gerät warm werden, dann suchte er nach einem Sender. Doch lediglich das schwache Knacken atmosphärischer Störungen drang an sein gespannt lauschendes Ohr; nirgends wurde ein Programm gesendet. Er wechselte auf Kurzwelle, aber auch dort herrschte Schweigen. Sorgfältig ging er noch mal beide Frequenzen durch. Natürlich, dachte er, sind noch Stationen in Betrieb, aber vermutlich senden sie nicht rund um die Uhr.
Er stellte auf einen Sender ein, von dem er wusste, dass er besonders stark war – oder gewesen war. Wenn das Programm kam, würde er es hören. Dann legte er sich auf die Couch.
Trotz seiner Situation empfand er alldem gegenüber eine sonderbare Distanz – als spiele sich vor ihm der Schlussakt eines großen Dramas ab. Er war ein Student (oder war es gewesen, es kam nicht mehr so genau darauf an), ein angehender Wissenschaftler, und als solcher lag es ihm mehr, zu beobachten, als teilzuhaben. Ja, kurzzeitig überkam ihn sogar eine ironische Genugtuung, als er die Katastrophe als den Beweis einer These betrachtete, die er einmal von einem Ökonomen gehört hatte: »Die Wirrnisse, die man erwartet, treten niemals ein. Es geschieht immer etwas im Verborgenen, das einen Anstoß in eine andere Richtung gibt.« Die Menschheit hatte bei dem Gedanken an ihre Vernichtung durch einen Krieg gezittert, hatte sich Städte vorgestellt, die mitsamt ihren Bewohnern in die Luft fliegen, und verstrahlte Tiere und hinweggeblitzte Pflanzen. Nun aber schien es, als würden lediglich die Menschen ausgelöscht, ohne dass sich irgendwelche anderen Störungen vollzogen. Das, so dachte er vage, würde interessante Bedingungen für die Überlebenden ergeben. Wenn jemand am Leben blieb.
Behaglich lag er auf der Couch. Der Abend war warm. Er war von der Krankheit immer noch erschöpft, und auch seine seelischen Kräfte schienen verbraucht. Er schlief bald ein.
Hoch oben zogen Mond, Planeten und Sterne ihre langen, weiten Bahnen. Sie hatten keine Augen, sie konnten nicht sehen; doch seit jener Zeit, als sich im Menschen die Fantasie gebildet hatte, war er überzeugt, dass sie auf die Erde hinabblickten.
Und wenn wir noch immer diesem Glauben anhingen, und wenn sie tatsächlich in dieser Nacht zur Erde hinabblickten – was sahen sie dann?
Sie sahen keinerlei Veränderung. Auch wenn von Schloten und Schornsteinen und Lagerfeuern kein Rauch mehr aufstieg und die Atmosphäre verdüsterte, erhob sich nach wie vor der Rauch der Vulkane und der Waldbrände. Selbst vom Mond aus betrachtet, muss der Planet Erde in dieser Nacht geschimmert haben wie gewöhnlich – weder strahlender noch düsterer.
Er erwachte im hellen Tageslicht. Er untersuchte seine Hand und stellte fest, dass sich der Schmerz von dem Schlangenbiss bis auf eine lokale Empfindlichkeit verflüchtigt hatte. Auch sein Kopf war klar, und er spürte, dass sich die andere Krankheit – wenn es denn eine andere Krankheit und nicht eine der Folgen des Schlangenbisses gewesen war – ebenfalls gebessert hatte. Dann hielt er plötzlich inne, als ihm etwas einfiel, das er zuvor nicht bedacht hatte. Der Gedanke lag nahe, dass auch er an dieser neuen Seuche erkrankt war und dass sie gegen das Schlangengift in seinem Blut angekämpft hatte – mit der Folge, dass das eine das andere neutralisiert hatte. Zumindest stellte das die einfachste Erklärung dafür dar, dass er noch am Leben war.
Während er ausgestreckt auf der Couch lag, empfand er eine große Ruhe. Die einzelnen Teile des Puzzles rückten nach und nach an die Stellen, an die sie gehörten. Die beiden Männer, die, von panischem Entsetzen gepackt, davongelaufen waren, als sie in der Hütte einen Kranken hatten liegen sehen – sie waren nur arme Flüchtlinge gewesen, voller Furcht, dass die Seuche sie bereits überholt hatte. Das Auto, das in der Dunkelheit an der Hütte vorbeigefahren war, hatte weitere Flüchtlinge befördert – vielleicht waren es sogar die Johnsons gewesen. Und der aufgeregte Collie hatte versucht, ihm zu sagen, dass im Kraftwerk seltsame Dinge geschehen waren … Während er so dalag, erzeugte nicht einmal der Gedanke allzu große Unruhe, dass er vielleicht der einzige noch lebende Mensch auf dem Planeten war. Möglicherweise rührte das daher, dass er in den letzten Wochen nur wenige Menschen zu Gesicht bekommen hatte, sodass ihn diese Vorstellung weniger hart traf als jemanden, der seine Mitmenschen ringsum hatte sterben sehen. Aber letztlich konnte er nicht glauben (und er hatte auch keinerlei überzeugenden Grund für diese Annahme), dass er der einzige Überlebende auf der Erde war. In der Zeitung hatte gestanden, dass sich die Bevölkerungszahl um ein Drittel vermindert hatte. Die Evakuierung einer kleinen Stadt wie Hutsonville bewies lediglich, dass die Menschen in eine andere Stadt abgewandert oder überführt worden waren. Nein, bevor er über die Vernichtung der Zivilisation und das Aussterben der Menschheit auch nur eine Träne vergoss, musste er herausbekommen, ob die Zivilisation tatsächlich vernichtet und die Menschheit ausgestorben war. Und das Erste, was ihm dabei als seine Aufgabe erschien, war, in das Haus zurückzukehren, in dem seine Eltern gelebt hatten oder, wie er hoffte, noch immer lebten. Nachdem er so einen festen Plan entworfen hatte, überkam ihn Genugtuung, wie stets, wenn er aus wirren Gedanken zu einer zeitweiligen Gewissheit gelangte.
Er stand auf und suchte ein weiteres Mal beide Wellenbereiche des Radios ab, erneut ohne Ergebnis.
Dann ging er in die Küche. Als er die Kühlschranktür öffnete, merkte er, dass das Gerät noch in Betrieb war. In den Fächern stand eine schöne Auswahl an Nahrungsmitteln, wenn auch nicht in der Menge, wie er es erwartet hatte. Offenbar waren die Vorräte schon etwas knapp geworden, als die Bewohner das Haus verlassen hatten. Trotzdem fanden sich ein halbes Dutzend Eier, fast ein Pfund Butter, ein wenig Speck, ein paar Salatköpfe und eine kleine Sellerieknolle. Im Küchenschrank stand eine Dose Grapefruitsaft, und im Brotkasten lag ein Laib Brot, der zwar ziemlich trocken, aber nicht ungenießbar war. Er schätzte, dass das Brot etwa fünf Tage lang da gelegen hatte, und so bekam er eine deutlichere Vorstellung von dem Zeitpunkt, an dem die Stadt verlassen worden war. Mit diesen Vorräten hätte er sich als erfahrener Camper draußen über einem offenen Feuer eine wunderbare Mahlzeit bereiten können, aber er schaltete den Elektroherd ein und spürte, wie die Platten Hitze auszustrahlen begannen. Wie stets, wenn er aus den Bergen kam, hatte er Hunger auf frisches Grün, und so fügte er dem gewohnten Frühstück – Eier mit Speck und Kaffee – einen Salatkopf hinzu.
Dann ging er zurück zur Couch, bediente sich aus der rotlackierten Dose auf dem danebenstehenden Tischchen und rauchte zum Nachtisch eine Zigarette. Bis jetzt, so überlegte er, zog das Ende der Zivilisation keinerlei Schwierigkeiten nach sich – nach einem guten Frühstück eine Zigarette zu rauchen, war nicht das Schlechteste, was einem passieren konnte. Und die Zigarette war nicht einmal ausgetrocknet. Bisher hatte ihn vor allem die Ungewissheit gequält, also beschloss er, ihr nicht nachzugeben, solange er nicht genau wusste, ob es dafür eine Notwendigkeit gab.
Als er die Zigarette zu Ende geraucht hatte, fiel ihm ein, dass es nicht einmal die Notwendigkeit gab, das Geschirr abzuwaschen. Da er von Natur aus ordnungsliebend war, ging er allerdings noch einmal in die Küche und überzeugte sich, dass die Kühlschranktür geschlossen und der Elektroherd ausgeschaltet war. Dann nahm er den Hammer, der sich bereits als nützlich erwiesen hatte, und ging durch die zertrümmerte Haustür hinaus. Er stieg in seinen Wagen und machte sich auf die Heimfahrt.
Eine halbe Meile hinter der Stadt kam der Friedhof in Sicht. Während des vorangegangenen Tages war Ish der Friedhof nicht ein einziges Mal in den Sinn gekommen. Ohne den Wagen zu verlassen, sah er sich um und bemerkte eine lange Reihe neuer Gräber. Er sah auch einen Bagger neben einem großen Erdhaufen. Offenbar, so schloss er, waren nicht allzu viele Menschen übrig geblieben, die Hutsonville hatten verlassen können.
Nach dem Friedhof führte die Straße hinab in flaches Gelände. Wieder überkam ihn das bedrückende Gefühl der Einsamkeit. Er wünschte, wenigstens ein einzelner Lastwagen würde ratternd über die vor ihm liegende Bodenwelle kommen. Aber es kam kein Lastwagen.
Zusammen mit einigen Pferden standen ein paar junge Ochsen auf einem Feld neben der Straße. Sie wehrten mit den Schwänzen die Fliegen ab, wie an jedem anderen heißen Sommermorgen. Über ihnen drehten sich die Flügel einer Windmühle langsam im leichten Wind, um den Wassertrog herum wuchs ein Fleckchen Grün, und der schlammige Boden war zertrampelt. Es war, wie es schon immer gewesen war – nicht anders.
Auf der Straße, die von Hutsonville wegführte, hatte allerdings nie viel Verkehr geherrscht, und er hätte auch an jedem anderen Morgen etliche Meilen fahren können, ohne jemandem zu begegnen. Doch das änderte sich, als er zum Highway kam. An der Kreuzung war die Ampel noch in Betrieb, und automatisch hielt er an, als er sah, dass das Signal rot war. Wo auf den vier Fahrspuren Trucks und Busse und PKWs in großer Zahl hätten dahinsausen müssen, war nichts als Leere. Nachdem er für einen kurzen Augenblick gehalten hatte, fuhr er schließlich unter der roten Ampel hindurch, wobei ihn das leise Gefühl überkam, gegen das Gesetz zu verstoßen.
Auf dem Highway, auf dem er alle vier Spuren für sich hatte, wirkte alles noch geisterhafter. Ihm war, als fahre er in einer Art Betäubung, aus der ihn hin und wieder ein besonderes Ereignis herausrüttelte, das in sein Bewusstsein drang … Etwas lief auf der inneren Spur vor ihm her. Er fuhr darauf zu. Ein Hund? Nein, er sah spitze Ohren und helle, magere Beine, die graugelblich waren. So sah kein Farmköter aus. Es war ein Kojote, ein Präriewolf, der in aller Ruhe und im hellen Tageslicht den Highway entlanglief. Sonderbar, wie schnell er erkannt hatte, dass die Welt anders geworden war und dass er sich nach Belieben der neuen Freiheit bedienen konnte. Ish fuhr näher an das Tier heran und hupte – der Kojote lief etwas schneller, wechselte auf die andere Spur und verschwand dann über die Felder, ohne dass ihm irgendeine Unruhe anzumerken gewesen wäre.
Zwei Wagen lagen ineinander verkeilt da und blockierten zwei Spuren. Offenbar hatte sich hier ein schwerer Unfall ereignet. Ish beugte sich aus dem Fenster und hielt an. Unter einem der Wagen lag die verkrümmte Leiche eines Mannes. Ish stieg aus und sah sich um. Es war keine andere Leiche zu sehen, obwohl sich Blutflecken auf dem Pflaster fanden. Selbst wenn er einen besonderen Grund für den Versuch gehabt hätte, hätte er den Wagen nicht von der Leiche des Mannes heben und ihn bestatten können. Also fuhr er weiter.
Er machte sich nicht einmal die Mühe, den Namen der Stadt festzustellen, in der er anhielt, um zu tanken, obwohl es eine große Stadt war. Die Stromversorgung funktionierte noch. An einer Tankstelle nahm er den Schlauch von einer der Pumpen und füllte den Tank. Da sein Wagen so lange in den Bergen gewesen war, überprüfte er auch Licht und Batterie und goss etwas Öl nach. Einer der Reifen brauchte Luft, also drückte er den dünnen Schlauch gegen das Ventil und hörte den Motor anspringen, der den nötigen Druck wieder herstellte. Ja, mit den Menschen war es offenbar aus, aber erst seit so kurzer Zeit, dass ihre wohldurchdachten technischen Vorrichtungen nach wie vor funktionierten …