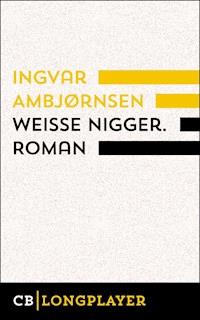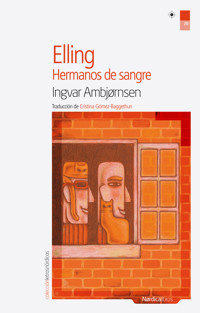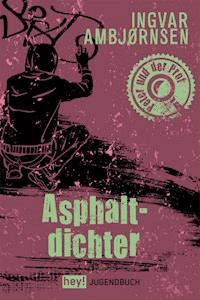Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ingvar Ambjørnsens größter Held ist zurück: Elling. Er ist älter geworden, inzwischen 58, und macht sich auf den Weg nach Oslo, wo er bei einer Witwe namens Annelore Frimann-Claussen eine Einliegerwohnung bezieht. Bisher war er in einer betreuten Wohnsituation, nun aber darf er sein Glück allein versuchen, und er ist fest entschlossen, es zu schaffen. Elling lebt sich in der neuen Umgebung ein, und er wäre ja nicht Elling, wenn er sich nicht dauernd in irgendwelche Phantasien hineinsteigerte (hat Annelore als Witwe wirklich jedes Interesse an Sex aufgegeben, oder phantasiert sie nicht doch über ihn, den in ihren Augen doch sehr jungen Elling?). Irgendwann traut er sich in ein Café, deren Betreibern er einen Teller schenkt, den er beim Ausräumen im Schuppen gefunden hat, und sie schenken ihm im Gegenzug ein Exemplar der Literaturzeitschrift, die sie herausgeben. Literatur ist aber gar nicht mehr so seins, denn neuerdings hat Elling einen Internetanschluss, und er hat gerade erfahren, dass es Facebook gibt! Nun richtet er unter dem Namen Chris Brenna (so würde er gern heißen, bestimmt wäre er dann ganz anders, so ein richtig lebenshungriger Draufgänger) ein Profil ein und postet dazu ein Foto, das er heimlich mit dem Handy von einem sehr gut aussehenden Fremden gemacht hat. Dann sucht er sich Facebook-Freunde und macht sogar einen eigenen Blog zum Thema Essen auf: "Der Gastrobaron". Doch nicht nur in der digitalen Welt sorgt Elling für Furore … "Elling ist ein liebenswerter, tragischer und skurriler Romanheld, der Ambjørnsen zu Norwegens Nationalhelden gemacht hat." DER SPIEGEL "Ingvar Ambjørnsen ist einer der aufregendsten norwegischen Gegenwartsautoren. Wegen seiner Elling-Reihe genießt er Weltruhm." DIE ZEIT
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Ingvar Ambjørnsen
Echoeines Freundes
Ein Elling-Roman
Aus dem Norwegischenvon Gabriele Haefs
Die Originalausgabe des vorliegenden Buches erscheint unter dem Titel Ekko av en venn bei Cappelen Damm, 2019.
Diese Übersetzung wurde mit finanzieller Unterstützung durch NORLA veröffentlicht.
Das Gedicht »Traum« von Olav H. Hauge wurde zitiert nach: ders., Gesammelte Gedichte, Edition Rugerup 2012, übertragen von Klaus Anders.
Andrzej Stasiuk, Hinter der Blechwand, wurde zitiert aus der Übertragung von Renate Schmidgall, Suhrkamp 2016.
Wir danken den Verlagen herzlich für die Genehmigung.
Edition Nautilus GmbH · Schützenstraße 49 a
D - 22761 Hamburg · www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten · © Edition Nautilus GmbH 2018
Deutsche Erstausgabe Mai 2019
Umschlaggestaltung: Maja Bechert, Hamburg
ePub ISBN 978-3-96054-184-4
Inhalt
1 Verspätete Ankunft
2 Annelore Frimann-Clausen
3 Die Sockelwohnung
4 Ein gesegnet normaler Supermarkt
5 Schimmelpilz
6 Die Sigurdsbude
7 Reue und späte Einsicht
8 Dr. med. Lennart Borg
9 Chris
10 Facebook
11 Leber in Sahnesoße
12 Der letzte Sonntag im Monat
13 Harmloses Spiel
14 Der Kreis weitet sich aus
15 Die Zeitschrift
16 Wartezimmer
17 Eine wichtige Korrektur
18 Das Haus in der Nacht
19 Bjarte
20 Bente Strahlsberg
21 Neue Strömungen
22 Essen aus China
23 Zurück zum Schwan
24 Letzte Runde
Nachwort Elling und seine Freunde
Aus unserem Verlagsprogramm
1
Verspätete Ankunft
Ab Drammen gab es Schienenersatzverkehr. Mit Wartezeit und Umsteigen hatte ich nun mehr als eine Stunde Verspätung. Ich beschloss, sie anzurufen und über die Situation zu informieren. Das kostete, aber ich sah keinen anderen Ausweg. Das endlose Klingeln, ehe sie sich endlich meldete. Mein Herz, das schlug und schlug. Dann endlich, zum allerersten Mal ihre etwas kratzige Stimme im Ohr.
Na gut, meinte sie. Beim lieben Gott und bei der norwegischen Eisenbahn sei eben kein Ding unmöglich. Ein trockenes Lachen an der Grenze zum Husten. Ich sah vor mir das Litermaß voll Wasser, das auf dem Küchentisch stand. Das zweimal pro Tag gefüllt und geleert werden musste, denn sonst …
Und mein eigenes Lachen, das sich mit ihrem mischte. Die Nervosität, die mich plötzlich verließ.
Ich sei jedenfalls willkommen, sagte Annelore Frimann-Clausen. Sie sei keine von der Sorte, die früh schlafen geht.
Dann war sie verschwunden.
Es regnete. Ich musterte mein Spiegelbild in der triefnassen Fensterscheibe. Und in einem inneren Film sah ich sie vor mir, wie sie in der alten Villa in Grefsen umherstapfte. Denn natürlich hatte sie einen Teller mit Schnittchen vorbereitet, das musste bei Frauen ihrer Generation fast als Gesetzmäßigkeit gelten. Nach meinem Anruf bedeckte sie jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach den Teller mit Plastikfolie, um ihn dann an einen kühlen Ort zu stellen. Oder auf die Hintertreppe, falls es eine solche gab. Eine Variante zeigte sie auch, wie sie den gesamten Teller im Kühlschrank verstaute, ich hoffte aber wirklich, dass das pure Phantasie meinerseits war. Eiskalte Butterbrote sind nichts für uns mit etwas abgewetzten Füllungen und unbehandelten Löchern. Vor allem nicht, wenn sie mit in Scheiben geschnittenem Fischpudding oder Rührei mit Räucherlachs belegt sind. Dann hat man wirklich Probleme.
Ich stellte fest, dass sie mir leidtat. Denn man weiß doch: Egal, wie gelassen eine ältere Dame mit einer Abweichung vom festgelegten Programm umzugehen vorgibt, ja, so sind solche Mitteilungen für sie eine Plage. Vor allem, wenn das Programm etwas mit Essen zu tun hat. Das ist keine Behauptung, sondern eine Tatsache. Ich glaubte nicht, dass sie nach Beendigung unseres Gesprächs in Tränen ausgebrochen war. Oder wütend geworden. Das nicht. Aber ich war überzeugt, dass sie jetzt eine feine kleine Traurigkeit hatte, die sie auskosten konnte. Eine Wehmut darüber, dass Nachmittag und Abend nicht wie geplant verlaufen würden. Einen Gemütszustand von der Sorte, die eine ältere Frau zwischen Küche und Wohnzimmer hin und her treibt. Die sie den Raum durchqueren und stehen bleiben lässt, um hinaus in den Garten zu blicken, wo sich nun die Dämmerung senkt. Und dem Regen zu lauschen. Vielleicht zwei verwelkte Blätter von der Christrose abknipsen, dem Geschenk eines Neffen zu irgendeinem Anlass, an den sie sich nicht mehr erinnern kann. Na gut. Da kommt er also später. Macht doch nichts. Kaffee schon in der Thermoskanne. Die Brote in Plastik gehüllt, den Teller auf die Kellertreppe gestellt. Alles fix und fertig. Da sollte er einfach kommen, wenn es so weit wäre. Sie hatte sonst nichts vor. Wieder in die Küche. Der Kühlschrank. Hatte sie auch Sahne gekauft? Ja. Natürlich hatte sie Sahne gekauft. Dann zurück ins Wohnzimmer und ein weiterer Blick hinaus in den Garten, wo es jetzt fast ganz dunkel geworden war. Hatte sie da eine Autotür schlagen hören? Abermals in die Küche. Aber vorsichtig jetzt. Sich langsam dem Küchenfenster nähern. Sich vorbeugen, halb versteckt hinter dem Vorhang. Falscher Alarm. Die Nachbarstochter, nach Hause gebracht vom Ex, der inzwischen zu einem wirklich guten Freund geworden war. Zu ihrer Zeit hatte es das nicht gegeben. Wenn man verlobt war, heiratete man. Eine gelöste Verlobung bedeutete den Untergang der Familie. Sie schaut ein weiteres Mal auf die Uhr. Natürlich hatte das nicht der neue Mieter sein können. Den konnte sie vielleicht in einer Stunde erwarten. Vielleicht in zweien. Es waren doch so viele Unwägbarkeiten mit im Spiel.
Vom Osloer Hauptbahnhof nehme ich ein Taxi. Das ist ganz schön großkotzig, aber ich sehe keine andere Lösung. Ich bin schon fast zwei Stunden zu spät. Das setzt mir furchtbar zu. Der Pakistani hinter dem Lenkrad starrt mich im Rückspiegel ausdruckslos an. Das macht nichts. Ausdruckslos kann ich auch. Ich denke, dass es schon ein bisschen seltsam ist, dass mich das Schicksal wieder in Richtung Grefsen führt, doch so ist es nun einmal. Gerade dieser Teil von Oslo scheint mein Siegel zu tragen. Aber egal. Das Alte ist längst begraben. Von fast allen vergessen. Ich kann mich eigentlich selbst auch nicht mehr an besonders viel erinnern. Im Grunde sehe ich nur kurze unangenehme Szenen vor mir, die ich sofort in die Korridore und Irrwege des Gemüts jage. Weg mit euch. Es ist nichts Schwerwiegendes geschehen. Dafür habe ich Zeugenaussagen genug.
Etwas später stehe ich in einer stillen Straße und sehe, wie sich die roten Rücklichter des Taxis entfernen. Es ist jetzt ganz dunkel. Die Straße ist nur spärlich beleuchtet, das weiß ich zu schätzen. Es wirkt beruhigend so. Als ich die Straße überquere, kann ich deutlich das verbogene Rad meines Rollkoffers hören.
Es klingt wie ein gequälter Vogel. Ein winzig kleiner Spatz, der bald sterben muss.
2
Annelore Frimann-Clausen
Der Fiolvei ist eine stille Angelegenheit. Ein ausgetrockneter schwarzer Fluss zwischen weiß gestrichenen Villen in großen grünen Gärten. Nun stehe ich in der Dunkelheit auf dem Bürgersteig vor Nr. 5. Ein zweistöckiges Wohnhaus mit blauen Fensterrahmen. Weshalb das ganze Weiß? Unschuld? Vergangenheit? Wir malen weiß. Das Haus wirkt gepflegt, wie es im Fiolvei eben Sitte ist. Wir halten alles in Schuss. Das Haus liegt an einem Hang, genau, wie es mir erzählt worden ist. Der Garten ein grüner Abgrund, der zu einer hohen Fichtenhecke hin verschwindet. Und das weiß ich ja: Dort unten ruhen die letzten ungeschriebenen Kapitel meines Lebens. Hier ist es. Ich bin angekommen. Ich öffne das schmiedeeiserne Tor und betrete den Kiesweg. Ich kann sehen, dass in der Küche Licht brennt, und ich registriere, dass sie nicht hinter dem Vorhang auf der Lauer liegt. So eine ist sie also nicht. Eine gewaltige Erleichterung überkommt mich.
Aber kaum habe ich den Finger auf den Klingelknopf gesetzt, schon wird die Tür mit einem heftigen Ruck aufgerissen. Sie muss im Gang gestanden haben, ich stelle mir vor, dass sie dort schon lange gewartet hat. Dann ist sie allerdings so eine. Eine Frau, die mäuschenstill im Dunkeln steht und wartet. Ja, ja.
Ich sehe das Ganze von außen. Der alternde Mann, der mit dem ramponierten Koffer in der einen Hand auf der Treppe steht, während er die andere der älteren Frau so vertrauensvoll hinstreckt, wie es in unserem Teil der Welt Sitte und Brauch ist. Mann oder Frau, jung, alt, homo wie hetero, wir strecken einander die Hand hin, wir packen die Hand unseres Gegenübers, legen das eigene Fleisch auf das der anderen, bekannt oder unbekannt, das spielt keine Rolle, das Erste, was wir tun, wenn wir einander begegnen, ist, die Haut unseres Nächsten zu befühlen, und dabei die Feuchtigkeit der fremden Hand zu registrieren, die Festigkeit und die Stärke der Muskeln, um uns darauf aufbauende Vorstellungen und Theorien über die Psyche der anderen Person zu machen. Ihre Hand ist trocken und vertrauenerweckend, und in Gedanken sieht er eine alte Kiefer vor sich, die sich seit Jahrzehnten in einem Felsspalt am Meer anklammert, geformt vom Sturm und Wind und Regen und Schnee, es liegen Wille und Kraft in dieser Hand, in diesem Menschen, der sich in seinen über achtzig Jahren auf der Welt langsam aber sicher auf diesen Augenblick zugearbeitet hat, diese kosmische Begegnung mit dem neuen Mieter, dem, der den Namen trägt, den er jetzt mit einem etwas verlegenen Lächeln von sich gibt, mit einem Lächeln, von dem er hofft, sie werde, wenn sie schon nicht begeistert davon ist, doch immerhin Zutrauen dazu entwickeln, er hat dieses Lächeln nämlich geübt, es sitzt ein bisschen schief, der eine Mundwinkel ist ein klein wenig nach unten gezogen, und jetzt hört er sich selbst die Verspätung bedauern, ihr versichern, dass er keiner ist, der Verstöße gegen Abmachungen und Unpünktlichkeit auf die leichte Schulter nimmt, und er sieht, dass sie ihn aus kleinen braunen Augen mustert, sie ist wie ein Marder, denkt er nun, wie ein Marder oder ein Hermelin, zäh, ausdauernd, gar nicht so wenig neugierig, aber er hat bereits beschlossen, das Technische zu umgehen, sich an das eher Allgemeine zu halten, die Mitteilung, die per Lautsprecher durchgegeben wurde, als der Zug den Bahnhof Sande verließ, die Information, dass in Drammen Busse eingesetzt werden würden, um die Reisenden weiter nach Oslo zu befördern. Eine hervorragende Eröffnung, wie es sich herausstellen wird, ein wunderbarer Ausgangspunkt für eine Bekanntschaft, denn nun können sie beide die Norwegische Staatsbahn NSB auf scherzhafte Weise beschimpfen, da sie beide, wie überhaupt der Großteil der Bevölkerung in diesem Land, über ausgiebige Erfahrungen mit »Schienenersatzverkehr« verfügen.
Aber möchte er einen Moment hereinkommen?
Ach ja, aber er will nun wirklich nicht …
Und dann tun sie das, was sie tun, denkt er, denn sie sind Menschen auf der Erde, und natürlich stört er sie nicht, sie wollte ja ohnehin eine Tasse Kaffee trinken, ja, es würde mich nicht überraschen, denkt er weiter, während er vor seinem inneren Auge gleichzeitig die Weißbrotschnitten vor sich sieht, wie sie dort unter der Plastikfolie gewissermaßen leuchten, das Rührei mit dem orangeroten Räucherlachs, die Scheiben mit Fischpudding, Mayonnaise und einer winzig kleinen Krabbe sowie einem Petersiliepuschel, die Leberwurst, die mit einer von zwei Möglichkeiten versehen ist, es gibt nämlich zwei Schulen, wenn es um Leberwurstbrote geht, die, auf die er und seine Mutter immer geschworen haben, zwei Scheiben Gewürzgurken, und die etwas fremdere, aber gar nicht schlechte, eingelegte Rote Bete, auch diese in dünnen Scheiben, und dann die drei Schnitten mit weißem Käse und einer Scheibe roter Paprika, die werden noch immer auf dem Teller liegen, wenn beide satt sind, er denkt, dass sie ihn am Ende auffordern wird, diese Brote mitzunehmen, und er kann sich schon zögernd mit Ja antworten hören, während er abermals sein jungenhaftes Lächeln hervorzaubert. Und während sie so freundlich und zufrieden zurücklächelt, denn so ist die Natur: Frauen wollen, dass Männer so viel essen wie möglich. Es fängt schon mit der Brustwarze an, die sich in unseren Mund presst, denkt er zufrieden und stellt den Koffer vorsichtig in dem engen Gang ab; sie steht sofort mit einem Kleiderbügel parat, zusammen schälen sie ihn aus dem Mantel, er ist sich bewusst, dass das hier ihre erste gemeinsame Handlung ist, sie schälen ihn aus dem Mantel, den die Frau sofort wegzaubert, in einen zu diesem Zweck geeigneten Schrank hängt, er sieht für einen Moment ihren Mantel, dazu einen Regenmantel und eine moderne Allwetterjacke, und daran wird er bei seinem gesamten ersten Aufenthalt in Annelore Frimann-Clausens Zuhause nun regelmäßig denken: Sein eigener Mantel, der in der Dunkelheit bei ihren mehr oder weniger femininen Oberbekleidungsstücken hängt. Die Schuhe braucht er nun wirklich nicht auszuziehen, aber tut es trotzdem, nicht nur, um höflich zu sein, sondern auch, weil er sich am selben Morgen gründlich die Füße gewaschen hat, so gründlich, dass sie noch immer ein bisschen wehtun, außerdem hat er ein Paar nagelneuer Socken angelegt, eigenhändig vor einer guten Woche bei Dressman erstanden.
Ein Zuhause. Wann war ich zuletzt in einem Zuhause? Vor einer ganzen Weile. Und dennoch: Wie vertraut das alles ist! Von dem engen Gang führt eine Tür ins Wohnzimmer, wo sich die Möbel aus den sechziger Jahren mit ihren Messingbeschlägen und Teakflächen befinden, alle sind auch noch versehen mit einem Überfluss an bestickten Kissen in allen Formen und Farben, und auf kleinen und großen Beistelltischen (auch die aus Teak mit Messingbeschlägen) sind kleine und große Fotografien aufgestellt, alle sind eingerahmt, was auch für die Fotografien an den Wänden gilt, kleine und große, die dort nach einem schwer zu begreifenden System hängen, das ja vielleicht gar nicht begriffen werden soll, das ganz ohne Sinn ist, und auf diesen Fotografien kann man Menschen sehen, die nebeneinanderstehen, sei es nun in der freien Natur oder in allerlei Wohnzimmern und Aufenthaltsräumen, nicht Fotos geknipst an Stränden oder im Hochgebirge, einige wenige stammen aus einem Studio, sie sind schwarzweiß und zeigen nackte Säuglinge auf Eisbärfellen aus Webpelz, oder längst verstorbene Personen mit Kinnbart und Hut vor einem Hintergrund aus handgemalter Natur. Mir gefiel es hier. Mein erster Gedanke, als ich Annelore Frimann-Clausens Zuhause betrat, war, dass es mir hier gefiel. In einer eigenen Abteilung des Raumes war das Esszimmer untergebracht, auch das aus Teak und mit Stuhlsitzen aus dunkelbraunem Kunstleder. Derzeit wenig benutzt, das entnahm ich dem geordneten Chaos, das hier herrschte, Stapel von Büchern und Zeitungen, Briefen und Karten. Am Fenster: Das Kontrollzentrum des Zimmers. Der große moderne Sessel vom Typ Stressless, und der Tisch mit Illustrierten und Zeitungen, Brille und Kugelschreiber. Von dieser natürlichen Kommandozentrale aus konnte sie ohne irgendwelche Einschränkungen sehen, was sich auf dem großen Flachbildschirm abspielte, oder – falls ihr Sinnen und Trachten zufällig andersgeartet sein sollten – ihren Blick hinaus in den Garten schweifen lassen, der sich gerade jetzt hinter der Fensterscheibe als schwarzes Viereck offenbarte.
Ich sagte: »Was für ein schönes Zuhause, Frau Frimann-Clausen!«
»Naja«, meinte sie, gewissermaßen gurrend aus einer fast perfekten Siebziger-Jahre-Küche, die sie sofort angepeilt hatte, »hier hätte schon längst renoviert werden müssen, aber Sie wissen ja, wie das ist …«
Und das wusste ich ja.
»Setzen Sie sich doch einfach, der Kaffee ist gleich fertig.«
Das tat ich also. Ich setzte mich, während ich vorgab, mich in den Anblick der verschiedenen Personen auf den vielen Fotografien zu vertiefen, ehe mein Blick an einem großen Gemälde rechts vom Fernsehapparat haften blieb, es stellte etwas dar, bei dem es sich um ein Mittsommerfest irgendwo in Westnorwegen handeln konnte, Tanz und Spaß und Spiel, und ein großes Feuer, das sozusagen an der Sommernacht leckte.
Ob ich denn wohl kunstinteressiert sei?
Sie kam mit einem Tablett mit einer Thermoskanne hereingefegt. Stellte Tassen und Untertassen und Zucker und Sahne auf den Tisch, so etwas nehme ich nicht, aber nun ging mir auf, dass ich es diesmal doch tun würde. Zucker und Sahne nehmen.
Jetzt war ich damit an der Reihe, naja zu sagen. Und ich fügte hinzu, wenn unter »kunstinteressiert« zu verstehen sei, sich auf nichtprofessionellem Niveau an Kunst zu erfreuen, dann könnte eine solche Charakteristik vielleicht einigermaßen auf mich zutreffen. Es mache mir große Freude, ab und zu eine Gemäldeausstellung zu besuchen.
»Ja, das hat mein Onkel Ole gemalt«, sagte sie und nickte in Richtung des funkensprühenden Feuers.
Sie zeigte darauf. »O Slettan.« In Rot. Unten in der rechten Ecke.
Wirklich? Hatte sie denn selbst auch etwas von … dieser Ader?
Nein, jetzt solle ich aber aufhören. Und ich könne doch wohl sehen, dass es sich nur um eine hoffnungslose Astrup-Kopie handelte.
Jetzt lachten wir zum ersten Mal zusammen, und in Gedanken bedankte ich mich bei Onkel Ole.
Der übrigens die Silbertanne ganz unten im Garten gepflanzt hatte. Frau Frimann-Clausen zeigte hinaus in die Dunkelheit. Worauf ich beifällig nickte.
Kurz gesagt, eine feine Eröffnung, gänzlich ohne irgendwelche Misstöne, wenn ich von den belegten Broten absehe, die nicht existierten, es gab stattdessen ein Stück Sandkuchen ohne Rosinen, aber ich tröstete mich damit, dass ich mir am Morgen Reiseproviant geschmiert hatte, zwei Brote mit Käse und eins mit Ei und Sardellen, sie befanden sich im Koffer, zusammen mit Schlafanzug und Pantoffeln und mit dem grünen Strickpullover.
Wir konnten uns sehr bald auf das Allermeiste einigen. Erstens: Gegenseitigen Respekt. Was in der Praxis bedeutete, »sich nicht gegenseitig die Bude einrennen«. Distanz wahren. Das kam mir wie gerufen. Ich erklärte ihr, die Fähigkeit, eine respektvolle Distanz zu meinen Mitmenschen zu wahren, sei etwas, das mir ganz einfach angeboren sei, eine Eigenschaft, die in meinen Genen liege. Wenn sie eins nun wirklich nicht zu befürchten habe, dann meine Einmischung in ihr Leben und ihre Zeit, ich wisse es ganz besonders zu schätzen, dass auch sie nicht allzu viel Zeit in meinem Leben verbringen würde, auch wenn mein erster Eindruck von ihr ja durch und durch positiv war, aber das behielt ich natürlich für mich. Stattdessen betonte ich, dass in meinem Leben die Tage und Nächte ganz einfach mit Arbeit mannigfacher Art gefüllt seien. Ich verfügte unter anderem über ein umfassendes Archiv, das große Ansprüche an mich stellte, und dabei war das Alleinsein nicht nur eine große Hilfe, sondern geradezu eine Voraussetzung dafür, dass mir diese Aufgabe gelang. Sie hörte mir mit ernster Miene zu, während sie mich mit ihren neugierigen Nagetieraugen beobachtete, und als sie rasch einwarf, dass sie um halb elf Uhr abends Ruhe im Haus haben wollte, wenn auch mit Ausnahme von »normalen Fernsehgeräuschen«, konnte ich scherzhaft erwidern, dass unten bei mir bereits morgens um halb elf Ruhe herrschen werde. Ich sei ein Mann der Ruhe, das werde sie bald genug erfahren, sie dürfe nur nicht glauben, ich liege da unten und sei tot, wenn sie zwei Tage lang nichts von mir hörte. Darüber musste ich lachen und sie ein Lächeln andeuten, ehe sie unsere Kaffeetassen ein weiteres Mal füllte. Dann sei da noch eine Kleinigkeit. Das Internet funktioniere derzeit nicht. Es werde jedoch innerhalb der nächsten Tage in Ordnung gebracht werden. Was mir eine hervorragende Gelegenheit zu einem Plädoyer für das Papierbuch gab. Wir hatten ganz einfach einen angenehmen Abend. Sie bestand darauf, dass ich sie von nun an, also von unserem allerersten Abend im selben Haus, Annelore nennen sollte. Und wer dieses Angebot gern annahm, das war ich, Elling.
Dann sei da noch die Sache mit dem Garten. Wie ich sicher bemerkt hätte, liege das Haus an einem Hang. Ich antwortete, das hätte ich bei meiner Ankunft gesehen. Hervorragend, meinte sie, um die kleine Hecke am Tor und um das Staudenbeet werde sie sich selbst kümmern, aber es sei doch ihr Wunsch, dass ich den unteren Teil des Gartens übernähme, also die Rasenfläche und die drei Johannisbeersträucher, die alten Apfelbäume könne ich dagegen vergessen, die trügen kaum noch, Rasenmäher und andere Gartengeräte könnte ich in der Sigurdsbude finden.
In der Sigurdsbude?
Wieder ging es zum Fenster, wo sie in die Dunkelheit hinauszeigte.
Und richtig. Ich erspähte für einen Moment ein budenhaftes Gebäude draußen im Garten. Ich hatte schon begriffen, dass dieser Abend einer von der Sorte war, an die ich mich noch oft erinnern würde, und zwar mit Freude und Wehmut gleichermaßen.
Aber die Sigurdsbude?
Und nun war sie diejenige, die von Wehmut erfüllt wurde. Nach nur wenigen Sekunden saß ich mit dem gerahmten Hochzeitsbild in den Händen da, das junge Paar, sie schaute aus strahlenden Augen zu ihm auf, er hatte einen etwas zerstreuten André-Bjerke-Blick, er schien hinter dem Rücken des Fotografen mystische blaue Gipfel zu erspähen. Gab es ein Leben nach dem Tod?
Diese Bude habe Sigurd gebaut, erklärte Annelore, für den Fall, dass ich das noch nicht begriffen hätte, und in diesem Glauben ließ ich sie mehr als gern. Auf einem anderen Foto, das sich auf demselben Beistelltisch befand, starrte er uns mit Kirkeby-Brille und einer geraden Pfeife, wie der Vater von Dennis sie hatte, geradewegs ins Gesicht.
»Ein flottes Mannsbild!«, ich fügte hinzu: »Ein flottes Paar!«
Ja, vielen Dank für dieses Kompliment, er sei ein lieber Mann gewesen, es war der Krebs, und das ganze Leben in derselben Anwaltskanzlei, ja, auch in derselben Loge, übrigens. Und dann gebe es noch etwas, worüber sie nicht so gern spreche, das sich aber nicht unter den Teppich kehren oder totschweigen lasse, und das sei die Kiefernhecke.
Wieder ging ich mit ihr ans Fenster, und abermals wurde in den dunklen Garten gezeigt. Nach einer Weile ging mir auf, dass besagte Kiefernhecke ein Teil der Dunkelheit war, die die Sigurdsbude jetzt teilweise versteckte, und mitten in der Kiefernhecke konnte ich auch das Licht von einem Fenster im Nachbarhaus ahnen, es sah aus wie ein trübes gelbes Auge im tiefen Schwarz.
Diese Hecke gehöre Meijer, mit ij, sie betonte das gewaltig, und der Odem von dreißig Jahren nachbarlichem Zwist schlug mir entgegen wie ein eiskalter Wind, aber dann teilte sie einfach mit, die Hecke dürfe unter gar keinen Umständen beschnitten oder berührt werden. Es war spielerisch leicht zu verstehen, dass ich nicht zur Teilnahme an ihrem Krieg eingeladen wurde, aber dass ich, als neuer Hausbewohner, doch über den Frontverlauf im Bilde sein müsste.
Jetzt wusste ich es also.
Sie hatte vor Gericht verloren. Zu Lebzeiten Sigurds wäre das niemals passiert, aber so war das Leben und so war der Tod. Karsten Meijer arbeitete im Außenministerium. Und den Rest könnte ich mir ja wohl denken.
Das Letzte, worauf wir uns einigten, ehe ich voller Optimismus und Tatendrang die Schlüssel zu den Räumlichkeiten entgegennahm, in denen sich mein neues Leben abspielen würde, war, dass ich an jedem letzten Sonntag des Monats bei ihr essen sollte. Bei dieser Mahlzeit würden wir in einem praktischen und angenehmen Rahmen Dinge zur Sprache bringen, die sich auf das Mietverhältnis und das tägliche Leben im Haus bezogen. Eine hervorragende Alternative dazu, »einander die Bude einzurennen«, da stimmten wir beide überein, und ich sah schon eine gute altmodische Mahlzeit vor mir, serviert auf weißen Porzellantellern mit Goldrand, Kalbsfrikassee, Hammelkohl, geräucherter Schellfisch, leicht gesalzener Kabeljau und Schweinerippe.
Der letzte Sonntag im Monat? Bis dahin waren es nur noch vierzehn Tage. Dann würde der September in den Oktober übergehen. Wir kamen überein, dass es eine ganz hervorragende Idee war.
Zitat: »Denn dann kannst du doch einfach die ganze Mängelliste mitbringen und wir können das gleich alles klären.«
Worauf wir mit wieherndem Lachen voneinander Abschied nahmen und ich in die Dunkelheit hinausglitt und mit ihr eins wurde.
3
Die Sockelwohnung
Der Weg war mir erklärt worden. Ein Irrtum war angeblich unmöglich, und zum Glück stimmte das dann auch. Ich folgte den Schieferplatten zur Hausecke, wo eine gelbe Außenlampe angebracht war. Vermutlich von Sigurd, dachte ich dankbar, und sicher hatte er bei der Planung an jemanden wie mich gedacht. Eine Außenlampe hinten an der Ecke, damit ein eventueller Mieter der Sockeletage sich nicht im Stockfinsteren seinen Weg suchen müsste. Das hier – also, dass er an mich gedacht hatte, ohne auch nur eine Ahnung von meiner Existenz auf Erden zu haben, fand ich rührend. Vor allem im Hinblick darauf, dass er jetzt tot und verschwunden war. Dass wir niemals eine Gelegenheit gehabt hatten, uns zu begegnen, damit ich mich bedanken könnte. Da und dort, als ich gerade um die Ecke bog und die Treppe betrat, auf die mich Annelore Frimann-Clausen vorbereitet hatte, beschloss ich, dass die »Mängelliste«, wie sie das vorhin so scherzhaft genannt hatte, stattdessen eine Liste über alles sein sollte, was ich an meinem neuen Aufenthaltsort zu schätzen wusste. Wenn ich in meinem bisherigen Leben etwas gelernt habe, dann, dass es sich zeitweise lohnen kann, das Suchlicht auf das Positive zu richten. Auf alles, was funktioniert und das Leben leichter macht. Und da Sigurd also in weiser Voraussicht an der Hausecke diese Außenlampe angebracht hatte, fiel das Licht eben auf diese Seite, so dass die Treppe zu meiner Wohnungstür nun strahlend erleuchtet war, sogar an einem dunklen Herbstabend.
Gut gedacht, dachte ich, während ich meinen Koffer auf die Schieferplatten stellte und den Schlüssel aus der Jackentasche zog.
Ich beschloss, mir diese Ankunft einzuprägen. Dafür zu sorgen, dass sie mir in Erinnerung blieb. Nicht, weil ich damit rechnete, dass ich jemals gebeten werden würde, über dieses für mich historische Ereignis zu sprechen, sondern einfach für mich selbst. Wie oft war ich umgezogen, seit ich seinerzeit, in einem Alter von einunddreißig, aus meinem Elternhaus vertrieben worden war? Es kam darauf an, wie ich das zählte. Und was man als neues Heim betrachtet. Ob man beschließt, alle Orte mitzunehmen, an denen man sich über einen gewissen Zeitraum aufhalten musste. Auf jeden Fall, dachte ich, um jetzt nicht stehenzubleiben und über solche Dinge nachzudenken, ist das hier, diese Sockelwohnung, die du im nächsten Augenblick betreten wirst, aller Wahrscheinlichkeit nach dein letzter Aufenthaltsort auf Erden. Diese Erkenntnis stimmte mich feierlich und ehrfürchtig, ich blieb für einen Augenblick stehen und fuhr mit der Hand über die weiß gestrichene Tür. Berührte vorsichtig die Türklinke. Wie oft würde ich durch diese Tür aus- und eingehen, ehe mich der Tod in sein Reich rief? Aus und ein, bei Regen und bei Sonne, bei Schnee und Wind. Sommer, Winter, Herbst und Frühling. In Freude und Trauer. Ich sah mich so deutlich vor mir. Wie ich in Shorts und Sandalen die Treppe heruntertänzelte, und dann wieder mit Mantel und Wollmütze. Auf dem Weg nach und von, wie das Leben nun eben ist. Hier und jetzt: Ein Fremder, der zum ersten Mal diese Tür aufmachen würde. Aber schon in einem oder in drei Tagen: Alltag. Routine. Der Schlüssel, der unbewusst aus der rechten Hosentasche gezogen und automatisch ins Schloss gesteckt wurde. Das vertraute Klicken, das verriet, dass die Tür offen war. Dass ich einfach eintreten könnte. Der sichere Winkel im Dasein, wo die vertrauten Geräusche und Gerüche herrschten. Dort, wo die Stunden vorhersagbar waren.
Aber jetzt. Da steht er. Der Fremde. Eine dunkle Gestalt im Durchgang zwischen dem hohen Bretterzaun zum Nachbargrundstück und der weiß gestrichenen Hauswand. Der groben Grundmauer. Die Füße fest auf die Steinplatte vor der Tür gesetzt. Den Schlüssel in der Hand. Und der unvermeidliche Gedanke: Was, wenn der nicht passt? Was, wenn du den Schlüssel ins Schloss schiebst und dann kannst du ihn weder nach rechts noch nach links drehen? Du steckst fest. Du kannst den Schlüssel auch nicht herausziehen. Wenn du Gewalt anwendest, bricht er ab. Als ob er aus Glas wäre. Andere Menschen haben diese Tür tausendmal geöffnet, aber wenn die Reihe an dich kommt, ja, dann geht es schief. Mit einer solchen Nachricht zu Annelore Frimann-Clausen zurückzukehren, ist ausgeschlossen. Es ist ganz einfach unmöglich. Du auf der Flucht hinunter nach Sandaker und weiter. In freiem Fall in ein Dasein als drogensüchtiger Obdachloser. Der Weg ist kurz. Darüber lesen wir in der Zeitung. Sehen es im Fernsehen. Jede menschliche Zerstörung beginnt mit etwas, das im Ausgangspunkt wie eine alltägliche Bagatelle wirken kann. Dann kommt eins zum anderen. Und dann bricht alles zusammen.
Es ist ein Schlüssel Marke Yale. Es ist ein Schloss Marke Yale. Ich bugsiere den Yale-Schlüssel vorsichtig ins Yale-Schloss. Steht jetzt jemand im Dunkeln bereit und beobachtet mich? So kommt es mir vor. Ich ziehe den Schlüssel vorsichtig wieder heraus. Schleiche mich zur Ecke. Dort liegt der kleine Garten in seiner ganzen steilen Pracht. Dort liegt die Sigurdsbude, halb verschlungen von der Kiefernhecke. Dann gehe ich mit entschiedenen Schritten zurück und schließe ohne weiteres Federlesen die Tür zum Gang auf. Ziehe die Tür hinter mir ins Schloss. Bin endlich zu Hause.
Wohnzimmer mit Küchenecke, eine sogenannte »offene Lösung«. Das gefällt mir. Vor dem einen Fenster zum Garten: ein blau gestrichener Tisch. Zwei Stühle. Das gefällt mir auch. Man kann nie wissen, was die Zukunft im Schilde führt, auch wenn die Zeit langsam zu Ende geht. Vielleicht eines Tages. Zwei. Eine Frau und ein Mann, die hatten einander so lieb. Küche? Ein Spülbecken und eine Kochplatte. Was will man noch mehr? Zwei Platten, ein Backofen mit Platz für ein mittelgroßes Hähnchen. Das ist mehr als genug. Übersichtlich und praktisch. Die Schränke voller Gläser und Teller. Ich scherze mit mir selbst. Sage mit lauter Juxstimme, dass ich erst irgendwann im Frühling spülen muss. Jage mich in die Sofaecke, dann weiter ins Schlafzimmer. Wo ich zuerst einen kleinen Zusammenbruch erleide, ehe ich das Lächeln wieder hervorzwinge. Die Tapete ist aus Kunststoff und stammt aus den achtziger Jahren. Gelb und Braun in Kreisen und Quadraten. Schwarzer Pilzangriff oben unter der Deckenleiste. Fenster? Nein. Doch. Zwei Stück im Format fünf mal fünfzehn Zentimeter. Aussicht auf die Rückseite der Mülltonne. Ich lasse mich auf das Bett fallen, das nach Schimmel riecht, vielleicht nach etwas noch Gefährlicherem. Im Badezimmer mit der Toilette hat der schwarze Pilz seinen Feldzug zum vollen Sieg fortgesetzt, und im Abfluss der Dusche hat jemand seine DNA in Form von Kopf- oder Schamhaaren hinterlassen. Unwiderlegbare Beweise, aber der Täter ist über alle Berge.
Ich weigere mich zu weinen. Ich versichere mir selbst, dass ich hiermit umgehen kann. Ich weiß nur zu gut, was die Alternative ist.
Laufe auf der Stelle. Beruhige mich. Das hier wird ein schönes Zuhause werden. Ein wunderschöner Aufenthaltsort. Meine Höhle. Schlafzimmer ohne Fenster ist Gewöhnungssache. Es wird sich ein Rat finden. Es wird sich für alles ein Rat finden.
Draußen im Gang stehen die Kartons mit meinen Habseligkeiten. Wie versprochen. Und der mit einem Tuch bedeckte Fernseher. Ich trage ihn vorsichtig ins Wohnzimmer und bugsiere den Stecker in die Dose. Minuten später sitze ich in meiner eigenen Wohnküche und sehe irgendeine Fernsehdiskussion. Ohne Laut. Nur sicherheitshalber. Es ist nicht lange nach neun, aber dennoch. Kein Grund, die gute Stimmung aufs Spiel zu setzen, die wir meinem Gefühl nach während der gerade hinter uns liegenden kurzen Begegnung etabliert haben. Sie sitzt doch immerhin jetzt da oben und lauscht. Etwas anderes kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich würde genau dasselbe tun, wenn ich in ihrer Lage wäre. Die Fernsehdiskussion scheint an Tempo zu gewinnen. Der Moderator versucht, die Gemüter zu beruhigen, das aber ohne besonders viel Glück. Schwenk zu einem Marktplatz. Blut. Eine Menge Blut. Zerfetzte Leiber, halb mit Plastikplane bedeckt. Zurück ins Studio. Ton ist absolut unnötig. Leicht, von den Lippen zu lesen. Das hat nichts mit dem Islam zu tun, sagt der mit der Hornbrille. Rein gar nichts. Worauf der, der ein bisschen aussieht wie ein Forscher, oder vielleicht eher wie ein Archäologe, einen zornbebenden Zeigefinger auf eine Person richtet, die nicht mit im Bild ist. Kamera in Bewegung. Vermutlich zu Lars Gule. Aber nein. Eine junge Frau in hellblauem Hidschab. Die sicher etwas über Mackerherrschaft und Brand im Haus des Islam sagt. Der gelöscht werden muss und wird. Der Archäologe nutzt die Gelegenheit, um eine skeptische Miene aufzusetzen.
Doch, wenn ich Annelore wäre, würde ich jetzt unbedingt mit gespitzten Ohren dasitzen, an diesem allerersten Abend mit einem Fremden im Haus. Obwohl der erste Eindruck so absolut ermutigend war. Es ist immerhin ihr Haus. Ich würde denken: Wir werden in den kommenden Jahren schließlich zusammenleben. Es ist sehr wohl möglich, dass er mich nach dem Gehirnschlag finden wird. Wenn ich hilflos im Badezimmer liege. Oder schlimmer: Auf dem Klo. Gebadet in eigenen Sekreten. Es wird nicht länger als zwei Tage dauern, dann kennt er meine Gewohnheiten, und ebenso schnell wird er auf Abweichungen reagieren. Ich werde in meinem dunklen Wohnzimmer sitzen und auf seine Aktivitäten horchen. Um sie besser kennenzulernen.
Schwenk zu einer wütenden Menschenmenge. Bart. Jede Menge Bart. Grüne Flaggen mit seltsamer Schrift. Flammen. Ich schalte um auf Kanal 7. Travel. Indien. Der Ganges, vermutlich. Muntere Frauen, die im grauen Flusswasser bunte Kleidungsstücke waschen. Vermutlich zu den Klängen einer gutgestimmten Sitar. Ich achte nicht auf die Untertitel. Gebe mich den Bildern hin. Eine Leiche treibt vorbei. Jemand wäscht einen Elefanten. Kinder, die spielen und auf den Kameramann zeigen. Das Leben geht seinen endlosen Gang, und vielleicht werden wir im nächsten Leben als Dromedare und Bienen geboren. Habe ich im Küchenschrank nachgesehen? Im Kühlschrank? Nein. Der Kühlschrank, ein praktisches kleines Teil mit eingebautem Tiefkühlfach, ist ganz einfach leer. Dazu gründlich gesäubert. Leuchtend rein. Kalt. Das Tiefkühlfach eisfrei. Gut. Ich versuche mir vorzustellen, wie es wäre, in eine Wohnung mit einem schmutzigen Kühlschrank zu ziehen. Fischblut unten, dazu ein vergessener Brokkolistrunk in voller Schimmelblüte. Ich habe Glück gehabt. Mit dem Schimmelpilz in Schlafzimmer und Bad kann ich viel leichter umgehen. Der ist längst nicht so dreckig. Im Küchenschrank: eine Schachtel Liptons Tee mit acht Beuteln. Und eine Packung Salz. Nicht schlecht, denke ich nun, um dann meinen nächsten Gedanken auf den Proviant im Koffer draußen auf dem Gang zu richten. Bald darauf sitze ich zum allerersten Mal an dem blauen Tisch, mit einer schlichten, aber wohlschmeckenden Brotzeit und einem dampfenden Becher Tee. Aber Moment! Das mittlere Fenster ist ja wohl eine Tür? Wahrlich, wahrlich! Und der Schlüssel steckt von innen und überhaupt. Ich stehe auf der Türschwelle und trinke den heißen Tee. Gleichzeitig nehme ich den frischen Herbstabend in mich auf. Flüstere in die Dunkelheit hinein: Hier wirst du es gut haben. Du hast sogar direkten Zugang zum Garten.
Nun zieht Annelore Frimann-Clausen oben im ersten Stock an der Schnur. Ein sanftes Gurgeln in den Rohren hängt für einige Sekunden gewissermaßen in der Luft, während das Unaussprechliche weggetragen wird, vermutlich unter den Rasen, wo sich der große Tank befindet. Nun gut. Die Herrscherin des Hauses hat ihr Geschäft verrichtet, ob nun Bimmelim oder Bommelom (wie meine Großmutter immer sagte), und macht sich jetzt bereit für die Nacht. Gott segne sie und unser teures Vaterland, denke ich.
Und verwende den Teebeutel ein weiteres Mal.
Ich hasse Verschwendung.
4
Ein gesegnet normaler Supermarkt
Ich träume, ich wäre eingesperrt. Bekäme keine Luft. Im Traum befinde ich mich in einer winzigen Wohnung unter der Erde. Ungeheuer kleine, klaustrophobische Kammern, noch dazu mit Möbeln vollgestopft. Tische, Sofas und Stühle, ich stolpere mit Staub und Schimmel im Mund umher. Ich kann nicht schlucken, ich will um Hilfe rufen, aber das Einzige, was aus mir herauskommt, ist ein fremdes, boshaftes Lachen. Zwischen den kleinen Kammern gibt es ein Netzwerk aus langen engen Gängen, die Wände sind niedrig, ich muss mit einer Art Heroinknick in den Knien gehen, ab und zu muss ich sogar niederknien, jemand ist hinter mir her, ein nach Schweiß stinkender Schatten; etwas haucht mir in den Nacken, ich flehe auf Knien um mein Leben, und darum, nicht ganz und gar den Verstand zu verlieren, oder ist es schon zu spät? Hat die Vernunft mich bereits verlassen? Woher kommt dieses fremde Lachen, das die ganze Zeit durch mich hindurchströmt wie ein Abwässerfluss? Josef Fritzl maskiert als Annelore Frimann-Clausen. Nackt. Verzerrt, mit runzliger Elefantenhaut. Ich selbst gefangen in einem Käfig. Annelore Frimann-Clausen, die aufschließt und die acht Türen zu der Wohnung aufschiebt, in der sie mich gefangen hält, zusammen mit der Tochter Elisabeth, Kellersklavin in vierundzwanzig grauenhaften Jahren, ich ahne die Zeit wie einen kalten Windstoß Revue passieren. Vergewaltigungen. Einsame Geburten. Jetzt hält sie meinen Schwanz in der Hand, und ich merke, dass ich überaus widerwillig wachse und hart werde. Und sie lächelt ohne Zähne, habe ich daran gedacht? Wie gut es ohne Zähne wäre? Nun wecke ich mich selbst, ich vertreibe mich aus diesem Kellerkerker, beschämt und wütend, schweißnass und gehetzt. Und befinde mich auch jetzt in einem fremden Raum unter der Erde, mit einer kräftigen Pilzoffensive oben an der Decke. Ich glaube, den Geruch dieses schwarzen Schleimes wahrzunehmen …
Ich stehe auf und gehe ins Wohnzimmer. Dort wird es besser. Als ich mich umdrehe, sehe ich die beiden winzigen Fenster oben unter der Decke dessen, was mein Schlafzimmer sein soll, was sich aber schon jetzt, in der ersten Nacht, als Fritzl-Zimmer etabliert hat, als Inzestabteilung, denn war dort drinnen nicht auch etwas mit Mutter …
Es ist so ekelhaft. Ich hole mir die Bettdecke und lege mich aufs Sofa. Denke, damit darf ich nicht anfangen, das muss ich in Zukunft einfach vermeiden, denn sonst verliere ich die Hälfte des Platzes in meinem neuen Dasein, ohne dass die Miete deshalb auch nur um eine Krone reduziert wird, aber dann schwebe ich wieder in eine Mischung aus Gedanken und Träumen, jetzt geht es besser, ich laufe über eine Blumenwiese. Auf ein Haus in einem Garten zu, es ist Fiolvei 5, ich weiß das, auch wenn das Haus ganz anders aussieht, jetzt ist Fiolvei 5 eine Art Schloss mit Sälen und Hallen, und in großen Spiegeln an den Wänden sehe ich mich selbst in Gestalt von Annelore Frimann-Clausen, ich bin Annelore, ich besteige einen Thron aus Eis und Kristall, ich fordere die römischen Soldaten auf, umgehend den Gefangenen hereinzuführen, und der bin ich. Elling.
Wache wieder auf. Unruhig. Ach, dieser ganze Unsinn. Warum muss es so sein? Aber im tiefsten Herzen weiß ich das ja. Es ist die Große Veränderung, die irgendwo in mir auf die dicke Trommel schlägt. Ob sie da oben wohl auch wach liegt? Ganz still in der Dunkelheit? Auch für sie war es ein Tag der Umwälzungen. Doch, ja. Alles ist gutgegangen. Der neue Mieter wirkt eigentlich wie ein ordentlicher, ruhiger Mann. Aber das ist es ja gerade. Dass er ein Mann ist. Wäre eine Lehramtsstudentin nicht doch besser gewesen? Was weiß sie eigentlich über Männer in meinem Alter? Ich gehe davon aus, dass sie genug Lebenserfahrung hat, um zu wissen, dass ein Mann von Mitte fünfzig nicht als tot betrachtet werden muss, wenn es um das Sexuelle geht. Gleichzeitig gehe ich davon aus, dass sie in dieser Hinsicht das Handtuch geworfen hat. Ich kann mich irren, aber so sehe ich das. Ich bin überzeugt davon, dass sie nicht dort oben liegt und mich als möglichen Kandidaten für unverbindliche Gemütlichkeit betrachtet. Jedenfalls nicht so. Wanderkamerad, vielleicht. Ein Mieter, den man eventuell mit ins Theater oder auf einen kleinen Ausflug nach Høvikodden locken kann. Aber nicht als Aktivist ins Bett. Andererseits. In unserer Zeit ist kein Ding unmöglich. Das habe ich mit eigenen Augen im Netz gesehen.
Weiß sie übrigens von dem Pilzangriff? Von den biologischen Kriegshandlungen, die sich im Schlafzimmer unter ihr abspielen? Und im Badezimmer? Ich werde kein Wort darüber sagen. Ich werde die Wohnung preisen, wie ich es beschlossen hatte. Vor allem das kleine warme Loch von Schlafzimmer. Was soll man überhaupt mit einem Fenster in einem Zimmer, in dem man nur schlafen wird? Bewusstlos sein? Fort von der Welt?
Ich springe vom Sofa auf, ich stürze ins Badezimmer und reinige den Abfluss in der Dusche mit den Fingern, entferne das widerliche kleine vertrocknete Haarbüschel, werfe es ins Klo, fast ohne es zu merken, es geht so schnell, so schrecklich schnell, ich drehe das heiße Wasser auf und seife mich ein, aber was ist los mit diesen Seifenstücken, die auf den Toiletten in diesem Land herumliegen, in Haus und Hütte, diesen kleinen harten Seifenstücken, die man einfach nicht richtig zum Schäumen bringen kann, jede Menge verfärbter Risse weisen sie außerdem auf, aber vor allem sind sie steinhart und ganz und gar geruchlos, kein Hauch von Duft, und dabei komme ich mir so durch und durch verdreckt vor, nachdem ich diesen elenden Haarstrang angefasst habe, der so voller Bakterien und Dreck war, und ich schrubbe und schrubbe mit dem dysfunktionalen Seifenstück, schleudere es voller Wut weg, sehe vor meinem inneren Auge die halbvolle Zaloflasche beim Spülbecken in der Wohnzimmer-Küchen-Kombination.
Aber am Ende findet sich dann irgendwie doch noch alles. Als ich jedoch die Toilette abziehe, schwimmt das Haarbüschel oben. Zundertrocken natürlich. Ich muss die Zeit arbeiten lassen. Erst richtig Wasser einziehen lassen, ehe ich den nächsten Versuch mache. Denn das ist klar: Jedesmal, wenn ich die Toilette abziehe, schicke ich gleichzeitig ein Signal zu ihr dort oben, dass etwas erledigt ist. Und zum Beispiel jetzt: Dass ich wach und für den Tag bereit bin. Was ich im Grunde nicht bin, da es ja erst halb sechs ist, und da ich gelinde gesagt schlecht geschlafen habe. Als ich abermals unter die Decke auf dem Sofa krieche, höre ich es klar und deutlich. Dass auch ein Stock weiter hoch an einer Schnur gezogen wird. Das gleiche Grummeln in den Rohren wie gestern Abend.
Sie antwortet, denke ich. Dann schlafe ich wieder ein.
Und erwache in einem Meer aus Licht, ja, in der Sonne, die durch frisch geputzte Fenster hereinflutet, sie legt sich über den Boden wie ein goldener Teppich, und das grüne Leuchten des Gartens … Wohin ist die entsetzliche Nacht verschwunden? Die kranken Träume? Die unruhigen Morgenstunden? Der widerliche Strang fremder Schamhaare?
Ich laufe hinüber und ziehe an der Schnur.
Später besteige ich den Thron zum ersten Mal. Hervorragend. Es ist eng hier, man muss sich wegen des Waschbeckens ein wenig zur Seite beugen, aber das macht nichts. Es gibt Schlimmeres auf der Welt, als sich ein wenig zur Seite zu beugen. Das kann ich unterschreiben. Auch diese kleine Eigenheit wird nicht auf irgendeiner Mängelliste zu finden sein, wenn ich in einigen Tagen eine vermutlich ziemlich gute Mahlzeit mit meiner lieben Vermieterin verzehre. Auch die Dusche funktioniert hervorragend, aber es ist klar: Man steht ja dort draußen und fragt sich, wie man sich dem Pilzangriff gegenüber verhalten soll. Ich werde mir etwas einfallen lassen müssen.
Ich trinke zuerst eine Tasse Tee, während ich die handgezeichnete Karte studiere, die ich bekommen habe. Ich habe offenbar die Wahl zwischen zwei Supermärkten. Der eine, eine Spar-Filiale, liegt gleich die Straße hinunter. Und dann haben wir unten im Sandaker-Center einen Coop. Letzterer wird die erste Wahl sein, wenn der Herr sich zusätzlich zum eigentlichen Einkauf auch einen soliden Spaziergang wünscht.
Aber das wäre heute kaum das Richtige, da leere Schränke und Regalfächer darauf warten, mit Grundnahrungsmitteln gefüllt zu werden. Heute ist der Nah-Spar angesagt, danach ein schneller Rückzug, ein spätes Frühstück und dann trautes Heim.
So sieht der Plan aus.
Aber zuerst einen guten Becher Tee, abermals anonym spendiert, vermutlich von meinem Vormieter oder meiner Vormieterin, vielleicht war diese Person ja auch mit Annelore verwandt, was weiß denn ich. Hier gilt es jedenfalls, die Fenster und die Tür zum Garten geschlossen zu halten, wenn man selbst nicht anwesend ist. Ein Heim auf Bodenniveau ist trotz allem mehr gefährdet als ein etwas weiter oben gelegenes. Andererseits würde schon einiges dazugehören, wenn ein Außenstehender mich hier unten in meinem Eckchen entdeckte. Die Wohnung ist von Straße und Bürgersteig her nicht zu sehen, und sie ist durch den Garten sehr schwer zugänglich, wegen des großen Steinbeetes, das die Witwe am Hang angelegt hat. Der einzig logische Weg in meine Wohnung hier in der Sockeletage ist die Treppe, die ich selbst gestern Abend hinuntergestiegen bin. Dann aber muss man an Annelores Küchenfenster vorbei. Und da der Bereich zwischen Gartentor und Haus von Kies bedeckt ist, würde sie sicher sofort gewarnt sein, selbst, wenn sie sich hingelegt hätte oder vor dem Fernseher säße.
Denke ich.
Streife die Pantoffeln über und öffne die Tür zum Garten.
Schon gefällt mir diese Abkürzung. Direkt in den Garten, aus dem eigenen Heim. Ich verstehe sehr bald, dass das Sonnenfunkeln, zu dem ich erwacht bin, das einzige dieses Tages ist. Hier draußen herrscht eine schöne Dunkelheit. Die massive Kiefernhecke, die den Meijern gehört, steht da wie ein zerzauster Riese. Gut. Dann brauche ich diese Leute nicht zu sehen. Es wäre nicht besonders lustig, ohne diese Hecke hier draußen zu wohnen. Dann hätten sie zu mir hereinschauen können. Und ich zu ihnen. Ich weiß nicht, was schlimmer gewesen wäre. Dass die nämliche Hecke die Sigurdsbude mehr oder weniger verschlungen hat, ist nicht meine Sache.
Ich drehe eine Runde durch das feuchte Gras. Johannisbeersträucher, wie versprochen. Hier und dort hängt noch eine Beere im gelben Blattwerk. An einem Apfelbaum: ein einzelner grüner Apfel. Die anderen Bäume sind nackt.
War da eine Bewegung hinter dem Wohnzimmervorhang oben?
Möglicherweise.
Sicherheitshalber schlendere ich wieder ins Haus. Es steht nicht fest, ob es ihr gefällt, wenn ich Tassen und Teller in den Garten hinausschleppe.
Ab und zu überkommt sie mich. Eine Mutlosigkeit. Im Laufe der Jahre hat sich vieles verändert, aber gerade diese Mutlosigkeit scheint ein Schatten zu sein, der mir bis ans Ende des Weges folgen wird. Da stehe ich so froh und zufrieden und schließe die Tür hinter mir zu, ich genieße das leise Klicken des Schlosses, versuche es einmal, zweimal, dreimal, die Tür ist abgeschlossen, das ist gut, ich nehme die Treppe in Angriff, aber als ich die Hausecke erreiche, ist Schluss.
Ich habe keine Lust, an Annelore Frimann-Clausens Küchenfenster vorbeizugehen.
Ich habe ganz einfach keine Lust.
Warum? Es hat etwas mit … Ich weiß nicht. Doch. Natürlich weiß ich es. Es liegt daran, dass ich weiß, dass sie von der Sorte ist, die im Halbdunkel steht und wartet. Wie gestern Abend. Die Tür ging ungefähr in dem Moment auf, in dem meine Fingerspitze den Klingelknopf berührte. Sie hatte gehört, wie ich das schmiedeeiserne Tor öffnete. Gleich darauf meine Schritte im Kies. Sie war bereit. Sie stand mäuschenstill da und wartete.
Gibt es denn einen Grund, warum sie nicht gehört haben sollte, wie ich die Wohnung unten im Haus verlassen habe? Nein, natürlich nicht. Diese Wohnung hat eine ganze Weile leer gestanden, das weiß ich. Der ehemalige Mieter, wer immer es gewesen sein mag, hat sie in totaler Einsamkeit zurückgelassen. Er (ich gehe davon aus, dass es ein Mann war, denn so wie ich das sehe, würde sich eine Frau preisgegeben fühlen, unsicher in einer Wohnung, wo sich fremde Männer in der Nacht verstecken und einfach hereinschauen können) hatte seine häuslichen Geräusche mitgenommen und sich zu einem anderen Aufenthaltsort weiterbegeben. Und da sitzt sie nun, geblendet von der plötzlichen Leere des Hauses. Nicht der Stille, denn alle Häuser haben ihre Geräusche, da ist der Wind, der die Zweige der Bäume über die Wände streichen lässt, es gibt plötzliches Sickern und Seufzen, es gibt Gurgeln in der Dachrinne. Nein, keine Stille, sondern Leere. Das Fehlen der Geräusche, die von einem anderen Menschen aus Fleisch und Blut stammen. Aber dann vergehen die Tage und die Wochen und die Monate, und sie gewöhnt sich daran. Das ist doch der große Segen des Menschen, jedenfalls ein großer Segen. Dass wir, egal was passiert, uns daran gewöhnen.
Und dann plötzlich, gerade, als sie dieses Fehlen akzeptiert hat, ja, da kommt ein anderer Bursche des Weges. Es ist doch klar, dass es ihr auffällt, wenn er zum allerersten Mal die Tür hinter sich abschließt und sich bereit macht zu einer Einkaufsrunde.
Na und, sagt jetzt vielleicht der Einfühlungslose. Wenn sie am Küchentisch sitzt oder von mir aus auch mitten im Zimmer steht. Kannst du denn nicht einfach am Fenster vorbei und zum Tor hinausgehen? Es ist doch sogar möglich, ihr frisch und fröhlich zuzuwinken?
Tja. Wenn mich das Leben etwas gelehrt hat, dann, solche Fragen lieber nicht zu beantworten. Nicht einmal dann, wenn ich selbst sie gestellt habe.
Es geht ja vorüber. Im einen Augenblick ist man total erschlagen, dann aber zählt man zweimal bis tausend und sagt seinen Namen rückwärts. Und schwupp. Man setzt sich in Bewegung und wirft nicht einen einzigen Blick ins Küchenfenster. Zieht das schmiedeeiserne Tor ordentlich hinter sich zu. Mit der Karte in der Hand, mit der Hand in der Manteltasche. Ein herrlicher Tag. Hier oben auf Straßenniveau scheint die Sonne. Ich beschleunige auf dem Weg in den neuen Tag. Häuser und Gärten flimmern vorbei, Grefsen hat etwas Solides und zugleich Zurückhaltendes. Der Geruch von altem Geld liegt in der Luft, es ist fast ein bisschen seltsam, dass ich zu einer Spar-Filiale unterwegs bin und nicht zu einem Feinkostladen, aber andererseits und zum Glück: Spar passt um einiges besser zu mir.
Und abermals: Wie oft werde ich diesen Laden aufsuchen, ehe meine Zeit auf Erden vorüber ist? Man tritt zum allerersten Mal ein. Es ist natürlich ein Ereignis. Der Einfühlsame kennt sich mit solchen Dingen aus. Dort, wo der oberflächliche Grobklotz nur einen ganz gewöhnlichen Supermarkt sieht, erblickt der Einfühlsame eine heilige Handelsstätte, einen Ort, an dem Geld gegen lebensnotwendige Waren eingetauscht wird. Hier findet sich die eigentliche Grundlage für die alltägliche Nahrungsaufnahme, von der wir allesamt, unabhängig von Geschlecht und Zivilstand, abhängig sind. Hier, hinter den funkelnden, frisch geputzten Glastüren, ist die eigentliche Quelle zu finden, und das noch dazu in der fast unvorstellbaren Vielfalt der modernen Gesellschaft. Denn wir finden hier drinnen nicht nur unsere Kost, und das in allen erdenklichen Varianten, sondern auch Mittel zur Sauberhaltung von Böden, Wänden und Decken, Zähnen und Mundhöhle, Klosett, Fenstern und Kochplatten, Besteck, Geschirr und Gehörgängen. Nach kurzem Überlegen wird das sogar der Oberflächlichste begreifen: dass im Grunde nicht Kirche oder Moschee das Allerheiligste in unserem Alltag repräsentieren, sondern der Supermarkt, in dem wir jeden Tag alles einkaufen, was nötig ist, um das Leben, das Gott oder physische und chemische Zufälle uns zugeteilt haben, zu erhalten und zu pflegen. Ja, eigentlich müsste vor dem Eingang zum Supermarkt ein Gebetsteppich liegen, wo man jeden Tag niederknien und seine vielen Sünden und Verfehlungen bekennen könnte, um dann, geläutert und von Schuld befreit, eintreten und seine Geschäfte tätigen könnte. Nicht mit Priestern und Kardinälen oder Imamen und heiligen Männern, die in Indien Hasch rauchen, sondern mit Männern und Frauen, die nach dem Abitur nicht studiert, ja, die nicht einmal Abitur gemacht haben, sondern die sich Nylonkittel überzogen und geradewegs ins Arbeitsleben eintraten, nicht, um die Karriereleiter hochzusteigen und anderen auf Finger und wehe Zehen zu treten, sondern schlicht und ergreifend, um Regale einzuräumen, um Paletten oder Kartons ins Lager oder aus dem Lager zu tragen, und nicht zuletzt, um die Waren in die Kasse einzugeben, um Geld und Plastikkarten entgegenzunehmen und dafür zu sorgen, dass die Kundschaft, wir anderen, ihr Wechselgeld erhält, oft mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen. Ich kann mich noch an die Kassiererinnen im Zentrum in der Satellitenstadt erinnern, wo ich aufgewachsen bin. Sie erschienen mir als die Tanten, um die die Wirklichkeit mich betrogen hatte. In allen Jahren begleitete ich meine Mutter auf ihrem festen Samstagseinkauf, als kleiner Junge, der noch kaum gehen konnte, und als erwachsener Mann, der seiner Mutter auf ihren allerletzten Runden beistand; inzwischen hatte ich die Einkaufskarre übernommen und Mutter trottete hinter mir her. In meinen Gedanken und Phantasien waren die Kassiererinnen und die Männer, die die Regale aufräumten, Mitglieder eines verschworenen Clans, einer Sekte, die Supermarkt oder Einkaufszentrum niemals verließen, sondern eine Art geheimnisvolles Campingdasein draußen in den großen Hallen fristeten, die man ab und zu hinter den schweren Plastikportieren für einen Moment sehen konnte, die Räume, in denen nach geheimen Systemen mit Gas betriebene Wagen Butter und Milch und Käse palettenweise hin und her frachteten, und wenn die Nacht sich über sie senkte, zündeten sie Feuer an, während die Tanten und die Aufräumjungen und die Männer, die oft ein wenig seltsam waren, mit langen Hälsen und Ohren, um das Lagerfeuer Ringelreihen tanzten, während andere Gitarre spielten und noch andere ihre Kastagnetten klappern ließen. Bis sich die Sonne über den Horizont erhob und es abermals Zeit wurde, Büchsen mit Makrele in Tomate und Kartoffeleintopf in die Regale zu stapeln. Ja, so vergingen die Tage und so vergingen die Jahre, und hier kauften alle Menschen aus unserem Block ein, und auch alle Menschen aus den anderen Blocks, wir aßen das Gleiche und wuschen mit Zalo ab, und niemand fand das auf irgendeine Weise seltsam, und es ist ja durchaus möglich, dass es auch nicht seltsam war, es kommt darauf an, wie philosophisch man veranlagt ist.
Ich schlendere zwischen Regalen und Kühltresen, und ich bade in einem guten, Geborgenheit schenkenden Gefühl: Es sind die Segnungen der Ketten, die sich jetzt geltend machen. Alles neu, neue Winkel, neue Raumlösungen, und dennoch so wunderbar vertraut für einen wie mich, der schon länger einen Überblick über die Angebote bei Spar hat, über deren Vorzüge und Schwächen; man kann sich einfach klarmachen, dass alles stimmt. Das Angebot an Frischfleisch und -fisch ist zwar etwas bescheiden, aber die Auswahl in Gefriertruhe und -fächern ist mehr als gut genug für jemanden, der normalerweise nicht rund um die Uhr jammert und klagt. Ich registriere zudem ein nicht unwichtiges Detail: Hier herrscht eine ruhige und höfliche Stimmung. Es ist zwar erst halb zehn, aber dennoch. So etwas merkt man. Hier oben auf dem Hügel hat man keine hektischen U-Bahnpendler bei der Kundschaft, hier herrscht aller Wahrscheinlichkeit nach auch während der Arbeitszeit Ruhe. Eine Annahme, die mehr oder weniger bestätigt wird, als ich sehe, mit wem zusammen ich einkaufe. Hausfrauen in verschiedenen Altersstufen. Mit und ohne Kinder. Solche, die das Essen auf den Tisch stellen, wenn der Mann von der Arbeit kommt, so, wie es in meiner Kindheit Sitte und Brauch war, auch wenn wir bei uns zu Hause am Tisch keinen Gatten und Vater vorweisen konnten. In Grefsen ist es noch immer so. Denke ich. Und amüsiere mich bei der Vorstellung, was passieren würde, wenn ich das laut ausspräche, es in die rosa Gehörgänge flüsterte, von denen ich hier umgeben bin.
Ich lege Grundnahrungsmittel in den Wagen. Milch. Margarine. Ein dickes Stück Gouda. Eine Packung Pfeffersalami. Und so weiter.
Auf einen Impuls hin bleibe ich bei einem vertrauenswürdig aussehenden Mann stehen, der auf Knien liegt und Seifenpulverpackungen ins unterste Fach stellt. Er schaut ein wenig verängstigt zu mir hoch, als ich einfach anhalte und keine Anstalten mache, weiterzugehen.
Um die Lage nicht schwierig zu machen, frage ich freundlich, ob er sich vielleicht mit Schimmelpilzen und solchen Dingen auskennt.
»Schimmelpilzen?« Er erhebt sich zögernd.
Ich erkläre, dass ich in eine etwas unangenehme Situation geraten bin. Habe eben gleich hier um die Ecke ein Haus gekauft. Und jetzt stellt es sich heraus, dass die Mieterin in der Sockelwohnung im Badezimmer Pilzbefall entdeckt hat. Ich werde das natürlich dem Makler und dem ehemaligen Besitzer gegenüber zur Sprache bringen müssen. Aber was tun? Die Mieterin ist eine alte Dame. Ich will sie ja nur ungern warten lassen, und man kann doch nicht jedesmal, wenn etwas schiefgeht, Polen anrufen …
Wir wiehern jetzt beide. Das hier ist ein guter Supermarkt.
»Die Frage ist ja, ob Sie zu einem Fachgeschäft müssen«, sagt er zögernd. »Wie sieht das denn aus?« Er zieht sein Smartphone hervor.
Ich beschreibe den Pilz. Schwarze Punkte, die an einzelnen Stellen zu einer kompakten Masse zusammengewachsen sind. Ein bisschen wie Gelee. Glitschig.
»Ach, du meine Güte. Scheint ja echt Mist zu sein. – Und wir haben hier wie gesagt kein Spezialmittel gegen sowas … Mal sehen … Schimmelpilz … Ja. Sieht wirklich aus, als hätten Sie Schimmelpilz erwischt, ja.«
Ich erkläre, dass ich den Schimmelpilz nicht erwischt habe, sondern dass selbiger die ganze Zeit schon da war. Und dass der ehemalige Hausbesitzer ihn mir unterschlagen hat. Verschwiegen. Getarnt.
»Ja, ja. Egal wie. Das müssen Sie in Ordnung bringen. Kann für Atemwege und Augen gleichermaßen schädlich sein. Unnormale Müdigkeit. Kaum das Richtige für eine alte Dame.«
Ich spüre, wie sich meine Kehle zusammenschnürt.
»Aber Moment mal, hier steht, Sie können es mit Chlor versuchen.«
»Mit Chlor? Aber ist das denn nicht gefährlich?«
»Das ist nichts, was man sich so mal kurz hinter die Binde gießt, das nicht, nein. Gummihandschuhe. Führen wir auch. Und dann müssen Sie auf Ihre Augen aufpassen.«
Er wird jetzt dominierend und belehrend. Ich bin schon mein ganzes Leben lang von dieser Sorte von Männern umgeben. Solche, die wissen, wie alles Mögliche in Ordnung gebracht werden kann. Die wissen, wie es auf der Rückseite deines Kühlschrankes aussieht. Willst du dich hier etwa bei mir einschmeicheln, denke ich. Daraus wird aber nichts. Ich interessiere mich nämlich nicht für Pilzbefall, und für Fliesenlegen im Bad auch nicht. Aber das tut dieser Bursche. Das steht fest. Wenn ich diesen Mann frage, ob er Segen der Erde gelesen hat, wird er mich für schwul halten.
»Kaufen Sie immer hier ein?«
Ich: »Warum?«
»Ich kann mich mal für Sie erkundigen, wenn Sie wollen. Aber ich schlage auf jeden Fall vor, dass Sie es zuerst mit Chlor versuchen.«