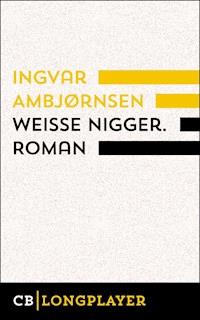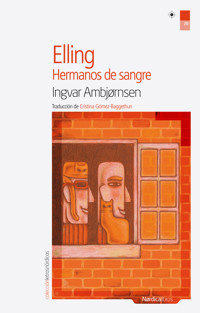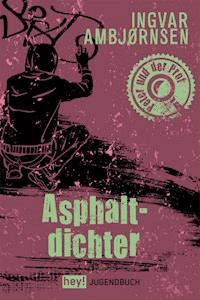Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ulf Vagsvik hat mit seinem früheren Leben gebrochen, mit leichtem Gepäck Oslo verlassen, sich diesen neuen Namen zugelegt und einen Hut gekauft. Den Hut wird er zwar sehr bald verleugnen, aber als er auf die kleine Insel in Nordwestnorwegen kommt, wo seine Brieffreundin Berit wohnt, da kommt er, um zu bleiben. Er scheint auf Vaksoy Frieden gefunden zu haben. Doch bald wird die kleine Inselgemeinschaft dramatische Dinge erleben. Eine niederländische Familie hat ihre Ankunft auf der Insel angekündigt. Hier sind neue Steuerzahler sehr willkommen, und so richten die Bewohner liebevoll das alte Schulhaus für die van der Klerks her. Beim großen Empfang mit Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus jedoch tritt die Katastrophe ein und die Idylle bricht zusammen. Ulf wird gezwungenermaßen zum Vertrauten des zwölfjährigen Tom van der Klerk - was ihm seine eigene Vergangenheit näher bringt, als ihm lieb ist. Den Oridongo hinauf ist ein wunderschöner und verstörender Roman über eine Gemeinschaft, die von dramatischen Ereignissen heimgesucht wird - und eine ganz besondere Liebesgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INGVAR AMBJØRNSEN
DEN ORIDONGO HINAUF
ROMAN
AUS DEM NORWEGISCHEN VON GABRIELE HAEFS
EDITION NAUTILUS
Die Originalausgabe des vorliegendenBuches erschien unter dem TitelOpp Oridongo, © Cappelen Damm, Oslo 2009
Die Übersetzung aus dem Norwegischenwurde durch NORLA finanziell unterstützt.
Edition Nautilus Verlag Lutz SchulenburgSchützenstraße 49 a · D-22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten · © Edition Nautilus 2012
Deutsche Erstausgabe Februar 2012
Umschlaggestaltung: Maja Bechert, Hamburg
www.majabechert.de
Druck und Bindung:
Freiburger Graphische Betriebe
1. Auflage
Print · ISBN 978-3-89401-750-7
E-Book · ISBN 978-3-86438-066-2 (ePub)
ISBN 978-3-86438-067-9 (PDF)
Teil I
1
Um diese Tageszeit, wenn der Nachmittag zum Abend wird, kann ich die Schiffe der Hurtigrute draußen in der Dunkelheit zwischen Skarven und der Insel vorübergleiten hören. Und ich liege hier in meiner eigenen Dunkelheit, den Kopf unter der Decke und die Augen geschlossen. Hier liege ich und döse vor mich hin und lausche den gewaltigen Schiffsmotoren und dem Wind. Der singt im Draht, der das Haus festhalten soll, wenn wieder ein Orkan wütet. Ein seltsames Stück Musik. Es ist nicht schön, aber es ist stark und beruhigend. Wenn ich die Hand unter der Wärme der Decke hervorstrecke und die kalte Wandtäfelung berühre, spüre ich, wie das Haus leise vibriert. Es scheint unter meinen Fingerspitzen zu leben. Es tut mir gut zu denken, dass das Haus lebt, da soll dieser Einfall so banal und dumm sein, wie er nur will, denn ich habe nicht vor, andere mit solchen Gedanken zu belästigen.
Und ich sehe das Schiff vor mir, wie es jetzt durch den Sund nach Norden weiterfährt, wie es in der Herbstdunkelheit leuchtet, wie die Gesichter sich hinter den Fenstern von Restaurant und Kabinen dem Land zuwenden, jemand schaut in den schwarzen Nachmittag hinaus, und vielleicht erfassen einzelne dieser Augen den Umriss unseres Hauses hier im Inneren der Bucht, vielleicht sogar den Umriss von ihr, die unten im halbdunklen Wohnzimmer steht, die eine Hand auf die Fensterbank gestützt, so steht sie nämlich jeden Tag da, wenn die Hurtigrute auf dem Weg nach Norden vorüberkommt, so steht sie in dem halbdunklen Wohnzimmer und stützt sich mit einer Hand auf die Fensterbank, eine magere Hand zwischen Topfblumen und Kerzen. Das weiß ich, das kann ich klar vor mir sehen, denn oft stehe ich mit ihr zusammen dort, stehe hinter ihr, eine Hand auf ihrer Schulter, oder vielleicht sogar eine Hand auf ihrer Hüfte, so stehen wir da und sehen die vielen Lichter der Hurtigrute langsam in Richtung Ozean verschwinden, ehe sie hinter Nabben dann plötzlich erlöschen.
Ich liege da und schlafe ein und wache auf, stelle die Wirklichkeit auf den Kopf, während Traumbilder sich mit meinen Gedanken verflechten, und wenn das Geräusch der Schiffsmotoren sich in der Ferne verliert, wird das schmale Bett, in dem ich liege, zu einem anderen Bett an einem anderen Ort, zu einer Pritsche, und das Zimmer wird zu einer Kajüte umgeträumt, ehe das Geräusch der Motoren wieder durch meine Gehörgänge pocht, ich fahre den Oridongo hinauf, den düsteren Strom hinauf, und es ist so heiß und feucht und hämmernd einsam, so erfüllt von Krankheit und Sehnsucht, und wenn die Motoren ausgeschaltet werden, kann ich daliegen, die Hände vors Gesicht geschlagen oder zwischen die Oberschenkel geschoben, und dem Geplapper der Vögel des Dschungels lauschen, oder Lachen und Weinen aus den anderen Kajüten und von Deck, laufenden Füßen, dem Klang von Trommeln, weit, weit weg, ich kann einfach ganz still daliegen, und Sekunden, Minuten und Stunden zerbrechen.
Auf diese Weise bekomme ich eine gute Beziehung zur Zeit.
Zur geträumten und zu der, die in der Welt der Wachen herrscht.
Später gehe ich in die Küche hinunter und setze Kaffeewasser auf. Schneide zwei Stücke vom Kringel ab und bringe sie auf einer Untertasse ins Wohnzimmer.
Berit sitzt im Schaukelstuhl, das Kinn auf der Brust. Ihr Tuch ist heruntergeglitten, es liegt zerknüllt auf dem Boden. Sie behauptet, niemals Mittagsschlaf zu halten, aber hier haben wir sie in ihrer ganzen bewusstlosen Pracht! Wenn ich mich nur erinnern könnte, wo ich die IXUS hingelegt habe, dann würde sie es selbst sehen. Aber es ist ja auch so, dass sie durchaus auf die Idee gekommen sein könnte, das Zeitliche zu segnen. Statt also nach dem Fotoapparat zu suchen, stelle ich die Untertasse auf den Tisch neben der Seekiste und beuge mich über sie. Die Halsschlagader pocht … ich hebe das Tuch vom Boden auf und lege es vorsichtig um ihre Schultern.
Und dann wacht sie auf, natürlich.
Im Licht der vielen Kerzen sehe ich, wie sie das rechte Auge öffnet, dann das linke, während sie mich zugleich anlächelt, und ich kann es nicht erklären, ich weiß nicht, warum, aber ich verbinde diesen Blick und dieses Lächeln immer mit etwas »Schwedischem«, ihr ganzes Gesicht hat gleichsam etwas Schwedisches, wenn sie so dasitzt und listig und ein wenig geheimnisvoll aussieht. Die grauen, lebhaften Augen. Das schmale Gesicht. Die geschwungenen Lippen.
Und natürlich hat sie nicht geschlafen. Sie schläft nachts, kann sie mitteilen. Nicht tagsüber.
Ich bin es, der tagsüber schläft.
Sie hat mich durch die Wohnzimmerdecke schnarchen hören.
Ob ich geträumt habe?
Offenbar habe ich auch ein wenig gewimmert.
Darauf antworte ich weniger als nichts. Ich gehe in die Küche und gebe Kaffee in die Kanne. Vier Maße. Nicht mehr und nicht weniger.
Ich kann hören, wie sie aufsteht und durch das Wohnzimmer geht. Ein wenig später, wie sie sich am CD-Gerät zu schaffen macht, ehe sich Miles Davis’ »In a Silent Way« weich über das Zimmer legt.
Dann sitzen wir im Halbdunkel mit unseren Kaffeetassen da und lauschen dieser Musik, die es noch vor wenigen Jahren in meiner Welt nicht gegeben hat, diesen fremdartigen Tonfolgen, und den Musikern, die sie in mein Leben eingebracht hat, Miles Davis, Wayne Shorter, Herbie Hancock und die vielen anderen, und als das Stück Kringel verzehrt ist, schiebe ich mir einen Priem ein, eine Prise, sie liegt salzig und scharf unter meiner Oberlippe.
Wir reden nicht viel. Wir haben einander schon so viel gesagt. Außerdem hat sie nach dem, was geschehen ist, eine Art Schüchternheit entwickelt, sie hat sich ein behutsames Nuscheln zugelegt, das S ist ein wenig unklar, es spielt ein bisschen mit C und H, und es ist wohl auch so, dass die Zeit der langen verwickelten Sätze unwiderruflich vorüber ist. Das macht ihr natürlich zu schaffen, und bisher hat sie kein besonderes Interesse an den von mir entwickelten Ausspracheübungen an den Tag gelegt – Sara Selmers siebter Einsatz als serbische Sachensucherin –, aber jetzt ist es nun einmal so, dass Gott der Herr dafür gesorgt hat, dass sie mich hat und ich sie. Das ist groß, und deshalb gibt es nicht sehr viel darüber zu sagen. Alles liegt ein wenig jenseits der Worte.
So zu sitzen. Mit Lutschtabak und Kaffee. In einem Zimmer mit einer Frau. Zum Gott weiß wievielten Mal geht mir auf, wie gemütlich dieses Wohnzimmer ist, vor allem um diese Tageszeit, und nachts, ja, die ganze Zeit, bis im Osten das erste Tageslicht zu sehen ist. In all diesen Stunden, vom Nachmittag bis zum Morgengrauen, ist dieses Zimmer das Herz des Hauses. Ja, so denke ich. Dass das Wohnzimmer das Herz des Hauses ist. Tagsüber sitze ich in der Küche, vom Frühstück an und in jedem müßigen Augenblick. Sitze da mit Ziegenkäse und Kaffee oder nur mit Kaffee, sitze da zusammen mit ihr oder allein, trinke Kaffee und schaue hinaus auf die Straße, so wie Tausende andere Menschen in diesem langgestreckten Land ebenfalls am Küchentisch sitzen und auf die Straße hinausschauen, den Nachbarn vorüberradeln sehen, mit dem Auto vorbeifahren, vorbeigehen, so wie sie vertraute Autos und fremde Autos bei jeder Art Wetter sehen, sommers wie winters fahren die vorbei, von links nach rechts, oder von rechts nach links, und wenn man einen anderen Menschen hat, kann man darüber reden, über die Bewegungen, die sich draußen vor dem Küchenfenster abspielen, während der, der allein ist, alles in sich versinken lassen muss, ich kenne mich aus mit diesen beiden unterschiedlichen Zuständen. Und nach dem Essen kommen die warme Dunkelheit des Wohnzimmers und das Meer, das sich in die Unendlichkeit erstreckt, das Rauschen des Strandes und die Schreie der Seevögel, und hier sitze ich und lasse alles auf mich einwirken, nicht die Schreie der Seevögel, die schweigen jetzt in der Dunkelheit, aber die Wellen, die gegen das Ufer schlagen, und das Knistern im alten Holzofen, nachdem Miles für diesmal Feierabend gemacht hat. Ja. Das Herz des Hauses. Das Bücherregal. Eine ganze Wand, bedeckt von Buchrücken. Abgegriffene Bücher und neuere Bücher. Die Seekiste unter dem Fenster, mit den Tischdecken, die Berit in den langen Wintermonaten bestickt hat, Jahr um Jahr. Der Diwan hinten beim Ofen, und das Holz, das ich selbst ins Haus getragen habe. Wenn ich auf dem Diwan liege, ich hätte fast gesagt: Wenn der Kater mir gestattet, mich auf den Diwan zu legen, dann riecht es nach warmem Holz und ein wenig schimmelig von dem dicken Wandbehang. Es ist ein gewebter Wandbehang, ein Bild, das einen röhrenden Hirsch zeigt, dazu zwei kleine Hirschdamen, die ihn unter einer alten Eiche fragend mustern. Gemälde. Bäume. Blumen. Fjord und Inseln. Der Leuchtturm von Skarven. Sie hat sie selbst gemalt. Sie ist sehr begabt, aber nicht als Malerin, und diese Unbeholfenheit in Öl auf Leinwand gibt mir ein Gefühl, das an Mitleid erinnert, das aber etwas ganz anderes ist, ich weiß nicht so recht, was.
Der Kater steht in der Küchentür und betrachtet mich. Große aufgerissene Augen, als habe er einen soeben gelandeten Außerirdischen entdeckt, er steht da in der Türöffnung und ist in der Welt zugegen, wie erstarrt für einige Sekunden, ehe er zum Schaukelstuhl hinüberstolziert, um dann einen Sprung auf Berits Schoß zu machen, zu ihr, die seine Auserwählte ist, seine Bevorzugte auf Erden, und darin liegt ein tiefes Verständnis zwischen dem Kater und mir.
Das Mobiltelefon in der Seitentasche meiner Arbeitshose piept. Ein schwaches Vibrieren an meinem Oberschenkel.
Es ist Reinert von Neset. Jetzt will er das Holz bringen.
Ich gehe in den Gang hinaus und ziehe Magnes schwere Arbeitsstiefel und Magnes Jacke mit den Farb- und Harzflecken an.
Dann gehe ich hinaus.
Es weht. Hier oben weht es fast immer. Starker Wind kommt vom Meer herein, gewürzt mit winzigkleinen Eiskristallen, die sich an den Nähten der Jacke ablagern, die weiße Linien auf den groben Stoff zeichnen. Die Lampe auf dem Hof legt einen gelben Halbkreis in den Kies. Ich gehe über den Hofplatz zur Scheune und öffne die Doppeltür, ich weiß nicht, warum, es ist doch zu früh, aber ich sichere beide Türen mit den dicken Eisenbolzen. Und die Bolzen wiederum sind im Boden verankert.
Unten am Strand bleibe ich stehen und stoße mit dem Fuß den dicken Stamm an. Der lässt sich ein wenig bewegen. Ich denke, dass wir zwei noch gute Freunde werden, in den Stunden, die wir brauchen, um dich mit Säge und Axt zu zerteilen, dich Stück für Stück ins Haus zu bringen, zum Trocknen beim Ofen, ehe der Ofen dich bekommt und Berit und ich die Wärme.
Dann gehe ich in die Hocke und halte die Hand in das eiskalte Wasser.
Berühre die glatten Steine.
Wie ich das sonst nur mache, wenn die alte Unruhe mich erreicht.
Das geschieht nicht oft.
Jetzt bin ich ganz ruhig. Deshalb zähle ich nicht bis tausend, sondern denke stattdessen an Walhai und Rochen, an Tigerhai und Seelachs, die da unten in der großen nassen Welt umherschweben, in die ich jetzt meine Hand geschoben habe, in dem hohen Himmel aus Salzwasser, der sich über den Tiefen wölbt, kalt und dunkel und gewaltig. Es ist überwältigend. Eine einzige große schwimmende Gebärmutter, und ich wohne so nah dabei, dass die Stürme große Schaumsoden von der Oberfläche reißen und sie mit einem weichen Klatschen, das ich aus irgendeinem Grund mit Sex assoziiere, gegen die Wohnzimmerfenster werfen. Der grelle Leuchtturm draußen auf Skarven brennt jetzt und alle paar Sekunden fegt der Lichtkegel über Meer und Schären und Inseln hier drinnen in unserem Teil der Bucht, jetzt durch das immer dichter werdende Schneegestöber. Ich ziehe die Hand aus dem Meer und will mir durch die Haare fahren, ich nehme die Mütze ab, um mir durch die Haare zu fahren, aber im selben Moment merke ich, dass die nicht mehr da sind: Es ist vier Jahre her, aber ich habe mich noch immer nicht daran gewöhnt, dass ich auf dem Weg den Oridongo hinauf die Haare verloren habe. Das macht nichts. Als ich in die alte Welt zurückkehrte, stellte ich fest, dass ein kahler Schädel bei Männern jetzt modern war. Berit sagt, ich hätte schöne Ohren. Sie ähnelten Muscheln.
Ich gehe zurück zur Scheune. Ich hätte die Doppeltür natürlich nicht öffnen dürfen. Der Schnee legt sich auf den Boden. Andererseits habe ich keine Lust, die Tür zu schließen, wo ich sie nun schon sperrangelweit aufgerissen habe. Ich will Reinert von Neset klarmachen, dass ich die Dinge auf meine eigene Weise erledige. Und jetzt stelle ich mir vor, dass er die Ladung direkt in die Scheune kippen soll. Aber warum habe ich nicht warten können, bis er hier ist? Weil ich nicht die Zeit eines anderen vergeuden will. Ich will, dass alles bereit ist, wenn er kommt. Außerdem ist es ja so, dass der Schnee den grauen Staub auf den breiten Bodenbrettern bindet, stimmt das nicht? Doch. Wenn ich mit dem Besen darüberfahre, wird der Schnee grau gefärbt, fast schwarz, und dann brauche ich den Dreck ja nur noch auf den Hof hinauszukehren; was ich hier mache, ist wirklich fast schon genial. Nicht so dumm, der alte Vågsvikinger, denke ich. Er hat seine Eigenheiten, das schon. Wer hat die nicht? Er beharrt auf seiner Meinung und gibt sich nur selten geschlagen. Das ist hier draußen am offenen Meer nicht direkt ein Nachteil. Im Gegenteil. Es ist sogar eine Annäherung an die Gemeinschaft, die verstanden und respektiert wird. Offener Trotz ist ein Teil des Inselkodex. Ich glaube fast, das sagen zu dürfen.
Ich höre Reinert, ehe ich ihn sehe. Das heißt, ich höre seinen Traktor hinter dem Haus. Dann sehe ich die blauen Lichtkegel der Scheinwerfer über dem Briefkasten, ehe der Traktor plötzlich aus der Dunkelheit auftaucht und auf dem Hofplatz rangiert, hin und her, oder auf und ab, wie Reinert selbst sagen würde, wenn er Lust hätte, sich zu dieser Frage zu äußern, aber vorläufig begnügt er sich damit, zum Gruß mit einem Finger an seine Pelzmütze zu tippen, was ich damit beantworte, dass ich braun ins Scheinwerferlicht spucke, ehe ich ihn mit beiden Händen zu mir winke, als er mit seiner Ladung zur Scheune zurücksetzt. Näher. Näher. Er dreht das Kinn über die rechte Schulter und starrt mich misstrauisch an, während er vorsichtig auf das Gaspedal tritt. Noch näher? Ja. Noch näher. Bis fast ganz zu mir. So machen wir das da, wo ich herkomme. Am Ende will er nicht mehr und leert die Ladung Birkenholz so heftig ab, dass die Scheite mitten in die Scheune krachen. Dann dreht er den Motor aus und dreht sich eine Zigarette.
Jetzt ist es wichtig, nicht »danke« zu sagen und keinerlei Form von Enthusiasmus zu zeigen. Er kann in solchen Situationen ungeheuer reizbar sein.
Ich packe eine weitere Prise und schiebe sie mir unter die Lippe. »Du kommst doch auf einen Kaffee mit rein?«
Er gibt sich Feuer. »Nein. Komm nicht rein.«
Er steigt vom Traktor und macht sich an die Inspektion der Ladung, die er angeliefert hat. Schiebt mit dem Fuß zwei Scheite zurecht. Dann entdeckt er das Holzlager, das ich aufgeschichtet habe, und schnalzt auf eine Weise mit der Zunge, die ich als Anerkennung deute. Und von mir aus gern. Es hat seine Zeit gebraucht, um alles so zu legen, wie er es jetzt sieht, und die einzige Hilfe, die ich dabei bekam, stammte von meinen eigenen Händen. Ich zeige und erkläre. Zuerst zwei Bretter, parallel durch die gesamte Länge des Raumes gelegt, das innere dicht vor die Wand. Ich habe sie, mit einem Zwischenraum von zwanzig Zentimetern, an den Boden genagelt, sicherheitshalber, nicht zweiundzwanzig und nicht fünfundzwanzig, sondern zwanzig. Dann muss man die Sache mit der Wasserwaage überprüfen, kleine Keile dazwischenschieben, zurechtrücken und begradigen, bis es an diesem Fundament, dieser Unterlage, nicht auch nur eine Abweichung von einem Millimeter von Kante zu Kante gibt, oder, wenn man so will – von Wand zu Wand, es dauert einige Tage, aber es ist ein gutes Gefühl, wenn alles stimmt und wenn man anfangen kann, das Holz zu legen. So nenne ich das. Das Holz legen. Langsam. Vorsichtig. Schieben. Herausziehen. Eine Schicht nach der anderen an der ganzen Länge der Wand entlang legen, mit so wenig Zwischenraum wie möglich zwischen den Scheiten, die wegnehmen, die nicht hineinpassen, sie durch neue ersetzen, die hier nicht passen, passen anderswo, probieren, sich irren, wieder und wieder, bis das Holzlager fast als massive Wand daliegt. Und dann? War das eine Kunst? Nein, das vielleicht nicht, aber jetzt zeige ich Reinert von Neset den Hammer. Hebe ihn hoch. Schlage vorsichtig auf ein Holzscheit, sodass es die notwendigen drei Millimeter nach innen rutscht und damit in besserer Harmonie mit dem restlichen Lager daliegt. Ich habe jedes einzelne Holzscheit hier angepasst, und deshalb kann man am Lager vorbeigehen und mit der Hand über die Endscheite fahren, mit dem Gefühl, über die glatte Wand zu streichen, und ich gebe zu, wenn auch nur insgeheim und nicht anderen gegenüber, das wage ich nicht, das traue ich mich nicht, aber wenn ich allein hier wäre, ja, dann würde ich den weißen Enden zwei Lackschichten verpassen. Denn das wäre noch ein wenig schöner.
Er sieht mich mit einem Blick an, den ich nicht deuten kann. Ist das Ver- oder Bewunderung?
Berit kommt mit einem dampfenden Becher Kaffee in der Hand über den gefrorenen Kies. In der anderen Hand hält sie das vollgestopfte Portemonnaie. Der Boden knirscht unter ihren großen Holzschuhen. Sie hat sich rote Wollsocken über die Hose gezogen.
Sie reicht Reinert den Becher und fängt an, die Geldscheine abzuzählen.
Du dürftest nicht hier draußen in der Kälte stehen, denke ich, sage es aber nicht.
Ich müsste die Arme um dich legen und dich vor dem Wind beschützen. Ich bringe das nicht über mich, solange dieser Trottel da steht und glotzt. Jetzt fangen sie an, eine Art Gespräch zu führen, es besteht aus Räuspern und halben Sätzen. Ein Gespräch von der Sorte, die die Leute aus den entlegenen Gebieten wütend macht, wenn es in einem norwegischen Spielfilm vorkommt. Ich versuche mich ebenfalls an einigen amputierten Sätzen, aber das ist irgendwie … nicht … da gehe ich lieber zum Birkenholz hinüber und fange an, die Stücke in die Scheune zu werfen, damit wir die Tür schließen können, wenn die Nacht sich über uns hereinsenkt.
Ich höre, wie Reinert den Motor anlässt und losfährt.
»Lass es liegen!«, sagt sie. »Komm jetzt ins Haus.«
»Du dürftest nicht hier draußen in der Kälte stehen«, sage ich.
Dann drehe ich mich um und lege die Arme um sie.
2
Am nächsten Tag haben wir fünf Grad über null, trockenen Asphalt, hohen Himmel und fast keinen Wind. Ich ziehe in der Garage die Plane vom Moped und schiebe es hinaus auf den Hofplatz. Die fünf Farbeimer zu je zehn Litern hebe ich auf den Gepäckträger. Denke, dass es wohl so kommen sollte. Wie so vieles andere. Ein Dreirad mit Ladefläche in meinem Besitz.
Ich fahre am Meer entlang. An einzelnen Stellen führt der Weg fast zu den Ebbesteinen hinunter, an anderen schlängelt er sich durch Felder und windschiefe Wäldchen, ich komme an Höfen und einsamen Häusern vorbei, und ich weiß, dass ich gesehen werde und dass an den Küchentischen über mich gesprochen wird, dass jemand hinter Wohnzimmervorhängen und in Türspalten auf der Lauer liegt; das macht mir nicht das Allergeringste aus, und ab und zu ist es sogar so, dass ich einen Arm hebe, ich winke Menschen zu, die ich zu kennen glaube, und die ihrerseits glauben, mich zu kennen. Und über uns allen das große blaue Himmelsgewölbe, ich war so total unvorbereitet darauf, dass der Himmel so hoch sein kann wie hier oben, ich werde mich wohl nicht daran gewöhnen, und was könnte besser sein als ein Entzücken, das dauert und dauert? Draußen auf dem Sund gleitet ein Krabbentrawler in einer Wolke aus anfeuernden Möwen vorbei.
Unten bei Nivangen biege ich von der Hauptstraße ab und folge dem Kiesweg, der den Hang hochführt, zum Holländerhaus am Waldrand unter dem schwarzen Berg. Es ist die alte Schule der Insel, aber Algebra und Choräle liegen jetzt schon lange zurück.
Ellen Svendsen tritt in die Tür, sowie ich den Motor ausschalte. Sie trägt einen blauen Overall und hat ihre rote Mähne zu einem Pferdeschwanz gebunden. »Komm rein! Wir essen gerade!«
Auf dem Gang riecht es nach Farbe und Öl. Mitten im Zimmer steht eine Trittleiter, und unter der Decke hängt ein einsames Stromkabel mit einer gespaltenen Zunge aus Kupfer.
In dem Zimmer, in dem früher der Unterricht abgehalten wurde, sitzen Ellen und Arne und frühstücken an einem Tisch, der aus einer über zwei Böcke gelegten Tür besteht. Der Tisch ist auf der einen Seite übersät von Lebensmitteln und Tassen und Tellern, auf der anderen von Werkzeug und Farbbeuteln. Auf dem Boden steht ein Propankocher mit einer Bratpfanne; Schweinefett und Eier zischen.
»Schön, dass du kommen konntest!« Arne redet mit vollem Mund, er grüßt mit einem Messer mit kurzer Klinge, das in seiner großen Hand teilweise versteckt ist. Er benutzt dieses Messer zu allem Möglichen. Jetzt schneidet er damit Hammelwurst. Und begrüßt mich. »Ich hoffe, du musst nicht gleich wieder los?«
Ich ziere mich ein wenig. Sage etwas über eine Aufsichtsratssitzung.
Sie lachen.
Ich finde, das hier läuft ziemlich gut.
»Aber jetzt setz dich doch, Mann! Eier? Oder Speck?«
Ich setze mich auf einen alten Hocker. »Warum oder? Und vielleicht eine winzigkleine Tasse Kaffee.«
Davon habe ich ein halbes Leben lang geträumt. Dem lockeren Tonfall. Den Scherzen unter Ebenbürtigen. Jetzt lebe ich den Traum aus. Ich nehme das große Graubrot und schneide mit dem samischen Messer eine schiefe Scheibe ab, während Ellen Eier und Speck auf einen gelben Plastikteller schaufelt.
»Wir wollen heute das große Doppelfenster einsetzen. Den alten Dreck könnten wir einfach runterwerfen. Aber wir müssen zu dritt sein, um den neuen Rahmen hochzuhieven und zu sichern.«
Ich nicke und spachtele Eier und kross gebratenen Speck. Aber sicher doch. Wenn sie einen Mann brauchen, dann haben sie einen Mann. Ich habe keine Erfahrung mit solchen Dingen, und das wissen sie. Keine Verstellung. Keine Lügen. Ich bin der gelehrige Bursche aus der Stadt. Der, der nie so tut als ob. Der, der die offenen Bürolandschaften und die wechselnden Winde an der Börse am Ende satt hatte. Der, der alles gegen das hier eingetauscht hat.
»Wie geht es Berit?« Ellens grüne Augen mustern mich.
»Der geht’s gut«, sagte ich. »Sie nuschelt ein wenig. Das ist alles. Ich bin sicher der Einzige, der hier oben klar und deutlich redet.«
Und punkte ein weiteres Mal.
»Sie ist stark, die Berit«, sagt Arne. »Sie ist noch mit über fünfzig über den Sund und zurück geschwommen. Ich glaube nicht, dass irgendwer hier oben das heutzutage noch versuchen würde.«
Ich sage mir, dass das nicht böse gemeint war. Das war nicht böse gemeint. Das hier macht den jovialen Ton zwischen Ebenbürtigen aus. Ich sehe, dass Arne sie kurz von der Seite her anblickt und dass sie das bemerkt.
Aber es darf hier jetzt nicht still werden, denke ich, deshalb sage ich, dass sie da ganz recht hat. Und konzentriere mich darauf, nicht zu lachen, denn ich weiß, dass dieses Lachen mir ein wenig zu tief in der Kehle stecken würde.
Dann wird es trotzdem still.
Bis Arne sich räuspert und eine neue Ladung Eier und Speck für alle drei bringt. »Ich hab mir eins überlegt«, sagt er und zieht das Messer durch das gelbe Dotter, sodass es über den Teller fließt. Schiebt mit einem Stück Brot die Schweinerei zusammen und stopft sich alles in den Schlund. »Oder genauer gesagt, Ellen und ich haben darüber gesprochen.«
Er kaut.
»Ehe die Holländer kommen«, sagt Ellen erleichtert.
»Das sind Niederländer«, sage ich. »Keine Holländer.«
War das richtig? Vielleicht.
Arne nickt. »Natürlich.«
»Das ist nicht natürlich«, sage ich. »Die ganze Insel redet von Holländern und das stimmt nicht.«
Habe ich recht? Jetzt bin ich plötzlich unsicher.
»Wie dem auch sei«, sagt Ellen und bläst den Dampf von dem Kaffee, den sie gerade in ihren Becher gegossen hat. »Du bist der letzte Einwanderer hier auf der Insel. Der letzte, der von außen gekommen ist.«
Jetzt bin ich auf der Hut.
»Und da dachten wir, du könntest vielleicht…«
Es stellt sich heraus, dass sie gedacht haben, dass sie untereinander und mit anderen darüber gesprochen haben, dass sie eine Art Interview arrangieren könnten, ein Gespräch zwischen Ellen und mir im Gemeindehaus, mit den anderen Inselbewohnern als Publikum, mit dem Ziel, die Erwartungen und Befürchtungen der Neuankömmlinge zu untersuchen, und genauer gesagt – meine Erfahrung damit, von außen zu kommen, um mich an diesem windgebeutelten Ort niederzulassen, zu einem Teil dieser Gemeinschaft zu werden, die für einen Außenstehenden doch fremd wirken muss, schwer zugänglich vielleicht.
Und das alles, um den Niederländern den Anfang so leicht wie möglich zu machen.
Nicht ausgesprochen, aber zwischen den Zeilen einwandfrei vorhanden: leichter, als er für mich war.
Was ich dabei empfinde? Schwer zu sagen, abgesehen davon, dass mir sofort ein wenig übel wird, ich muss kurz nach draußen, ich springe auf und gehe (jetzt hör doch auf, Mann! Setz dich, wir können doch über alles reden usw.), aber ich gehe also hinaus, und zum Glück sind sie gescheit genug, nicht hinterherzukommen, das wäre ja noch schöner. Tja. Ich gehe zum Moped und in die Hocke. Beschließe, dass mit der Kette etwas nicht stimmt. Berühre sie vorsichtig mit den Fingerspitzen. Ziehe einen Bausch Putzwolle aus dem Werkzeugkasten und wische ein wenig Öl weg. Ziehe das Bremskabel straffer, aber im selben Moment fällt mir ein, was passiert ist, als ich es zuletzt straffen wollte, mein Nacken tut noch immer weh, und deshalb lockere ich es wieder. Überlege, dass es im Grunde keine schlechte Idee ist, die Arne und Ellen da ersonnen haben, auch wenn die Probleme der Niederländer, der van der Klerks, ja zwangsläufig ganz anders aussehen werden als meine, und überhaupt, Probleme … kann ich denn von Problemen reden? War es nicht im Grunde die reine Freude? Herzuziehen? Ich hatte schon lange die Einladung, herzukommen, vielleicht nicht gerade, mich hier für immer niederzulassen, aber zu Besuch zu kommen, »eine Weile zu bleiben«, sie wollte mich in Trondheim abholen, ich könnte mit dem Flugzeug oder der Bahn nach Trondheim kommen, und da würde sie mich erwarten, ich brauchte nur einige Tage vorher Bescheid zu sagen, aber ich sagte nicht Bescheid, ich schrieb keinen Brief und ich rief nicht an, ich nahm einfach den Nachtzug nach Trondheim und dann den Bus, ich hatte einen leichten Koffer mit zwei Hemden und etwas Unterwäsche gepackt, ich hatte mir einen Hut gekauft, den ich in Oslo nicht aufzusetzen wagte, den ich aber mit großer Selbstverständlichkeit trug, als ich in Trondheim aus dem Zug stieg, ja, mit großer Selbstverständlichkeit, es fiel mir leicht, den Hut zu tragen, jetzt, da ich in eine ganz neue Phase meines Lebens eintreten würde, ich ging durch Trondheim mit dem Hut auf dem Kopf und dem Koffer in der Hand, und ich fühlte mich wie ein ganz anderer als der, der ich bisher im Laufe meiner fast fünfzig Jahre auf Erden gewesen war, ich war ein anderer, und mein alter Name lag hinter mir wie ein geprügelter Hund mit gebrochenem Rücken. Da ging ich also und dachte, dass es Mut verlangt, in dieser unserer Zeit einen Hut zu tragen, in einer Zeit, in der der Hut dem Exzentriker vorbehalten ist, dem Künstler, nicht wie früher auf der Welt, als jeder Mann sich bei der Konfirmation den Hut auf den Kopf setzte und die Pfeife in den Mund steckte, Arbeiter und Fischer, Lehrling und Hofknecht – jetzt verlangte es Mut und geraden Rücken, einen Hut zu tragen, und diesen Mut und diesen geraden Rücken besaß ich, obwohl ich weder Künstler noch Exzentriker war, eher ein ziemlich normaler Mann aus dem Volke. Und ich trug den Hut im Bus und später auf der Fähre, und da es ein fast windstiller Tag Ende April war, trug ich den Hut auch, als ich an Land ging, ich traf auf Vaksøy mit einem Hut und einem leichten Koffer ein, ja, sogar mit der Jacke über der Schulter, den Zeigefinger durch den Aufhänger, und voller Übermut beschloss ich, den Bus Bus sein zu lassen und lieber am Meer entlang zu dem Haus zu spazieren, das ich so oft auf den Fotos betrachtet hatte, die sie mir geschickt hatte, das weiße Haus, das da draußen in Viken lag, auf der Mitte zwischen Laugen und Vingan, Berits Heim, wo sie, wenn nicht ihr ganzes Leben, so doch den größten Teil ihres Lebens verbracht hatte, ein Haus, von dem ich im tiefsten Herzen wohl hoffte, dass es auch mein Zuhause werden könnte, ach ja, das waren meine Hoffnung und mein Gebet! Und alles war doch so schön! Die Inseln. Das Meer. Der gelbbraune Strand und die fast schwarzen Felsen. Der windgebeutelte Wald…
Jetzt richte ich mich auf und gebe dem Moped einen Klaps, während ich höre, wie mir ein kleines dumpfes Lachen entweicht, ich stehe plötzlich auf dem Hofplatz vor dem Holländerhaus und lache, denn es ist genau so, als sähe ich meine eigene kleine Gestalt von damals aus der Vogelperspektive, sähe mich selbst mit dem Blick einer Möwe, wie ich am Strand entlangstolpere, in Stadtkleidung und Halbschuhen durch den feuchten Sand, und dann kommt natürlich der Wind, er hatte nur eine Stunde Pause gemacht, jetzt kommt er angefegt, wie es so seine Art ist, und weg mit dem Hut und her mit der Jacke – aber so oft ich mir auch die Karte der Insel angesehen habe, so habe ich die Entfernungen hier draußen doch niemals ganz begreifen können, es scheint so einfach zu sein, vom Fähranleger in Laugen zum Haus in Viken hinauszuspazieren, und es mag ja für einen Einheimischen mit der richtigen Fußbekleidung auch einfach sein, aber ich selbst muss feststellen, dass die Haut an meiner linken Ferse einreißt und dass mein rechter großer Zeh besonders groß und ganz und gar fremd wirkt, und dann kommt es, wie es kommen muss, und der Wind jagt einen Hagelschauer zum Land hin, und es gibt keinen Unterschlupf, nicht einmal ein Bootshaus oder eine Bude, nur diesen Ziegenpfad, der nicht einmal auf den Wald zuführt.
Und darüber haben wir gemeinsam so oft gelacht.
Wie jetzt, da ich hier stehe und ganz allein vor dem Holländerhaus über dieses nämliche Ereignis schmunzele.
Mein eigenes Eintreffen.
Das ich mir in etlichen wachen Nächten so vorgestellt hatte: Bei schlechtem Wetter – der Bus wartet am Fähranleger, steht mit laufendem Motor da, ich steige ein, zusammen mit all denen, die einander kennen, all denen, die bei meinem Anblick sich und den anderen Fragen in Bezug auf meine Erscheinung stellen werden, Fragen, die im Grunde wohl schon während der Überfahrt von Binnøya gestellt und bearbeitet worden sind, hier sitzt ein Fremder mit Hut und Koffer, SMSe und Telefongespräche von der Fähre nach Vaksøy durch den Kosmos, aber ich weiß doch, im tiefsten Herzen bin ich mir darüber im Klaren, dass alle mehr als nur eine vage Ahnung haben, wer ich bin, dass hier Berits Freund aus der Stadt seinen Einzug hält, so sieht er also aus, der Mann, über den sie zweifellos gesprochen hat, kahlköpfig und mit Hut, und mit unzweckmäßiger Stadtkleidung und nur einem leichten Koffer. So zu sitzen, mit einem freundlichen Lächeln für jede und jeden, während die Landschaft vor den Busfenstern vorüberrennt, die Felder, der Wald, usw., so dazusitzen und darauf zu warten, dass der Fahrer bremst, sich umdreht und verkündet, dass wir jetzt in Viken sind, jetzt haben wir Viken erreicht, und alle starren, als ich aus dem Bus steige, mit einer einfachen Frage im Schädel: Hat jemand Berit angerufen und sie über mein Eintreffen informiert? Feststeht, dass es hier in Viken für einen Mann wie mich nichts anderes zu tun gibt, als über den kurzen Kiesweg zu Berits Haus zu gehen, also wissen sie es jetzt allesamt, jetzt wissen sie, dass Berit Besuch aus der Stadt bekommt, und in meinen Halbträumen und Fantasien ist Berit inzwischen die Einzige, die nicht darüber informiert ist, sie steht in der Küche und bäckt Brot oder nimmt Fisch aus, und sie hört P3, den leichten Musiksender, oder vielleicht das Lokalradio, und dann sieht sie mich kommen, da kommt der Mann, auf den sie schon so lange wartet, den sie so oft eingeladen hat, er, den sie in Trondheim abholen wollte, aber dort steht er nun im Kies vor dem Küchenfenster, steht da und lächelt, denn er wollte sie überraschen, er ist von der spontanen Sorte, die plötzlich auf die Idee kommen kann, den Anker zu lichten und neue Küsten aufzusuchen, um nicht zu sagen, Frauen, und Letzteres ist falsch, das weiß sie, denn so ist er nicht, dafür hat sie sein Wort, und sie hat ihn als Mann kennengelernt, auf dessen Wort Verlass ist.
Oder bei gutem Wetter – wie es sich in Wirklichkeit also nicht ergeben wird; auf den Bus mit allen Klatschbasen und -vettern zu verzichten, den Bus zu ignorieren, ihn wegfahren zu sehen, Gesichter mit fragenden Mündern hinter den versalzenen Fenstern, die undeutlichen Umrisse der Insulaner hinter den Busfenstern, und die vielen Gesichter hinter den Fenstern der Privatwagen, den Wagen, die mit der Fähre von Binnøya gekommen sind, und denen, die am Anleger gestanden haben, um Reisende abzuholen, Geliebte und Ehepartner, Kinder und Eltern, auf sie allesamt zu pfeifen und stattdessen den Koffer zu nehmen und mich auf den Weg zum Strand hinunter zu begeben, der kein Weg ist, sondern irgendeine Idee von Schaf oder Ziege und Regen und Wind; eine Art Streifen durch das Heidekraut, aber was macht das schon, denn da liegt der gesegnete Strand in der Frühlingssonne, und dann geht es an die kleine Strecke zwischen Fähranleger und Haus in Viken, die sich also als alles andere denn als kleine Strecke entpuppen wird, sondern eher als etwas für Menschen mit Sinn für Extremsportarten, Polfahrer, denke ich, als das Unwetter losbricht, als der Wind mit Hagelkörnern groß wie Amseleier um sich wirft. Nach zwei Minuten schon bin ich triefnass und wie gerädert, es sind tatsächlich große Eisklumpen, die mir den Hut vom Kopf schlagen und auf meine nackte Kopfhaut donnern, ich ziehe mir die Jacke über den Kopf und gehe in die Hocke, ich denke, das ist sicher nur ein kleiner Schauer, sie hat geschrieben, dass es hier oben viele Wetter gleichzeitig gibt, sie kann auf der Türschwelle stehen und zusehen, wie ein Wetter ein anderes ablöst, und deshalb hocke ich also hier und warte darauf, dass Wetter Nummer eins von Wetter Nummer zwei abgelöst wird, während ein drittes und ein viertes Wetter über den Strand und die davorliegenden Untiefen streifen, dass zum Beispiel der strahlende Sonnenschein nach einer kleinen Runde über das Inselinnere zurückkehrt. Aber als die Ablösung kommt, als der Hagelschauer verschwindet, meldet sich eiskalter und massiver Regen dienstbereit, der flach vom Fjord hereinjagt, wie irgendein von Menschen geschaffener Klimaknoten, eine biologische Waffe, die ihr eigenes Leben lebt, und hier sitze ich in einer Art aufrechter Embryostellung, und ich lasse und lasse alles über mich ergehen, und es gibt ja auch nichts anderes zu tun, als alles über mich ergehen zu lassen und auszuhalten, denn hier gibt es wie gesagt keinen Unterschlupf, nicht einmal einen winzigkleinen vom Wind zerzausten Busch.
Und ich würde über den Strand gehen und über die glatt geschliffenen Felsen, würde den Kiefernwald verlassen und sie auf dem Hofplatz Holz hacken sehen, würde ihren Namen rufen, und sie würde sich aufrichten und sich umsehen, würde sehen, wie ich da stehe und den Hut durch die Luft schwenke, wie in einem Film aus alten Zeiten, einem Schwarz-Weiß-Film, hier kommt er, und da steht sie so warm und gut, und der Koffer landet im Heidekraut und die Axt im Kies, und es wird gelaufen, dass die Röcke flattern und der Hut herunterfällt, Umarmungen und Küsse, und alles soll nur schön sein, so bohrend schön und zärtlich und ein wenig wild.
Aber die Wirklichkeit will es also anders als Träume und Vorstellungen, so ist es ja oft im Leben, so ist es fast immer im Leben, in Wirklichkeit hocke ich hier mit der Jacke über dem Kopf, der teuren Jacke, die vermutlich einlaufen und unbrauchbar sein wird nach der brutalen Begegnung mit diesem Wetter, vor dem ich im Grunde oft genug gewarnt worden bin, worüber ich in Berits vielen Briefen jedenfalls gründlich informiert worden bin, und so kauere ich mitten in meiner Hilflosigkeit da, und dann fällt mir mein Mobiltelefon ein, das sich in der Innentasche der Jacke befindet, und alle Artikel, die ich über diese avancierten technologischen Entwicklungen gelesen habe – die ausgerechnet kein Wasser vertragen, ja, die sogar unter sengender Sonne einen Kurzschluss bekommen können, wegen schweißnasser Handflächen, und was ist dann mit diesem Regen, der mir den Jackenstoff gegen das Rückgrat peitscht? Das geht zum Teufel, denke ich, jetzt geht es zum Teufel mit meinem Mobiltelefon, und als dieser Gedanke gedacht ist, ist es mein nächster Gedanke, dass ich Berit anrufen muss, ehe es zu spät ist, ehe das Mobiltelefon ertrinkt, es ist eine Niederlage, die ich jetzt vor mir sehe, ich sehe das Gegenteil meiner Träume in mir und um mich herum aufsteigen, wie so oft, muss ich wohl zugeben, aber gerade das hier, dass ich also Erfahrung mit persönlichen Niederlagen habe, bringt mich dazu, das Mobiltelefon hervorzuziehen, mich der Schadensbegrenzung zu widmen – das ist eine Aktivität, die ich im Laufe der letzten Jahre trainiert habe, auf dem Oridongo und in der Zeit danach, deshalb ziehe ich jetzt das Mobiltelefon hervor und suche Berits Nummer, das gesegnete grüne Display leuchtet mir aus der Dunkelheit der Jacke entgegen, Berits Name und Nummer, sie meldet sich sofort.
Was für eine wunderbare Überraschung, dass ich gerade jetzt anrufe! Gerade habe sie noch an mich gedacht. Jetzt müsse ich aber wirklich bald zu Besuch kommen! Es sei so schön hier oben, jetzt im Frühling. Die Zugvögel kehrten schon zurück.
Berit! Ich habe Schutz unter meiner Jacke gesucht. Es ist eine dünne Jacke.
Ich brauche eine Weile, um ihr klarzumachen, dass ich mich nicht auf Bygdøy oder an einem anderen Ort am Oslofjord herumtreibe. Dass ich hier bin. Auf Vaksøy. Dass ich sie überraschen wollte.
Sie sagt, ich hätte sie noch nie so überrascht wie gerade jetzt. Sie sagt, ich sei ein Mann der Überraschungen. Sie sagt, sie wisse fast nicht, was sie sagen solle. Am Strand? Wo denn?
Ich bin so erleichtert. Jetzt heben sich Stimmung und Lebensfreude. Nass? Na gut. Na und? Jetzt steigen neue Fantasien und Visionen vor mir hoch. Gerettet. Ins Bett geführt. Honig & Rigabalsam.
Wo am Strand?
Keine Ahnung.
Bleib, wo du bist!
Und ich bleibe, wo ich bin. Ich stehe auf und stehe da am Strand, mit der Jacke über dem Kopf, wie einem winzigen Zelt, ich stehe da und schaue durch den Regen über Inseln und Meer hinweg, ich sehe auf meine ruinierten Schuhe hinunter, und auf den Koffer, dessen Kunstleder große Flecken aufweist, und es sickert und fließt mir über Hacken und Rücken, ein Fluss unter dem Hemd, so stehe ich und heiße Erkältung und Fieber willkommen und habe mir das Mobiltelefon in die Unterhose gesteckt, das ist für den Moment der einzige trockene Ort.
Und die Zeit vergeht, wie sie das eben macht, und es regnet und regnet, aber jetzt warte ich ja immerhin auf etwas Gutes, auf Berit, ich versinke in einer Art Meditation, ich schalte so viele mentale Leitungen aus wie möglich, ich schließe die Augen und versinke in mir selbst, ich hyperventiliere, ich falle und falle, während ich physisch fest dastehe, fest wie ein Pfahl dort am Strand in dem nassen Sand, während ich auf Wind und Wasser horche – und am Ende auch auf das Geräusch eines Motors, der sich irgendwo hinter mir befindet, es ist ein Fahrzeug, das offenbar näher und näher kriecht, und als ich mich aus Trance und Selbsthypnose reiße, kann ich mich umdrehen und einen Traktor sehen, der langsam vorwärts wackelt, der auf einem Weg, den ich offenbar übersehen habe (in meinem Eifer, zum Strand zu gelangen), hin und her geworfen wird, ein Traktor, der angewackelt kommt, und ich sehe einen gelben Helly-Hansen-Arm, der mir hinter dem Führerhaus zuwinkt, vermutlich von einem Anhänger, und ich winke zurück, gelassenes breites Winken, hier bin ich, hier stehe ich, jetzt bin ich endlich aus der Stadt und hier zu dieser Insel im Meer gekommen, über die ich so viel gehört und gelesen habe, die sich aber dennoch von einer dermaßen überraschenden Seite zeigt, ja, ist es nicht sogar ein bisschen witzig, dass dieser triefnasse Stadtmann da steht und winkt, sodass das Wasser von seinen Fingerspitzen spritzt?
Doch.
Sie springt von der Ladefläche und fällt mir um den Hals, noch ehe der Fahrer den Traktor anhalten kann, und da stehe ich nun und registriere, dass ich ganz ohne Scheu in meinen Fantasien immer wieder ihren Rücken streichele, den schmalen Rücken, und ich rieche ihre Haare, die riechen nach Äpfeln und Salzwasser, so weich und warm, ehe sie zurücktritt und mir auf jede Schulter eine Hand legt und mich mit diesem ein wenig seltsamen schelmischen Blick ansieht, mit diesen Augen, die ich also immer mit etwas Schwedischem verbinde, dem Blick, der mich ein wenig wacklig in den Knien macht, das heißt, etwas hinten in meinen Kniekehlen scheint zu schmelzen, etwas im Knorpel oder vielleicht in den Sehnen, und natürlich ist das nur Unsinn, das alles spielt sich doch in meinem Kopf ab, das habe ich nach all diesen Jahren immerhin gelernt, ich habe gelernt, dass vieles und manches ganz anders ist, als es im ersten Moment aussieht. Nehmt doch diesen Mann, der hier in all seiner reservierten Macht dasteht und nicht einmal seinen Namen hergibt, auch nicht, als ich ihm meinen gebe, der nur zögernd die Hand ausstreckt, als ich ihm meine eigene anbiete. In einem früheren Leben hätte ich ihn zur Rede gestellt, ich hätte ihm etwas über das Geheimnis der Zivilisation erzählt, über die Kommunikation zwischen den Einzelindividuen als eigentliche Grundlage für den Aufbau einer modernen, funktionierenden Gesellschaft, aber das kann jetzt auch egal sein, denn durch Berits viele Briefe und nicht zuletzt durch lange nächtliche Telefongespräche habe ich so einiges über das Wesen der Inselbevölkerung gelernt, vor allem über deren männlichen Teil, einmal schreibt Berit, dass die Männer hier oben in vieler Hinsicht Ähnlichkeit mit Kühen haben, sie stehen da und kauen und glotzen einen blöd an, eine Charakteristik, die ich damals für einen winzigen Flirt damit gehalten habe, was vermutlich Berits Vorstellungen über meine Vorurteile sind, die Fehlkenntnisse des Stadtmannes über Bauern und Fischer im Nordwesten des Landes. Die also auf den ersten Blick so einiges mit der Wirklichkeit zu tun zu haben scheinen. Aber da es plötzlich aufhört zu hageln, kommt es zu einer Art Gespräch, an dem wir uns von Mann zu Mann beteiligen, und als ich mich ein weiteres Mal vorstelle, stellt es sich heraus, dass der Mann Reinert heißt, auf eine direkte Frage sagt er das ganz offen, und Berit lacht mit weißen Zähnen und schüttelt freundlich den Kopf, was wiederum uns, Reinert und mich, veranlasst, einander verständnisinnig anzulächeln, obwohl wir doch im Grunde noch zu rein gar keinem Verständnis gelangt sind. Aber ich denke, dass wir von nun an aller Wahrscheinlichkeit nach miteinander auf Grußfuß stehen werden, wenn die physische Entfernung zwischen uns nicht zu groß ist. Wir werden nicht an entgegengesetzten Feldrainen mit den Armen fuchteln, aber es wird wohl zu einem Nicken kommen, wenn wir einander auf der Straße begegnen.
Und Berit fragt nach der Reise, und ich erzähle von der Reise, und sie fragt, ob ich Hunger habe, und ich sage, dass ich pappsatt bin, auch wenn mein Gedärm schreit, ich habe keine Ahnung, warum ich behaupte, satt zu sein, warum um alles in der Welt lügt man über solche Dinge, und ich versuche, Reinert dazu zu bringen, ein wenig über Fischerei und Landwirtschaft zu erzählen, und er sagt »ohoch«.
Aber dann fängt es wieder an zu regnen, und das Regenwetter scheint ihn auf irgendeine Weise zu beleben, »werden wohl sehen«, sagt er. Dann läuft er zum Traktor hinüber, holt einen grünen Regenmantel und reicht ihn mir, und als ich den anziehe, passiert etwas, worüber ich in den folgenden Tagen und Wochen staunen werde, ja, worüber ich ehrlich gesagt bis zum heutigen Tage keine Klarheit gewonnen habe. Es verhält sich nämlich so, dass Berit einen kleinen Ausruf ausstößt. Es ist kein ganzer Satz und auch kein kurzes verständliches Wort, es ist einfach nur eine Art verdutztes Quaken, und ich begreife ja, dass es um etwas geht, dass ihr ganz plötzlich eingefallen ist oder das sie ebenso plötzlich entdeckt hat.