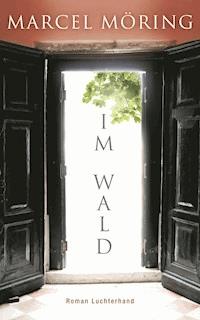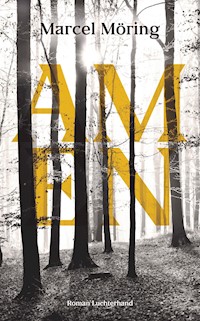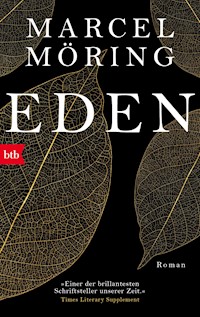
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über einen uralten Mythos und die Suche nach einer Heimat - ein überwältigender Roman von einem der bedeutendsten Erzähler der Niederlande.
„Reden ist mein Ding“, sagt der Psychiater Mendel Adenauer, der in einer Klinik in Assen im Nordosten der Niederlande arbeitet und ganz gut zu tun hat, auch einige Erfolge verzeichnen kann. Bis ein mysteriöser Mann umherirrend im Wald gefunden wird und ebenso mysteriös wieder verschwindet. Die Geschichte dieses Niekas reicht viele Jahrhunderte zurück und vereint die Legende von Ahasver, dem wandernden Juden, und den uralten Mythos des Buches Raziel, nach dem Niekas sucht: Bei der Vertreibung aus dem Garten Eden gab der Engel Raziel Adam ein Buch, das das Schicksal der gesamten Menschheit enthalten soll …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
»Reden ist mein Ding«, sagt der Psychiater Mendel Adenauer, der in einer Klinik in Assen im Nordosten der Niederlande arbeitet und ganz gut zu tun hat, auch einige Erfolge verzeichnen kann. Bis ein mysteriöser Mann umherirrend im Wald gefunden wird und ebenso mysteriös wieder verschwindet. Die Geschichte dieses Niekas oder Lazar oder de Zwarte – er hat im Laufe seines Lebens viele Namen bekommen – reicht einige Jahrhunderte zurück und vereint die Legende von Ahasver, dem wandernden Juden, und den uralten Mythos des Buches Raziel, nach dem Niekas sucht: Bei der Vertreibung aus dem Garten Eden gab der Engel Raziel Adam ein Buch, das das Schicksal der gesamten Menschheit enthalten soll …
Autor
MARCEL MÖRING, geboren 1957 in Enschede, gilt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Literaten der Niederlande. Für seinen ersten Roman »Mendel« erhielt er 1991 den wichtigsten Debütpreis des Landes, den Geertjan-Lubberhuizen-Preis, und weitere Romane wurden mit dem AKO-Literaturpreis, der Goldenen Eule und dem Flämischen Literaturpreis ausgezeichnet. Sein Roman »Der nächtige Ort« wurde 2007 mit dem Ferdinand-Bordewijk-Preis zum besten niederländischen Roman des Jahres gekürt. Marcel Möring lebt in Den Haag.
MARCEL MÖRING BEI BTBDer nächtige Ort. Roman
Marcel Möring
Eden
Roman
Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Eden« bei De Bezige Bij, Amsterdam.Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds für die großzügige Unterstützung dieser Arbeit.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe September 2022
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © 2017 Marcel Möring
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2022 btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, München
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Covermotiv: © Shutterstock/ Phatthanit; Yuliya Koldovska
CP · Herstellung: sc
ISBN: 978-3-641-22373-1V001www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für Harry Cock
History, Stephen said, is a nightmare from which I am trying to awake.
James Joyce, Ulysses
Ich bin geboren in einem Wald ohne Grenzen, alt und wüst wie die Schöpfung selbst, wo der Wisent umherzog und die Bäume älter waren als alles, was lebte. Es gab Wölfe und Bären, und wenn es Winter wurde, lag der Schnee so hoch, dass sich jeder Gedanke an Reisen verbot, Dörfer monatelang eingeschlossen waren und einsame Holzfäller hungers starben oder erfroren. Im Frühjahr, wenn der Schnee schmolz und das Eis auf Bächen und Flüssen und Tümpeln brach, war über all im Wald Wassertröpfeln zu hören und das Murmeln kleiner Rinnsale, die sich einen Weg zwischen Baumwurzeln und umgestürzten Stämmen suchten, bis sie einen Bach oder Fluss erreichten, in den sie sich strudelnd und schäumend ergos- sen. Gräser und Kräuter schossen nach diesem ersten Frühlingstag in die Höhe. Die Vögel, die den ganzen langen, kalten Winter über wie verstummt geschie- nen hatten, riefen einander zu. Bäume und Büsche begannen zu knospen. Keine zwei Wochen später lag über allem ein Hauch von zartem jungem Grün. Im Sommer schien die Sonne lange auf das dichte Blätterdach, die dicke Humusschicht am Boden erwärmte sich, und überall roch es nach moderndem Laub und Harz und frisch gesägtem Holz, denn die Männer waren dann schon wieder in den Wald gezogen, um Bäume zu fällen. Wilde Erdbeeren schimmerten wie Blutstropfen zwischen dem Grün, Orchideen dufteten betäubend, Bienen schwirrten umher, und honigtrunkene Hummeln umsummten die blühenden Thymiansträucher. Nach dem langen, stillen Winter herrschte im Wald emsiges Treiben: Holzarbeiter fällten Baumriesen für die Sägewerke, Jäger schossen Bären um der Felle willen, Wisente wegen des Fleischs und Wölfe zu ihrem Vergnügen. In gemächlich dahinfließenden Flüssen und Bächen lauerte der Hecht reglos auf Beute, Karpfen wurden groß und fett, Otter spielten im quecksilbrig glitzern- den Wasser, und Biber
In diesem Wald, in einem Dorf ohne Namen, kam ich zur Welt. Es hatte keinen Namen, weil es dort gar nicht hätte sein sollen. Es war ein Ort, an dem sich Holzfäller, Köhler und Pelzjäger niedergelassen hatten. Wenn einer von uns gefragt wurde, wo wir wohnten, dann sagte er »dort« und wies in die Richtung des nicht existierenden Dorfes, und wenn wir hier waren, inmitten unserer kleinen Häuser und Hütten, dann nannten wir es »hier« und schauten uns um, als müssten wir uns selbst davon überzeugen, dass es das Dorf tatsächlich gab.
Ich selbst hatte auch keinen Namen, und das aus demselben Grund. Vor meiner Geburt waren vier andere Kinder gestorben. Keines von ihnen war älter als einen Monat geworden. Es waren ein Mädchen, zwei Jungen und noch ein Mädchen gewesen. Als ich geboren wurde, war das Vertrauen meiner Eltern in die Lebensfähigkeit ihrer Sprösslinge so gesunken, dass sie hofften, der Engel des Todes würde mich übersehen, wenn ich namenlos blieb. Es war der gleiche Aberglaube, der Mütter ihren kranken Kindern einen anderen Namen geben ließ.
Meine Mutter war nach der Entbindung fiebrig und schwach. Ihre Brüste waren leer, und sie musste das Bett hüten. Da es im ganzen Dorf, das aus lediglich acht kleinen Häusern und einigen Hütten bestand, keine stillende Frau gab, wickelte mein Vater mich in Tücher, schlug ein Stück Fell um das Bündel und ging in das nächstgelegene Dorf. Dort fand er eine litauische Bäuerin, die ihr Kind noch an der Brust hatte. Doch sosehr er auch schmeichelte, jammerte und feilschte, sie wollte ihre Milch dem Balg eines Gottesmörders nicht zukommen lassen. Sie verstaute ihre tropfenden Brüste im Mieder, spuckte aus und rief den Bauern, der meinen Vater mit dem Dreschflegel vom Hof jagte. Und so ging es weiter, Tür um Tür, Hof um Hof. Am Ende des Tages, als mein Vater sich mit seinem hungrigen Kind auf den Rückweg machte, kam am Dorfrand eine Frau auf ihn zu. Es war eine Frau von schlechtem Ruf, die Kinder von verschiedenen Männern hatte und sich und ihre Sprösslinge dadurch am Leben erhielt, dass sie für die Bäuerinnen des Dorfes wusch. Es gab auch Leute, die sagten, sie verkaufe ihren Körper.
»He du«, rief sie meinem Vater zu, »wohin gehst du mit diesem Kind?«
Mein Vater, ein starker Holzfäller, aber lammfromm und scheu, wenn es um Weltliches ging, senkte den Kopf und erzählte ihr murmelnd von den vier toten Säuglingen, seiner kranken Frau, ihren leeren Brüsten und der fruchtlosen Suche nach einer Amme. Die Waschfrau betrachtete ihn unter ihren wirren Locken hervor und lächelte.
»Du siehst nicht aus wie ein Mann, der keine gesunden Kinder machen kann«, sagte sie. Sie griff ihn beim Arm, legte seine Hand auf ihren vollen Busen und sagte: »Ich habe genug für zwei. Ich habe sogar zu viel.« Sie ließ seine erstarrte Hand los und lachte. »Ich habe so viel, dass ich sogar dich noch säugen kann.« Dabei lachte sie so laut, dass mein Vater sich umsah, ob jemand sie beobachtete. Die Waschfrau winkte ihm und ging in ihr Häuschen, ohne zu schauen, ob mein Vater ihr folgte.
So wurde mir das Leben gerettet, durch die unbekümmerte Wohltäterin, die meine Amme wurde. Mein Vater legte mich in ihre Arme und überließ mich meinem Schicksal. Sein Kind würde mit Sicherheit sterben, falls er es in das Dorf ohne Namen zurückbrächte. Besser, es dort zu lassen, wo es vielleicht verdorben wurde, als es vor der Schändlichkeit der Welt zu bewahren, dabei aber seinen Tod zu riskieren, denn wer auch nur einen einzigen Menschen rettet, rettet die ganze Welt.
In jener Nacht, als er zu seiner fiebernden Frau zurück-kehrte, wo eine der anderen Frauen die Hitze mit einem Sauerampferwickel zu senken versuchte, zuckte er mit den Achseln und sagte, es sei alles zu spät gewesen und vergebens. So wenig Hoffnung hatte er, dass er sein Kind dem Engel des Todes übergab, bevor dieser es einforderte.
Die Waschfrau hieß Ana. Als mein Vater sie mit mir allein gelassen hatte, löste sie die Schnürung an ihrer Jacke, hob die linke Brust heraus und legte mich an. Ich trank wie ein Durstender, der lange umhergeirrt ist und endlich eine Quelle gefunden hat, und als die linke Brust leer war, legte sie mich an die rechte, und auch davon trank ich. In jener Nacht bangte sie um mein Leben, weil ich mich unter Krämpfen wand und trotzdem nicht schrie. Am nächsten Morgen, als sie mir den Bauch gerieben und meine Lippen mit Fenchelsud benetzt hatte, legte sie mich wieder an, und ich trank zum zweiten Mal, und obwohl mir die Milch auch diesmal Krämpfe bescherte, war bereits nach einem Tag zu sehen, dass ich kräftiger und gesünder wurde, und sechs Monate später, als mein Vater wieder ins Dorf kam, diesmal um Häute zu verkaufen und Salz und Stoffe mitzunehmen, sah er ein Kind mit roten Wangen, einem widerspenstigen Schopf pechschwarzen Haars und einem Leib wie ein fettes Ferkel. Meine Mutter war da bereits gestorben.
Als ich kein Säugling mehr war, holte mein Vater mich ab, und ich kehrte zurück in das Dorf, das es nicht gab. Weil niemand dort je von einem Kind ohne Namen gehört hatte und es keinen gab, der Aufschluss geben konnte, beließ mein Vater es dabei. Man nannte mich »der weg war« oder Niekas, was »niemand« bedeutet.
Die Jahre verstrichen, heiße Sommer kamen, weiße Winter gingen, und ich wuchs zu einem Jungen heran, der beim Fällen der Eiche und beim Häuten des Bibers half. Wenn ich am dahineilenden Wasser stand, in dem die Baumstämme stromabwärts trieben, war es, als sei der Wald die ganze Welt und als gehöre alles zu ihm. Bäume wuchsen und fielen, und kaum lagen die Stämme der frisch gefällten Bäume auf der Erde, da schossen schon wieder junge kleine Eichen aus ihr hervor. Laub trudelte zu Boden, wurde, noch ehe es verdorren und vermodern konnte, unter einer dicken Schneeschicht begraben und bildete im Frühling, wenn der Schnee geschmolzen war, eine duftende Humusschicht, in der sich Würmer und Käfer und Mäuse und Salamander tummelten, und aus dieser vermodernden Schicht schossen Farne und Gräser und Kräuter in die Höhe und kleine blasse Orchideen und duftende Anemonen und winzige Walderdbeeren, die wie frische Blutstropfen zwischen den grünen Blättern blinkten. Die Lerche stieg über Waldlichtungen zur Sonne empor, riesige Ameisen krabbelten über morsche Baumstümpfe, die manchmal kaum sichtbar waren unter den Moosen, der Wisent stand still und starrte traurig vor sich hin, als wüsste er bereits, welches Schicksal ihm beschieden war, und aus dem gemächlich vorbeifließenden Fluss schnellten Fische empor und pflückten eine Wasserjungfer oder eine Fliege aus der Luft. Es wurden Bäume gefällt, es wurde gefischt. Häute wurden gegerbt und Beeren gepflückt. Die Jahre glitten dahin, und die Zeit wiederholte sich. Was war, war schon gewesen und würde wieder sein. Alles war Leben, alles verging und wurde neu und alt, und ich war ein Teil davon.
Als ich alt genug war, wurde ich zum Fluss geschickt. Dort waren wir zu fünft: die Zwillinge, die Moses und Aaron genannt wurden, weil der eine stotterte und der andere seine gebrochenen Worte ergänzte; Jaakov, der Jüngste; Adam und ich. In einer Biegung des Flusses lagen die Baumstämme, die die Männer stromaufwärts gefällt und ins Wasser gerollt hatten. Wir banden sie zu Flößen zusammen, die wir aneinander festmachten und zur Flussmitte stakten, worauf wir sie zum nächsten Dorf treiben ließen, wo das Holz zur Lagerung in ein Nassloch gezogen wurde. Wenn wir fertig waren, brachten wir die Fischnetze aus, setzten uns ans grasige Ufer und schauten den träge über den Feldblumen hängenden Hummeln zu und dem Blütenstaub in der Luft. Aus dem Wald ertönte das Hämmern der Spechte. Wir kauten auf langen Halmen herum und lagen rücklings im duftenden, würzigen Gras.
Eines Tages, der Himmel fast weiß und die Sonne so grell, dass das Grün an den Bäumen dumpf und schlaff herabhing und die Hitze uns die Haut versengte, sahen wir Malka, die Gänsehirtin, ein Mädchen unseres Alters, das so eigensinnig wie in sich gekehrt war und am liebsten allein durch den Wald streifte. Jeder wusste noch, wie sie einmal auf einem Tarpan ins Dorf geritten war. Das Pferd habe sie gefragt, ob sie nicht auf seinen Rücken steigen wolle, sagte sie. Die Gruppe, die sich um sie versammelt hatte, war in Hohngelächter ausgebrochen, und ein Junge hatte gerufen, dass Pferde nicht sprechen könnten, und wieder ein anderer, ob sie am nächsten Tag mit einem Stein ankäme, wenn dieser sie bäte, ob er mitdürfe. Malka war ungerührt sitzen geblieben, die Fäuste in der struppigen Mähne, die dünnen braunen Beine fest an die Flanken gedrückt. Ihre einsamen Streifzüge durch den Wald hatten ein Ende gefunden, als sie Gänsehirtin wurde und ihre Vögel am Flussufer weidete.
An jenem heißen Sommertag, als wir vom Waldrand zum Fluss gekommen waren, um Flöße zu bauen, stand sie ein Stück weiter stromaufwärts und hütete ihre Gänse. Das Gras reichte ihr bis zu den Knien, sie trug ein verschossenes braunes Kleid, und ihr rotes Haar flammte im Sonnenlicht. Stäubchen und Blütenfädchen umschwebten sie. Hoch über uns schossen Schwalben durch die Luft. Adam rief und winkte, und Malka drehte sich um. Ich stakste steif und unbehaglich durchs hohe Gras und schaute nicht auf, als Malka Adams Gruß erwiderte.
Es lag viel Holz herum, und wir hatten lange damit zu tun, die Stämme aneinanderzubinden. Als das erste Floß fertig war, stakte Jaakov es zu dem Pfahl, der ein Stück vom Ufer entfernt in den Grund geschlagen war, und machte es dort fest. Adam folgte und band sein Floß an das von Jaakov. Moses und Aaron stritten sich, wer jetzt folgen sollte, und derweil stand ich auf meinem Floß und sah mich um. Um uns herum nichts als Schilf, saftiges Grasland, Rieselwiesen und der Waldrand. Malka war aus dem Blickfeld verschwunden, doch meine Augen suchten sie noch, und ihr Bild im kniehohen Gras mit ihrem verschossenen Kleid und dem flammenden Haar wollte mir nicht aus dem Sinn.
Als wir die Stämme beisammenhatten und in der gemächlichen Strömung davonschwimmen sahen und die Netze ausgebracht waren, ließen wir uns im Gras nieder. Ich schloss die Augen, lauschte den anderen und spürte, wie mein Körper sich an die Erde schmiegte. Jaakovs Stimme erklang. Das Gras federte seufzend hoch, und ich hörte das schwiek-schwiek, schwiek-schwiek von Füßen, die durch die langen Stängel strichen. Jemand rief, ein Platschen, das Prusten nach dem Wiederauftauchen. Ich sah Moses und Aaron Hand in Hand vom Uferrand springen, Jaakov, der bereits im Wasser schaukelte, der Kopf knapp über der Oberfläche, Haare nass an den Schläfen, Adam, der mit dem rechten Fuß fühlte, wie kalt es war. Es dauerte eine Weile, bevor mir klar wurde, dass meine Augen noch immer geschlossen waren. Sah ich, was ich nicht sehen konnte?
Mein Blick schweifte vom Wasser weg und stieg wie eine Lerche empor. Jetzt waren die Köpfe der Jungen kleine dunkle Kugeln auf der glitzernden Wasserfläche, ein dünnes Wölkchen hing in der Ferne über der Lichtung, auf der unser Dorf stand. Kinder spielten dort um ein Feuer, ein paar Frauen kneteten Teig im Holztrog vor dem Kochhaus, zwei Hunde lagen, den Kopf auf dem Bauch des anderen, schlafend im Sand. Vor einem Haus saßen ein paar Mädchen und flochten Kränze aus Feldblumen.
»Langer! Komm ins Wasser!«
Ich stand am grasbewachsenen Ufer und blickte auf die schaukelnden Köpfe meiner Freunde. Ich konnte mich nicht erinnern, aufgestanden zu sein.
»Spring rein, Niekas. Spring!«
Die Augen der Jungen waren wegen des glitzernden Wassers zu schmalen Schlitzen zusammengekniffen. Ich fragte mich, was da vor sich ging und warum es schmerzte, was ich gesehen hatte. Dann schüttelte ich den Kopf, stieß mich ab und sprang wie jemand, der ins Nichts taucht.
Eines Tages war das Dorf, das es nicht gab, verschwunden. Wir kamen mit dem Fang vom Fluss zurück, und Jaakov, der vorausgegangen war, blieb plötzlich stehen. Als wir neben ihm standen, sahen wir die Frauen und die Kinder zwischen Hausrat und Töpfen und Pfannen und den schwelenden Haufen beieinandersitzen, die unsere Häuser gewesen waren. Die Männer des Herrn waren gekommen und hatten alles dem Erdboden gleichgemacht.
An jenem Abend saßen wir um ein großes Feuer herum, die Gesichter orangerot im Widerschein der Flammen, und es gab keinen, der nicht an den Weg unserer Vorfahren dachte. Jakub, der Älteste, erzählte die Geschichte den Kindern, und die Männer und die Frauen erhoben ihre Becher und sagten »nächstes Jahr, nächstes Jahr zu Hause«, doch währenddessen wurden Pläne für ein neues Dorf gemacht, nicht weit von hier, in der Nähe des Flusses. Die Frauen tunkten den kleinen Finger in den Wein und benetzten damit die Lippen der Kleinsten. Ich fragte meinen Vater, warum wir jedes Mal, wenn unser Dorf zerstört wurde, weggingen und neu begannen, warum wir jedes Jahr hofften, wir würden im nächsten zu Hause sein, warum wir nicht aufbrachen und fortzogen. Warum nahmen wir unser Schicksal nicht in die eigene Hand?
»Es ist nur eine Geschichte«, sagte mein Vater.
»Gibt es denn kein Gesetz, das uns schützt?«, fragte ich. »Die Welt gehört doch allen, oder?«
Einer der Männer blickte auf: »Welches Gesetz? Das Gesetz ist das Gesetz des Stärkeren. Wer macht das Gesetz? Der Wolf oder der Hirsch? Und wenn der Hirsch das Gesetz macht, kümmert sich der Wolf dann darum?«
Im Flackern der Flammen starrten die milchigen Augen des alten Jakub in meine Richtung. Ich verfolgte die Fünkchen, die aus dem Feuer aufstiegen und zwischen den blau in den schwarzen Himmel ragenden Baumwipfeln verschwanden, und fragte mich, ob mein Leben so sein würde wie die Geschichte unseres Dorfes: aufbrechen und von neuem beginnen, fortziehen und ankommen, und ich dachte an die Geschichte, die Jakub über einen Vorfahren erzählt hatte, der zu Fuß aus einem Land gekommen war, in dem die Menschen in Holztürmen wohnten, hoch wie eine Eiche, untereinander verbunden durch Laufstege. Das Vieh graste dort auf Weiden, die zwischen den Türmen hingen, und es gab Äcker in der Luft, auf denen Roggen und Weizen angebaut wurden, und Obstgärten, in denen Äpfel, Pflaumen und Datteln wuchsen. Mir wurde klar, ich glaubte nicht mehr, dass der Wald die ganze Welt war.
Am Morgen darauf, alle waren am Packen für den Aufbruch, sagte ich, ich wolle nicht mit.
Mein Vater sah nicht auf und fuhr fort, die Strohsäcke auszuschütteln.
»Ich will in die Welt.«
Er stand auf, einen leeren Strohsack in den schwieligen Händen, und sah mich verständnislos an. Er schüttelte den Kopf und drückte mir den Sack in die Hände. Während ich ihn zusammenrollte, sagte ich, ich wolle mehr von der Welt wissen, wolle Dinge lernen, wolle andere Menschen und andere Länder sehen und nicht von einer Waldlichtung zur nächsten gejagt werden, wolle einen Ort finden, an dem ich bleiben könne, ein Zuhause.
»Dies hier ist zu Hause«, sagte mein Vater.
»Warum sagen wir dann immer ›nächstes Jahr zu Hause‹?«
»Das ist eine Geschichte. Nur eine Erzählung. Von Erzählungen kannst du nicht leben.«
»Aber Jakub …«, sagte ich.
»Jakub …«, knurrte mein Vater. Er starrte über mich hinweg und kniff die Augen zusammen, obwohl es nicht sonnig war, und verschränkte die Arme.
»Das war die Milch von der Amme.«
Ich sah ihn an.
»Stirb oder verdirb«, sagte er. »Das hab ich gedacht. Und jetzt sieh, was daraus geworden ist …«
Er nickte, als sei ich eine Bestätigung dessen, was er geahnt hatte, des Schicksals, das er befürchtet und vorhergesehen hatte. Er drehte sich um und ging zu der Stelle, wo unser Hausrat lag.
Um uns herum wurden Bündel geschultert und Riemen fester gezurrt, irgendwo belud man einen Karren. Die Zeit strömte dahin, und ich stand still. Mein Vater stand mit Sack und Pack bei den anderen Männern. Sogar so, von mir abgewandt, eine Kiste auf dem Rücken, sprach sein Körper. Er sagte: Ich nehme keinen Abschied von etwas, was ich nie willkommen geheißen habe.
An jenem Tag jedoch, als die Luft schwer von dem war, was nicht ausgesprochen wurde, als das Dorf, das keinen Namen hatte, kein Ort mehr war und mein Verlangen fortzugehen wie die ersten Schösslinge im Frühjahr hervorgebrochen war, an jenem Tag konnte ich dennoch keine Entscheidung treffen, und so nahm auch ich meine Sachen und zog zum nächsten Platz mit. Damals verstand ich noch nicht, dass große Wendungen im Leben selten die Folge von Beschlüssen sind, sondern einfach geschehen.
Im neuen Dorf hatten mein Vater und ich schweigend eine Hütte gebaut, und danach war er ohne Lebewohl in den Wald gezogen. Dort blieb er im Holzfällerlager und kehrte nicht zurück. Es hatte Momente gegeben, bevor er fortging, in denen ich ihm hatte sagen wollen, dass ich ihn nicht im Stich lassen wollte, dass ich zwar von einer, wie er es nannte, schlechten Frau genährt worden war, aber trotzdem sein Sohn war und sein wollte, doch jedes Mal, wenn ich in seine Nähe kam, drehte er mir den Rücken zu, und zwischen uns wurde es still und kalt, und mein Mund konnte die Worte nicht aussprechen, die mein Kopf dachte.
Ich zimmerte einen Tisch und eine Bank, und abends, wenn die Familien zum Essen hineingingen und sich der Platz zwischen den kleinen Häusern leerte, saß ich an diesem Tisch und aß Schwarzbrot mit Salzfisch und eingelegten Rüben, und wenn ich dann die Augen schloss, sah ich die anderen Väter, die Mütter und die Kinder beim Essen.
Ich war noch kein Mann, aber auch kein Junge mehr, als Jakub mich eines Tages zu sich rief. Er saß vor seiner Hütte, auf einer Bank, die lediglich eine entrindete Bohle auf zwei grob zugehauenen Holzkloben war. In die Sitzfläche hatte er mit seinem Messer endlos sich windende Weinranken geritzt. Der Boden rings um seine Füße war immer mit Spänen bedeckt und seine Kleidung mit Holzsplittern übersät. Es war mir ein Rätsel, wie jemandem, der nicht sehen konnte, solche feinen Schnitzereien gelangen, genauso wie ich auch nicht verstand, woher er wusste, wer gerade vorbeiging.
Als er jung war, musste er größer gewesen sein als die meisten Männer aus unserem Dorf, doch jetzt war alles an ihm geschrumpft. Sein Gesicht war gegerbt und runzlig und umrahmt von weißem Bart- und Kopfhaar. Er erinnerte mich an die Frucht, die Etrog heißt und jedes Jahr von einem Reisenden gebracht wurde, der sie in einer kleinen Kiste auf einem Strohbett mit sich trug. Jakubs Rücken war gebeugt, wo die Schulterblätter ansetzten, und sein Kopf nach vorn gestreckt, als starre er trotz seiner Blindheit in die Ferne. Er trug eine ärmellose Jacke aus Ziegenleder, die ihm bis knapp über die Hüften ging, die Beine seiner wattierten Hose steckten in oft geflickten Stiefeln, denen man aber immer noch ansah, dass sie einmal schön und kostbar gewesen waren.
»Mein Junge«, sagte er. »Du kennst die Buchstaben des Alphabets. Du kannst lesen. Aber wenn du in die Welt hinausziehst, musst du die Sprache der Menschen sprechen können, unter die du dich begibst, und du musst Dinge wissen, die man nirgendwo findet als in Büchern. Die Sprache ist dein Schild und deine Waffe, sie ist dein Haus und dein Bett, sie ist Speise und Trank.«
»Vielleicht bleibe ich hier.«
»Und außerdem muss jemand die Geschichten bewahren.«
»Welche Geschichten?«, fragte ich.
»Alle«, sagte Jakub. »Die von diesem und die von jenem und deine eigene Geschichte. Ich werde dich lehren, was ich weiß, und im Tausch dafür hörst du dir meine Geschichte an. Vielleicht kann sie dir irgendwann einmal nützen. Vielleicht erzählst du sie weiter, und meine Geschichte wird Teil deiner eigenen und deine wiederum der Beginn der Geschichte von jemand anderem. Da drinnen liegt mein Buch. Hol es.«
Es dauerte lange, bis meine Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnt hatten. Nach einer Weile entdeckte ich auf einem schiefen Tisch einen Stapel aneinandergenähter Blätter verschiedener Größe, manche kaum größer als eine Hand, andere so groß, dass sie zusammengefaltet im Buch steckten. Als ich darauf zuging, sah ich eine Bewegung. Ich blickte mich um. Nichts. Ich beugte mich vor, um nach dem Buch zu greifen. Wieder bewegte sich etwas. Ich richtete mich auf und inspizierte die Umgebung. Erst jetzt erkannte ich, dass die Wände des Häuschens mit Holzschnitzereien bedeckt waren, so dicht, dass es schien, als krabbelten Ameisen in langen, sich dahinschlängelnden Ketten über die Bretter. Meine Augen wanderten über die bewegte Schnitzerei, und mein Blick fiel auf die Tischplatte, die ebenfalls aus dichten, sich windenden Girlanden bestand. Im spärlichen Licht tauchten Buchstaben auf. Sie waren kaum zu erkennen, und die meisten hatten keine Ähnlichkeit mit denen, die ich kannte, sie waren merkwürdig rund oder aber hoch und eckig. Mir war, als wäre ich in einem Buch gelandet. Eine unbekannte Hast ergriff mich. Ich stellte mich vor eine der Wände und fuhr mit den Fingern über die Wölbungen und Einkerbungen. Nahe der Tür, in Höhe der Schlaufe, die als Klinke diente, erkannte ich ein Wort. Während Jakub fragte, wo ich bliebe, las ich eilig, mit den Fingern über die Wörter aus Holz wandernd, einen Satz, der am Türpfosten emporkletterte und wie Efeu weiterkroch und über die Wand wucherte. Es waren nicht nur Wörter und Sätze, sondern auch Textfetzen, Bruchstücke in unbekannten Sprachen, Abbildungen, ähnlich dem, was man mit einem Stock in den Sand malt, um einem Fremden den Weg ins nächste Dorf zu erklären, Wörter, die die Form eines Baums oder Hauses, von Wäldern und Seen angenommen hatten, Sätze, die sich dahinschlängelten wie Waldwege.
Als ich wieder ins Freie trat, war ich atemlos vor Staunen.
An jenem Tag zeigte Jakub mir das Buch, in dem er schreiben gelernt hatte und das er seitdem immer bei sich getragen hatte, ständig ergänzt um Erlebnisse und Wissenswertes, Karten von seinen Wanderungen und Dinge, die er gelernt hatte. Die Buchstaben auf der ersten Seite waren von Kinderhand geschrieben und sagten in drei Sprachen: »Ich bin Jakub ben Adam, geboren in der Stadt Kaffa.«
So, mit den jugendlichen Schreibübungen Jakubs als Vorbild, lernte ich die lateinische und die griechische Schrift, und während die Wörter und Sätze in dem Buch fließender wurden und der Schreibende gewandter, nahm auch meine Geschicklichkeit zu, und ich lernte, die Wörter an der passenden Stelle zu verwenden und Sätze zu bilden, die nicht mehr nur das Allersimpelste sagten, sondern in sich schön und rein waren.
Jakubs Buch war das erste, das ich je in Händen hielt, und wenn es nicht das merkwürdigste war, das ich in meinem Leben zu Gesicht bekommen sollte, so doch zumindest das zweitmerkwürdigste. Es enthielt Zeichnungen von Geschöpfen, die ich nur vom Hörensagen kannte: Zentaur, Zyklop, Greif, Feuervogel. Es enthielt fremdartige und furchterregende Kreaturen: Kynokephale, die einen Hundekopf auf dem Körper eines Menschen tragen; den dreiköpfigen Zerberus, Harpyien, die so grauenerregend schreien, dass Menschen das Blut in den Adern gerinnt. Das Buch enthielt Geschichten, die Jakub unterwegs gehört hatte, und berichtete von Menschen, denen er begegnet war: dem kabbalistischen Alchemisten Abramelin, der behauptete, er habe Einblick in das geheime Buch der Schöpfung genommen; dem letzten der Chasaren, der auf der Suche nach der letzten chasarischen Frau umherzog; dem okkulten Arzt Agrippa, der verkündete, Mann und Frau seien ganz sicherlich gleich, das weibliche Geschlecht jedoch wahrscheinlich vortrefflicher als das männliche. In dem Buch waren Orte abgebildet, so groß, dass ich erst glauben konnte, dass wirklich so viele Menschen beieinander wohnen können, als Jakub von seiner Heimatstadt erzählte, die aus Hunderten von Straßen und Tausenden von Häusern bestand.
Sie waren Regen in der Wüste meines Geistes, diese Geschichten und Bilder in Jakubs Buch. Samenkörner, die jahrelang im Sand gelegen und gewartet hatten, keimten, schossen in die Höhe und wurden zu einer Decke aus Blumen und Blättern, dicht und bunt wie die Teppiche der Perser. Neue Ideen, was möglich war und was unmöglich, kämpften um Beachtung. Dass Menschen in Städten wohnten, so groß wie ein Wald … Dass manche an Bord von Schiffen gehen, ohne die Gewissheit einer anderen Küste, um zu entdecken, was sie nicht kennen, oder auf der Flucht vor bereits allzu Bekanntem … Dass es Zwerge, Riesen, Einfüßler, gelbe und braune Menschen gibt, Menschen, die im Wasser oder auf ihm leben, und andere, die sich in den Wipfeln hoher Bäume aufhalten und den Fuß niemals auf festen Boden setzen … Eine Wüste nach einem Regenguss war ich, ein Wald, in dem es Frühling wurde. Alles in mir blühte und suchte das Licht.
Später, als ich in meinen täglichen Unterrichtsstunden schon etwas weiter vorangekommen war, erzählte Jakub von seiner Jugend; dass er als junger Mann ein begieriger Leser gewesen war, der bis spätabends bei flackerndem Kerzenlicht Wörter und Sätze akribisch studierte, und dass er morgens in aller Frühe aufstand, um noch vor dem Frühstück lesen zu können, und wie er, als die Jahre dahingingen und er fast alles gelesen hatte, was im Hause seines Vaters vorhanden war, merkte, dass seine Augen schwächer wurden, dass er sich immer tiefer über die Buchstaben beugen musste, um sie zu erkennen. Da hatte er gewusst, dass seine schwindende Sehkraft ihm den Zugang zu dem versagen würde, was er über alles liebte.
»Die Sehkraft wurde mir genommen, damit ich sehen konnte«, sagte er.
Die Geschichte von Jakub ben Adam und seinen Eltern, Adam von Zypern und Bella d’Ancona, ihre Ansiedlung in Kaffa am Schwarzen Meer, ihr Glück und ihr Unglück, und der Schwarze Tod, der von Kaffa aus über die ganze Welt zog
***
Der Vater von Jakub, Adam, wurde in Zypern geboren. Nicht lange nach seiner Geburt ließ dessen Vater Abraham, ein Gewürzhändler, sich in Kaffa nieder, einem genuesischen Handelsposten. Die Stadt war einige Jahre zuvor von Tochtai, dem Khan der Goldenen Horde, belagert worden. Die Genueser waren geflüchtet, indes erneut zurückgekehrt, als Tochtais Nachfolger, Özbeg, ihnen Frieden anbot und sogar die Stadt Tana schenkte. Um den Handel wieder in Gang zu bringen, riefen die Genueser Händler aus Städten rund ums Mittelmeer auf, sich in Kaffa niederzulassen. Jakubs Großvater war einer von ihnen. Die Stadt, gelegen an der unter genuesischer Oberhoheit stehenden Schwarzmeerküste, beherrschte zusammen mit Jalta und Balaklawa den Karawanenhandel aus dem Fernen Osten und die Schifffahrtsrouten aus Konstantinopel, den Niederlanden, den deutschen Fürstentümern, Haifa und Jaffa, Damaskus, dem Libanon, Riga, Danzig und Genua. Für den Gewürzhandel ließ sich kein besserer Ort denken, und so brachte die Übersiedlung der Familie Glück. Ihr Wohlstand mehrte sich, und Adam erhielt die Erziehung und Bildung, die dem Sohn eines begüterten Kaufmanns gemäß waren.
Die Kinder des Schicksals heißen Glück und Unglück, und wenn das eine seinen Besuch abgestattet hat, lässt das andere meist nicht lange auf sich warten.
Eines Tages wurden Adams Eltern auf der Straße von einem betrunkenen Griechen angegriffen, der sie für ein türkisches Paar hielt. Es war ein unglücklicher Zufall, ein Missverständnis, eine grausame Laune des Schicksals, die den gerade erst erwachsen gewordenen Adam zum Waisen machte. Bis dahin hatte er sich über alte Bücher gebeugt und überall in der Stadt Philosophen und Gottesgelehrten gelauscht, denn ihn dürstete es nach Wissen, und er wollte trotz der Bedenken seines Vaters aus jeder Quelle trinken, die seinen Durst löschen konnte. Jetzt trug er plötzlich die Verantwortung für das Gewürzgeschäft. Anstatt Kommentare zu alten Schriften zu verfassen, schrieb er Briefe an Händler in Indien und China, in der Türkei und in Ägypten. Er beugte sich über Kassenbücher und Vorratslisten, und mehr als einmal schweiften seine Gedanken zu der Zeit ab, als er noch studiert hatte und dazu vorbestimmt schien, der erste Gelehrte der Familie zu werden. Er fand sich indes mit seinem Schicksal ab und arbeitete hart, um die Geheimnisse des Gewürzhandels zu ergründen. Doch obwohl seine treue Hingabe dazu führte, dass die Geschäfte genauso gut gingen wie unter der Führung seines Vaters, blieb sein Geist hungrig, und er wusste, dass ihn nur die Bücher sättigen konnten, die er studiert hatte.
Eines Tages wurde ein Ballen Myrtenzweige geliefert, und während er zuschaute, wie dieser ins Lager getragen wurde, entdeckte er plötzlich Buchstaben auf den Pergamentstreifen, mit denen die duftenden Zweige umwickelt waren. Er ließ den Packen absetzen und zerschnitt die Schnur. Was er in den Händen hielt, als er die Streifen nebeneinandergelegt hatte, erkannte er sofort als Fragment eines seltenen alten Textes: das Buch des Aufrechten. Es war ein Buch, das keiner je gesehen hatte, von dessen Existenz man jedoch dank zweier obskurer Erwähnungen im Alten Testament wusste, eine in Samuel: »… es ist geschrieben im Buch des Aufrechten«, und die andere in Josua: »Ist dies nicht geschrieben im Buch des Aufrechten?« Am selben Abend noch schrieb er dem Armenier, der die Myrte geliefert hatte, und fragte nach dem Ursprung des Verpackungsmaterials. Die Antwort kam drei lange Monate später, und als Adam den Brief seines Handelspartners las, kannte seine Enttäuschung keine Grenzen. Das Pergament sei von einem Kaufmann aus Isfahan geliefert worden, der seinerseits eine Partie aus Susa geholt habe, und es sei nicht mehr zu ermitteln, wie die Pergamentreste, offenbar aus einer zerschnittenen Schriftrolle, dorthin geraten seien.
Der Fund ließ Adam keine Ruhe, und er benutzte seine Handelsverbindungen, um Erkundigungen über Schriftrollen, Handschriften und Bücher einzuziehen. Er kam in Kontakt mit Gelehrten, die wie er nach besonderen, geheimen oder scheinbar verschollenen Schriften suchten, und wann immer möglich, ließ er sich zusammen mit Pfeffersäcken, Zimtkisten und Ölkrügen auch Bücher kommen. Er sammelte alles in einem eigenen Raum im Haus, in dem die Regale voller und voller wurden. Abends saß er dort und las, machte sich Notizen und stellte Listen von Büchern und Schriftrollen und sogar Tontafeln auf, die ihm in seiner Bibliothek noch fehlten und ihn möglicherweise auf die Spur des verschollenen Buches des Aufrechten bringen könnten.
Als die Jahre dahingingen, verbreitete sich das Gerücht von seinem Wissen, und anfangs kamen ein paar vereinzelte, allmählich aber immer mehr Menschen zu ihm und baten ihn um Rat. Seine Weisheit wurde gerühmt, und sein richtiger Name, Adam von Zypern, geriet in Vergessenheit. Stattdessen nannte man ihn Adam den Wundertäter. Er verbrachte immer mehr Zeit in seiner Bibliothek, die inzwischen so umfangreich war, dass er eine Wand zum angrenzenden Raum hatte durchbrechen lassen.
Nicht lange nach dem tragischen Tod seiner Eltern war ihm die Hand von Bella, der ältesten Tochter eines seiner Lehrer, angeboten worden, und nachdem er sich vergewissert hatte, dass sie ein Mensch war, der sich zu helfen wusste und nichts auf äußeren Schein gab, hatte er sie zu seiner Frau genommen. Sie heirateten, und ein Jahr später wurde Jakub geboren. Er wuchs unter der Obhut seiner Mutter auf, die sich um seine Bildung kümmerte, ihn in den drei wichtigsten Sprachen der Stadt lesen und schreiben lehrte und im Gebrauch des Abakus unterrichtete sowie in Geometrie, Sprachlehre, Musik und Astronomie.
Obwohl das Bücherzimmer seines Vaters für jeden verbotenes Terrain war, durfte Jakub es jeden Abend vor dem Schlafengehen betreten.
»Dann setzte er mich auf seinen Tisch«, sagte Jakub, »und während ich da saß, unsere Gesichter auf gleicher Höhe, erzählte er Geschichten. Erst viele Jahre später sollte ich verstehen, dass jede Geschichte eine Lektion umfasste und dass mein Vater mich durch Geschichten bildete. In meinem späteren Leben hat es mehrfach Momente gegeben, in denen ich mich in einer heiklen Lage befand oder vor einem großen Problem stand, und dann plötzlich an eine seiner Geschichten dachte und eine Lösung fand.«
Da sein Vater mehr und mehr Zeit in seiner Bibliothek verbrachte und immer häufiger von Kaufleuten zu Ländern und Bräuchen, von Amtspersonen zu Fragen von Recht und Gesetz und auch von Bürgern und Bauern um Rat gebeten wurde, lagen die Geschicke der Gewürzhandlung schließlich in Bellas Händen. Sie war die Tochter aus einem Geschlecht von Schriftgelehrten und nicht an die Listen und Fallstricke des Handels gewöhnt, aber sie lernte schnell, und es dauerte nicht lange, da war sie bekannt als gewiefte, aber verlässliche Geschäftsfrau. Christen, Juden und Muslime respektierten sie und behandelten sie als Ebenbürtige.
So wuchs Jakub auf, mit den Geschichten, die ihm sein Vater erzählte, wenn er auf dem Tisch in dessen Bibliothek saß, und im Gewürzlagerhaus, in dem seine Mutter an einem Pult stehend Briefe schrieb und Verzeichnisse erstellte und in dem es nach schwarzem Pfeffer und getrocknetem Ingwer aus Indien, Zimt aus Ceylon, Muskat und Nelken von den Molukken-Inseln, griechischem Safran und Gelbwurz aus Indien, Paradieskörnern aus Afrika, Zucker in kegelförmigen Hüten, Sumach aus Neapel und Sandelholz aus Timor duftete. In einem gesonderten Raum lagen Kisten, mit Blei ausgeschlagen und mit schweren Schlössern versehen, in denen Weihrauch und Myrrhe aufbewahrt wurden. In einem großen, mit Eisenbändern beschlagenen Schrank lagen Blattgoldblätter zwischen Seidenpapier neben Gläsern und Holztöpfen mit seltenen und gefährlichen Ingredienzien für Arzneien wie Theriak, Opium, Borneo-Kampfer, ein Stoff namens Drachenblut, Ranunkelextrakt, chinesische Alraune, Sulphur vivum, Stiergalle, Eselinnenmilch und Biberwein, Kupferblüte, Grünspan und Alaun.
Genauso wie die Räume seines Vaters eine Schatzkammer waren, in der die Hervorbringungen des menschlichen Geistes gesammelt wurden, so enthielt auch das Lagerhaus seiner Mutter das Erlesenste dessen, was die Erde hervorgebracht hatte.
Jakubs Jugend war von Düften und Farben und Büchern und Geschichten geprägt. Er war ein Junge, der nie Hunger litt und jeden Tag die Wunder der Welt sah, wenn er mit seinen Freunden die Stadt durchstreifte und am Kai stand und zuschaute, wie Schiffe gelöscht und beladen wurden, wenn er seinen Vater an einem mit Schriftrollen und Buchbänden überhäuften Tisch sah, wenn er im Lager half und Säcke mit stark duftenden Gewürzen auf Wagen lud, wenn er durch die Straßen unterhalb der großen Zitadelle ging, zwischen Genuesern, Mongolen, Griechen, Venezianern, Arabern und Armeniern. Kaffa, das war endlose Mannigfaltigkeit, und dem jungen Jakub schien, dies alles werde nie vergehen.
»Ich wusste, dass die wirkliche Welt größer war«, sagte Jakub, »sogar noch größer als die, in der die Routen der Karawanen und Schiffe endeten, die Gewürze in unsere Lagerhäuser brachten, aber ich dachte auch, man könne alles, was es gab, in unserer Stadt sehen, als sei Kaffa im Kleinen, wie das Große aussah, eine Abbildung, genauso wie eine Landkarte auf einem einzigen Blatt zeigt, was in Wirklichkeit unüberschaubar ist.«
Eines Nachmittags im frühen Frühjahr erschien ein graubrauner Strich am Horizont, der sich mit dem Verstreichen der Stunden in eine hohe heranrollende Staubwolke verwandelte. Die Wächter auf den Mauern der Zitadelle hielten es für Sand, den ein ferner Sturm von den Steppen geblasen hatte. Doch am nächsten Morgen, als die Dämmerung wich und die ersten Sonnenstrahlen tief über das Land strichen, war die Stadt auf drei Seiten von einem riesigen Zeltlager eingeschlossen, und niemand konnte mehr an der Ursache der Staubwolke zweifeln. Unterhalb der Stadtmauern glühte das Gelb der Zelte, dem die Goldene Horde ihren Namen verdankte. Der Konsul berief unverzüglich eine Zusammenkunft mit einflussreichen Bürgern und Weisen ein, um die Belagerung durch Dschani Beg, den neuen Khan, zu erörtern. Unter ihnen befand sich auch Jakubs Vater.
Das Vertrauen in die Uneinnehmbarkeit der Zitadelle, deren Mauern in den Jahren zuvor noch verstärkt worden waren, war so groß, dass Thorello Adorno, Neffe des Herrschers von Genua und Kommandant der Truppen, sich über die Situation fast zu freuen schien.
»Unsere Mauern sind uneinnehmbar«, rief er. »Sie schützen nicht nur die Stadt, sondern auch den Hafen, so dass wir uns auch weiterhin mit Nachschub versorgen können. Das einzige Opfer dieser Belagerung wird dieser verräterische Hund Dschani Beg sein. Er wird seine Pferde schlachten müssen, um seine Truppe zu verproviantieren.«
»Ihr sprecht voller Vertrauen über die Unfehlbarkeit unserer Verteidigung«, sagte Adam. »Und es ist wahr, was Ihr sagt: Unsere Mauern sind hoch und dick, und falls er Leitern baut, die lang genug sind, um die Mauern zu erklimmen, werden seine Krieger leichte Ziele für unsere Verteidigung sein.«
Die Runde saß um einen langen Tisch im Ratskabinett des Konsuls. Außer Adam von Zypern waren zwölf Männer anwesend: sieben Genueser – Amtsträger, Händler und der Truppenkommandant –, zwei Griechen, ein Armenier, zwei Muslime. Alle nickten: Undenkbar, dass die Angreifer die Stadt durch eine Belagerung auf die Knie zwingen würden. Das war vierzig Jahre zuvor nicht geglückt und würde jetzt, mit den verstärkten Mauern und der Erfahrung der vorausgegangenen Belagerung, nur noch schwerer sein.
»Das Schicksal«, sagte Jakubs Vater, »hüllt sich freilich in den Mantel des Unwahrscheinlichen.«
Thorellos Gesicht verdüsterte sich.
»Der Sohn, der von seinem Vater als Findelkind ausgesetzt wird, damit dieser der Prophezeiung entrinnt, er werde ihn ermorden, tötet Jahre darauf im Kampf einen Unbekannten, der sich als sein Vater erweist. Was weggeworfen wurde, ist zurückgekehrt. Ein Mann wird von seinen eifersüchtigen Brüdern an Fremde verkauft und sieht sie Jahre später wieder, als er Großwesir eines mächtigen Reiches ist und seine hungrigen Brüder bei dem Mann Korn kaufen wollen, in dem sie ihren Bruder nicht erkennen. Was in die Tiefe geworfen wurde, steht jetzt über ihnen.«
»Wer hat den Fremden gebeten, Geschichten zu erzählen?«, rief Thorello. »Soll er sich doch auf den Markt stellen mit seinen Märchen. Hier sprechen Männer über den Krieg.«
Der Konsul hob die Hand und sah Jakubs Vater an.
»Herr Adorno«, sagte Adam, »ich habe Euren Grimm erregt. Ich bitte Euch um Verzeihung. Wie die übrigen Anwesenden kann auch ich nicht anders, als Euch, Euren Männern und unserer großartigen Zitadelle zu vertrauen. Ich wollte nur deutlich machen, dass es an Euch, der Mannschaft und den Mauern nicht liegen wird. Doch oft sind die Dinge nicht, was sie scheinen. Der Tod kann in Gestalt eines Freundes kommen, ein Geschenk kann ein Fluch sein, Kraft eine Schwäche und ein klares Ziel eine Luftspiegelung.«
»Und Verrat«, sagte Thorello, »kann die Gestalt hübscher Geschichten annehmen.«
Adam neigte das Haupt.
»Genug«, sagte der Konsul. »Unsere Mauern sind stark und unsere Verteidiger bereit. Wir werden die Vorräte rationieren und einen Boten per Schiff nach Genua schicken. Wir werden uns nicht zu einem Kampf provozieren lassen. Dschani Beg und seine Mannen können sich am Anblick unserer Türme erfreuen, bis sie sogar in ihren Träumen nichts anderes mehr sehen. Wir kommen morgen wieder zusammen.«
Beim Verlassen des Ratskabinetts hielt der Konsul Adam auf. Er führte ihn zum Fenster, und dort, mit Aussicht auf die Stadtmauern und die mit Zelten übersäte Ebene in der Tiefe, sagte er: »Thorello ist ein Hitzkopf, aber ein guter Soldat. Worüber macht Ihr Euch Sorgen, Adam von Zypern?«
»Darüber, was wir übersehen. Oder, nein, nicht das, was wir übersehen, sondern das, was in unserem Blickfeld liegt und was wir trotzdem nicht sehen. Die Griechen belagerten Troja zehn Jahre lang und …«
»Jajaja«, sagte der Konsul ungeduldig, »aber Ihr glaubt doch wohl nicht, dass wir ein hölzernes Pferd hereinschleifen?«
»Nein«, sagte Adam. »Aber ich fürchte unsere Sicherheit. Nichts ist heil und nichts ist vollkommen. Ich fürchte, dass wir unsere Fehlbarkeit vergessen. Ich bin mir dessen bewusst, Herr Konsul, dass meine Bemerkungen unklar sind und dass ich keine Schwachstelle in unserer Verteidigung benennen kann. Aber wir sollten sie lieber selbst suchen, bevor der Angreifer sie findet.«
Der Konsul starrte aus dem Fenster.
»Gut«, sagte er. »Wir werden die Anlage inspizieren, die Tore, die Wassertunnel und die Brunnen. Mehr kann ich nicht tun.«
Die Belagerung dauerte eine Woche, zwei Wochen, einen Monat, zwei Monate. Die Sommerhitze kündigte sich mit dem Salzgeruch der Meeresluft an, in der Stadt begannen die Weinranken zu klettern und Obstbäume zu knospen. Die Zelte der Belagerer leuchteten golden in der strahlenden Sonne, und jeder wusste, dass die Hitze in Dschani Begs Lager, das durch Bäume kaum geschützt war, mit jedem Tag unerträglicher wurde. Die Belagerungstürme, mit denen der Feind in den ersten Wochen versucht hatte, sich den Mauern der Zitadelle zu nähern, waren zerlegt worden, und aus dem Material hatte man Ballisten gebaut. Eine Zeitlang hatten die Belagerer die Stadt mit Trümmern und Steinen beschossen, doch die Angriffe hatten wenig Wirkung gezeigt. Sofern die Geschosse die hohen Mauern überhaupt überwanden, dauerte es nicht lange, bis Thorellos Bogenschützen die Männer an den Ballisten außer Gefecht gesetzt hatten. Es war eine ausweglose Situation entstanden. Nur hin und wieder galoppierten Reitergruppen auf der Ebene vor der Stadt hin und her, schwenkten ihre Speere und schossen von ihren kurzen Bögen Pfeile ab, während von den Mauern herab Beleidigungen ertönten und Hohngelächter.
Als der Sommer verstrichen und der Herbst gekommen war, war aus der Belagerung ein Ritual geworden. Von Zeit zu Zeit flog ein Geschoss über die Mauern, woraufhin die Waffe unschädlich gemacht wurde, und dann geschah wieder tagelang nichts. Die Lebensmittel waren rationiert, doch Hunger litt keiner in der Stadt, denn im Hafen konnten nach wie vor Schiffe anlegen. Dschani Begs Leute dagegen mussten immer weiter reiten, um Proviant zu finden.
»Es sind Heuschrecken«, hatte Thorello während einer der wöchentlichen Zusammenkünfte gesagt. »Sie fressen das Land kahl, und wenn nichts mehr da ist, werden sie weiterziehen.«
Der Einzige, der nicht zustimmend genickt hatte, war Jakubs Vater gewesen.
Es wurde Winter, und obwohl es nicht sehr kalt war, konnten sowohl die Belagerer als auch die Belagerten sich kaum wärmen. In der Stadt war das Brennmaterial knapp, und im Lager der Goldenen Horde sowie in dessen Umkreis waren die meisten Bäume gefällt, und man konnte nur noch Pferdemist verheizen. Doch es gab immer weniger Pferde und nicht genug Zeit, den Mist zu trocknen.
Dann, eines Morgens im Februar, ertönte ein Ruf von einem der sechsundzwanzig Wachtürme, und nicht lange danach tauchten weiße Segel mit dem roten Sankt-Georgs-Kreuz am Horizont auf. Die genuesische Flotte landete in dem geschützten Hafen, und ein endloser Strom von Soldaten ging von Bord. Sie wurden wie Helden empfangen. Zwei Tage später unternahmen sie einen Ausfall und fegten die Truppen der Goldenen Horde hinweg. Am Ende des Tages war die Ebene übersät mit Leichen.
Wieder rief der Konsul seine Berater zusammen. Thorello erschien in Kampfkleidung und bester Laune.
»Du hattest recht, Adam von Zypern. Das Schicksal hüllt sich in den Mantel des Unwahrscheinlichen. Dschani Beg konnte nicht ahnen, dass sein Heer von unserer Verstärkung weggefegt wird.«
Gelächter erhob sich, denn Thorello war jetzt der Mann, der die Stadt gerettet hatte, obwohl seine Truppen nur ein unbedeutender Teil der Befreiungsmacht gewesen waren, die aus dem Tor gestürmt war, um die durch Krankheit, Kälte und Erschöpfung geschwächten Belagerer anzugreifen.
Es war Frieden. Was zerstört war, wurde repariert, Bäume wurden gepflanzt, wo welche gefällt worden waren, verbrannte Äcker gepflügt und eingesät, die beim Ausfall getöteten Tataren begraben. Es wurde Herbst und Winter und Frühling, und da erschienen die Reiter abermals vor den Toren, und was geschehen war, geschah von neuem. Wie der Prediger sagt: Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder, und es geschieht nichts Neues unter der Sonne.
Die Tataren schlugen ihr Lager auf und bauten Belagerungswaffen, und in der Stadt wurden die Mauern erneut mit Bogenschützen besetzt, die jeden unter Beschuss nahmen, der sich zu nahe heranwagte. Die Freude über die siegreiche Befreiung war von kurzer Dauer gewesen, und die Bürger von Kaffa begannen, sich zu fragen, wie viele Belagerungen sie wohl durchstehen konnten. Der Hafen war voll von Schiffen, die Händler und ihre Familien mit ihrem gesamten Hab und Gut an sicherere Orte brachten.
Die zweite Belagerung zog sich hin und zog sich länger hin, und es änderte sich nicht viel an der Situation, bis es im Lager von Dschani Beg ruhig zu werden begann. Während einer Zusammenkunft beim Konsul versuchten die Mitglieder des Rates, eine Antwort auf die Frage zu finden, was da los sei.
Thorello kannte keine Zweifel.
»Ihr Widerstand ist gebrochen«, sagte er. »Sie sehen ein, dass die Zitadelle uneinnehmbar ist und dass Kaffa nicht fallen wird. Aber sie sind zu stolz, um das einzugestehen, und darum hocken sie wie alte Weiber in ihren Zelten und schmollen und zanken. Der Zwist ist so groß, dass es mehr Tote durch Streitereien gibt als durch den Krieg.«
»Tote?«, fragte Adam.
Thorello ignorierte ihn und sagte zum Konsul: »Jedes Mal, wenn eine Leiche aus einem der Zelte getragen wird, versammeln sich meine Männer auf dem Wehrgang und jubeln und rufen. Das erfüllt die Tataren mit ohnmächtiger Wut, und diese Wut kühlen sie aneinander.«
»Wie viele Tote?«, fragte Adam.
»Wie viele Tote?«, sagte Thorello. »Haltet Ihr mich für einen Totengräber, der ihre Leichen zählt?«
Der Konsul rief ihn zur Ordnung.
»Dies ist eine Ratsversammlung, Thorello. Beantwortet die Frage.«
Die Gesichtszüge des Garnisonskommandanten erstarrten.
»Ein paar«, sagte er.
»Was sind ein paar?«, fragte Adam.
»Sprecht ihr unsere Sprache nach all den Jahren in unserer Mitte noch immer nicht gut genug?«
Der Konsul schlug mit der flachen Hand auf den Tisch.
»Einige«, sagte Thorello widerstrebend.
»Fünf am Tag?«
Thorello zuckte mit den Achseln.
Adam von Zypern holte tief Luft. Dann sagte er: »Herr Konsul, es erstaunt mich, dass die Verluste des Feindes nicht gezählt werden. Wie sollen wir jetzt wissen, wie stark er ist?«
Er wandte sich zu Thorello und sah ihn lange an.
»Unsere heiligen Bücher, die auch die Eurigen sind, sagen: Freue dich nicht über den Fall deines Feindes. Anstatt zu jubeln, hätten Eure Männer besser zählen sollen.«
Thorello zog eine höhnische Miene. Der Konsul wandte sich an Adam und fragte ihn nach seiner Ansicht über die Toten im Lager Dschani Begs.
»Herr«, sagte dieser. »Es kann sein, was unser Kommandant denkt, dass Verzweiflung und Ärger zu Streit führen und dass Stolz sie daran hindert, die Belagerung abzubrechen.«
Thorello machte eine Geste, die Selbstzufriedenheit ausdrückte.
»Aber es kann auch etwas anderes sein. Daher möchte ich darum bitten, jemanden zu bestimmen, der über die Todesfälle im Lager Buch führt. Kampf ist nicht nur Waffengeklirr. Er ist auch Information. Je mehr Informationen wir haben, umso besser wissen wir über unseren Feind und seine Lage Bescheid.«
»Wir sind Soldaten, keine Buchhalter.«
»Thorello«, sagte der Konsul, »sucht einen Mann, der lesen und schreiben kann, lasst ihn die Toten zählen und mir täglich Bericht erstatten.«
»Herr …«, sagte Thorello.
»Damit ist die Versammlung beendet«, sagte der Konsul. »Morgen zur selben Zeit sprechen wir uns wieder.«
Eine dunkle Wolke zog über das Gesicht des Kommandanten der Zitadelle. Er starrte auf die Tischplatte und atmete schwer. Dann erhob er sich zusammen mit den anderen und stürmte aus dem Raum. Der Konsul hielt Adam auf.
»Etwas quält Euch.«
Adam nickte.
»Warum sollten unsere Belagerer sich gegenseitig umbringen?«, sagte er.
»Sie hocken schon fast ein Jahr im Lager«, sagte der Konsul, »ohne Ergebnis, die Bedingungen müssen dort schlecht sein. Glaubt Ihr nicht, dass …«
»Herr«, sagte Adam, »während der vorigen Belagerung war von Streit untereinander keine Rede. Warum dieses Mal?«
Der Konsul betrachtete ihn nachdenklich.
»Ihr seid ein weiser Mann, aber Ihr habt mehr Fragen als Antworten.«
»Einem Problem«, sagte Adam, »kommt man besser mit Fragen bei als mit Antworten.«
Ein paar Tage darauf kamen die ersten Berichte: Es wurden ungefähr zehn Tote pro Tag aus dem Lager getragen, die Belagerungsmaschinen standen unangerührt da, und es zeigten sich keine Reiter mehr auf der Ebene zwischen den Stadtmauern und dem Lager.
Der Rat trat zusammen und befasste sich mit der Lage. Im einfallenden Sonnenlicht glühte das Kirschbaumholz des großen Tisches rosarot. Der Konsul ließ seinen Blick über die Anwesenden wandern.
Er sprach: »Ich glaube nicht, dass diese Todesfälle lediglich die Folge von Streitigkeiten sind.« Er wandte sich an den armenischen Archimandriten Ioannes. »Was denkt Ihr, Vater?«
Der Priester sah aus wie ein Basaltmonolith. Er blickte reglos vor sich hin.
»Etwas anderes als die Strafe, die Gott dem Dschani Beg Khan zugeteilt hat?«, sagte er.
Er fuhr sich durch den Bart. Bevor er antworten konnte, ertönten draußen Rufe, es wurde an die Tür gehämmert, und ein atemloser Diener stürzte herein.
»Herr«, sagte er keuchend, »die Tataren …«
»Was ist mit ihnen?«
»Sie …«
Der Konsul verließ den Raum, auf dem Fuße gefolgt von den anderen.
Als sie draußen standen, in der Wärme der Sommersonne, die auf die Befestigungsanlagen schien, kam ein Mann durch die Luft geflogen. Er trudelte durch das Blau, Arme und Beine schlenkerten in alle Richtungen, und dann purzelte er wie ein angeschossener Fasan zu Boden.
Später am selben Tag sollte Jakub sie auch sehen. »Fliegende Männer«, sagte er, »die im Bogen über die Mauern der Zitadelle in die Stadt segelten. Es war wundersam und schrecklich.«
Die Tataren waren von einer unbekannten Krankheit befallen worden. Das war der Grund für die Sterblichkeit in ihrem Lager und die Abnahme der Angriffe. Jetzt hatten sie ihre Ballisten wieder in Stellung gebracht und schleuderten ihre Toten in die Stadt, um die Krankheit unter den Bewohnern von Kaffa zu verbreiten. Die Leichen schlugen auf Dächern und Plätzen auf und zerbarsten an Hauswänden. Ein grauenhafter Gestank entströmte ihren entstellten Körpern. Der Konsul gab den Auftrag, sie wegzuschaffen, doch nach einigen Tagen brach die Seuche auch unter denjenigen aus, die die Leichen weggeschleppt hatten, und nicht lange danach verbreitete sie sich auch unter den übrigen Bürgern. Draußen vor den Wällen steckten die Soldaten des Feindes ihre Belagerungsmaschinen in Brand, Zelte wurden abgebaut und Pferde eilends zusammengetrieben. Stunden später war das Lager verlassen. Hie und da lagen Leichen zwischen schwelenden Holz- und Aschehaufen, einige zusammengesackte Zelte waren zurückgeblieben, und die Ebene war übersät mit den Resten eines Heeres, das überstürzt aufgebrochen war.
Der Konsul befahl, Schiffe bereit zu machen, weil die Seuche jetzt wie ein Strohfeuer durch die Stadt jagte. Die Furcht, die die Tataren in die Flucht geschlagen hatte, nahm auch von Kaffa Besitz, Tausende strömten auf den Kais zusammen, manche mit ihrer Habe in Kisten und Säcken, andere lediglich mit dem, was sie am Leibe trugen. Man kämpfte um einen Platz an Bord, Menschen stürzten zu Boden und starben, Panik wogte durch die Menge. Schon bald wurde jeder, der krank war oder auch nur schlecht aussah, fortgejagt. Tote warf man ins Wasser.
Frieden, Sorge für den Nächsten, Verständnis, gute Manieren, sie sind eine dünne Haut. Wenn die Not groß ist und die Angst regiert, zerbirst die Haut und der Eiter quillt hervor, dann eitert der Körper der Familie, des Dorfes, der Stadt, und es gibt nur wenige, die nicht angesteckt werden und nach wie vor Würde und Mitmenschlichkeit aufbringen.
»Meine Eltern fanden einen Platz für mich auf einem der ersten Schiffe, die die Stadt verließen«, sagte Jakub. »Für das kleine Stückchen Deck, auf dem ich die Reise machte, zahlten sie ein Vermögen. Sie selbst blieben zurück, um die Kranken zu versorgen, die nicht reisen konnten. Ich fand Obdach bei einem Onkel meiner Mutter in Genua, doch als wir dort ankamen, stellte sich heraus, dass die Krankheit mit uns gereist war. Binnen einer Woche flog die Pest durch die Straßen, und mein Onkel schickte mich zu Verwandten nach Lucca, und als auch dort das Sterben begann, zog ich wieder weiter, jetzt allein, mit nicht viel mehr als einem Ranzen und einem Stock. Wir aus Kaffa hatten den Tod nach Genua gebracht, und von dort schlich er sich ins Umland ein und weiter, noch weiter, viel weiter. Später erreichten uns Berichte von erschreckenden Sterbeziffern in anderen Ländern, von Dörfern, in denen niemand überlebte, und Städten, in denen Menschen sich selbst einmauerten, um dem Tod zu entrinnen, von fernen Ländern, wo Totenschiffe strandeten. Jeder misstraute jedem, denn die Krankheit war unsichtbar, und jeder Mann, jede Frau und jedes Kind konnte sie in sich tragen. Am meisten misstraute man Fremden und Reisenden. Ich beschloss, mich als Bettelmönch zu kleiden, und zog so dahin, fünf lange Jahre. Dann war das schlimmste Sterben vorbei, und weite Teile der uns bekannten Welt lagen brach, die Dörfer ausgestorben.«
Jeden Tag auf dem Weg zum Fluss, wenn meine Füße über federndes Moos gingen und meine Hände durch die Blätter eines Haselnussstrauchs strichen, flüsterte ich: Lass alles neu und besonders sein, lass mich die Welt immer spüren. Das Sonnenlicht brach in stiebenden Bahnen durch das Laubdach, Stäubchen schwebten in der Luft, Zweige knackten und Bäume ächzten. Jeder Baum, jeder Strauch, jeder Kaninchenbau, jeder Wildpfad, jeder Stein wollte sehen. Die Stimme in meinem Kopf sagte: Es gibt zehntausend Dinge auf der Welt, und du bist eines von ihnen, du bist wie die Bäume, die Sträucher, die Kaninchen und die Füchse und die Libellen und die Bienen, du bist eins mit allem. Und dann spürte ich, wie mein Herz sich öffnete, und ich wusste, dass ich nicht nur die Welt spürte und alles, was in ihr war, sondern auch, was nicht da war, das Nichts zwischen meinem Vater und mir und das Nichts meiner Mutter, die ich nie gekannt hatte, nach der ich mich aber trotzdem sehnte, das Unbekannte, das außerhalb unseres Waldes lag und nach dem es mich hungerte. Ich lebte im Garten Eden, war jedoch, wie Adam, hungrig nach der Frucht, die Erkenntnis heißt, und würde hineinbeißen, wenn sie mir dargeboten wurde. Ich war hier, aber auf dem Weg nach dort, auch wenn ich noch keinen Schritt getan hatte.
»Warum«, fragte ich Jakub eines Tages, »bauen wir keine Gewächse an? Jetzt müssen wir zu den Bauern gehen, die viel zu viel von uns für das Schlechteste ihrer Ernte verlangen.«
»Weil wir in Erwartung leben«, sagte Jakub.
»Wie lange muss man warten?«, sagte ich. »Der Wald gehört allen. Niemand hat ihn gemacht, und was man nicht gemacht hat, gehört einem nicht.«
Jakub nickte. Seine Finger glitten über die Schale, an der er schnitzte, auf der Suche nach einer Unebenheit.
»Selbst das, was du gemacht hast, gehört dir nicht«, sagte er.
Er setzte das Messer an die Schale und schnitt einen Holzspan weg.
»Es gibt zehntausend Dinge auf der Welt«, sagte er, »und sie sind alle eins. Nichts ist für sich allein und jemandes Besitz.«
Er balancierte die Schale in seiner Hand und legte den Kopf in den Nacken, als wolle er im Geiste betrachten, was er geschaffen hatte.
»Geh«, sagte er. »Werde Bauer. Finde heraus, dass der Bauer nichts anderes ist als der Fischer oder der Holzfäller, dass das eine das andere ist und das andere das eine.«
An jenem Tag schnitzte ich einen Spaten aus Holz, brach die Erde hinter unserer Hütte und legte einen kleinen Acker an, auf dem ich Knollen und Bohnen aus den Vorräten pflanzte. Ich fasste das Rechteck aus schwarzer Erde mit Soden und Steinen ein, um kriechendes Getier fernzuhalten. Eine der Frauen kam vorbei und fragte, was ich machte, und ich sagte, dass ich Gewächse anbaute, damit wir nicht in entlegene Dörfer gehen müssten, um sie zu kaufen. Am nächsten Tag lieh sie sich meinen Spaten aus, und wieder einen Tag darauf kam eine andere Frau mit derselben Bitte. Überall im Dorf tauchten kleine Äcker auf, und Frauen und Kinder pflanzten Knollen und Bohnen und Samen. Die aufgeregten Stimmen der Kleinsten schrillten in der Luft, und von Zeit zu Zeit hörte ich die Frauen lachen. Einige Tage später jedoch kamen ein paar Männer aus dem Wald zurück, sie traten die Wälle um die Äcker weg, wühlten den Boden um und zerbrachen den Spaten. Ich fand ihn in drei Stücken vor meiner Tür.
»Wir sind kein Kainsvolk«, sagte einer von ihnen. »Und unsere Frauen brauchen nicht auf dem Land zu arbeiten, um für Nahrung zu sorgen.«
Ich stand auf meinem umgewühlten Acker und dachte an den Spaten und wie er das Gras durchschnitten hatte, dachte an die Soden, die ich gestapelt hatte, den dunklen Geruch, der aus der Erde aufgestiegen war, die Würmer, die zwischen den feuchten Schollen krochen, und die Sonne, die die Erde schließlich trocknete und grau machte. Einer der Männer hatte gesagt, dass es nicht zu uns passe, wie Bauern zu leben, denn der Bauer arbeite in Erwartung des kommenden Jahres und des Jahres danach. Er lebe in der Zeit, wir außerhalb davon. Ich dachte: Wir sind Zwischenmenschen.
An jenem Abend saß ich an dem Tisch, den ich gemacht hatte, und schaute auf die stille Lichtung zwischen den Häusern. Die Dämmerung sank auf das Dorf herab, eine tiefe grüne Dämmerung, wie es sie nur im Wald gibt, Vögel riefen gegen das nahende Dunkel an, aus den anderen Häusern drang das Geräusch von Stimmen. Ich verspürte Wut und Demut, Wut über das halsstarrige Festhalten am Alten bei den Männern und Demut, weil ich geglaubt hatte, recht zu haben sei genug, um Veränderungen herbeizuführen. Ich war stolz auf das gewesen, was ich bewerkstelligt hatte, aber alles hatte sich als vergebens erwiesen. Als ich mich bei Jakub beklagt hatte, hatte er gesagt, es sei schön, wenn eine Eichel auf den Waldboden falle, doch damit ein Baum entstehe, dafür brauche es mehr als nur eine Frucht.
»Die Menschen«, sagte er, »fürchten das Unbekannte, die Veränderung. Wer sie durch die Wüste in die Oase führen will, darf nicht nur den Weg weisen. Er muss ihren Glauben gewinnen, ihren Glauben an ihn.«