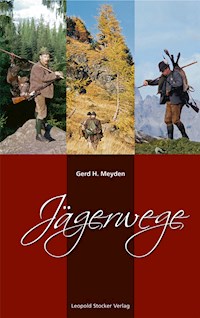Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stocker, L
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Gerd Meyden ist der erfolgreichste lebende Jagdschriftsteller und hat immer noch viel zu erzählen, wie sein sechstes Buch beweist. Sein spannender Stil "nimmt den Leser mit" zum Gamsjagern, zu Treibjagden auf Niederwild, zu Nachsuchen oder zur Hahnenpfalz. Ob im heimischen Revier im Allgäu, in Österreich oder anderswo in Europa: Wie immer steht sein Bestreben, das edle Weidwerk gerecht auszuüben, im Fokus seiner Erzählungen. Eindrucksvoll weiß er in Worte zu fassen, wie erfüllend und berührend es sein kann, die Natur und ihre Geschöpfe bewusst wahrzunehmen. Mit seiner bilderreichen und wortgewandten Erzählweise führt er seinen Lesern die Landschaft im Wechsel der Jahreszeiten und die vielfältigen Stimmungen auf dem Ansitz und der Pirsch vor Augen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerd H. Meyden
EdlesWeidwerk
Natur bewusst erleben
Leopold Stocker Verlag
Graz – Stuttgart
Umschlaggestaltung: DSR Werbeagentur Rypka GmbH,
8143 Dobl, www.rypka.at
Titelbild: Gerd H. Meyden
Alle Fotos im Innenteil des Buches wurden dem Verlag freundlicherweise vom Autor zur Verfügung gestellt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Hinweis:
Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die zum Schutz vor Verschmutzung verwendete Einschweißfolie ist aus Polyethylen chlor- und schwefelfrei hergestellt. Diese umweltfreundliche Folie verhält sich grundwasserneutral, ist voll recyclingfähig und verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne kostenlos unser Verlagsverzeichnis zu:
Leopold Stocker Verlag GmbH
Hofgasse 5
Postfach 438
A-8011 Graz
Tel.: +43 (0)316/82 16 36
Fax: +43 (0)316/83 56 12
E-Mail: [email protected]
www.stocker-verlag.com
ISBN 978-3-7020-2043-9
eISBN 978-3-7020-2067-5
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.
© Copyright by Leopold Stocker Verlag, Graz 2022
Layout: Ecotext-Verlag Mag. G. Schneeweiß-Arnoldstein, Wien
Repro: DSR Werbeagentur Rypka GmbH, 8143 Dobl
Inhalt
„Jagen ist gesteigertes Leben“
Vorwort – Ein Buch von der Zeit eines Jägers
Der Hahn vom Granitzl
Der Semmelgelbe
Albtraum – „live“
Der geteilte Hahn
Ein Rehbock beim Zahnarzt
Unwillkommene Gäste
Vom Winde verweht
Freikugel?
Vis-a-vis
Der Schneebock
Jägerlatein
Meisterführers Rezept
Der Bergretter
Reh tot
Abpraller
Ein Urmensch
Einhaklig
Rehbockfinale
Steinschlag
Im Advent
Schwarzer Traum auf weißem Grund
Eine „haarige“ Weihnachtsgeschichte
Winter am Berg
Danke, liebe Lederhose
Zu guter Letzt
„Jagen ist gesteigertes Leben“
Diesen Ausspruch fand ich vor Jahren in einem Buch des von mir sehr geschätzten Jagdschriftstellers Ludwig Benedikt Freiherr von Cramer-Klett. Das hat meine Empfindungen für die Jagd im Innersten getroffen und bestätigt.
Bin ich auf der Jagd, so höre und sehe ich alles in und aus meiner Umwelt in gesteigertem Maß. Wohin weht der Wind? Was sagt mir der Laut der Vögel?
Das Ziel der Jagd ist es, Beute zu machen. Der Weg zu diesem Ziel erfordert alle Sinne. Er fordert das bewusste Lesen aller Zeichen der Natur.
Das bedeutet für mich gesteigertes Leben.
Vorwort – Ein Buch von der Zeit eines Jägers
Gerd Meyden hat wieder ein wunderbares Buch mit Jagdgeschichten vorgelegt!
Doch wer, in unser alles verkürzenden Zeit, in der sich die Sprachgewalt einer ganzen Generation in Sätzen wie „hey Alter“ oder „Chayas klären“ zu erschöpfen scheint, wird noch ein Jagdbuch lesen? Wer kann überhaupt noch lesen, wenn bei manchen Einstellungsprüfungen für den öffentlichen Dienst fast die Hälfte der Bewerber – alles Maturanten – im Fach Deutsch scheitert?
Und wir Jäger, die wir unsere Jagdbegeisterung so gerne zeigen? Das jagdliche Erleben, mit all seiner gelegentlichen Mühsal, den uns erwachsenden Hochstimmungen und Niederlagen – suchen wir sie noch in einem Buch? Reicht uns zur Konservierung „unserer“ Jagd nicht das Handy, mit dem wir alles festhalten, was uns des Vorzeigens wert erscheint, mit dem wir unsere „Community“ weltweit bedienen und Stammtische wie unschuldige Nichtjäger unterhalten wie belästigen?
Gerd Meyden und die Jäger seiner Zeit kamen noch ohne Weitschuss-Seminar und ohne Nachtjagd-Optik aus. Wenn wir so wollen, dann war des Jägers Glück auch dem Umstand geschuldet, dass Handy, Drohne, Laptop und WhatsApp einfach noch nicht erfunden waren. Wenn dem so ist, dann waren weniger wir Jäger „aus anderem Holz“ als vielmehr die Zeit mit dem, was sie uns (nicht) bot!
Das Buch reflektiert nicht nur eine Jagd, an der heute die Zeit nagt. Der Autor setzt sich auch mit der Gesellschaft auseinander: mit den letzten Kriegsjahren, mit der Flucht und mit dem Schicksal, als Deutscher unter Deutschen gar nicht willkommen gewesen zu sein. Es zwingt uns damit, gleichermaßen über das Gestern wie auch über das Heute nachzudenken.
Gerd Meydens Weg führt vom alten Ostpreußen auf beschwerlichen Umwegen nach Bayern. Seine eigentliche Jägerjugend – die prägenden Jahre – hatten die in den ersten Nachkriegsjahrzehnten stillen Landschaften südlich Münchens zur Kulisse. Dann eroberte – nicht nur als Jäger – das Allgäu sein Herz. Jagdliche „Gastspiele“ führen auch im Buch nach Salzburg, ins Burgenland und bis in die Bergwelt Asiens, in den Altai. Seinen jagdlichen – immer noch andauernden – Ausklang findet der Autor im sanften, unspektakulären Gehügel der Schotterebene hinter München – seine Seele blieb wohl irgendwo im Allgäu hängen.
Gerd Meydens Weg, den er in diesem Buch sprachlich gekonnt beschreibt und der Weg dessen, der dieses Vorwort beisteuert, verliefen nicht parallel, aber sie kreuzten sich vielfach. Des einen Heimat war das alte Ostpreußen, von wo aus ihn das Schicksal schmerzhaft westwärts trieb – in des anderen Heimat. Dem wiederum ist Ostpreußen in späten Jahren zwar nicht zur zweiten Heimat, aber verdammt „lieb“ geworden. Beide waren wir – während einer gewichtigen Spanne unseres Lebens – im Allgäu daheim. Es war eine weiland großartige Landschaft, voll Stoff für „grüne Bücher“ – egal ob drinnen in den Hochbergen oder draußen in den stillen Mösern. Viel hat sich geändert …
Unsere jagdlichen Wege trennten sich jedoch, schon ehe wir im Allgäu landeten. Gerd Meyden ergriff einen „ordentlichen“ Beruf, wurde erfolgreich, was ihm auch ein reiches Jägerleben ermöglichte – nicht nur in der Heimat. Der Beruf ließ ihm zwar für die Jagd nicht übermäßig viel Zeit. Doch obwohl ihm in Summe weniger Zeit für die Jagd zur Verfügung stand – er „durfte“ jagen! Der Laudator dieses Werkes machte die Jagd hingegen zum Beruf. Er durfte die ihm vom Leben geschenkte Zeit ganz für die Jagd verwenden, musste sie verwenden. Gerade deshalb hatte er – „en detail“ – oft viel weniger Zeit für sie. Doch beide hatten dasselbe Ziel: die Jagd, so wie sie jeder von ihnen zu lieben gelernt hatte, auszukosten und in ihrem Kern zu erhalten. Das Buch soll dabei helfen.
Das Allgäu ist – man kann auch im „Kohlenpott“ leben – immer noch eine schöne Landschaft. In erster Linie ist es aber zur unverzichtbaren Kulisse für Millionen Urlauber, für die Massen der Mountainbiker, der Bergwanderer, Skifahrer und „Hobby-Jodler“ geworden. Zwischen ihnen sucht der Jäger heute sein Auskommen.
Viel, ganz viel verschwand: Traumhafte Wiesen voller Orchideen, Enzian, Primel und Trollblumen wurden zu trostlosen Fichtenplantagen und Maiseinöden. Stolze Bergwald-Buchen wurden noch Ende der 1980er-Jahre zu Tausenden chemisch und mechanisch geringelt, um Fichten Platz zu machen.
Zeit: Vielleicht stößt dem Leser dieser Einleitung das Wort „Zeit“ auf? Gewiss – es steht in fast jedem zweiten Satz. Aber es beschreibt nicht nur mehr oder weniger lange Abschnitte aus Jahren, Tagen und Sekunden, die wir Vergangenheit und Zukunft nennen. Zeit ist es, die in vielfacher Hinsicht – passiv wie aktiv – unser Leben, unsere Gefühle, unsere Hoffnungen bestimmt. Zeit war auch einmal der wichtigste Faktor des Jagens. Viele „Gestrige“ fanden ihren Weg zur Jagd mit viel – oft mit sehr viel – Zeit. Das Jägerwerden war oft ein Traum mit zähen Geburtswehen, vom Mitgehen-Dürfen, vom langsamen Hineinwachsen, vielleicht vom Wiederholen der Prüfung. Nach bestandener Prüfung wiederholte sich alles: Das Mitgehen-Dürfen und das langsame Hineinwachsen.
Heute müssen sich die Dinge, die wir tun, lohnen. Man verlangt es sogar von uns. Wer bei der Forstverwaltung einen Pirschbezirk bekommt, der soll „liefern“. Früher erregte Misstrauen, wer zu häufig lieferte. Wer heute Jäger wird, beschreitet einen rationalen Weg. Er lädt den Stoff, den er beherrschen soll, via App auf sein Smartphone. Er nimmt sich drei Wochen Zeit, besucht eine Jagdschule und büffelt standardisierte Antworten auf standardisierte Fragen. Mag sein, dass das, was er büffelt, korrekter ist als jenes, das uns früher ein Mentor oder Lehrprinz beibrachte.
Was aber wird bleiben, was wird uns auch dann noch berühren, wenn sich die morsch gewordenen Knochen einmal der aktiven Jagd verweigern? Das frühe, direkte, blutwarme Erleben draußen im Revier oder die perfekte Sammlung an Präparaten und anderen Lehrmitteln während des dreiwöchigen Lehrgangs? Was brennt sich tiefer ein: der erste selbst gesuchte und erlegte „Allerwelts-Rehbock“ mit Bescheidenheits-Garantie oder der sich zur bestandenen Jägerprüfung gegönnte „Abschuss“ eines weit besseren Bockes irgendwo, unter Führung eines Profis?
Zeit haben und sich Zeit lassen gehörte zum eisernen Kern des Jagens! Das war – auch wenn es als Widerspruch erscheint – vor wenigen Jahrzehnten noch möglich. Der Druck auf den einzelnen Jäger seitens der Behörden war gering und die jagdliche Konkurrenz ebenso. Man war eher alleine, und auch deshalb durfte man sich Zeit lassen. Der störende Einfluss auf die Jagdausübung – direkt wie indirekt – durch Gesellschaft, Landwirtschaft und Verkehr war vergleichsweise bescheiden.
Die Zeit und ihre oft verdammt morsche Moral: Welcher Autor dürfte es heute noch wagen, offen zu gestehen, dass er seinen ersten Hasen oder Rehbock ohne Jagdkarte erlegt hat – vielleicht sogar in fremdem Revier? Eine Mure aus moralsaurer, absolut tödlicher Heuchelei würde ihn verschütten – und doch haben viele von uns genauso angefangen! Große Geister wie Gagern oder Cramer-Klett durften das noch. Dafür mochte damals der Geist der Zeit mehr als eine Mure auslösen, wenn ein Rehbock den falschen Ausweis vorzeigte (siehe „Der Semmelgelbe“). Verständnis für Ausrutscher hatten eher jene, die damals schon reich ernteten, weniger die „Mächtigen“.
Und die Jungen, die Gerd Meyden ebenso erreichen will wie der Stocker Verlag – die wichtigste Zielgruppe? Können sie unser Verständnis von Jagd nachvollziehen und Gefallen daran finden? Kann man überhaupt etwas empfinden und überzeugt bejahen, wenn man es gar nicht mehr erleben durfte? Gerd Meyden muss davon ebenso überzeugt sein wie der Stocker Verlag. Der eine hat das Buch mit dem Herzen geschrieben, was ihm trefflich gelang, der andere verlegt es aus Überzeugung.
Heute ist der Leopold Stocker Verlag einer der letzten Verlage, der jagdliche Belletristik pflegt! Er hatte dereinst alle Werke Edmund Müllers herausgebracht – auch der ein ganz großer Allgäuer Jäger und Forstmann. Der Stocker Verlag war auch die verlegerische Heimat Philipp Merans und ehrte vor kurzem Friedrich von Gagerns Werk: Im Leopold Stocker Verlag ist unter der Herausgabe von Gerd Meyden, der ein ebenso großer Bewunderer Friedrich von Gagerns Jagderzählungen ist wie ich, eine Sammlung der besten Geschichten Gagerns erschienen. Dafür sei ihm gedankt!
Bruno Hespeler
Der Hahn vom Granitzl
Das Vorspiel zum eigentlichen Bergjagern hatte stets seinen gleichen stimmungsvollen Ablauf: Die Anreise durchs Salzburger Land, der Heimat meiner Ahnen, die Fahrt über den Radstädter Tauernpass mit meterhohen Schneemauern längs der Straße und sodann frisch hinab in den frühlingshaften Lungau mit grünen Wiesen voll buttergelbem Löwenzahn. Zunächst, wie immer, der obligatorische Antrittsbesuch beim Revierleiter, dem Tierarzt Dr. Noggler in Mariapfarr. Es war stets ein freudiges Wiedersehen mit dem alten Weidmann. Die Praxis voll wunderlicher Instrumente und in Spiritus eingelegter Abnormitäten lag im ersten Stock seiner großen Villa. Die Wände der breiten Stiege dort hinauf waren dicht an dicht bestückt mit Auer- und Spielhahnpräparaten. Alle nur „Schar und Stingl“, also kein balzender Vogel auf flechtenbehangenem Ast, sondern nur Brust und Schar der Hahnen mit den weitgespreizten krummen Federn. Dazwischen lugten Mankeiköpfe aus imitierten Felslöchern. Genussvoll nahm ich Stufe um Stufe und ließ die unvergessliche Szenerie wie als Einstimmung auf erhoffte Beute an mir vorbeiziehen.
Eine gute Weile verging mit dem Erzählen, was sich jagdlich in der Zwischenzeit hier und „drauß’ in Deutschland“ so ereignet hatte. Der „alte Herr“, ein Mittfünfziger mit einem markanten, spiegelblanken Charakterkopf war für mich jungen Hupfer mit gerade einmal 22 Jahren eine würdige Person, zu der man ob deren Erfahrung aufschauen konnte.
In den vielen darauffolgenden Jahren, wenn ich zu meinem Antrittsbesuch bei ihm einkehrte, und manchmal draußen ein besonders grausiges Wetter herrschte, gab er mir den unvergesslichen Rat mit: „Na, dees waar nix fir mi. Aans, Bua, muast dir merk’n, ’s Jagern muaß oiwei lustig sei!“
Meine Ankunft hatte er bereits Tage zuvor meinem bewährten Pirschführer, dem „Roda-Vota“ angekündigt. Zum Glück übersetzte niemand seinen Namen ins holprige Schriftdeutsch: „Rader-Vater.“ Auch nannte man ihn nach seinem Hausnamen „beim Max“ schlicht „da Mox“.
Wir hatten in den Jahren zuvor so manchen Pirschgang gemacht, wobei er mir die verschwiegenen Plätze und Steige zeigte, sodass ich auch oft allein zur Gamsjagd gehen konnte. Im Jahr unseres Kennenlernens erlegte ich mit dem rüstigen „Siebz’ger“ meinen ersten Spielhahn. Dabei ereignete sich das „Drama“ des Verlusts seiner unentbehrlichen Tabakspfeife, seinem „Tschibuk“. Das liebe alte Manndl jammerte so herzbrechend um das Lieblingsstück, dass ich nochmals, leider vergeblich suchend, den weiten Aufstieg zum morgendlichen Balzplatz machte. Anderntags kaufte ich ihm in Tamsweg einen neuen Tschibuk mit langem Rohr aus Rosenholz. Unvergesslich, wie das runzelfaltige G’sichtl des Alten vor Glück strahlte. Seitdem hieß dieser Hahn in meiner Erinnerung immer nur der „Tschibuk-Hahn“. Und heuer wollte ich mit ihm oben am Granitzl nach dem starken Platzhahn schauen, den ich im Vorherbst beim Gamsjagern bei der Herbstbalz entdeckt hatte.
Dieser Bergrücken, von einzelnen Zirben und Lärchen begrünt, war für Hirsch und Gams ein weiter freier Einstand, wo jede menschliche Annäherung früh, oft allzu früh eräugt wurde. Beerkraut bot reiche Äsung für Birk- und Auerwild. Doch nur selten sah man hier die Großen Hahnen, denn der Adler kam oft schnell und unverhofft über den Grat im Tiefflug herangeschossen.
Der Winter war schneereich zu Ende gegangen. Doch schon der April und die ersten Maitage waren sommerlich warm, und die Sonne ließ hier heroben nur noch ein paar Schneefleckerl übrig. So hoffte ich, der Weg hinauf wäre für die ersten drei- bis vierhundert Höhenmeter schon befahrbar.
Auf dem Weg ins Revier liegt der kleine Weiler mit dem „Mox’n-Hof“, dem bäuerlichen Daheim meines alten Jagdfreundes. Wie erhofft, stand er bereits heraußen, wohl mit einer kleinen Arbeit beschäftigt. Aber wie schaute er aus! Noch gebückter als sonst, noch mehr zusammengeschnurrt wie ein alter Apfel war sein liebes G’schau. Traurig hing sein weiß gewordener Schnauzbart herab. Und das Ärgste war – kein Tschibuk klemmte mehr in seinem Mundwinkel.
„Mei, Bua, i moan desmoi muast allans geh’! I bi’ neama ganz extra. A klans Schlagerl hob i ghobt, und de Fiaß loss’n a scho aus. ’s Jagern is mir a rechter Tschoch“. (eine rechte Plage)
Er gestand mir, dass er keinen Hahn ausgemacht habe, die Steigerei könne er nun nicht mehr machen. Jetzt erzählte ich ihm von meiner Beobachtung vom Vorjahr und fragte ihn, was er vom Granitzl halte.
„Jo, Bua, des probierst“, stimmte er zu. Nur mit dem Hausen in seinem alten, ein wenig talwärts abgerutschten Hütterl, dem „Mox’n Hüttl“, gäbe es ein Problem. Von dort aus käme ich nur schwer aufs Granitzl. Am besten wäre es, ich würde droben in der jetzt noch nicht von Almleuten besetzten Granitzlhütte bleiben. Da hätte ich es am Morgen nicht allzu weit zu den vermuteten Balzplätzen.
„Den Schlissl zur Hüttn find’st leicht unterm Brünndl herausd am Treet (eingezäunter Hüttenvorplatz). Grod unter a’m (einem) großn Stoa. Und hinauffahr’n müssat leicht geh’, mit ’m Schnee is neama so arg.“
Abschiedwinkend entließ er mich mit vielen guten Wünschen. Zum Trauern, dass nun dieser schöne Abschnitt des gemeinsamen Jagerns vorbei sei, ließ mir meine jubelnde, jugendliche, jagerische Vorfreude keinen Raum.
Und tatsächlich, ich kam ziemlich weit hinauf mit meinem – damals noch nicht geländegängigen – Auto. Doch dann, als eine Schneeg’wahn (Schneewächte) die Weiterfahrt endgültig versperrte, buckelte ich den bleischweren Rucksack auf. Denn nun lag ein dreiviertelstundenlanger, schweißtreibender Aufstieg vor mir.
Noch war’s früher Nachmittag. Nach kurzem Rucksackausräumen meiner Siebensachen auf den Hüttentisch wollte ich mir den Platz ausgucken, wo hoffentlich das morgendliche Schauspiel stattfinden würde.
Blick ins Lignitztal
Bald war ich an der großen freien Fläche angekommen, wo weit verstreut nur einzelne Lärchen, Latschen und Zirben aufragten. Ein Schneefleck sollte es sein, wo nach meiner Erfahrung sich die Hahnen mit ihrem Schauspiel den Hennen präsentierten. Doch welcher Schneefleck könnte es sein? Es gab hier noch im weiten Rund deren etliche. Ich musste es meinem Glück überlassen und zumindest am kommenden Morgen schauen, wo ich eine Chance hätte. Mit der Büchsflinte hätte ich dazu auch die Möglichkeit mit der Kugel ein wenig weiter hinzulangen. Vorsorglich hatte ich meine 7x57 mit Vollmantelkugeln präzise eingeschossen.
Neben einem kleinen Felsköpferl richtete ich mir so etwas wie einen Schirm her, von dem aus ich, halbwegs verborgen, das Balzgeschehen beobachten könnte. Zum nächsten, etwas größeren Schneefleck war es einen knappen Kugelschuss weit. Bis zum letzten Licht blieb ich dort hocken, schaute den Gams zu, die unterhalb von meinem Platz ästen, und erst als der junge Mond mit schmaler Sichel über den östlichen Bergkamm herüberschaute, war ich am Rückweg zur Hütte.
Zu allererst eingeheizt, dass die Herdplatte glühte. Die klamme Winterkälte wollte vertrieben sein. Als ich meine Herrlichkeiten aus dem Rucksack auf dem Tisch sortierte, rührte mich ein Schreck. Butter, Brot, Äpfel, Schokolad’, zwei Flaschen Wein, an alles hatte ich gedacht, nur… den Lungauer Speck, den ich mir wie immer in Mariapfarr kaufen wollte, den hatte ich vor lauter Vorfreude vergessen. Verflixt! Nun ja, verhungern würde ich wohl nicht, doch schätze ich ein gemütliches Hüttenleben über alles. Und dazu passt halt eine g’hörige Brotzeit.
Als Abendlektüre hatte ich das Büchlein von Max Speiser dabei. Er war in den Jahren um 1900 Berufsjäger in den Allgäuer Alpen bei Oberstdorf. Anschaulich, lehrreich und absolut ehrlich schreibt er tagebuchmäßig über seine Erlebnisse im Berg. In einem Kapitel erzählt er, dass er in seinem Leben über hundert Spielhahnen geschossen hat. Und das als Berufsjäger! Doch das nimmt sich geradezu bescheiden aus, gegenüber der Strecke von 830 Auerhahnen und 170 Spielhahnen des Prinzen Leopold von Bayern. Solche jagdlichen Vielfraße müssten in der heutigen Zeit verhungern.
In Gedanken über die seitdem veränderte Umwelt schlief ich ein. Einen Wecker brauchte ich nicht. In den Nächten der ersten Jagdtage ist mein Schlaf stets hauchfein wie bei einem Mäuserl. Jede Stunde spähte ich auf meine Uhr. So war ich bereits um zwei Uhr auf den Läufen. Der neue Mond war längst über die Nockberge herabgesunken, er hätte mir auch zu wenig Licht gespendet, und so musste ich mir mit der Taschenlampe den Weg hinab erfunzeln. Das Sternenlicht war bei all seiner Pracht in dieser staubfreien Luft fürs Bergsteigen nicht ausreichend. Die Milchstraße gleißte als breites Band über mir. Kein Streulicht irgendwelcher entfernten Lichtquellen störte ihr reines Strahlen. Zum Glück war der Himmel wolkenlos, sonst wäre es wirklich „kuhranzennacht“ oder auch „schwarz wie im Bärenarsch“ gewesen.
Stunde um Stunde verrann. Nur ab und zu ein Ruf der Waldkäuze vom talwärts liegenden Wald. Irgendwo schreckte ein Reh. Ansonsten umhüllte mich eine Stille, wie man sie heutzutag’ nur noch in abgelegenen Gebirgen oder der fernsten Tundra finden kann.
Endlich das allererste Ahnen des Tags. Und kaum, dass die Umrisse der Bäume gut erkennbar wurden, blies ein Hahn.
Wo war er? Und jetzt war schon ein zweiter zu hören. Flattersprünge, Grugeln erzürntes Girren und immer wieder das Blasen „tschhüisch“.
Mit dem Glas suchte ich Schneefleck um Schneefleck ab. Es war noch zu finster. Warten! Aber bald – er war ziemlich weit weg – sah ich den Hahn. Gut hob sich sein Umriss auf der weißen Fläche ab. Nur langsam jetzt, nur die Ruhe! Ich erinnerte mich an meinen ersten, als der Roda mich Ungeduldigen ermahnen musste: „No neet, Bua! Es is no z’noocht!“
Die Entfernung war weit, viel zu weit. Soll ich ihn „herspotten“? So wie mir das der Roda vorgemacht hatte. „Tschhüisch!“ Der Hahn kümmerte sich nicht darum. Noch einmal: „Tschhüisch!“ Ha! Das war schon besser. Jetzt steht er zu! Aber nur bis zum nächsten, glücklicherweise viel näheren Schneefleck.
Das Abkommen im Zielfernrohr stand ruhig auf dem Hahn. Stark erschien er mir, stark mit langem Spiel und breiten Krummen. Am Felsbrocken vor mir angestrichen, die Wollhandschuh’ untergelegt, schnell war die Auflage perfekt für die Büchse hergerichtet.
Auf den Schuss schlittelte er mit gebreiteten Schwingen verendet von seinem Tanzboden ins fahle Lahnergras. Ein paar kleine Federn wehte der Wind über die weiße Fläche. Wie benommen war ich. So ein Glück! Gleich am ersten Morgen! Es war wie im Traum. Nichts hielt mich nun mehr in meinem Versteck. Hinaufgesprungen zu meiner Beute! Den schillernd stahlblauen Hahn an seinen Füßen aus dem Gras gehoben! Ich traute kaum meinen Augen. Beiderseits fünf lange, breite Krumme. Immer wieder zählte ich nach. Ein kapitaler, alter Hahn. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Mein Glück, das Glück des jungen Jägers, der Kinder und der Narren.
Lange saß ich im trockenen Lahnergras, konnte mich an meiner schönen Beute nicht sattsehen. Erst als es heller Tag geworden war, die Vogelstimmen rings umher erwacht waren und im Tal der Kuckuck rief, band ich mir den Hahn auf den Rucksack und stieg zu Hütte hinauf. Das festliche Schmausen war nun zu einem reinen Butterbrotessen geworden, den Speck hatte ich ja verseppelt. Doch bei dem Anblick, der vor mir lag, hätte auch trocken Brot geschmeckt.
Noch etwas fiel mir ein. Heut war ja der 16. Mai. Vor genau zwei Jahren hatte ich mit dem Roda Vota meinen ersten Hahn geschossen und im Jahr darauf, noch in den bayrischen Bergen, meinen ersten Großen Hahn erlegt. Feierlich öffnete ich eine meiner Weinflaschen und erklärte diesen Tag zum „St. Hahnentag“.
Die Jagd war ja nun vorbei, dennoch dachte ich keineswegs an Abstieg. Noch mindestens den nächsten Tag wollte ich hier heroben bleiben. Ein paar Gänge machte ich den Bergrücken entlang, bis die steilen Kare begannen und ich über den Grat den Gams drunten zuschauen konnte, die bei der warmen Witterung im Schatten ruhten. Dabei guckte ich mir einen unglaublich starken Gamsbock aus. Nach dem wollte ich unbedingt im Herbst schauen. Aber – um es vorwegzunehmen – ich sah ihn nie wieder.
Der Abend nahte, das Menü mit Butterbrot lockte herzlich wenig. Doch da hing ja der Hahn. Krähen, Eichelhäher hatte ich auch nie geschossen, um sie dann alle wegzuwerfen. Warum nicht dem Hahn die Brustfilets auslösen? Lange überlegte ich. Dann jedoch schärfte ich mit meinem Nicker dem Hahn den Balg über dem Brustbein auf, zog vorsichtig die Haut bis zum Schwingenansatz beiseite. Das hatte ich unzählige Male bei Hähern, jungen Krähen und Graureihern gemacht. Dann löste ich mit wenigen Schnitten die Filets heraus. Ein Präparator, so sagte ich mir, würde genauso vorgehen. Dass durch die Vollmantelkugel die Brustfilets durchstanzt waren, machte mir in diesem Fall nichts aus.
Der alte Hahn
Das Auslösen war bald geschafft. Butter hatte ich genügend, und bald brutzelte es köstlich duftend in der Pfanne. Dazu ließ ich mir den mühsam heraufgeschleppten Zweigelt munden. Der Geschmack des scharf angebratenen Fleisches erinnerte ein wenig an würzigen Latschenduft, an Bergkräuter. Und dazu passte hervorragend das ebenfalls in der Pfanne angeröstete Brot. Kein Restaurant auf der ganzen Welt hätte Besseres bieten können.