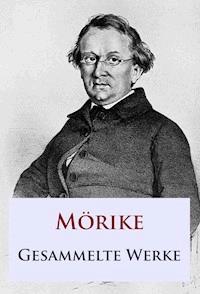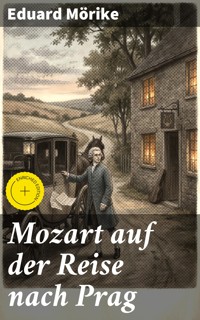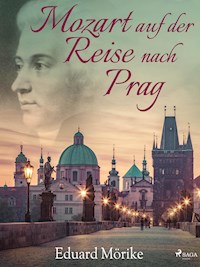Eduard Mörike: Märchen, Erzählungen, Briefe, Bühnenwerke & Gedichte (Über 360 Titel in einem Band) E-Book
Eduard Mörike
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Eduard Mörikes Sammelband "Märchen, Erzählungen, Briefe, Bühnenwerke & Gedichte" vereint über 360 Werke des herausragenden Dichters und Erzählers. Mörikes Erzählungen zeichnen sich durch ihre poetische Sprache, subtile Ironie und eine zarte Melancholie aus, die die Leser in eine phantastische und zugleich realitätsnahe Welt entführen. Die thematische Breite reicht von romantischen Bildern der Natur über fesselnde Menschendarstellungen bis hin zu tiefgründigen Reflexionen über das Leben und die Liebe, wodurch die Sammlung nicht nur literarisch wertvoll, sondern auch kulturell zeitlos ist. Eduard Mörike, geboren 1804 in Ludwigsburg, war ein maßgeblicher Vertreter der schwäbischen Romantik. Zunächst Lehrer und später als Dichter in literarischen und akademischen Kreisen aktiv, entwickelte er ein Gespür für die feinen Nuancen des menschlichen Daseins. Mörikes persönliche Erfahrungen, die geprägt waren von Verlust und Sehnsucht, sowie sein Interesse an der Natur und der deutschen Folklore, fließen stark in seine Werke ein und verleihen ihnen eine authentische Tiefe. Dieser Sammlung wird jeder Leser gerecht, der sich für die zeitlose Kraft der Literatur interessiert. Mörikes stilistische Virtuosität und seine Fähigkeit, emotionale Tiefe mit humorvollen Anmerkungen zu verweben, machen diese Werke zu einem unentbehrlichen Bestandteil jeder Bibliothek. Lassen Sie sich von Mörikes Wortgewalt verzaubern und erleben Sie die Faszination seiner literarischen Welt. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine umfassende Einführung skizziert die verbindenden Merkmale, Themen oder stilistischen Entwicklungen dieser ausgewählten Werke. - Ein Abschnitt zum historischen Kontext verortet die Werke in ihrer Epoche – soziale Strömungen, kulturelle Trends und Schlüsselerlebnisse, die ihrer Entstehung zugrunde liegen. - Eine knappe Synopsis (Auswahl) gibt einen zugänglichen Überblick über die enthaltenen Texte und hilft dabei, Handlungsverläufe und Hauptideen zu erfassen, ohne wichtige Wendepunkte zu verraten. - Eine vereinheitlichende Analyse untersucht wiederkehrende Motive und charakteristische Stilmittel in der Sammlung, verbindet die Erzählungen miteinander und beleuchtet zugleich die individuellen Stärken der einzelnen Werke. - Reflexionsfragen regen zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der übergreifenden Botschaft des Autors an und laden dazu ein, Bezüge zwischen den verschiedenen Texten herzustellen sowie sie in einen modernen Kontext zu setzen. - Abschließend fassen unsere handverlesenen unvergesslichen Zitate zentrale Aussagen und Wendepunkte zusammen und verdeutlichen so die Kernthemen der gesamten Sammlung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Eduard Mörike: Märchen, Erzählungen, Briefe, Bühnenwerke & Gedichte (Über 360 Titel in einem Band)
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Diese groß angelegte Ausgabe versammelt in einem Band über 360 Stücke aus Eduard Mörikes Werk und macht seine erzählerische wie lyrische Spannweite auf einen Blick erfahrbar. Sie führt von ausgreifender Prosa über Bühnenstücke und Märchen bis hin zu Briefen und einer Fülle von Gedichten sowie einem umfangreichen Komplex griechischer Lyrik in deutscher Gestalt. Ziel ist ein Gesamtüberblick, der nicht nur Hauptwerke präsentiert, sondern auch kürzere, seltenere Stücke einbindet und so die Kontinuitäten im Ton, die Wandlungen der Form und die feinen Übergänge zwischen Erzählung, Reflexion und Gesang sichtbar macht. Der Band lädt zum Querlesen ein und zeigt Mörike als vielseitigen Autor, dessen Motive in verschiedensten Gattungen Resonanz finden.
Im Zentrum der erzählerischen Prosa steht der Roman Maler Nolten, flankiert von Novellen, Erzählungen und Skizzen wie Der Schatz, Lucie Gelmeroth, Die Historie von der schönen Lau, Mozart auf der Reise nach Prag, Traumseele und Der Spuk im Pfarrhaus zu Cleversulzbach. Hinzu kommen Bruchstücke eines Romans, die Geschichte von der silbernen Kugel oder der Kupferschmied von Rothenburg, Aus dem Gebiete der Seelenkunde sowie Die Würzburger Lügensteine. Diese Texte spannen den Bogen vom Märchenhaft-Schwebenden bis zur präzisen Beobachtung, verbinden Sagenstoffe und Alltagswelt und zeigen den feinen Wechsel von heiterer Ironie und ernster Nachdenklichkeit.
Die Märchen dieses Bandes – Der Bauer und sein Sohn, Das Stuttgarter Hutzelmännlein und Die Hand der Jezerte – pflegen den Ton des Volkserzählens und verwandeln ihn in literarische Form. Sie setzen auf anschauliche Bilder, sprechende Dinge und eine höflich-verschmitzte Erzählhaltung, die Humor und Melancholie ausbalanciert. Das Wunderbare tritt nahe an die Lebenswirklichkeit heran und gibt ihr eine gesteigerte Farbe. Zugleich entfalten die Geschichten einen Raum regionaler Prägung, in dem Sitten, Sprichwörter und Typen der Bevölkerung mitschwingen, ohne je zur bloßen Folklore zu werden.
Mit den Briefen an Luise Rau wird eine persönliche Seite sichtbar, in der Stimme, Stimmung und Nachdenken des Autors in unmittelbarer Nähe erfahrbar sind. Sie beleuchten die Entstehungsumstände, Lektüren und künstlerischen Selbstverständnisse, ohne ins bloß Private einzusinken. Die Bühnenwerke Die Regenbrüder und Spillner zeigen Mörikes Sinn für Szene, Dialog und Pointierung. Sie arbeiten mit klaren Situationen, komischen Reibungen und moralischen Prüfungen und ergänzen die Prosatexte um eine theatrale Perspektive. So entsteht ein Bild von bemerkenswerter Breite, das Werkstatt, Öffentlichkeit und poetische Form aufeinander bezieht.
Die Gedichte bilden ein Herzstück der Sammlung und führen durch Natur- und Liebeslyrik, Balladen und Gelegenheitsdichtung. Titel wie Er ist’s, Im Frühling, Das verlassene Mägdlein, Der Feuerreiter, Gesang Weylas, Verborgenheit, Um Mitternacht oder der Zyklus Peregrina zeigen die Spannweite vom leisen Innenlied bis zur dramatischen Ballade. Präzise Bildlichkeit, feine Musikalität und ein unaufdringlicher, oft ironisch gebrochener Ton prägen die Sprache. Neben großen Themen des Gefühls stehen Miniaturen des Alltags, Widmungen und zeichnerische Studien, die das Handwerkliche der Form ebenso spürbar machen wie die Freiheit der Einbildungskraft.
Ein besonderer Akzent liegt auf dem Abschnitt griechische Lyrik, der Übertragungen und Nachdichtungen antiker Dichtung umfasst, darunter die Homerischen Hymnen sowie Stücke nach Anakreon, Theognis, Theokrit, Bion und Moschos. In diesen Texten mischen sich klassisches Maß, heitere Anmut und pointierte Lebensklugheit mit deutscher Sprachkunst. Motive wie Eros, Wein, Natur und Geselligkeit erscheinen in klar geschnittenen Bildern und gewinnen zugleich eine neue Klangfarbe im Medium der Übertragung. Der Dialog mit der Antike ergänzt Mörikes eigene Lyrik um eine historische Tiefenschicht und unterstreicht seine Sensibilität für Form, Rhythmus und das sprechende Detail.
Als Ganzes zeigt der Band, wie sich wiederkehrende Themen – Natur, Liebe, Kunst, Erinnerung, Glauben und Aberglauben, Gemeinsinn und Vereinzelung – durch alle Gattungen ziehen und jeweils anders leuchten. Charakteristisch sind die Genauigkeit der Beobachtung, melodische Linienführung, Maß und Leichtigkeit, aber auch ein Hauch des Unheimlichen. Die Sammlung erlaubt Querverbindungen: Märchenton und Balladenspannung, Briefstimme und Erzählstimme, antike Maßfigur und modernes Empfinden. So erweist sich die Vielgestaltigkeit nicht als Zerstreuung, sondern als innere Einheit, die den Reiz dieser Werke bewahrt und ihre Lektüre immer wieder neu lohnend macht.
Historischer Kontext
Eduard Mörike (8. September 1804, Ludwigsburg – 4. Juni 1875, Stuttgart) wurde im Umbruch zwischen napoleonischer Herrschaft und Restauration sozialisiert. Württemberg war 1806 zum Königreich erhoben worden; nach 1815 prägten die Beschlüsse des Wiener Kongresses und eine verfassungsgebundene Monarchie mit der Verfassung von 1819 das Land. Zwischen 1818 und 1826 studierte Mörike am Tübinger Stift Theologie, in einer Institution, die zuvor Friedrich Hölderlin, Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Friedrich Schelling geprägt hatte. Der Unterricht verband humanistische Sprachen, Bibelphilologie und pietistische Disziplin. Gleichzeitig bestimmten die Karlsbader Beschlüsse von 1819 die studentische Öffentlichkeit durch Überwachung und Zensur, ein Rahmen, der die frühe literarische Haltung zur Innerlichkeit begünstigte.
Im regionalen Milieu bildete sich die sogenannte Schwäbische Dichterschule, deren wichtige Stimmen Ludwig Uhland (1787–1862), Justinus Kerner (1786–1862) und Gustav Schwab (1792–1850) waren. Von Tübingen und Stuttgart aus pflegten sie eine poetische Kultur, die Volksliedton, klassizistische Maßhaltung und romantische Bildsprache zusammenführte. Diese Konstellation prägt Mörikes Erzählungen, Märchen, Gedichte und kleinen Dramen gleichermaßen: der Tonfall ist lebensnah, häufig liedhaft, die Szenen sind bürgerlich-intim und doch von gelehrter Bildung unterlegt. Die Biedermeierzeit (1815–1848) beförderte häusliche Beschaulichkeit, religiöse Sensibilität und Naturnähe; zugleich wurde das Prosastück zur bevorzugten Form für pointierte Beobachtung, während das Gedicht die Synthese von persönlichem Empfinden und formaler Classicität suchte.
Mörikes beruflicher Weg führte ihn nach dem Examen über mehrere Vikariate in die württembergische Provinz; von 1834 bis 1843 war er Pfarrer in Cleversulzbach bei Neckarsulm. Das Pfarrhaus, der Kirchhof, der Jahreslauf der Landwirtschaft und die Dorfgemeinschaft liefern den Erfahrungsraum vieler Texte. Volksglauben, Sagenstoffe, Aberglauben und aufgeklärte Skepsis begegnen einander, schwäbische Sprechweise mischt sich mit kunstvoller Dichtung. Die südwestdeutsche Landschaft – vom Neckarraum über den Schwarzwald bis zu alten Reichsstädten wie Rothenburg ob der Tauber – erscheint als dichterischer Resonanzraum. Zugleich wirkt das protestantische Amtsverständnis ordnend: seelsorgerliche Beobachtung, Selbstprüfung und eine nüchterne, oft ironisch gebrochene Moral prägen Erzähl- und Gedichtton.
Die politischen Spannungen des Vormärz bilden den Hintergrund der Publikationen. Nach dem Hambacher Fest von 1832 und dem Frankfurter Wachensturm 1833 verschärfte sich die Presseaufsicht in den deutschen Staaten; in Württemberg blieb der Landtag zwar aktiv, doch regulierte die Zensur die literarische Öffentlichkeit. Dieser Rahmen förderte eine indirekte, symbolisch dichte Schreibweise. Mörikes Gedichte erschienen gesammelt 1838 und in erweiterter Fassung 1848, im Revolutionsjahr, als die Paulskirche in Frankfurt tagte. Zwischen innerer Emigration, biedermeierlicher Ruhe und wacher Gegenwartsbeobachtung oszilliert sein Ton. Die Märchen und Novellen verarbeiten zeitgenössische Debatten über Bildung, Sittlichkeit, Geschlechterrollen und bürgerliche Selbstvergewisserung, ohne agitatorisch zu werden.
Ein zweiter Grundstrom ist der Klassizismus und die deutsche Philhellenismustradition. Nach dem Griechischen Unabhängigkeitskrieg (1821–1830) intensivierten Universitäten wie Tübingen die Beschäftigung mit antiken Texten. Übersetzungen und Nachbildungen homerischer Hymnen, anakreontischer Lieder und bukolischer Dichtung Theokrits, Bions und Moschos’ wurzeln in einer Bildungsbewegung, die von Winckelmann und Goethe vorbereitet worden war und bei Gelehrten wie Friedrich Thiersch Resonanz fand. Mörikes griechische Lyrik fasst diese Tradition in eine elegante, liednahe Moderne und spiegelt zugleich das Ideal der heiteren Maßhaltung. Die Antike erscheint nicht museal, sondern als Modell gelassener Form, das pastoral-idyllische Szenen ebenso trägt wie witzige Epigrammatik und erotische Miniaturen.
Der literarische Markt im Königreich Württemberg profitierte von leistungsfähigen Verlagen wie Cotta in Stuttgart und Tübingen (Johann Friedrich Cotta, 1764–1832), von Lesegesellschaften und einer bürgerlichen Musikkultur. Hausmusik, Liedersingen und das Hoftheater in Stuttgart bildeten Resonanzräume für poetische Kurzformen und szenische Entwürfe. Der europäische Mozart-Kult, zumal im Jubiläumsjahr 1856, verband historische Imagination und Gegenwartskunst; das 18. Jahrhundert wurde als Inspirationsquelle neu gelesen. Mörikes Prosastücke und Gedichte reagieren auf diese Konjunktur mit musikalisch gefassten Perioden und Rollengedichten. Ihre Rezeptionsgeschichte setzt sich fort, als Hugo Wolf 1888/89 zahlreiche Mörike-Lieder komponierte und damit den kammermusikalischen Ton dieser Dichtung in die musikalische Moderne überführte.
Die Briefe dokumentieren ein dichtes Kommunikationsnetz der Gelehrten- und Künstlerwelt zwischen Tübingen, Stuttgart und süddeutschen Kleinstädten. Die Institution des Stifts, literarische Freunde wie Friedrich Theodor Vischer (1807–1887), Gustav Schwab und Karl Mayer sowie weibliche Adressatinnen aus dem bürgerlichen Milieu strukturieren Austausch, Kritik und literarische Selbstverständigung. Die sich modernisierende Post – vom Thurn-und-Taxis-System zur deutsch-österreichischen Postvereinsreform 1850 – erleichterte diese Korrespondenzen. In demselben Milieu wuchsen naturkundliche Interessen, Altertumssammlungen und Lokalhistorie, die in Gedichten und Erzählungen als gebildete Kuriosität und humorvoller Skeptizismus auftauchen. So verschränken sich Privatheit, gelehrte Öffentlichkeit und spielerischer Umgang mit Wissenschafts- und Kunstmoden der Zeit.
Nach dem vorzeitigen Rückzug aus dem Pfarramt lebte Mörike in Stuttgart und wirkte in den 1850er und 1860er Jahren als Lehrer für deutsche Literatur am Katharinenstift. Die wachsende Residenzstadt, Eisenbahnanschlüsse seit 1845 (Stuttgart–Cannstatt) und der aufgeklärte Hof unter König Wilhelm I. (reg. 1816–1864) erweiterten die kulturellen Möglichkeiten. Die Revolution von 1848/49, die Reaktionszeit und schließlich die Reichsgründung von 1871 bildeten den politischen Horizont einer Dichtung, die bewusst das Maß, den Humor und die kleine Form kultivierte. Mörike starb am 4. Juni 1875 in Stuttgart. Sein Werk, zwischen Romantik, Biedermeier und frühem Realismus, bündelt südwestdeutsche Sagen, bürgerliche Lebenswelt und humanistische Bildung.
Synopsis (Auswahl)
Maler Nolten
Ein Künstlerroman, der die Liebesverstrickungen und das Schuldgefühl des Malers Nolten verfolgt und daraus eine psychologisch feine Studie über Kunst, Leidenschaft und Verhängnis entfaltet.
Der Schatz
Novelle über die verhängnisvolle Anziehungskraft eines vermeintlichen Schatzes, der Aberglauben, Misstrauen und Habgier in einer Dorfgemeinschaft entfesselt.
Lucie Gelmeroth
Charakter- und Sittenbild einer jungen Frau zwischen Gefühl und gesellschaftlicher Erwartung; leise zeigt die Novelle, wie kleine Entscheidungen ihr Schicksal prägen.
Die Historie von der schönen Lau
Märchenhafte Erzählung von einer Wasserfrau im Blautopf, die das Lachen wiederfinden muss; eine heitere, schwäbische Parabel über Melancholie und Lebenslust.
Mozart auf der Reise nach Prag
Erzählung über Mozart und Constanze auf dem Weg zur Prager Don-Giovanni-Aufführung; ein fein beobachtetes Porträt, das Alltagsszenen mit Reflexionen über Genie und Musik verbindet.
Traumseele
Poetische Prosaskizze über das Eigenleben der Träume und die Übergänge zwischen Bewusstsein und der nachtseitigen Welt der Seele.
Der Spuk im Pfarrhaus zu Cleversulzbach
Humoreske Geistergeschichte aus dem Pfarrhaus, die Volksglauben mit nüchterner Aufklärung konfrontiert und Erwartungen spielerisch unterläuft.
Bruchstücke eines Romans
Unvollendete Romanfragmente, die Motive von Liebe, Gesellschaft und künstlerischem Selbstverständnis skizzieren und Einblick in Mörikes Werkstatt geben.
Geschichte von der silbernen Kugel oder der Kupferschmied von Rothenburg
Legendenhafte Erzählung um einen Handwerker und eine rätselhafte Kugel, in der Handwerkerehre, Aberglaube und Rechtssinn aufeinandertreffen.
Aus dem Gebiete der Seelenkunde
Reflexive Miniaturen und Fallgeschichten zur Innenwelt: Träume, Vorahnungen und seelische Ausnahmezustände werden beobachtend und erzählerisch verknüpft.
Die Würzburger Lügensteine
Satirische Darstellung des berühmten Fossilien-Schwindels; ein Lehrstück über Eitelkeit, Leichtgläubigkeit und die Risiken wissenschaftlicher Reputation.
Der Bauer und sein Sohn
Volkstümliche Fabel über das vergebliche Bemühen, es allen recht zu machen; pointiert zur Einsicht, dass allgemeine Gefälligkeit unmöglich ist.
Das Stuttgarter Hutzelmännlein
Weitläufiges Kunstmärchen mit schwäbischem Lokalkolorit, in dem ein koboldhafter Helfer Alltagswelt und Wunderbares verknüpft; enthält als Binnenerzählung die ‚schöne Lau‘.
Die Hand der Jezerte
Balladenhaftes Märchen um eine geheimnisvolle Hand aus dem See und die zerstörerische Kraft von Eifersucht und Rache; düster in Ton und Bild.
Briefe an Luise Rau
Persönliche Korrespondenz mit der Braut, die poetische Selbstzeugnisse, Alltagsbeobachtungen und Überlegungen zu Dichten, Glauben und Gesundheit vereint.
Die Regenbrüder
Bühnenstück aus dem schwäbischen Milieu, das in heiter-ironischen Szenen dörfliche Typen und ihre Missverständnisse vorführt.
Spillner
Dramatisches Charakterbild um den Titelhelden, dessen Lebenspläne an gesellschaftlichen und inneren Widerständen scheitern; ein Kammerspiel über Ehrgeiz und Selbsttäuschung.
Wispeliaden
Satirische Gedichte und Prosastücke im humoristischen Ton, die Gelehrsamkeit, literarische Moden und bürgerliche Grillen aufs Korn nehmen.
Idylle vom Bodensee oder Fischer Martin
Erzählgedicht in gelassener Pastorale, das Alltag, Landschaft und leise Konflikte eines Fischers am Bodensee in harmonischem Gleichmaß schildert.
Griechische Lyrik (Homerische Hymnen bis Moschos)
Nachdichtungen antiker Autoren von heroischen und dionysischen Anrufungen über Kriegs- und Trinklieder bis zu bukolischer Liebes- und Naturlyrik; stilistisch klar und melodisch.
Natur- und Jahreszeitenlyrik
Gedichte, die das Umschlagen der Jahreszeiten, Morgen- und Abendstimmungen und das intime Verhältnis zur Landschaft ausloten (z. B. Er ist’s, Im Frühling, An einem Wintermorgen, Septembermorgen, In der Frühe).
Liebesgedichte und Rollenlieder
Vom schlichten Minneton bis zur ironisch gebrochenen Maske entfalten diese Stücke Stimmen von Liebe, Sehnsucht und Trennung (u. a. Erstes Liebeslied eines Mädchens, Gesang zu zweien in der Nacht, Nimmersatte Liebe, Der Gärtner, Schön-Rohtraut).
Balladen, Sagen- und Geistergedichte
Dramatische Erzählgedichte, die Volksglauben, historische Stoffe und das Unheimliche verdichten, oft mit pointiertem Schluss (u. a. Der Feuerreiter, Die Geister am Mummelsee, Des Schloßküpers Geister, Die Tochter der Heide, Der Schatten).
Künstler-, Reflexions- und Religionsgedichte
Texte über Kunst, Inspiration, Krankheit und Hoffnung sowie kontemplative Stücke religiöser Prägung; klassizistische Form verbindet sich mit nachdenklicher Intimität (z. B. Johann Kepler, Der Genesene an die Hoffnung, Denk es, o Seele!, Karwoche, Gebet).
Reise-, Landschafts- und Wanderlieder
Beobachtungen unterwegs und topographische Miniaturen, in denen Gehen, Schauen und Selbstgespräch ineinanderfließen (Fußreise, Auf einer Wanderung, Besuch in Urach, Im Weinberg, Am Rheinfall).
Stimmen, Masken und Chorlieder
Rollenpoesie und imaginierte Stimmen aus fremden Zeiten und Kulturen, die Sprachfarben variieren und Empathie erproben (Gesang Weylas, Chor jüdischer Mädchen, Maschinka, Akme und Septimius).
Zyklus: Peregrina
Ein in fünf Gedichten erzählter Liebeszyklus von Erinnerung, Verblendung und Verlust; nüchtern im Ton und von dunkler Innenspannung.
Zyklus: Schiffer- und Nixen-Märchen
Vier versifizierte Märchen vom Wasser und der Liebe, die Gefahr, Verlockung und List an der Grenze von Menschen- und Nixenwelt variieren.
Zyklus: Bilder aus Bebenhausen
Elf Betrachtungen in Vers und Prosa über das Kloster Bebenhausen, die Architektur, Natur und Geschichte in kontemplativen Impressionen verbinden.
Zyklus: Erzengel Michaels Feder
Eine kleinzyklische Erzählung in zwei Teilen, die wunderliche Begebenheiten und moralische Einfälle mit Schwabenton und Humor mischt.
Gelegenheits- und Widmungsgedichte
Inschriften, Widmungen und Festgedichte zu Personen und Anlässen zeigen Mörikes Rolle zwischen privatem Dank und öffentlichem Zeremoniell (u. a. Auf eine Lampe, Inschrift auf eine Uhr, Kantate bei Enthüllung der Statue Schillers).
Satiren, Epigramme und Scherze
Pointierte Kurzformen, Spott- und Lehrverse, die Amtsschimmel, Kritikertum, Gelehrtenhuberei und Alltagskomik zuspitzen (Epigramme, Scherz, Lose Ware, Grabschrift des Pietro Aretino, Auf die Prosa eines Beamten, Die Anti-Sympathetiker).
Freundschafts-, Familien- und Albumblätter
Zugewandte Gelegenheitsstücke an Verwandte, Freunde und Gönner, in denen Dank, Rat und heitere Neckerei überwiegen (An meine Mutter, Meiner Schwester, An Karl Mayer, An H. Kurtz, An Pauline).
Kinder-, Tier- und Spielgedichte
Leichte, oft humorvolle Miniaturen und Reimspielereien für und über Kinder, Tiere und Hauswesen (Zitronenfalter im April, Auf ein Kind, Vogellied, Mausfallen-Sprüchlein, Unser Fritz, Häusliche Szene).
Historische und lokalpatriotische Gedichte
Stücke zu Geschichte, Stadt- und Landesbewusstsein, die Erinnerungskultur und Heimatstolz literarisch fassen (Der König bei der Krönung, Eberhard Wächter, Auf die Nürtinger Schule, Kantate bei Enthüllung der Statue Schillers).
Eduard Mörike: Märchen, Erzählungen, Briefe, Bühnenwerke & Gedichte (Über 360 Titel in einem Band)
Erzählungen:
Maler Nolten
Ein heiterer Juniusnachmittag besonnte die Straßen der Residenzstadt. Der ältliche Baron Jaßfeld machte nach längerer Zeit wieder einen Besuch bei dem Maler Tillsen, und nach seinen eilfertigen Schritten zu urteilen, führte ihn diesmal ein ganz besonderes Anliegen zu ihm. Er traf den Maler, wie gewöhnlich nach Tische, mit seiner jungen Frau in dem kleinen, ebenso geschmackvollen als einfachen Saale, dessen antike Dekoration sich gar harmonisch mit den gewöhnlichen Gegenständen des Gebrauchs und der Mode ausnahm. Man sprach zuerst in heiterm Tone über verschiedene Dinge, bis die Frau sich in Angelegenheiten der Haushaltung entfernte und die beiden Herren allein ließ.
Der Baron saß bequemlich mit übereinandergeschlagenen Beinen im weichen Fauteuil, und indes die Wange in der rechten Hand ruhte, schien er während der eingetretenen Pause den Maler in freundlichem Nachsinnen mit der neuen Ansicht zu vergleichen, die sich ihm seit gestern über dessen Werke aufgedrungen.
»Mein Lieber!« fing er jetzt an, »daß ich Ihnen nur sage, warum ich vornehmlich hieher komme. Ich bin kürzlich bei dem Grafen von Zarlin gewesen und habe dort ein Gemälde gesehen, wieder und wieder gesehen und des Sehens kaum genug gekriegt. Ich fragte nach dem Meister, der Graf ließ mich raten, ich riet und sagte: Tillsen! – schüttelte aber unwillkürlich den Kopf dabei, weil mir zugleich war, es könne doch nicht wohl sein; ich sagte abermals: Tillsen, und sagte zum zweitenmal: Nein!«
Bei diesen Worten zeigte sich eine Spur von Verdruß und Verlegenheit auf des Malers Gesicht; er wußte sie jedoch schnell zu verbergen und fragte mit guter Laune: »Nun! das schöne Wunderwerk, das meinen armen Pinsel bereits zweimal verleugnet hat – was ist es denn eigentlich?«
»Stellen Sie sich nicht, Bester«, erwiderte der Alte aufstehend, mit herzlicher Fröhlichkeit und glänzenden Augen, »Ihnen ist wohl bekannt, wovon ich rede. Der von Zarlin hat Ihnen das Bild abgekauft und Sie sind nach seiner Versicherung der Mann, der es gemacht. Hören Sie, Tillsen«, hier ergriff er seine Hand, »hören Sie! ich bin nun einmal eben ein aufrichtiger Bursche[1q], und mag, wo ich meine Leute zu kennen glaube, nicht übertrieben viel Vorsicht brauchen, also platzte ich Ihnen gleich damit heraus, wie mir’s mit Ihrem Bilde ergangen; es enthält unverkennbar so manches Ihrer Kunst, besonders was Farbe, was Schönheit im einzelnen, was namentlich auch die Landschaft betrifft, aber es enthält – nein, esistsogar durchaus wieder etwas anderes, als was Sie bisher waren, und indem ich zugebe, daß die überraschende Entdeckung gewisser Ihnen in minderem Grade eigenen Vorzüge mich irregemacht, so liegt hierin ein Vorwurf gegen Ihre früheren Arbeiten, den Sie immer von mir gehört haben, ohne darum zu zweifeln, daß ich Sie für einen in seiner Art trefflichen Künstler halte. Ich fand jetzt aber eine Keckheit und Größe der Komposition von Figuren, eine Freiheit überall, wie Sie meines Wissens der Welt niemals gezeigt hatten; und was mir schlechterdings als ein Rätsel erschien, ist die auffallende Abweichung in der poetischen Denkungsart, in der Wahl der Gegenstände. Dies gilt insbesondere von zwei Skizzen, deren ich noch gar nicht erwähnte und die Sie dem Grafen in Öl auszuführen versprochen haben.
Hier ist eine durchaus seltene Richtung der Phantasie; wunderbar, phantastisch, zum Teil verwegen und in einem angenehmen Sinne bizarr. Ich denke dabei an die Gespenstermusik im Walde und Mondschein, an den Traum des verliebten Riesen. Tillsen! um Gottes willen, sagen Sie, wann ist diese ungeheure Veränderung vorgegangen? wie erklären Sie mir sie? Man weiß und hat es bedauert, daß Tillsen in anderthalb Jahren keine Farbe angerührt; warum sagten Sie mir während der letzten zwei Monate nicht eine Silbe vom Wiederanfange Ihrer Arbeiten? Sie haben heimlich gemalt, Sie wollten uns überraschen, und wahrlich, teuerster, unbegreiflicher Freund, das ist Ihnen gelungen.« Hier schüttelte der feurige Redner den stummen Hörer kräftig bei den Schultern, schmunzelte und sah ihm nahezu unter die Augen.
»Ich bin wahrhaftig«, begann der andere ganz ruhig, aber lächelnd, »um den Ausdruck verlegen, Ihnen meine Verwunderung über Ihre Worte zu bezeugen, wovon ich das mindeste nicht verstehe. Weder kann ich mich zu jenem Gemälde, zu jenen Zeichnungen bekennen, noch überhaupt faß ich Ihre Worte. Das Ganze scheint ein Streich von Zarlin zu sein, den er uns wohl hätte ersparen mögen. Wie stehen wir einander nun seltsam beschämt gegenüber! Sie sind gezwungen, ein mir nicht gebührendes Lob zurückzunehmen, und der Tadel, den Sie vergnügt schon auf die alte Rechnung setzten, bleibt wo er hingehört. Das muß uns aber ja nicht genieren, Baron, wir bleiben, hoff ich, die besten Freunde. Geben Sie mir aber doch, ich bitte Sie, einen deutlichen Begriff von den bewußten Stücken. Setzen Sie sich!«
Jaßfeld hatte diese Rede bis zur Hälfte mit offenstehendem Munde, beinahe ohne Atemzug angehört, während der andern Hälfte trippelte er im Zickzack durch den Saal, stand nun plötzlich still und sagte: »Der Teufelskerl von Zarlin! Wenn ja der – aber es ist impossibel, ich behaupte trotz allen himmlischen Heerscharen, Sie sind der Maler, kein anderer; auch läßt sich nicht annehmen, daß es etwa nur zum Teil Ihre Produktion wäre; Sie haben sich in Ihrem Leben nie auf Fremdes verlegt.« Der Maler bat wiederholt um die Schilderung der befragten Stücke.
»Ich beschreibe Ihnen also, weil Sie es verlangen, Ihr eigen Werk«, hub der alte Herr, sich niedersetzend, an, »aber kurz, und korrigieren Sie mich gleich, wenn ich wo fehle. – Das ausgeführte Ölgemälde zeigt uns, wie einer Wassernymphe ein schöner Knabe auf dem Kahn von einem Satyr zugeführt wird. Jene bildet neben einigen Meerfelsen linker Hand die vorderste Figur. Sie drückt sich, vorgeneigt und bis an die Hüften im Wasser, fest an den Rand des Nachens, indem sie mit erhobenen Armen den reizenden Gegenstand ihrer Wünsche zu empfangen sucht. Der schlanke Knabe beugt sich angstvoll zurück und streckt, doch unwillkürlich, einen Arm entgegen; hauptsächlich mag es der Zauber ihrer Stimme sein, was ihn unwiderstehlich anzieht, denn ihr freundlicher Mund ist halb geöffnet und stimmt rührend zu dem Verlangen des warmen Blicks. Hier erkannte ich Ihren Pinsel, Ihr Kolorit, Ihren unnachahmlichen Hauch, o Tillsen, hier rief ich Ihren Namen aus. Das Gesicht der Nymphe ist fast nur Profil, der schiefe Rücken und eine Brust ist sichtbar; unvergleichlich das nasse, blonde Haar. Bei der Senkung einer Welle zeigt sich wenig der Ansatz des geschuppten Fischkörpers, in der Nähe schlägt der tierische Schwanz aus dem grünen Wasser, aber man vergißt das Ungeheuer über der Schönheit des menschlichen Teils und der Knabe vergeht in dem Liebreiz dieses Angesichts; er versäumt das leichte, nur noch über die Schulter geschlungene Tuch, das der Wind als schmalen Streif in die Höhe flattern läßt. Eine Figur von großer Bedeutung ist der Satyr als Zuschauer. Die muskulose Figur steht, auf das Ruder gelehnt, etwas seitwärts im Schiffe, und überragt, obgleich nicht ganz aufrecht, die übrigen. Eine stumme Leidenschaft spricht aus seinen Zügen, denn obgleich er der Nymphe durch den Raub und die Herbeischaffung des herrlichen Lieblings einen Dienst erweisen wollte, so straft ihn jetzt seine heftige Liebe zu ihr mit unverhoffter Eifersucht. Er möchte sich lieber mit Wut von dieser Szene abkehren, allein er zwingt sich zu ruhiger Betrachtung, er sucht einen bittern Genuß darin. Das Ganze rundet sich vortrefflich ab und mit Klugheit wußte der Maler das eine leere Ende des Nachens rechter Hand hinter hohe Seegewächse zu verstecken. Übrigens ist vollkommene Meeraussicht und man befindet sich mit den Personen einsam und ziemlich unheimlich auf dem hülflosen Bereiche. Ich sage Ihnen nichts weiter, mein Freund. Ihre gelassene Miene verrät mir eine hinlängliche Bekanntschaft mit der Sache; Sie dürften übrigens, wenn keine Verwunderung, doch wahrlich ein wenig gerechten Stolz auf ihr Werk blicken lassen, wofern nicht eben in diesem Anscheine von Gleichgültigkeit schon der höchste Stolz liegt.«
»Die Skizzen, wenn ich bitten darf!« erwiderte der andere; »wie verhält es sich damit? Sie haben mich sehr neugierig gemacht.«
Der Baron holte frisch Atem, lächelte und begann doch bald ernsthaft: »Federzeichnung, mit Wasserfarbe ziemlich ausgeführt, nach Ihrer gewöhnlichen Weise. Das Blatt, wovon jetzt die Rede ist, hat einen tiefen, und besonders als ich es zum zweitenmal bei Lichte sah, einen fast schauderhaften Eindruck auf mich gemacht. Es ist nichts weiter als eine nächtliche Versammlung musikliebender Gespenster. Man sieht einen grasigen, etwas hüglichten Waldplatz, ringsum, bis auf eine Seite, eingeschlossen. Jene offene Seite rechts läßt einen Teil der tiefliegenden, in Nebel glänzenden Ebene übersehen; dagegen erhebt sich zur Linken im Vordergrunde eine nasse Felswand, unter der sich ein lebhafter Quell bildet und in deren Vertiefung eine gotisch verzierte Orgel von mäßiger Größe gestellt ist; vor ihr auf einem bemoosten Blocke sitzt im Spiele begriffen gleich eine Hauptfigur, während die übrigen teils ruhig mit ihren Instrumenten beschäftigt, teils im Ringel tanzend oder sonst in Gruppen umher zerstreut sind. Die wunderlichen Wesen sind meist in schleppende, zur Not aufgeschürzte Gewande von grauer oder sonst einer bescheidenen Farbe gehüllt, blasse mitunter sehr angenehme Totengesichter, selten etwas Grasses, noch seltener das geschälte häßliche Totenbein. Sie haben sich, um nach ihrer Weise sich gütlich zu tun, ohne Zweifel aus einem unfernen Kirchhof hieher gemacht. Dies ist schon durch die Kapelle rechts angedeutet, welche man unten in einiger Nähe, jedoch nur halb, erblickt, denn sie wird durch den vordersten Grabhügel abgeschnitten, an dessen eingesunkenem Kreuze von Stein ein Flötenspieler mit bemerkenswerter Haltung und trefflich drapiertem Gewande sich hingelagert hat. Ich wende mich aber jetzt wieder auf die entgegengesetzte Seite zu der anziehenden Organistin. Sie ist eine edle Jungfrau mit gesenktem Haupte; sie scheint mehr auf den Gesang der zu ihren Füßen strömenden Quelle, als auf das eigene Spiel zu horchen. Das schwarze, seelenvolle Auge taucht nur träumerisch aus der Tiefe des inneren Geisterlebens, ergreift keinen Gegenstand mit Aufmerksamkeit, ruht nicht auf den Tasten, nicht auf der schönen runden Hand, ein wehmütig Lächeln schwimmt kaum sichtbar um den Mundwinkel und es ist, als sinne dieser Geist im jetzigen Augenblicke auf die Möglichkeit einer Scheidung von seinem zweiten leiblichen Leben. An der Orgel lehnt ein schlummertrunkener Jüngling mit geschlossenen Augen und leidenden Zügen, eine brennende Fackel haltend; ein großer goldenbrauner Nachtfalter sitzt ihm in den Seitenlocken. Zwischen der Wand und dem Kasten scheint sich der Tod als Kalkant zu befinden, denn eine knöcherne Hand und ein vorstehender Fuß des Gerippes wird bemerkt. Unter den Gestalten im Mittelgrunde zeichnet sich namentlich eine Gruppe von Tanzenden aus, zwei kräftige Männer und ebensoviel Frauen in anmutigen und kunstvollen Bewegungen, mit hochgehaltener Handreichung, wobei zuweilen nackte Körperteile edel und schön zum Vorschein kommen. Indessen, der Tanz scheint langsam und den ernsten, ja traurigen Mienen derjenigen zu entsprechen, welche ihn aufführen. Diesen zu beiden Seiten und dann mehr gegen den Hintergrund entfaltet sich ein vergnügteres Leben; man gewahrt muntere Stellungen, endlich possenhafte und neckische Spiele. Etwas fiel mir besonders auf. Ein Knabengerippe im leichten Scharlachmäntelchen sitzt da und wollte sich gern von einem andern den Schuh ausziehen lassen, aber das Bein bis zum Knie ging mit und der ungeschickte Bursche will sich zu Tode lachen. Hingegen ein anderer Zug ist folgender: Vorn bei dem Flötenspieler befindet sich ein Gesträuche, woraus eine magere Hand ein Nestchen bietet, während ein hingekauerter Greis sein Söhnchen bei der hingehaltenen Kerze bereits einem Vogel in die verwundert unschuldigen Äuglein blicken läßt; der Bursche hat übrigens schon eine zappelnde Fledermaus am Fittich. Es gibt mehrere Züge der Art; es gäbe überhaupt noch gar vieles anzuführen. Die Beleuchtung, der wundervolle Wechsel zwischen Mond-und Kerzenlicht, wie dies einst beim Ölgemälde, besonders in der Wirkung aufs Grün, sich zauberisch darstellen wird, ist überall bereits effektvoll angedeutet und mit großer Kenntnis behandelt. Doch genug! der Henker mag so was beschreiben.«
Tillsen hatte schon seit einer Weile zerstreut und brütend gesessen. Jetzt da das Schweigen des Barons ihn zu sich selbst gebracht, erhob er sich rasch mit glühender Stirn vom Sessel und sprach entschlossen: »Ja, mein Herr, ich darf es sagen, von meiner Hand ist, was Sie gesehen haben, doch« – hier brach er in ein gezwungenes Gelächter aus. »Gott sei Dank!« unterbrach ihn der Baron, entzückt aufspringend, »nun hab ich genug; lassen Sie sich küssen, umarmen, Charmantester! die anderthalb Jahre Fastenzeit, worin Sie die Palette vertrocknen ließen, haben Wunder an Ihnen gereift, eine Periode entwickelt, über deren Früchte die Welt staunen wird. Nun geht es Schlag auf Schlag, geben Sie acht, seitdem der neue, starke Frühling für Ihre Kunst durchbrochen hat, und in dieser Stunde prophezei ich Ihnen die Fülle eines Ruhmes, der vielleicht Hunderte begeistern wird, das ganze Mark der Kräfte an die edelste Kunst zu wenden, aber auch Tausende zwingen muß, in mutlosem Neide sie abzuschwören. Ach lieber, bescheidener Mann, Sie sind bewegt, ich bin es nicht weniger von herzlicher Freude. Lassen Sie uns in diesem glücklichen Moment mit einem warmen Händedruck auseinandergehen, und kein Wort weiter. Ich gehe zum Grafen. Leben Sie wohl! auf Wiedersehen.« Damit war er zur Türe hinaus.
Der Maler, unbeweglich, sah ihm nach. Es wollte ihn jetzt fortreißen, dem Baron zu folgen, ihm eine plötzliche Aufklärung zu geben, aber ein unwillkürlicher trockener Entschluß hielt ihn wie an den Boden gefesselt. Erst nach einer langen Stille brach er, beinahe schmerzlich lächelnd, in die Worte aus: »O betrogener redlicher Mann! wie hast du dich unnötig über mich verjubelt, mir arglos meine ganze Blöße gezeigt! Ich mußte ein Lob anhören, das nicht mir, sondern einem andern gehört und das just alles das heraushob, was mir zum rechten Maler abgeht, ewig abgehen wird!« Es ist wahr, fuhr er in Gedanken fort, die Ausführung jener Kompositionen ist mein und ist nicht das Schlechteste am Ganzen; sie dient, jenen Erfindungen die rechte Bedeutung zu geben; ohne mein Zutun wären vielleicht die Skizzen des armen Zeichners gleichgültig übersehen worden. Aber nur auf der SpurseinesGeistes stärkte, belebte sich der meinige, und nur von jenem ermutigt konnte ich sogar auf eine Höhe des Ausdrucks kommen, bis zu welcher ich mich nie erhoben hatte. Wie arm, wie nichts erschein ich mir diesem unbekannten Zeichner gegenüber! Wie würf ich mit Freuden alles hin, was sonst an mir gerühmt wird, für die Gabe, solche Umrisse, solche Linien, solche Anordnungen zu schaffen! Ein Crayon, ein dürftig Papier ist ihm genug, damit er mich über den Haufen stürze. Wüßten nur erst die Herren, daß es die Werke eines Wahnsinnigen sind, welche sie bewundern, eines unscheinbaren verdorbenen Menschen, ihr Staunen würde noch größer sein, als da sie in mir den Meister gefunden zu haben glauben. Noch kennt außer mir niemand den wahren Erfinder, aber gesetzt, ich wollte auf die Gefahr, daß dieser sein eigensinniges Inkognito brechen kann, mir dennoch den Ruhm seiner Schöpfung erhalten, ich fände einen weit stärkeren Grund dagegen in dem eigenen innern Bewußtsein. Darum muß es an den Tag, lieber heute als morgen, ich sei keineswegs der Rechte.
Das waren ungefähr die Gedanken des lebhaft aufgeregten Mannes. Indessen war er, was den letzten Punkt betrifft, noch nicht so ganz entschieden. Hatte er bisher die Meinung der Freunde so hinhängen lassen, ohne sie eben zu bestärken, ohne zu widerlegen, indem er sich mit zweideutigem Scherz in der Mitte hielt, so dachte er jetzt, er könne unbeschadet seines Gewissens noch eine Zeitlang zuwarten mit der Enthüllung, und er wolle sein Benehmen nachher, wenn es nötig sei, schon auf ehrenvolle Art rechtfertigen.
Soeben trat die junge Frau wieder ins Zimmer: sie bemerkte die auffallende Bewegung an ihrem Manne, sie fragte erschrocken, er leugnete und herzte sie mit einer ungewohnten Inbrunst. Dann ging er auf sein Zimmer.
Es verstrichen mehrere Wochen, ohne daß unser Maler gegen irgend jemanden sich über den wahren Zusammenhang der Sache erklärte, seinen Schwager, den Major v. R., ausgenommen, dem er folgende auffallende Eröffnung machte. »Es mag nun bald ein Jahr sein, als mich eines Abends ein verwahrloster Mensch von schwächlicher Gestalt und kränklichem Aussehen, eine spindeldünne Schneiderfigur, in meiner Werkstätte besuchte. Er gab sich für einen eifrigen Dilettanten in der Malerei aus. Aber die windige Art seines Benehmens, das Verworrene seines Gesprächs über Kunstgegenstände war ebenso verdächtig, als mir überhaupt der ganze Besuch fatal und rätselhaft sein mußte. Ich hielt ihn zum wenigsten für einen aufdringlichen Schwätzer, wo nicht gar für einen Schelmen, wie sie gewöhnlich in fremden Häusern umherschleichen, die Leute zu bestehlen und zu betrügen. Hingegen wie groß war meine Verwunderung, als er einige Blätter hervorzog, die er mit vieler Bescheidenheit für leichte Proben von seiner Hand ausgab. Es waren reinliche Entwürfe mit Bleistift und Kreide voll Geist und Leben, wenn auch manche Mängel an der Zeichnung sogleich ins Auge fielen. Ich verbarg meinen Beifall absichtlich, um meinen Mann erst auszuforschen, mich zu überzeugen, ob das alles nicht etwa fremdes Gut wäre. Er schien mein Mißtrauen zu bemerken und lächelte beleidigt, während er die Papiere wieder zusammenrollte. Sein Blick fiel inzwischen auf eine von mir angefangene Tafel, die an der Wand lehnte, und wenn kurz vorher einige seiner Urteile so abgeschmackt und lächerlich als möglich klangen, so ward ich jetzt durch einige bedeutungsvolle Worte aus seinem Munde überrascht, welche mir ewig unvergeßlich bleiben werden, denn sie bezeichneten auf die treffendste Weise das Charakteristische meiner Manier und lösten mir das Geheimnis eines Fehlers, den ich bisher nur dunkel empfunden hatte. Der wunderliche Mensch wollte mein Erstaunen nicht bemerken, er griff eben nach dem Hute, als ich ihn lebhaft zu mir auf einen Sitz niederzog und zu einer weiteren Erörterung aufforderte. Es übersteigt jedoch alle Beschreibung, in welch sonderbarem Gemische des fadesten und unsinnigsten Galimathias mit einzelnen äußerst pikanten Streiflichtern von Scharfsinn sich der Mensch in einer süßlich wispernden Sprache nun gegen mich vernehmen ließ. Dies alles zusammengenommen und das unpassende Kichern, womit er sich selber und mich gleichsam zu verhöhnen schien, ließ keinen Zweifel übrig, daß ich hier das seltenste Beispiel von Verrücktheit vor mir habe, welches mir je begegnet war. Ich brach ab, lenkte das Gespräch auf gewöhnliche Dinge und er schien sich in seinem stutzerhaft affektierten Betragen nur immer mehr zu gefallen. Dies elegante Vornehmtun machte mit seinem notdürftigen Äußern, einem abgetragenen, hellgrünen Fräckchen und schlechten Nankingbeinkleidern einen höchst komischen, affreusen Kontrast. Bald zupfte er mit zierlichem Finger an seinem ziemlich ungewaschenen Hemdstrich, bald ließ er sein Bambusröhrchen auf dem schmalen Rücken tänzeln, indem er zugleich bemüht war, durch Einziehung der Arme mir die schmähliche Kürze des grünen Fräckchens zu verbergen. Mit alle diesem erregte er meine aufrichtige Teilnahme. Mußt ich mir nicht einen Menschen denken, der mit seinem außerordentlichen Talente, vielleicht durch gekränkte Eitelkeit, vielleicht durch Liederlichkeit, dergestalt in Zerfall geraten war, daß zuletzt nur dieser jämmerliche Schatten übrigblieb? Auch waren jene Zeichnungen, wie er selbst bekannte, aus einer längst vergangenen, bessern Zeit seines Lebens. Auf die Frage, womit er sich denn gegenwärtig beschäftige, antwortete er hastig und kurz: er privatisiere; und als ich von weitem die Absicht blicken ließ, jene Blätter von ihm zu erstehen, schien er trotz eines preziösen Lächelns nicht wenig erleichtert und vergnügt. Ich bot ihm drei Dukaten, die er mit dem Versprechen zu sich steckte, mich bald wiederzusehen. Nach vier Wochen erschien er abermals und zwar schon in merklich besserem Aufzuge. Er brachte mehrere Skizzen mit: sie waren womöglich noch interessanter, noch geistreicher. Indessen hatt ich beschlossen, ihm vorderhand nichts weiter abzunehmen, bis ich über die Rechtmäßigkeit eines solchen Erwerbs völlig ins reine gekommen wäre, etwa dadurch, daß er veranlaßt würde, gleichsam unter meinen Augen eine Aufgabe zu lösen, die ich ihm unter einem unverfänglichen Vorwande zuschieben wollte. Ich hatte meine Gedanken hiezu schriftlich angedeutet, erklärte mich ihm auch mündlich darüber, und er eilte sogleich mit der Hoffnung weg, mir seinen Versuch in einigen Tagen zu zeigen. Aber wer schildert meine Freude, als schon am Abende des folgenden Tages die edelsten Umrisse zu der angegebenen Gruppe aus dem Statius vor mir lagen, in der ganzen Auffassung des Gedankens weit kühner und sinnreicher als der Umfang meiner Imagination jemals reichte. Manche flüchtige Bemerkung des närrischen Menschen bewies überdies unwidersprechlich, daß er mit Leib und Seele bei der Zeichnung gewesen. Auch dieser Entwurf und in der Folge noch der eine und andere ward mein Eigentum; allein plötzlich blieb der Fremde aus und eigensinnigerweise hatte er mir weder Namen noch sonstige Adresse zurückgelassen. Nach und nach fühlte ich unwiderstehliche Lust, drei bis vier der vorhandenen Blätter vergrößert in Wasserfarbe aufs neue zu skizzieren und sofort in Öl darzustellen, wobei denn bald die liebevollste wechselseitige Durchdringung meiner Manier und jenes fremden Genius stattfand, so daß die Entscheidung so leicht nicht sein möchte, wenn nunmehr bei den völlig ausgemalten Tableaus ein zwiefaches und getrenntes Verdienst gegeneinander abgewogen werden sollte. Vor einem Freunde und Schwager darf ich dieses selbstgefällige Bekenntnis gar wohl tun, und vielleicht wird das Publikum mir nicht mindere Gerechtigkeit widerfahren lassen, wenn ich ihm demnächst bei der öffentlichen Ausstellung jene Bilder vorführen werde, ohne ihren doppelten Ursprung im mindesten zu verleugnen; denn dies war längst mein fester Entschluß.«
»Das sieht dir ähnlich«, erwiderte hierauf der Major, welcher bisher mit gespannter Aufmerksamkeit zugehört hatte; »es bedarf, dünkt mich, bei einem Künstler von deinem Rufe nicht einmal großer Resignation zu einer solchen Aufrichtigkeit, ja man wird in dem ganzen Unternehmen eine Art Herablassung finden, wodurch du jenes unbekannte Talent zu würdigen und zu ehren dachtest. Aber, um wieder auf den armen Tropfen zu kommen, hast du ihn denn auf keine Weise ausfindig machen können?«
»Auf keine Weise. Einmal glaubte mein Bedienter seine Spur zu haben, allein sie verschwand ihm wieder.«
»Es wäre doch des Teufels«, rief der Major aus, »wennmeineSpürhunde mich hier im Stiche ließen! Schwager, laß mich nur machen. Die Sache ist zu merkwürdig, um sie ganz hängen zu lassen. Du magst mich vor aller Welt nur selbst für den geheimnisvollen Narren ausgeben, wenn ich dir ihn nicht binnen vierundzwanzig Tagen aus irgendeiner Spelunke, Dachstube oder dem Narrenhause selbst hervorziehe!«
Diese vierundzwanzig Tage waren noch nicht um, so geschah es, daß Tillsen über die wahre Bewandtnis der Sache auf einem ganz anderen Wege aufgeklärt wurde, als er je vermuten konnte.
In seiner Abwesenheit meldete sich eines Morgens ein wohlgekleideter junger Mann im Tillsenschen Hause an, und die Frau führte ihn indes in ein Seitenzimmer, wo er ihren Gemahl erwarten möchte. Sie selbst, obgleich durch eine sehr vielversprechende und auffallend angenehme Gesichtsbildung nicht wenig interessiert, entfernte sich sogleich wieder, weil die zerstreute Unruhe seiner Miene ihr hinlänglich sagte, daß eine weitere Ansprache hier nicht am Platze sein würde. Nach einer Viertelstunde erst trat der Maler in das bezeichnete Kabinett. Er fand den jungen Mann nachdenkend, den Kopf in beide Hände gestützt, auf einem Stuhle sitzen, den Rücken ihm zugewandt und dem großen Gemälde gegenüber, das, bis auf die breit goldene Rahme, verhüllt an der Wand dahing. Der Maler, einigermaßen verwundert, trat stillschweigend näher, worauf dann der andere erschrocken auffuhr, indem er zugleich hinter einer angenehmen, verlegenen Freundlichkeit die Tränen zu verstecken suchte, worin er sichtbar überrascht worden war. »Ich komme«, fing er jetzt mit heiterem Freimute an, »ich komme in der wunderlichsten und zugleich in der erfreulichsten Angelegenheit vor Ihr Angesicht, verehrter Mann! Meine Person ist Ihnen unbekannt, dennoch haben Sie, wie ich weiß, mein eigentliches Selbst bereits dergestalt kennengelernt und bis auf einen gewissen Grad sogar liebgewonnen, daß ich mich nun mit unabweislichem Vertrauen unter Ihre Stirne dränge. Doch, lassen Sie mich deutlich reden. Ich heiße Theobald Nolten und studiere in hiesiger Stadt ziemlich unbekannt die Malerei. Nun fand ich gestern in der aufgestellten Galerie unter andern ein Gemälde, das Opfer der Polyxena vorstellend, das mir auf den ersten Blick als eine innig vertraute Erscheinung entgegentrat. Es war, als stünde durch Zauberwerk hier ein früher Traum lebendig verkörpert vor meinem schwindelnden Auge. Diese schmerzvolle Königstochter schien mich so schwesterlich bekannt zu grüßen, ihre ganze Umgebung deuchte mir so gar nicht fremd, und doch, über das Ganze war ein Licht, ein Reiz gegossen, der nicht aus meinem Innern, der von einer höhern Macht, von den Olympischen selbst herabgestrahlt schien; ich zitterte, bei Gott! ich –«
»Was?« unterbrach ihn Tillsen, »Sie wären – ja Sie sind der wunderbare Künstler, dem ich so vieles abzubitten –«
»Nicht doch«, entgegnete jener feurig, »nein! derIhnenUnendliches zu danken hat. O edelster Mann! Sie haben mich mir selbst enthüllt, indem Sie mich hoch über mich hinausgerückt und getragen. Sie weckten mich mit Freundeshand aus einem Zustande der dunkeln Ohnmacht, rissen mich auf die Sonnenhöhe der Kunst, da ich im Begriffe war, an meinen Kräften zu verzweifeln. Ein Elender mußte mich bestehlen, damit Sie Gelegenheit hätten, mir in Ihrem klaren Spiegel meine wahre, meine künftige Gestalt zu zeigen. So empfangen Sie denn Ihren Schüler an das väterliche Herz! Lassen Sie mich sie küssen, die gelassene Hand, welche auf ewig die verworrenen Fäden meines Wesens ordnete – mein Meister! mein Erretter!«
So lagen sich beide Männer einige Sekunden lang fest in den Armen und von diesem Augenblicke an war eine lebhafte Freundschaft geschlossen, wie sie wohl in so kurzer Zeit zwischen zwei Menschen, die sich eigentlich zum ersten Male im Leben begegnen, selten möglich sein wird.
»Erlauben Sie, mein Lieber«, sagte Tillsen, »daß ich erst zur Besinnung komme. Noch weiß ich nicht, bin ich mehr beschämt oder mehr erfreut durch Ihre herzlichen Worte. Ich werde Sie in der Folge noch besser verstehen. So sagen Sie fürs erste nur, wie verhält sich’s denn mit dem diebischen Schufte, dem wenigstens das Verdienst bleiben muß, uns zusammengeführt zu haben?«
»Wohl! Hören Sie! Nach meiner Rückkehr aus Italien, es ist nun über ein Jahr, traf ich auf der Reise hieher, wo ich völlig fremd war, einen Hasenfuß, Barbier seiner Profession – er nannte sich Wispel –, der mir seine Dienste als Bedienter antrug, und ich nahm ihn aus einem humoristischen Interesse an seiner Seltsamkeit um so lieber auf, da er neben einem, daß ich so sage, universal-enthusiastischen Hieb, neben einem badermäßigen Hochmut, immer eine gewisse Gutmütigkeit zeigte, die in der Folge nur der borniertesten Eitelkeit weichen konnte; denn so wollt ich darauf schwören, er hatte mit jenen entwendeten Konzepten anfangs keine andere Absicht, als vor Ihnen den Mann zu machen.«
»Allein er nahm doch Geld dagegen an?«
»Und wenn auch; diese Spekulation ward sicherlich erst durch Ihr Anerbieten bei ihm erweckt.«
»Aber er stellte sich völlig närrisch!«
»Ich zweifle sehr, daß er es darauf anlegte, oder gesetzt, er legte es darauf an, so geschah es nur, nachdem er Ihnen bereits den interessanten Verdacht abgelauscht. Seiner Dummheit kam übrigens die List beinahe gleich; so wußte er mich unter einem ausgesuchten Vorwande zu einer Zeichnung aus dem Stegreife zu bewegen, die ohne Zweifel auch für Sie bestimmt war, und wozu ich mich selbst durch den angenehm proponierten Gegenstand angereizt fühlte. Wenn er Sie ferner durch den Schein eigener Bildung irregeführt hat, so begreif ich nur um so besser, warum er sich bei den Unterhaltungen, welche gelegentlich zwischen mir und einem Freunde vorkamen, immer viel im Zimmer zu schaffen machte. Er mag Ihnen auf diese Art manchen schlecht verdauten Brocken hingeworfen haben.«
»Ach«, sagte Tillsen nicht ohne einige Beschämung, »freilich, dergleichen Äußerungen sahen mir dann immer verdächtig genug aus, wie Hieroglyphen auf einem Marktbrunnenstein, ich wußte nicht, woher sie kamen. Aber ein abgefeimter Bursche ist es doch! Und wo steckt denn der Schurke jetzt?«
»Das weiß Gott. Seit einem halben Jahre hat er sich ohne Abschied von mir beurlaubt; etliche Wochen später entdeckt ich die große Lücke in meinem Portefeuille.«
»Ich will sie wieder ausfüllen!« erwiderte Tillsen mit Heiterkeit, indem er den Freund vor das verhängte Bild führte. »Ich wollte es diesen Morgen noch zur öffentlichen Ausstellung wegtragen lassen; doch, es ist nun Ihr Eigentum. Lassen Sie sehen, ob Sie auch hinter diesem Tuche Ihre Bekannten erkennen.«
Nolten hielt die Hand des Malers an, während er das Geständnis ablegte, daß er vorhin der Versuchung nicht widerstanden, den Vorhang um einige Spannen zurückzustreifen, daß er ihn aber, wie von dem Gespenste eines Doppelgängers erschreckt, sogleich wieder habe fallen lassen, ohne die Überblickung des Ganzen zu wagen.
Jetzt schlug Tillsen miteinemMale die Hülle zurück und trat seitwärts, um den Eindruck des Stückes auf den Maler zu beobachten. Wir sagen nichts von der unbeschreiblichen Empfindung des letztern und erinnern den Leser an das wunderliche Geisterkonzert, wovon ihm der alte Baron früher einen Begriff gegeben. Bewegt und feierlich gingen die Freunde auseinander.
Die umständlichere Erzählung dieser Begebenheit mußte vorangeschickt werden, um die rasche und erfreuliche Entwicklung desto begreiflicher zu machen, welche es von nun an mit der ganzen Existenz des jungen Künstlers nahm. War es ein gewisser Kleinmut oder Eigensinn, grillenhafter Grundsatz, was ihn bisher bewegen mochte, mit seinem Talente unbeschrieen hinter dem Berge zu halten, bis er dereinst mit einem höhern Grade von Vollendung hervortreten könnte: soviel ist gewiß, daß die Behandlung der Ölfarbe ihm bisher große Schwierigkeiten entgegensetzte, jedoch, wie Tillsen fand, nicht so große, als unser bescheidener Freund sich gleichsam selbst gemacht hatte. Vielmehr entdeckte jener auch diesfalls an den Versuchen des letztern die überraschendsten Fortschritte, und gerne faßte er den Entschluß zur förderlichen Mitteilung einzelner Vorteile. In kurzem stand Nolten, was Geschicklichkeit betrifft, jedem braven Künstler gleich, und in Absicht auf großartigen Geist hoch über allen. Seine Werke, sowie seine Empfehlung durch Tillsen, verschafften ihm sehr schätzbare Verbindungen, und namentlich erwies der Herzog Adolph, Bruder des Königs, sich gar bald als einen freundschaftlichen Gönner gegen ihn.
War Theobald auf diese Weise durch die rasche und glänzende Veränderung seines bisherigen Zustandes gewissermaßen selbst überrascht und anfänglich sogar verlegen, so verwunderte er sich in der Folge beinahe noch mehr über die Leichtigkeit, womit er sich in seine jetzige Stellung gewöhnte und darin behauptete. Allerdings brauchte er die Achtung, durch die er sich vor andern ausgezeichnet sah, nur als etwas Verdientes hinzunehmen, so kam sie ihm auch ganz natürlich zu.
Durch die Vermittlung des Herzogs erhielt er Zutritt im Hause des Grafen von Zarlin, der sich ohne eigene Einsichten, und wie mehrere behaupteten, aus bloßer Eitelkeit als einen leidenschaftlichen Freund jeder Gattung von Kunst hervortat, und dem es wirklich gelang, einen Zirkel edler Männer und Frauen um sich zu versammeln, worin geistige Unterhaltung aller Art, namentlich Lektüre guter Dichterwerke vorkam. Die lebendig machende Seele des Ganzen jedoch war, ohne es zu wollen, die schöne Schwester des Grafen, Constanze von Armond, die junge Witwe eines vor wenigen Jahren gestorbenen Generals. Ihre Liebenswürdigkeit wäre mächtig genug gewesen, den Kreis der Männer zu beherrschen und Gesetze vorzuschreiben, aber die angenehme Frau blieb mit der sanften Wirkung zufrieden, welche von ihrer Person auf alle übrigen Gemüter ausging, und sich allgemein in der erwärmteren Teilnahme an den Unterhaltungsgegenständen offenbarte; ja, Constanze schien ihrer natürlichen Lebendigkeit öfters einige Gewalt anzutun, um die Huldigung von sich abzuleiten, womit die Herren sie nicht undeutlich für die Königin der Gesellschaft erklärten. Auch Theobald fühlte sich insgeheim zu ihr hingezogen, und während der anderthalb Monate, worin er jede Woche drei Abende in ihrer Nähe zubringen durfte, entwickelte sich dies heitere Wohlgefallen zu einem stärkeren Grade von Zuneigung, als er sich selbst eingestehen durfte. Die Reize ihrer Person, die Feinheit ihres gebildeten Geistes, verbunden mit einem lebhaften, selbst ausübenden Interesse für seine Kunst, hatten ihn zu ihrem leidenschaftlichen Bewunderer gemacht, und wenn sein Verstand, wenn die oberflächlichste Betrachtung der äußern Verhältnisse ihm jeden entfernten Wunsch niederschlugen, so wiederholte er sich auf der andern Seite doch so manche leise Spur ihrer besondern Gunst mit unermüdeter Selbstüberredung, wobei er freilich nicht vergessen durfte, daß er in dem Herzog einen sehr geistreichen Nebenbuhler zu fürchten habe, der ihm überdies, was Gewandtheit und schmeichelhaften Ton des Umgangs betrifft, bei weitem überlegen war. Die Leidenschaft des Herzogs war Theobalden desto drückender, je inniger sonst ihr beiderseitiges Verhältnis hätte sein können, dagegen nun der letztere seinem arglosen fürstlichen Freunde gegenüber eine heimliche Spannung nur mit Mühe verleugnete.
Übrigens hatte er wohl Grund, sich über seine wachsende Neigung so gut wie möglich zu mystifizieren, denn eine früher geknüpfte Verbindung machte noch immer ihre stillen Rechte an sein Herz geltend, obwohl er dieselben mit einiger Überredung des Gewissens bereits entschieden zu verwerfen angefangen hatte. Das reine Glück, welches der unverdorbene Jüngling erstmals in der Liebe zu einem höchst unschuldigen Geschöpfe gefunden, war ihm seit kurzem durch einen unglückseligen Umstand gestört worden, der für das reizbare Gemüt alsbald die Ursache zu ebenso verzeihlichem als hartnäckigem Mißtrauen ward. Die Sache hatte wirklich so vielen Schein, daß er das entfernt wohnende Mädchen keines Wortes, keines Zeichens mehr würdigte, ihr selbst nicht im geringsten den Grund dieser Veränderung zu erkennen gab. Mit unversöhnlichem Schmerz verhärtete er sich schnell in dem Wahne, daß der edle Boden dieses schönen Verhältnisses für immerdar erschüttert sei, und daß er sich noch glücklich schätzen müsse, wenn es ihm gelänge, mit der Bitterkeit seines gekränkten Bewußtseins jeden Rest von Sehnsucht in sich zu ertöten und zu vergiften. In der Tat blieb aber dieser traurige Verlust nicht ohne gute Folgen für sein ganzes Wesen; denn offenbar half diese Erfahrung nicht wenig seinen Eifer für die Kunst beleben, welche ihm nunmehr ein und alles, das höchste Ziel seiner Wünsche sein sollte. Vermochte er nun aber nach und nach über eine schmerzliche Empfindung, die ihn zu verzehren drohte, Herr zu werden, so war auf der andern Seite das Mädchen indessen nicht schlimmer daran. Agnes glaubte sich noch immer geliebt, und dieser glückliche Glaube ward, wie wir später erfahren werden, auf eine wunderliche Art, ganz ohne Zutun Theobalds, unterhalten, währenderschon eine freiwillige Auflösung des Bündnisses von ihrer Seite zu hoffen begann, denn das Ausbleiben ihrer Briefe nahm er ohne weiteres für ein Zeichen ihres eigenen Schuldbewußtseins. In dieser halbfreien, noch immer etwas wunden Stimmung fand er die Bekanntschaft mit der Gräfin Constanze, und nun läßt sich die Innigkeit um so leichter begreifen, womit die gereizten Organe seiner Seele sich nach diesem neuen Lichte hinzuwenden strebten.
Im Spanischen Hofe, so hieß das bedeutendste Hotel der Stadt, war es am Abende des letzten Dezembers, wo die vornehme Welt sich bereits eifrig zur Maskerade zu rüsten hatte, ungewöhnlich stille. In dem hintersten grünen Eckzimmer leuchteten die beiden hellbrennenden Hängelampen nur zweien Gästen, wovon der eine, wie es schien, ein regelmäßiger, mit Welt und feinerer Gasthofsitte wohlvertrauter Besuch, ein pensionierter Staatsdiener von Range, der andere ein junger Bildhauer war, der erst vor wenig Stunden in der Stadt anlangte. Sie unterhielten sich, in ziemlicher Entfernung auseinander sitzend, über alltägliche Dinge, wobei sich Leopold, so nennen wir den Reisenden, bald über die zerstreute Einsilbigkeit des Alten heimlich ärgerte, bald mit einem gewissen Mitleiden auf die krankhaften Verzerrungen seines Gesichts, auf die rastlose Geschäftigkeit seiner Hände blicken mußte, die jetzt ein Fältchen am fein schwarzen Kleide auszuglätten, jetzt eine Partie Whistkarten zu mischen, oder eine Prise Spaniol aus der achatnen Dose zu greifen hatten. Das Gespräch war auf diese Weise ganz ins Stocken geraten, und um ihm wieder einigermaßen aufzuhelfen, fing der Bildhauer an: »Unter den Künstlern dieser Stadt und des Vaterlandes soll, wie ich mit Vergnügen höre, der junge Maler Nolten gegenwärtig große Aufmerksamkeit erregen?«
Diese Worte schienen den alten Herrn gleichsam zu sich selber zu bringen. Seine Augen funkelten lebhaft unter ihrer grauen Bedeckung hervor. Da er jedoch noch wie gespannt stille schwieg und eine Antwort nur erst unter den schlaffen Lippen zurechtkaute, fuhr der andere fort: »Ich habe seit drei Jahren nichts von seiner Hand gesehen und bin nun äußerst begierig, mich zu überzeugen, was an diesem ausschweifenden Lobe, wie an den heftigen Urteilen der Kritiker Wahres sein mag.«
»Befehlen Sie«, sagte der Alte fast höhnisch, »daß ich nun mit einem hübschen Sätzchen antworte, wie etwa: vielleicht in der Mitte liegt das fürtreffliche Talent, das seine bestimmte Richtung erst sucht – oder: es ist das Größte von ihm zu hoffen, wie das Schlimmste zu fürchten – und was dergleichen dünnen Windes mehr ist? Nein! ich sage Ihnen vielmehr geradezu, dieser Nolten ist der verdorbenste und gefährlichste Ketzer unter den Malern, einer von den halsbrecherischen Seiltänzern, welche die Kunst auf den Kopf stellen, weil das ordinäre Gehen auf zwei Beinen anfängt langweilig zu werden; der widerwärtigste Phantasie-Renommiste! Was malt er denn? eine trübe Welt voll Gespenstern, Zauberern, Elfen und dergleichen Fratzen, das ist’s, was er kultiviert! Er ist recht verliebt in das Abgeschmackte, in Dinge, bei denen keinem Menschen wohl wird. Die gesunde, lautere Milch des Einfach-Schönen verschmäht er und braut einen Schwindeltrank auf Kreuzwegen und unterm Galgen; apropos, mein Herr!« (hier lächelte er ganz geheimnisvoll) »haben Sie schon Gelegenheit gehabt, eine der köstlichen Anstalten zu sehen, worein man die armen Teufel logiert, die so, verstehn mich schon, einen krummen Docht im Lichte brennen – nun? Kam Ihnen da nicht auch schon der Gedanke, wie es wäre, wenn sich etwa der Ideendunst, der von diesen Köpfen aufsteigen muß, oben an der Decke ansetzte, welche Figuren da in Fresko zum Vorschein kommen müßten? Was sagen Sie? Nolten hat sie alle kopiert, hä hä hä, hat sie sämtlich kopiert!«
»Sie scheinen«, erwiderte Leopold gelassen, »wenn ich Sie anders recht fasse, mehr die Gegenstände zu tadeln, unter denen sich dieser Künstler, nur vielleicht etwas zu vorliebig, bewegt, als daß Sie sein Talent angreifen wollten; nun läßt sich aber ohne Zweifel auf dem angedeuteten Felde so gut als auf irgendeinem das Charakteristische und das Rein-Schöne mit großem Glücke zeigen, abgeschmackte und häßliche Formen jedoch, geflissentliches Aufsuchen sinnwidriger Zusammenstellungen kann man von Nolten nicht erwarten; ich kenne sein Wesen von früher und kam in der Absicht hieher, ihn mit einem gemeinschaftlichen Freunde, der auch Maler ist, zu besuchen und uns an seiner bisherigen Ausbildung zu erfreuen.«
Der alte Herr hatte diese Worte wahrscheinlich ganz überhört, denn er ging mit lautem Kichern nur wieder in den Refrain seines vorhin Gesagten über: »Hat sie sämtlich kopiert, ja ja, zum Totlachen! Ei, das muß er täglich von mir selber hören.«
In diesem Augenblicke trat Ferdinand, der Reisegefährte des Bildhauers, ein und rief diesem mit einem glänzenden Blicke voll Freude zu: »Er kommt! er folgt mir auf dem Fuße nach! Er ist der gute Nolten noch, sag ich dir! o gar nicht der achselblickende junge Glückspilz, wie man ihn schildern wollte. Stelle dir vor, er vergaß vorhin im Jubel über unsre Ankunft eine Einladung vom Herzog, mit dem er trefflich stehen muß, und eilte nur von der Straße weg, sich zu entschuldigen.«
Nach einiger Zeit erschien, in Begleitung eines andern, der Erwartete wirklich. Es war ein herzerfreuendes Wiedersehen, ein immer neu erstauntes trunkenes Begrüßen und Frohlocken unter den dreien. Wie ergötzten sich die Freunde an dem stattlichen Ansehen Theobalds, an dem reinen Anstande, den ihm das Leben in höherer Gesellschaft unvermerkt angehaucht hatte, nur verbargen sie ihm nicht, daß die kräftige Röte seiner Wangen in Zeit von wenigen Jahren um ein Merkliches verschwunden sei. Er sah jedoch immer noch gesund und frisch genug neben seinem hageren Begleiter, dem Schauspieler Larkens, aus, den er soeben freundschaftlich produzieren wollte, als dieser sofort mit der angenehmsten Art sich selber empfahl und mit den Worten schloß: »Nun setz dich, liebes Kleeblatt! Ich werde mich mit eurer Erlaubnis bald auch zu euch gesellen, aber den ersten Perl-und Brauseschaum des Wiederfindens müßt ihr durchaus miteinander wegschlürfen! Ich sehe dort ein paar Spielerhände konvulsivisch fingern, das ist aufmichabgesehen.«
Damit setzte er sich zu dem alten Herrn in der Ecke, den unser Nolten erst jetzt gewahr wurde und nicht ohne Achtung begrüßte. »Sag mir doch«, fragte Leopold heimlich, »was für eine Art von Kenner das ist? Er hat die wunderlichsten Begriffe von dir.«