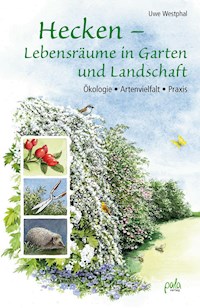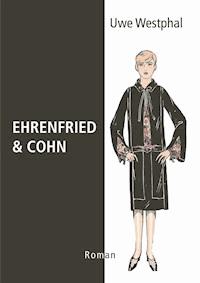
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Berlin 1935. Die jüdischen Modedesigner Kurt Ehrenfried und Simon Cohn haben es geschafft. Sie stehen vor ihrem größten Triumph: einer sensationellen Modenschau kurz vor den Olympischen Spielen. Doch die wachsende Gewalt und der Hass gegen Juden bedrohen den Erfolg von Ehrenfried & Cohn immer mehr. Gute Freunde werden über Nacht zu Feinden. Wer ist Täter, wer ist Opfer? Da ist der "anständige Verbrecher" Rube, wie Ehrenfried den Stoffhändler nennt, der durch Schmiergelder der Nazis reich wird und gleichzeitig die Flucht von Berliner Juden ins Ausland organisiert. Auch der schwule Simon Cohn, Partner und Top-Designer der gemeinsamen Firma flieht nach Palästina. Ehrenfried bleibt. Er klammert sich an seinen Traum, in Berlin das berühmteste Konfektionshaus zu leiten. Die Modenschau wird zu einem rauschenden Triumph. Das Publikum ist begeistert – doch Ehrenfried verliert innerhalb weniger Minuten all sein Hab und Gut. Ehrenfried flieht im letzten Moment mit seiner Frau Lore und seinen Kindern Max und Sara nach London. Er schließt sich dem britischen Geheimdienst an und arbeitet für den illegalen Widerstand im besetzten Frankreich. Ein Jahr nach dem Bau der Mauer reist Ehrenfried nach Westberlin. Er will zurückholen, was ihm die Nazis raubten: sein Konfektionshaus. Er ist bereit, den Kampf in der Stadt seiner größten Erfolge noch einmal aufzunehmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Uwe Westphal
EHRENFRIED & COHN
Für Margarete Feldmann
THE SECOND COMING
Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.
Surely some revelation is at hand;
Surely the Second Coming is at hand.
The Second Coming! Hardly are those words out
When a vast image out of Spiritus Mundi
Troubles my sight: somewhere in sands of desert sand;
A shape with lion body and the head of a man,
A gaze blank and pitiless as the sun,
Is moving its slow thighs, while all about it
Wind shadows of the indignant desert birds.
The darkness drops again; but now I know
That twenty centuries of stony sleep
Were vexed to nightmare by a rocking cradle,
And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born?
William Butler Yeats (1865-1939)
DANK
Es waren sehr viele Menschen in Großbritannien, Israel, Deutschland und den USA, die diesen Roman ermöglichten. Hunderte von Briefen, Fotos und erzählten Erinnerungen halfen mir, ihre Zeit als Modeschöpfer im Berlin der dreißiger Jahre zu verstehen.
ANMERKUNG
Die im vorliegenden Roman verwendeten Personennamen und Firmennamen sind zum Teil frei erfunden. Namensähnlichkeiten mit noch lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig. Die im Roman genannten Firmennamen sind frei erfunden.
IMPRESSUM
Herausgeber: Uwe Westphal
Umschlag-Design: Ilaria Fioravanti
Preis: 4,99 ,- €
ISBN 978-3-7375-7485-3
© Uwe Westphal
Kontakt zum Autor:
Weitere Informationen über Uwe Westphal gibt es unter www.uwewestphal.com
Der Autor des vorliegenden Romans, Uwe Westphal, besitzt das Recht auf Veröffentlichung, Verwertung und Vervielfältigung. Sämtliche Rechte an den verwendeten Abbildungen liegen ebenfalls beim Autor. Ohne seine ausdrückliche Genehmigung ist insbesondere eine anderweitige Veröffentlichung, Verwertung und Vervielfältigung untersagt.
Bei Verletzung dieser Rechte ist der Autor berechtigt, Unterlassung zu verlangen und Schadensersatz geltend zu machen.
Vorspiel
Der Schmerzensmann
Regen prasselt auf das hölzerne Dach der kleinen bretonischen Kirche. „Welcome to the historic Church of Cléguérec“, begrüßt der Fremdenführer die kleine Reisegruppe in hörbar ungeübtem Englisch. Klackend fährt der Metallschlüssel in das Schloss, und die Tür zum Kirchenschiff öffnet sich. Durch die Fenster dringt fahles Licht. Kurt, ein weiterer Deutscher, zwei Engländer und zwei Iren treten zögernd ein. Albert, der Fremdenführer, beginnt seinen Vortrag über die Geschichte des im 15. Jahrhundert erbauten Gotteshauses. „Viel wird er in diesem abgelegenen Teil der Bretagne fast ohne Touristen nicht zu tun haben“, denkt Kurt.
Nach wenigen Minuten löst sich Kurt von der Reisegruppe und schlendert allein auf den Altar zu. Neben dem Abbild des gekreuzigten Jesus Christus, grob aus Granitfels geschlagen, entdeckt er eine hölzerne Figur. Ungefähr so groß wie ein zehnjähriger Junge. Der rötliche Kopf ist haarlos, die starr ins Nichts blickenden Augen haben keine Lider, der Mund hat keine Lippen. Die Zähne ragen hervor, fast wie bei einem Totenkopf. Die Nase ist durch zwei Löcher nur angedeutet. “Das ist unser Saint-Barthélémy, der heilige Bartholomäus“, hört er Albert sagen, der plötzlich hinter ihm aufgetaucht war. Kurt tritt einige Schritte näher an die Figur heran. Erst jetzt erkennt er, dass der kleine nackte Eichenholzkörper des Bartholomäus viele senkrechte Schnitte aufweist. Es sind tiefe Schnitte, Verletzungen. Als hätte jemand den Bartholomäus vom Kopf bis zu den Füßen absichtlich mit diesen Schnitten übersät, fast geschändet. Auf dem braunrötlichen Untergrund des Holzes der Skulptur war Kurt das zuerst nicht aufgefallen.
Fragend schaut Kurt Albert an. „Das sind doch Wunden, überall blutende Wunden, am ganzen Körper.“ Albert nickt und zeigt auf den rechten Arm der Figur. Halb abgewinkelt vom Körper hält Bartholomäus ein Messer in der Hand. Die scharfe Schneide ist dem Körper zugewandt. Über dem angewinkelten linken Unterarm, fest an den kleinen Holzkörper gedrückt, hängt eine Art grauer Stoff, so als trüge die Figur einen Vorhang oder ein Kleidungsstück mit sich. Auf diesem Tuch ist ein bärtiges Gesicht zu erkennen. Der Kopf hängt schlaff herab. Dort wo die Augen sein sollten, sind nur kleine Löcher. Ein flach gedrücktes Gesicht. Von der Taille abwärts hängt es in ordentlichen Stoffbahnen herab. Die Haltung dieser Figur ist Kurt seltsam vertraut. So hält auch er seinen Arm, wenn der Vater ihm Stoffe zur eiligen Lieferung an die Bekleidungsfirmen am Berliner Hausvogteiplatz mitgibt. Oder wenn die Mutter ihn bittet, Vorhänge in die Wäscherei zu bringen.
„Ja, mein Junge, das sind Wunden. Der Apostel Bartholomäus starb einen furchtbaren Tod. Aber kennst du denn diese Geschichte nicht?“ Kurt schaut. Dann schüttelt er seinen Kopf. „Soll ich sie dir erzählen?“ Kurt schaut noch immer. Dann nickt er „Bartholomäus hat Gottes Wort verkündet. Dafür haben sie ihn ermordet. Sie haben mit Knüppeln auf ihn eingeschlagen. Dann haben sie ihn auf einen Tisch gespannt und ihm bei lebendigem Leib die Haut abgezogen.“
Albert zieht aus seiner Hosentasche ein bretonisches Taschenmesser, wie es Kurt schon einmal bei den Fischern von St. Malo gesehen hatte, wenn sie die Köpfe der Fische abschnitten. Albert klappt es auf und deutet mit der Klinge kleine Schnitte auf seinem Jackenärmel an. „So ähnlich haben sie es mit Bartholomäus sicher auch gemacht.“ Kurt schwindelt bei dem Gedanken an die Schmerzen, und die Kälte im Kirchenschiff lässt ihn plötzlich frösteln. „Und daran ist Bartholomäus auch gestorben?“, fragt Kurt. „Nein“, antwortet Albert kurz und steckt sein Messer wieder in die Hosentasche. „Was hat er denn dann gemacht?“ „Er hat sich vom Tisch erhoben. Dann hat er seine Haut über den Arm genommen. So wollte er einfach davongehen.”
„Mit der Haut über seinem Arm?“ Verständnislosigkeit und Faszination mischen sich in Kurts Blick. „Oui, mein Junge. Natürlich haben sie ihn nicht gehen lassen. Sie haben ihn festgehalten. Dann haben sie ihm den Kopf abgeschlagen.“ „Das sind Legenden, nicht wahr?“
„Ja, mein Junge. Man nennt das Legenden. Ein Mensch ohne Haut, der Körper vereitert, ohne Schutz. So wurde Bartholomäus zum Schutzpatron der Aussätzigen, der Leprakranken. Sie haben seine Statuen und Bilder um Beistand und Hilfe angefleht. Aber die Leute hier sind auch praktisch. So wurde der Bartholomäus im 17. Jahrhundert auch zum Schutzpatron der bretonischen Gerber und Flachstuchhändler. Die Häute und Pelze von Füchsen, Kühen und Frettchen waren begehrt bei Pariser Schneidereien. Flachstücher aus der Bretagne gingen meist an die Hutmacher, für ihre opulenten Kreationen. Die Pariser Näherinnen bauten daraus auch Krinolinen für die hohen Herrschaften. Das brachte den Händlern der Bretagne Wohlstand, und so wählten sie den Bartholomäus als Patron aus.“
Albert zuckt die Schultern, als kenne er die ganze Geschichte auch nicht so genau. Für Kurt hört sie sich nachvollziehbar und trotzdem grausam an. Anschließend lässt der Fremdenführer Kurt stehen und beginnt, die Architektur der kleinen Kirche in Cléguérec zu erklären, während Kurt seinen Blick nicht von der Skulptur lösen kann. Es ist gut, denkt er, dass seiner in der Kirche gedacht wird. Und trotzdem versteht er nicht recht, dass in einem Gotteshaus solch grauenhafte Dinge dargestellt werden. In seiner Synagoge in Berlin, die er nach seiner Bar Mizwa selten genug besuchte, gab es solche Skulpturen nicht.
Vielleicht, sagt er sich, gehört es zum Christentum, solche Dinge den Gläubigen nahezubringen. Vielleicht haben Christen deshalb eine so große Angst vor ihrem Gott.
Er nimmt sich vor, sofort nach seiner Rückkehr nach St. Brieux seinem Vater von dem heiligen Bartholomäus zu berichten, ihn nach seiner Meinung zu fragen. Und Kurt ahnt, dass er diesen Ausflug in Erinnerung behalten, dass das Bild des Bartholomäus in ihm bleiben würde. Wieder draußen vor der Kirche verabschiedet sich Albert von der Reisegruppe, kassiert einige Francs und fährt mit seinem Auto davon. Während die beiden Engländer und die Iren in ein Gespräch vertieft sind, kommt der deutsche Tourist auf Albert zu.
„Na, wie hat dir denn dieser rohe Fleischklops gefallen, den du dir so lange in der Kirche angeschaut hast?“ „Oh, es ist … beeindruckend.“ antwortet Kurt. „Machst du Ferien hier?“ „Ja.“ Und mit einem Anflug von Stolz: „Mit meinen Eltern. Wir sind aus Berlin und mit dem Schiff hier hergekommen.“ „So, mit dem Schiff.“ Dann, plötzlich, mit scharfem Ton: „Jude, was?“ Kurt ist überrascht und auch verängstigt. „Ja.“ „Das habe ich sofort gesehen. Unsereins sieht das sofort. Dann merk dir mal eines, mein Junge. Das, was dieser Bartholomäus erlitten hat, das wird euch Juden auch noch passieren. Das ist die Strafe dafür, dass ihr unseren Jesus ermordet habt. Vergiss das niemals.“
Sechs Tage zuvor waren Kurt und seine Familie in die Ferien aufgebrochen. Die Abreise war wie immer chaotisch. Als sie endlich alle zusammen im Zugabteil saßen, war Kurts Vater Isidor völlig außer Atem. Seine Mutter suchte nun schon zum dritten Mal ganz nervös nach den Pässen, die sein Vater immer nur „Papiere“ nannte.
„Nun hör doch endlich auf, alles immer wieder auszupacken“, fauchte er sie an. „Ich habe alles bei mir, die Papiere, Fahrkarten, die Reservierungen“, versuchte er seine Frau zu beruhigen. Kurt ertrug das Gezänk seiner Eltern nur schwer, obwohl es ihm seit seinen frühesten Kindertagen vertraut war.
Schon Wochen vor dem Ferienanfang waren seine Eltern fast nur noch mit den Reisedokumenten beschäftigt. Sobald sie Berlin verließen, waren sie besorgt. „Wenn ein Jude verreist“, sagte Isidor Ehrenfried immer wieder, „muss er dafür sorgen, dass er besser als andere vorbereitet ist. Wir wissen ja nie, was so alles passieren kann.“ Kaum kam Kurts Mutter auch nur in die Nähe der Schublade mit den Reisedokumenten, bat sein Vater sie, die Papiere ja nicht anzurühren. Kurt verstand den angeblichen Zusammenhang von Ferienreisen und jüdischer Herkunft nicht. Er hielt diese Ängste auch für völlig übertrieben. Sie belustigten ihn fast. Denn schon vor Kriegsbeginn 1914 fuhren die Ehrenfrieds im August regelmäßig von Berlin nach St. Malo in die Sommerfrische. Dabei war noch niemals etwas Schlimmes passiert. Im Gegenteil, Kurt hatte viele gute Erinnerungen an die Bretagne, an die Strände, die Crêpes mit Zucker, die Tartes aux prunes und die alten Pensionen, die Chambres d‘hôte, in denen die Familie übernachtete. Die heimkehrenden und zerschundenen Soldaten aus den Schlachten im Frankreich des Weltkriegs, die kannte er zwar von den Straßen in Berlin und aus den Zeitungsberichten. Da sein Vater nicht als Soldat gedient hatte, ging das aber weitgehend an ihm vorbei. „Die Bretagne“, sagte Isidor Ehrenfried immer wieder ganz undeutsch und den verlorenen Krieg ignorierend, „das ist ein guter Ort, es gibt dort kaum Juden, und wir haben da nicht die Sorgen, die wir hier in Berlin haben.“
Kurt wusste fast nichts von den Sorgen, die seinen Vater so bewegten. Und warum sollte es gut sein, keine Juden um sich zu haben? Schließlich machte sein Vater einen großen Teil seines Umsatzes mit jüdischen Geschäftsleuten. Er traf sich jeden Tag mit Berliner Juden, mit Posener Juden, um Geschäfte im Stoffhandel und mit Schneidereizubehör zu betreiben.
Kurt kannte diese Begegnungen seit seiner Kindheit, die er zu einem nicht geringen Teil im Geschäft seines Vaters verbracht hatte. Kurt half beim Abmessen der Stoffbahnen, beim Einwickeln der Bestellungen in festes Packpapier. Und manchmal lieferte er selber kleinere Bestellungen mit dem Fahrrad in die Konfektionsfirmen am Hausvogteiplatz, der Krausenstraße und der Mohrenstraße. Erst als er immer mehr für sein Abitur arbeiten musste, blieb er dem väterlichen Geschäft fern.
Abbildung1: Die Kürschnerei-Werkstatt der Konfektionsfirma Lindemann in der Berliner Mohrenstraße 44 im Jahre 1930
Dieses langwierige Feilschen um Preise. Diese ständigen Versuche, den Geschäftspartner zu übervorteilen. All dies in jiddischer Sprache, die Kurt zwar verstand, aber nicht sprechen konnte und auch nicht sprechen wollte. Die immer neuen Händler, die versuchten, seinem Vater neue Waren aufzuschwatzen, all dies ging ihm, je älter er wurde, immer mehr auf die Nerven. Insofern verstand er sehr wohl, dass sein Vater sich nach Ruhe sehnte. Plötzlich hörte er draußen am Bahnsteig den scharfen Pfiff auf der Trillerpfeife des Zugschaffners. Der Zug ruckte beim Anfahren, und dann ging die Reise los, von Berlin nach Hamburg. Kurt hatte sich einen Fensterplatz im Abteil ausgesucht, das hatte er sich schon bei der Buchung zusammen mit seinem Vater im Reisebüro der Deutschen Reichsbahn in der Fasanenstraße gewünscht. Dort buchte sein Vater immer die Urlaubsfahrkarten, jedes Jahr die gleiche Reise. Zuerst nach Hamburg, dann auf das Schiff in Richtung Saint-Malo in der Bretagne.
Die Schiffskabine der Ehrenfrieds würde ein Außenfenster haben, darauf hatte seine Mutter bei der Reservierung bestanden.
„Wenn ich nicht rausschauen kann, werde ich seekrank“, behauptete sie einfach. Isidor war nichts anderes übrig geblieben, als diesen Grund zu akzeptieren. Das hektische Familientheater ums Koffer packen und Geld umtauschen war vor jeder Reise das Gleiche. Kurt kannte das schon. Seine Mutter nahm immer eine Reisetasche mit Proviant und einen kleinen Koffer mit einer Art von Picknickgeschirr mit. Noch bevor sie in Hamburg ankamen, hatten er und sein Vater mehr als die Hälfte der belegten Brote gegessen und die Thermoskanne mit Kaffee geleert. Als Zuglektüre diente seinem Vater ein deutsch-französisches Wörterbuch. Leise murmelte er die Vokabeln vor sich hin und wiederholte jedes Wort gleich mehrmals, als ob das seine Französischkenntnisse verbessern würde. Noch bevor die Ehrenfrieds dann im Hamburger Hafen ankamen, hielt Isidor eine kleine Ansprache an seinen Sohn: über den Sinn von Fremdsprachen und wie sich die Jugend damit ganz neue Berufsaussichten schaffen könne. In diesen wenigen, aber lästigen Minuten der Belehrung betrachtete Kurt seinen Vater mit etwas mitleidigen Augen. Ahnte er doch, und seine Mitschüler hatten es ihm im Gymnasium oft genug gesagt: Ein Jude kann niemals zu einem anderen werden, selbst wenn er fremde Sprachen fließend spricht. „Der Jud bleibt Jud“, hatte selbst sein Lateinlehrer ihm einmal gesagt, „egal was er tut“. Dabei hatte er das letzte „t“, ganz bewusst betont und die vier jüdischen Mitschüler in seiner Klasse dabei provozierend angeschaut.
Kurt wusste, dass sein Vater oft versuchte, seine so sichtbare jüdische Herkunft zu verbergen. Vor allem dann, wenn er mit nicht jüdischen Berliner Kaufleuten zusammen war. Kurt war das nicht etwa unangenehm. Vielmehr störte ihn, dass seine Mutter meinte, er sähe doch dem Vater sehr ähnlich. Und so tat er Vieles im Schulalltag, um genau diesen Eindruck zu vermeiden. Er war modern, er war nicht der „Jud“, sondern lebte im 20. Jahrhundert, kannte die Musik der Zeit, sprach zwar etwas Berliner Dialekt, aber immerhin fast perfektes Hochdeutsch, er zwang sich dazu. Das Jiddische war ihm zuwider. Was wollte er schon von der Herkunft seines Vaters und der Großeltern wissen?
Die Frankreichreisen sollten Kurt vor allem helfen, sein Französisch fürs Abitur zu verbessern.
Seine Mutter, die er liebte, aber niemals als besonders gebildet wahrnahm, wünschte sich, dass Kurt Lehrer würde. Er sollte es zu etwas bringen. Als Vorbild dienten ihr viele andere Berliner jüdische Familien in Charlottenburg, die meistens eine französische Haushälterin oder ein Kindermädchen hatten und die dann die Kinder gleich in zwei Sprachen erzogen.
Kurt war im guten Mittelschnitt seiner Klasse, obwohl während der letzten Kriegsjahre der Unterricht oft ausgefallen war. Ihm war es ziemlich egal, welche tieferen Beweggründe seine Eltern mit dem Urlaub verbanden. Er hatte sich dieses Mal besser auf die Reise vorbereitet. Nur nicht ganz so, wie seine Eltern es wollten. Kurt hatte zum ersten Mal seinen eigenen Koffer mit, und er hatte ihn vollgepackt mit sportlicher und legerer Bekleidung, die ihm seine Mutter noch kurz vor der Abreise im Kaufhaus Nathan Israel nach einigem Bitten und Drängen gekauft hatte. Kurt, eher hager, für seine 17 Jahre aber immerhin schon 175 cm groß und etwas schlaksig, hatte in der Herrenabteilung des Kaufhauses einige Anzüge anprobiert, schließlich einen dunkelblauen Leinenanzug und gleich mehrere Hemden mit weiß abgesetztem Kragen und umschlagbaren Ärmeln mit Manschetten ausgewählt. Denn endlich wollte auch er Manschettenknöpfe tragen, und die abendlichen Restaurantbesuche boten sich dazu bestens an. In der Freizeit- und Sportabteilung des Kaufhauses Wertheim hatte er schon im Juni zwei Paar Wildlederschuhe gekauft, außerdem englische Loafers für den Strandspaziergang. Ein ebenso elegantes wie praktisches Schuhwerk, ohne Schnürsenkel, einfach zum Hineinschlüpfen. Dazu aus der Sportabteilung bei Nathan Israel eine schwarze Badehose mit weißen Streifen an der Seite – genauso ein Modell, wie er es in einer Modezeitschrift in einem Bericht über britische Schwimmer auf einem Foto gesehen hatte. Kurz, Kurt fühlte sich bestens ausgerüstet für die Abende auf der Fähre, vor allem für den Dinnersaal und fürs Flanieren in der Altstadt von Saint-Malo am Nachmittag. Kurt mochte gute Bekleidung und konnte sich niemals satt sehen an den exzellent gekleideten Frauen, die er auf dem Schiff genauestens zu beobachten pflegte. Aber genau das war nun etwas, was seinem Vater völlig unsinnig erschien. Für ihn waren die eleganten Abendempfänge pure Zeitverschwendung. Auf den vergangenen Reisen hatte sich Isidor Ehrenfried schon meistens um 20 Uhr in die Familienkabine verzogen und schnarchend bis zum Morgen durchgeschlafen. So war es auch diesmal. Kaum hatten die Ehrenfrieds von der Bordbesatzung ihre Kabine zugewiesen bekommen, legte sich Isidor erst einmal hin und schlief sofort ein.
Für Kurt waren die Minuten vor dem Ablegen des Schiffs im Hamburger Hafen die spannendsten. Während seine Mutter die kleinen Schmuck- und Parfümläden auf dem vierten Zwischendeck aufsuchte und nach französischen Parfums durchstöberte, stand Kurt hoch oben an der Reling und wartete auf das Ablegen des laut tutenden Dampfers, dessen drei hohe und fauchende Schornsteine den dicken Dieselrauch in den Himmel bliesen. Mit ihm standen dort noch viele Passagiere, einige winkten wohl Verwandten und Freunden zu, die nicht in Ferien fahren konnten, andere waren einfach fasziniert von dem Lärm der Motoren, die das Schiff bei den engen Wendemanövern im Hafen auf dem Weg in die See erzittern ließen. Abschied, so dachte Kurt, das ist auch ein schönes Gefühl.
Das Fährschiff nahm jetzt Kurs auf die offene See. Der Hamburger Hafen wurde am Horizont immer kleiner. Zielhafen der Fähre war Bilbao. Das war auch der Grund, warum so viele spanische Passagiere an Bord waren. Laut palavernd und aufgeregt liefen die meisten von einer Seite des Schiffes auf die andere, und kaum waren sie dort angekommen, rief irgendjemand wieder etwas von der gegenüberliegenden Seite, und fast alle rannten wie fröhliche Kinder zurück. Fast pausenlos machten sie Fotos, und auch Kurt hatte seine Leica-Kamera mitgenommen. Ihm gefiel das Spektakel, und er machte am Oberdeck auch schnell die Bekanntschaft mit einem spanischen Mädchen. Er schätzte es auf 16 Jahre, und es war sicher auch mit den Eltern auf der Reise nach Bilbao. „How do you like the Ferry?“, fragte Kurt ein wenig unbeholfen. Und mit einem Strahlen, als wäre es ihr eine große Freude, mit Kurt ins Gespräch zu kommen, antwortete sie mit spanischem Akzent, ohne seine Frage offenbar verstanden zu haben: „How do you do? My name is Maria.“ Auch Kurt stellte sich vor, lächelte Maria an und verabschiedete sich. “See you later, Maria“, sagte er und stieg die Treppen zu den Unterdecks hinab, um nach seiner Mutter Ausschau zu halten. Obwohl die Begegnung nicht länger als eine halbe Minute gedauert hatte, hoffte er, Maria während der zwei Reisetage nach Saint-Malo wieder zu sehen. Draußen auf den engen Gängen der Fähre wurde es etwas ruhiger, dafür erklang nun aus dem Schiffsrestaurant Musik. Die Klänge der Swing-Band drangen leise und zart bis in die Kabine der Ehrenfrieds. Kurt war glücklich. Er freute sich auf die Ferien.
Kapitel 1
Berliner Hitze
Kurfürstendamm, Berlin, Juni 1935, Café Reimann. Drinnen herrschen Gedränge und Hektik, es duftet nach aufgebrühtem Kaffee und frisch gebackenen Schrippen, nach Kuchen. Von draußen dringt der Krach der vorbeifahrenden Straßenbahnen und Autos. Passanten winken, Droschken hupen. Im Reimann die gestikulierenden und schwatzenden Modeschöpfer, Vertreter, die Zwischenhändler, die Konfektionäre. Ein Bazar im Herzen Berlins. Das Reimann.
Die neuesten und wildesten Branchengerüchte über Auftragslagen, Lieferengpässe und billige Bankkredite. Um Geld geht es fast immer. Und über Spekulationen darüber, welcher Konfektionär welchem Konkurrenten die besten jungen Talente abwerben möchte. Wurde nicht über das Einkommen gesprochen, dann darüber, welcher erfahrene Konfektionär gerade wieder ein neues Auto gekauft hatte oder den Betrieb wechselte. Und der Tratsch: Wer hat gerade mit wem eine Affäre? Wer hat sich in einer der privaten Badeanstalten daneben benommen? Ehrenfried bestellte sich wie fast jeden Morgen seinen Kaffee im Reimann. Immer ohne Milch und Zucker, alle Kellner wussten das, die Bedienung war schnell, hier kannte man sich. Das Reimann war für Ehrenfried so etwas wie ein zweites Büro geworden. Was die Banken und die Wall Street für die Aktionäre waren, das war das Reimann für die Berliner Bekleidungsindustrie. Ehrenfrieds Firma Ehrenfried & Cohn in der Mohrenstraße war nur fünfzehn Autominuten vom Café entfernt; auf dem Weg dorthin besorgte sich Ehrenfried jedes Mal schnell die neuesten Zeitungen und Magazine. Die Mohrenstraße lag inmitten des Berliner Konfektionsviertels, das im Norden vom Prachtboulevard Unter den Linden, im Westen durch die Friedrichstraße, im Süden von der Kochstraße und im Osten durch die Jerusalemer Straße begrenzt wurde. Jedes Mal, wenn Ehrenfried im Reimann saß, hatte er das unbestimmte Gefühl, als hätten er und die vielen anderen jüdischen Cafébesucher ihr Reimann verteidigt und gehalten. Denn etwa vier Jahre zuvor, am 12. September des Jahres 1931, war das Reimann von Nazis überfallen worden. Kurt und Lore hatten an jenem Abend die Synagoge in der Fasanenstraße verlassen, wo sie mit vielen anderen Juden das Rosch ha-Schana, das jüdische Neujahrsfest begangen hatten. Als sie auf die Straße traten, erblickten sie mit Schrecken brüllende Nazihorden. „Prost Neujahr! Juda verrecke! Deutschland erwache!“, so scholl es durch die Straßen. Die Nazis prügelten auf Passanten ein, die sie für jüdisch hielten. Ein älterer Mann in Begleitung einer Dame wurde niedergeschlagen und am Boden liegend mit Fußtritten traktiert. Die Polizei schritt nicht ein. Sie hielt sich zurück. Einige Augenzeugen kommentierten solche Szenen kaltherzig und ungerührt: „Warum tragen diese dicken Jüdinnen auch Pelze und Blumensträuße?“, und: „Die Leute haben recht. Auf der einen Seite Not und auf der anderen Festtagskleider.“ Immer wieder hallten die Parolen über den Kurfürstendamm: „Juda verrecke! Schlagt die Juden tot!“. Die Nazitrupps schlugen die Scheiben des Reimann ein. Schüsse fielen. Einige Cafébesucher wurden schwer verletzt. Die Rädelsführer des Pogroms wurden später zu geringen Geldstrafen verurteilt. Vor Gericht waren sie von Roland Freisler und Hans Frank verteidigt worden. Jetzt, vier Jahre später, waren Ehrenfried und viele andere jüdische Konfektionäre noch immer Stammgäste in ihrem Café Reimann.
Schon während der Fahrt in seinem Mercedes Benz Richtung Reimann hatte Ehrenfried einen Blick auf die Zeitungen geworfen. Politik interessierte ihn, viel wichtiger aber waren die Wirtschaftsseiten mit den Devisenkursen. Obwohl er nun wirklich keinerlei Sympathien für die Nazis hatte, bewunderte Ehrenfried doch die Stabilität der Reichsmark. Nur zu gut konnte sich Ehrenfried an die Inflationszeit erinnern, die Deutschland im Jahre 1923 heimgesucht hatte. Damals hatten manche Händler das Geld nicht mehr gezählt, sondern gewogen: Es waren einfach zu viele Scheine gewesen. Cohn hatte irgendwo die Geschichte von dem Mann aufgetan, der eine Tasse Kaffee getrunken hatte. Sie kostete damals 5.000 Reichsmark. Als der Mann noch eine zweite Tasse bestellt und ausgetrunken hatte, bekam er eine Rechnung über 14.000 Reichsmark. Das Personal erklärte dem entgeisterten Gast: Während er den ersten Kaffee getrunken habe, sei der zweite eben schon wieder teurer geworden. Wer ins Ausland exportierte, für den mussten die Wechselkurse damals jeden Tag neu geschrieben werden. Feste Preise gab es überhaupt nicht mehr – das denkbar miserabelste Klima für alle Firmen, die ihre Produkte exportierten.
Erst mit dem energischen Auftreten von Hjalmar Greeley Schacht änderte sich alles zum Guten. Ehrenfried nannte Schacht immer „Greeley“ und niemals „Hjalmar“, aus voller Absicht und mit fast angelsächsischer Bewunderung. Die steile Abschussfahrt der deutschen Währung fand ein Ende. Die Finanzgrundlagen ordneten sich endlich wieder. Ehrenfried blickte auf Schacht mit Wohlwollen und Bewunderung: Ein erfahrener Banker mit Verstand und internationalen Kontakten, außerdem sprach er fließend Englisch und Französisch – kurz: Greeley hob sich aufs Angenehmste von den lärmenden NS-Propagandisten und einiger noch grobschlächtigerer Nazis ab. Außerdem war der Minister, und davon verstand Ehrenfried mehr als von Politik, stets vorzüglich gekleidet. Im Gegensatz zu Hitler und dessen anderen Ministern trug Schacht eher schlanke einreihige Anzüge, angefertigt von Londoner Schneidern. Oft und lange sah sich Ehrenfried die Pressefotos der offiziellen Empfänge mit Greeley an. Er bemerkte sofort die englische Qualitätsarbeit: an der klaren Linienführung der Kragen und daran, wie genau die eingesetzten Brusttaschen im Jackett bei den meist gestreiften Stoffen passten. Greeley hatte internationales Flair und sah manchmal sogar fast wie ein amerikanischer Politiker aus dem Senat aus. Nur zu gern hätte Ehrenfried die Gattin des Ministers, Manci Schacht, einmal ausgestattet. Aber die trug edelste Couture aus Paris, die trug keine Berliner Konfektion. Nahezu alle Konfektionäre hatten in den vergangenen Jahren schon einmal versucht, Frau Ministerin Schacht zu ihren Modenschauen einzuladen. Immer vergeblich. Wer es wenigstens einmal schaffte, zum Beispiel die Tochter eines Ministers für eine Präsentation zu gewinnen, der sorgte dafür, dass spätestens zwei Tage nach der Schau Fotos davon in den Zeitungen zu sehen waren. Das war blendend fürs Geschäft, für den Ruf— und es brachte manchmal Regierungskontakte ein, die die Händler natürlich nutzen wollten. Denn seit 1928 waren die Exporte von Textilien um mehr als zwei Drittel gefallen.
Geordnete Wirtschaftsverhältnisse. Die waren für Ehrenfried von enormer Bedeutung. In Deutschland und in seiner Firma. Mehr Umsatz, mehr Export! Die Geschäftspartnerschaft zwischen ihm und dem Konfektionär Simon Cohn versprach noch sehr viel. Cohn war der Mann, der in allen kreativen Stilen der Modebranche bewandert war. Gerade waren wieder einmal die Exportzahlen für Fertigkleidung aus dem Hause Ehrenfried & Cohn erfreulich gestiegen.
Schachts Wirtschaftsimpulse förderten eben nicht nur die Schwerindustrie, sondern auch die Konfektion. „Du und Dein Greeley“, so nahmen ihn manche seiner Kollegen ob seiner Bewunderung mitunter auf die Schippe. Die Schachts, so dachte sich Ehrenfried dann bisweilen, die bewiesen, dass es auch eine NSDAP der Marke „Noblesse oblige“ geben kann. Allerdings gab es da ein leichtes Unbehagen: Etlichen Artikeln aus der „Frankfurter Zeitung“ konnte Ehrenfried entnehmen, dass sein Greeley von der völligen Überlegenheit der christlichen Kultur und Weltordnung überzeugt war. Solche Ausrutscher, wie Ehrenfried sie nannte, waren ihm nicht völlig einerlei, aber er fühlte sich davon nicht gleich bedroht. Außerdem war es seit dem April 1933 in Deutschland fast normal, dass die Juden für die Inflation, für den verlorenen Krieg, schlechtes Wetter, Zugverspätungen, kurz: das gesamte Elend dieser Welt verantwortlich gemacht wurden. „Eine Zeiterscheinung, die wird vorbeigehen“, sagte er einmal in einem freilich etwas besorgten Ton.
Jetzt, im Reimann, hatte Ehrenfried auch einige Post aus dem Ausland vor sich liegen. Seine Sekretärin, die er, aber nur in ihrer Abwesenheit, „die dralle Perschke“ nannte, hatte sie ihm zurechtgelegt. Simon Cohn, der aus seiner Homosexualität kein Geheimnis machte, witzelte ständig über die so rechtschaffene Erika Perschke. Sie war ein Fels in der Brandung bei Ehrenfried & Cohn. Wenn es hoch herging im Geschäft, vor allem in der Sturm und Drang - Periode von Januar bis Februar und von August bis September, da blieb die dralle Perschke nicht selten 18 Stunden am Tag im Büro.
Vor sich sah Ehrenfried Korrespondenzen aus Australien, Brasilien, den USA und Kanada, England und Holland. Fast alle enthielten Bestellungen aus den Kollektionen der vergangenen beiden Modenschauen, die er und Cohn in der Mohrenstraße präsentiert hatten. Bestellungen aus Übersee trafen oft mit sechs bis zwölf Monaten Verspätung nach den ursprünglichen Modenschauen ein. Das war einfach so. Die meisten Konfektionsbetriebe nahmen diese Nachzügler zum Anlass, jene Bekleidungsstücke, die in Europa und vor allem in Berlin beim besten Willen nicht mehr verkauft werden konnten, an die Vertreter im Ausland dann doch noch abzusetzen. Was wussten die Käufer im 12.000 Kilometer entfernten Buenos Aires schon von den Mänteln und Kostümen, die seit einem Jahr auf den Kleiderständern der Berliner Lager hingen?
Kaum hatte sich Ehrenfried die Bestellungen aus Übersee angeschaut, wurde er von Max Graumann angesprochen. Ehrenfried und Graumann kannten sich seit gut acht Jahren. Er leitete die gleichnamige und eben auch konkurrierende Mantelfirma in der Taubenstraße. Ehrenfried hatte Graumann noch nie leiden können. Zum einen, weil Graumann unsäglich unmodische Mäntel herstellen ließ. Zum anderen, weil seine Verkaufszahlen viel höher lagen als die Ehrenfrieds. Jedoch: Man kennt sich, und man gehört zum gleichen Verein. Wenn Ehrenfried vom „Verein“ redete, dann meinte er damit die Jüdische Gemeinde zu Berlin. Max Graumann war dort sogar Schatzmeister. Ehrenfried hingegen zahlte seinen jährlichen Obolus mehr oder minder freiwillig; die Synagoge in der Oranienburger Straße kannte er besser von außen als von innen.
Heute war Max anders als sonst, vertraulicher, nicht von oben herab den großen Geschäftsmann spielend, dennoch bestimmt.
Er zog Ehrenfried ein wenig beiseite und deutete mit dem Finger auf eine kleine Meldung in der „Berliner Zeitung“. Ehrenfried las nur die beiden Titelzeilen und wusste, was gemeint war.
„Deutsche Mode“, so stand dort, „ist auf dem Weg nach vorn.“ Und darunter: „Artgemäße deutsche Kleidungskultur ist nicht mehr auf jüdische Produzenten angewiesen.“
Ehrenfried kannte solche Zeitungsmeldungen. Seit 1933 waren sie in ähnlicher Form immer wieder aufgetaucht. Graumann sah nun besorgt aus. So besorgt, wie ihn Ehrenfried nur zu Zeiten der Trennung von dessen erster Frau einige Jahre zuvor erlebt hatte. Die hatte das Weite gesucht, nachdem sie herausgefunden hatte, dass ihr Mann Max seit längerem gleich mehrere Affären gepflegt hatte. Max konnte der Versuchung einfach nicht widerstehen, seine sehr jungen und hübschen Modelle für die eigenen Modenschauen nicht nur an-, sondern nach dem Dienst und schließlich sogar im Büro, auch auszuziehen. Als er schließlich begann, das eine oder andere Modell mit auf die zweimal jährlich in Paris stattfindenden Modenschauen zu nehmen, da blieb auch Max‘ Frau nicht länger verborgen, worüber das halbe Café Reimann längst Witze riss. Solche Gerüchte, solche Nachrichten ließen sich auf dem Bazar nie ganz verheimlichen. Die Konfektionschefs und die Modeschöpfer kannten sich schließlich bestens. Und der Hausvogteiplatz war für die Modelle, die meist frisch aus den Kunsthochschulen kamen, gerade ihr Studium abgeschlossen hatten und nach Gelegenheitsjobs suchten, eine Art inoffizieller Arbeits- und Kontaktmarkt. Viele junge Modelle starteten hier ihre Karriere, manche beendeten sie bereits nach dem ersten Probelauf.
Graumann fuchtelte nun mit der Zeitungsseite direkt vor Ehrenfrieds Nase herum. „Was soll‘s!“, wehrte Ehrenfried ihn ab.
„Die können doch gar nicht ohne uns. Wir wissen, wie man den Markt bedient, wir wissen, wo die besten exportfähigen Modellideen für unsere Klamotten herkommen.“ Um vor Graumann noch besser informiert dazustehen, warf er die neuesten Exportquoten ein.
„Der deutsche Textilexport lag vor einem Jahr bei knapp 52 Milliarden Reichsmark. Das ist verheerend, schlicht und einfach. Aber wir, wir kennen doch die Abnehmer, die richtigen Banken für Kredite, die Zulieferer. Wir zahlen hohe Steuern, und das alles nicht erst seit gestern.“
Er drehte den Kopf weg und beschäftigte sich wieder mit seiner Post. So ganz wohl war ihm nicht bei der Art und Weise, wie er Graumann angegangen war. Aber dieses ewige Gejammer über die Nazis und wie schrecklich möglicherweise alles noch werden würde – das konnte er nicht mehr hören. Außerdem hatten er und Simon Cohn schon mit den Plänen für die 1936er Olympia-Modenschauen begonnen. Das würde ein wahres Modefeuerwerk werden, es würde Berlin Reputation und der Firma neue Kunden bringen.
Es lief doch gut! Ehrenfried freute sich beim Lesen der Korrespondenz über reichlich eingegangene Bestellungen. Er würde mit der Perschke noch heute über eine neue Hilfskraft im Büro sprechen. Die Stellenanzeige könnte schon in der nächsten Ausgabe des „Konfektionär“ erscheinen. Mit dem Auftragsvolumen, was jetzt, im Juni, schon da ist und einer neuen Kollektion, dachte er freudig, würde er Graumann vielleicht schon bis zum Jahresende im Gesamtumsatz abhängen können.
Abbildung 2: Die letzte Kontrolle vor dem Warenausgang: Modelle helfen bei der Begutachtung von Pelzmänteln des Berliner Konfektionshauses Lindemann Am Hausvogteiplatz im Jahre 1930
Nach dem Kaffee legte er die Korrespondenzen in die Zeitung, eilte zurück in die Mohrenstraße in sein Büro, stellte sich neben die Perschke, um den Text und die Gestaltung der Stellenanzeige zu besprechen. Anschließend musste er sich mit drei seiner Betriebsangestellten unterhalten. Es waren die Schneiderzwischenmeister. Es war das übliche, sich in regelmäßigen Abständen wiederholende Ritual: Die wollten mehr Geld, und Ehrenfried wollte nicht zahlen. Er mochte solche Besprechungen nicht. Für ihn waren das nichts anderes als reine Erpressungsversuche. Nun ging ohne die Zwischenmeister aber gar nichts, weder in seinem noch in irgendeinem anderen Betrieb. Sie bildeten das Scharnier zwischen ihm und Cohn. Sie waren dafür verantwortlich, die Entwürfe in Schnittmuster umzusetzen. Sie waren verantwortlich, die Qualitätskontrollen und die Kalkulation haargenau einzuhalten und all dies mit klaren Anweisungen an die Schneiderwerkstätten mit ihren ameisenfleißigen Näherinnen weiterzugeben, die überall in Berlin zu finden waren.
Was Ehrenfried fast verachtete, das war die Attitüde dieser Leute, dieser Zwischenmeister. Er produzierte in Zeiten der Hochkonjunktur rund 20.000 Bekleidungsstücke pro Monat. Hochindustriell. Trotzdem, so glaubte Ehrenfried, hatte sich an der Haltung der Zwischenmeister seit 300 Jahren nichts verändert. Als ob solche Leute immer noch den Dunst der längst abgeschafften ständischen Handwerkerzünfte verströmten. Die Räume dieser Leute lagen meist im Erdgeschoss. Sie rochen muffig, sie durchwaberte besonders zur Mittagszeit der Geruch von aufgewärmtem Essen und kaltem Tabakrauch. Als Ehrenfried eintrat, saßen seine drei Angestellten bereits an einem fünf Meter langen Tisch, der sonst für Stofflieferungen reserviert war. Die Lehrlinge wurden hinausgeschickt. Kaum hatte Ehrenfried die Tür geschlossen, da stand auch schon Franz Windschild, mit 46 Jahren der älteste der Gruppe, auf und fing mit einer kleinen Rede bedeutungsvoll an.