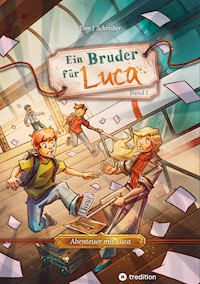
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Abenteuer mit Luca
- Sprache: Deutsch
Die Sommerferien stehen vor der Tür. Die schönste Zeit des Jahres. Nicht so für Jean. Die Konflikte mit seinem Vater lassen sich im Urlaub nicht einfach ausblenden. Die alljährliche Eskalation scheint vorprogrammiert. Doch dann taucht ein Fremder auf und bald wird klar: Diesen Sommer wird er das größte Abenteuer seines Lebens eingehen. Gemeinsam mit seinem besten Freund Marcel, begibt er sich auf eine spannende Reise, um die Wahrheit herauszufinden. Wenn er dabei nur nicht immer diese toten Augen sehen würde! Jean erkennt, dass Mut die Angst überwindet und Freundschaft stärker ist als die Macht der Verzweiflung. Ach ja ... warum es im Titel um Luca geht und nicht um Jean, das liegt daran, dass es manchmal einen ganz tollen Bruder (oder Schwester) benötigt, um tapfer zu sein. Das ist dann aber eine neue Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
für Tim,
dem ich zeit meines Lebens
einen Kaffee schulden werde.
Tom J. Schreiber
Ein Bruder für Luca
© 2022 Tom J. Schreiber (tomjschreiber.de)
2. Auflage, Vorgängerausgabe 2021
Umschlaggestaltung & Illustration: © 2022 Philipp Ach
Lektorat: Stefanie Brandt (steffis-buchecke.de)
ISBN Softcover: 978-3-347-57853-1
ISBN Hardcover: 978-3-347-57854-8
ISBN E-Book: 978-3-347-57855-5
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung „Impressumservice“, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Prolog
Alles in meinem Kopf schwirrt voller Gedanken. Kälte kriecht unter meinen Sweater. Der Regen hat aufgehört, so ist es angenehmer zu laufen. Ein Rhythmus, eine Geschwindigkeit, das beruhigt. Ich trete in eine Lache. Tiefer als gedacht. Wasser läuft in die Sneaker. Ich verliere den Takt - nur kurz. Schritt für Schritt ordnet sich alles wieder, auch meine Gedanken. Ich kann die Guten von den Schweren unterscheiden. Es sind ständig die gleichen Bedenken, die mich erdrücken. Ich konzentriere mich auf die guten. Ich laufe weiter, Schritt für Schritt. Da kommt die Biegung. Der Asphalt verschwindet. Der Weg ist weicher, sandiger - angenehm. Zehrt mehr an den Kräften, dennoch gefällt es mir besser hier zu laufen. Es tut gut, mich anzustrengen. Ich beginne meinen Körper zu spüren. Zuerst die Beine. Bei jedem Schritt fühle ich die Muskulatur. Nicht unangenehm oder erschöpft, aber ich spüre sie. Dann die Lunge, wie sie Sauerstoff in ihre Flügel pumpt. Mein Brustkorb senkt sich auf und ab. Es ist angenehm, die frische Luft einzusaugen.
Was stimmt nicht mit mir? Ich kann kaum mehr atmen. Etwas steckt in der Luftröhre. Was ist mit mir? Unerwartet eine Frau - Licht. Meine Lider werden schwer - Dunkelheit. Egal welche Gedanken mich treiben, ich bin nur an einem interessiert. Frischer Sauerstoff. Was mir guttut, ist einatmen und laufen. Ich sprinte weiter, bald müsste der Gehweg auftauchen. Seltsam, alle Unruhe ist aus mir verschwunden. Die Promenade. Der Weg ist härter. Ich spüre jeden meiner Schritte auf dem Asphalt. Es ist schön, wieder mühelos zu laufen. Sand hat sich den Weg in die Sneaker gebahnt. Sie sind feucht von der Pfütze. Menschen begegnen mir. Ich sehe niemanden an. Autos hupen, ein Krankenwagen fährt vorbei. Ich höre nichts. Mein Kopf ist leer. Die Kälte ist längst aus dem Sweater verschwunden, aus den Sneakern ebenfalls. Ich laufe schneller. Es ist schön zu sprinten. Ich spüre, dass es bald vorbei ist. Da ist die Tür, dahinter das Treppenhaus - noch eine Tür. Wasser prasselt auf meinen Kopf nieder. Angenehmes, warmes Wasser. Langsam kehren die Gedanken zurück. Vorerst nur die guten.
1
Heftig atmend, saß ich aufrecht im Bett und starrte in die Dunkelheit. Alles, an was ich mich erinnern konnte, war ein Paar Augen, das mich leer aus tiefen Augenhöhlen anstarrte. Konzentriert versuchte ich, das Gesicht wieder entstehen zu lassen. Es klappte nicht. So sehr ich mich bemühte, es tauchte nicht noch mal auf. Ich war mir sicher, dass da mehr gewesen war. Es blieb verschwunden. Langsam gewöhnten sich meine Augen an die Dunkelheit und ich konnte schemenhaft das Zimmer erkennen. Die Leuchtziffern des Radioweckers zeigten halb sechs. Ich ließ mich in das Kopfkissen zurückfallen. Noch eineinhalb Stunden, bis er klingelte, aber ich musste mich von wahnwitzigen Träumen wecken lassen. Eine Weile lag ich da, starrte im Dunkeln an die Decke. Schließlich gab ich auf. Meine Gedanken schweiften zurück in die Wirklichkeit. Mir war warm. Die Nacht hatte die Hitze des Tages kaum vertrieben. Ich roch an meinen Achseln. Ganz okay, aber besser ich würde etwas lüften. Letzter Schultag. Komplett für die Katz, wie ich fand. Unterricht würde ohnehin nicht stattfinden. Auf der anderen Seite wäre sonst gestern der letzte Schultag gewesen, und der folglich genauso überflüssig. Wenn man diesen Gedanken fortführte, würde am Ende das ganze Schuljahr unnötig sein. Ich lachte. Zum Glück kam es nicht oft vor, dass ich morgens so früh wach war. Nicht auszudenken, auf was für Ideen ich kommen würde. Besser ich stand auf. Die nächsten zwei Monate würde ich jeden Tag ausschlafen können, so musste ich mich heute nicht zwingen, liegen zu bleiben. Was hatte mich aus dem Schlaf gerissen? Ein bisschen unheimlich war mir das Ganze schon. Ich hatte nie Albträume. Um den Gedanken endgültig wegzuwischen, öffnete ich die Fensterläden. Die aufgehende Sonne tauchte mein Zimmer in ein zartes Licht. Der Himmel verwandelte seinen schwarzen Mantel zu einem neuen Tag. Unten wartete die Straße, friedlich und verlassen, von den schlafenden Menschen belebt zu werden. Selbst bei der älteren Dame von gegenüber waren die Läden noch geschlossen. Ich erinnerte mich nicht, dass es das schon gegeben hatte. Mitunter winkte ich ihr vom Fenster aus zu. Angesprochen hatte ich sie noch nie. Keine Ahnung warum. Ab und zu stellte ich mir vor, ob sie vielleicht einen Enkel hatte, wie mich. Ein trauriger Gedanke. Meine eigene Oma hatte ich nie kennengelernt. Als hätte sie mein Unbehagen gespürt, öffneten sich die grünen Läden und sie kam dahinter zum Vorschein. Freudig winkte sie mir zu. Ich hob lächelnd die Hand. Das nächste Mal auf der Straße würde ich sie ansprechen. Vielleicht ging ich auch direkt einmal zu ihr hinüber. Schließlich wohnten wir eine Ewigkeit vis-à-vis. Jetzt machte mich das frühe Aufstehen auch noch sentimental. Gelangweilt ging ich im Zimmer umher. Mein Vater hatte wirklich recht, wenn er ständig mit der Unordnung hier drin nervte. Überall lagen Klamotten. Es lohnte sich aber nicht aufzuräumen. Meistens landeten sie sowieso ungefragt, durch unsere Haushaltshilfe, in der Wäsche. Wobei ich sie insgeheim in Verdacht hatte, vieles ungewaschen wieder in den Schrank zurückzulegen. Beweisen konnte ich ihr das freilich nicht. Es war mir sowieso egal. Genau wie meine Klamotten legte ich auch nichts anderes dahin zurück, wo ich es hervorgezogen hatte. Ich benutzte es und ließ es woanders liegen. Da ich immer alles wiederfand, störte mich die Unordnung nicht im Geringsten. Aufräumen wäre reine Zeit- und Energieverschwendung. Mein Vater sah das naturgemäß anders. Er hatte jedoch aufgegeben sich mit mir darüber zu streiten. Kurz überlegte ich, ob ich ihn mit einem aufgeräumten Zimmer überraschen sollte, kickte letztlich nur den Rucksack unters Bett und griff stattdessen nach dem Handy. Mal sehen, ob Marcel bereits wach war. Seit der Grundschule waren wir beste Freunde.
[Hey], schrieb ich wie immer, wenn ich wissen wollte, ob er am Handy war.
Blöderweise kam nichts zurück und so surfte ich durch ein paar Websites. Auf dem Bettrahmen entdeckte ich den Kaugummi, den ich gestern dort deponiert hatte. Er sah eklig aus, aber bis zum Frühstück lohnte sich kein neuer. Ich steckte ihn in den Mund. Er war geschmacklos und hart. Mit etwas Speichel, so wie kräftigen Kaubewegungen, wurde er wieder geschmeidiger, aber natürlich nicht geschmackvoller. Egal, mit der Zeit hatte ich festgestellt, dass es mir mehr ums Kauen, als um den Geschmack ging. Mit einem Mal wurde die Tür aufgerissen. Mein Vater steckte den Kopf ins Zimmer.
»Hab ich richtig gehört«, fing er an zu meckern. »Leidest du jetzt schon an Schlaflosigkeit wegen diesem Mistding? Leg es weg … sofort!«
»Dir auch einen guten Morgen«, sagte ich provozierend. »Weiß nicht, was dich daran stören sollte«, brummte ich und wandte mich wieder dem Display zu.
»Sag mal, hörst du schlecht?«, schrie er.
»Von deinem Rumgeplärre muss man ja schwerhörig werden«, brüllte ich genervt zurück. Diese Form der Unterhaltung war für uns beide leider normal geworden. Ich hatte das Gefühl, dass er an allem etwas auszusetzen hatte und begegnete ihm entsprechend. Er fühlte sich provoziert und wurde laut. Im Endeffekt sprachen wir die darauffolgende Stunde oder länger nicht miteinander, bis es zur nächsten Auseinandersetzung kam. Harmonische Tage mit meinem Vater waren selten geworden. Im Grunde konnte ich mich schon nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich Spaß mit ihm hatte. Zornig kam er auf mich zu. Ich befürchtete, dass ich es heute zu weit getrieben hatte und er die Kontrolle verlor. Stattdessen griff er ohne ein Wort nach meinem Handy und schaltete es aus.
»Na super! Da können Daten weg sein«, schrie ich wohl wissend, dass das nicht stimmte. Er zuckte mit den Schultern.
»Schwerhörig, ich sag’s ja.« Mit diesen Worten verließ er das Zimmer, nicht ohne die Tür hinter sich zuzuknallen. Keine Ahnung, wo sein Problem lag. Er las Zeitung zum Frühstück und ich surfte im Internet. Ob ich ihm einfach mal seine Morgenzeitung wegnehmen sollte, um ihm die Augen zu öffnen. Idiot, dachte ich bei mir und spuckte meinen Kaugummi in den Mülleimer. Die Halbwertszeit für die zweite Benutzung war zugegeben recht kurz. Eine Erkenntnis für heute Morgen, die zu etwas taugte. Ich schaltete mein Handy wieder an.
[Hey, Bro. Bist aber früh wach? Kannst den letzten Schultag gar nicht erwarten? Lol]
Er sagte andauernd ›Bro‹ zu mir. Das Einzige, was Marcel nutzte, um cool zu wirken. Eine Macke, die ich ihm nicht abgewöhnen konnte.
[Haha, nein. Dafür hat mein Dad schon voll rumgestresst. Hat mein Handy ausgeschaltet. Wie ein Kind.]
[Ich versteh den Mann nicht. Hat er kein eigenes Leben, dass er immer dich piesacken muss?], schrieb er.
[Das ist jetzt auch etwas hart], schwächte ich ab.
[Ich weiß, er ist dein Dad … aber weiß er das auch?]
Ich sah ihn genau vor mir, wie er die Augen verdrehte. [Ich geh vorm Frühstück ne Runde Laufen. Wir treffen uns nachher unten], brach ich das Gespräch ab.
Es ärgerte mich, wenn Marcel so über meinen Vater redete, obwohl er vermutlich recht hatte. Wortlos verließ ich die Wohnung, zog meine Sneaker an, die vor der Tür lagen, und ging nach unten. Ich lief jeden Tag, mindestens zwei Mal, eine Runde an der Uferpromenade. Das Wetter war mir dabei egal. Es entspannte mich mehr als alles andere, was ich je ausprobiert hatte.
Eine halbe Stunde später, war ich zurück, duschte und setzte mich an den Frühstückstisch. Dad las Zeitung. Ich überlegte meinen Racheplan direkt durchzuführen, verwarf die Aktion allerdings für heute. Ich war nicht in der Stimmung für eine weitere Auseinandersetzung.
»Ich möchte nicht, dass du in Zukunft schon am Morgen dein Handy nutzt. Ich werde es dir sonst abends wegnehmen«, sagte er beiläufig aber bestimmt. Schon bereute ich, nicht in die Offensive gegangen zu sein.
»Mach mir lieber ne Liste, was ich darf. Ist leichter für mich durchzusteigen.« Ich stand auf, griff mir ein Croissant für den Weg und stürmte aus dem Zimmer. »Ich gehe in die Schule, da nörgelt nicht dauernd jemand an mir rum.«
Diesmal war ich es, der die Tür lautstark zuschlug. Mir war flau im Magen. Ich wusste, dass mein Vater diesen Auftritt nicht auf sich sitzen lassen würde. Warum war es mir nicht ein einziges Mal möglich ruhig zu bleiben? An sich hatte ich vorgehabt mit ihm darüber zu reden, nicht mit in den Urlaub fahren zu müssen. Ich wollte viel lieber mit meinen Freunden in ein Ferienlager. Das konnte ich nach diesem Auftritt mit Sicherheit vergessen. Zornig kickte ich mit dem Fuß gegen die Holzvertäfelung des Treppenhauses. Ich wusste ja nicht, dass es bald keine Rolle mehr spielen würde. Wütend durchsuchte ich die Hosentaschen meiner Jeans nach einem Kaugummi und hatte Glück. Sofort war ich etwas ruhiger. Als ich aus dem Haus trat, kam Marcel gerade mit seinem Fahrrad angefahren. Er machte eine Vollbremsung und grinste mich an. Keine Rede von meinem Vater, keine schlechte Laune, weil ich ihn abgewürgt hatte. In solchen Momenten wusste ich, was für ein toller Freund er war. Zehn Minuten später, bogen wir vergnügt scherzend, in die Hofeinfahrt unseres Colleges ein. Gechillt stellten wir die Räder ab und trotteten in Richtung Eingangstor.
»Ich hab gar keine Lust auf Schule«, stöhnte ich.
»Ach was, heute ist sowieso kein Unterricht mehr. Der Vormittag ist schneller vorüber, als du denkst.«
Er hatte recht. Zwei belanglose Unterrichtsstunden später, waren wir inmitten einer Masse von Schülern auf dem Weg, die große Haupttreppe hinunter, zur Aula. Dort würde wie jedes Jahr zum Ferienbeginn, der Rektor des Colleges eine tolle Rede halten, die uns tief bewegte. Zumindest dachte er sich das. Marcel und ich, saßen angeödet im hintersten Eck der Aula, auf dem Boden. Der ganze Saal war voller Schüler, die schnatternd darauf warteten, dass es losging oder besser gesagt, dass es vorbei war.
»Hier stinkt’s gewaltig nach Fußkäse«, verzog Marcel das Gesicht. Ich grinste und deutete mit dem Kopf zu einem Mitschüler, der zwei Meter von uns entfernt, ebenfalls auf dem Boden saß. Seine Beine waren in unsere Richtung ausgestreckt. Beiläufig zog ich meine eigenen Füße zurück, um mich darauf zu setzen. Einfach um sicherzugehen.
»Hey ihr zwei, kommt ihr nach der Schule zum Meer mit runter?«
Lea, ein Mädchen aus unserer Jahrgangsstufe, hatte sich zu uns gebeugt. Sie lächelte vielversprechend. Marcel sah mich fragend an. Er wusste, dass es bei mir nicht immer möglich war, dass ich gehen konnte. Mein Dad war aber noch nicht zu Hause, wenn ich von der Schule kam. Ich nickte also.
»Klar«, sagte Marcel. Zufrieden zog sich Lea auf ihren Platz zurück.
»Bro, ich glaube, die mag dich«, zwinkerte er mir bedeutungsvoll zu.
»Ich glaube, die steht mehr auf deine südländische Bräune, als auf weiße Jungs wie mich!«, stieß ich ihm in die Seite.
Vorn im Saal war ein Podest aufgebaut, das unser Rektor in diesem Moment betrat. Schlagartig wurde es still. Eine ausgesprochene Leistung von ihm. Egal wo er auftauchte, zog er die Aufmerksamkeit auf sich. Auch ich sah zu ihm nach vorn. Dabei streifte ich den Jungen, den ich heimlich mit Marcel gehänselt hatte. Wie ein Blitz durchfuhr es meinen Körper. Ich wusste mit einem Schlag, was mich heute Morgen aus dem Schlaf gerissen hatte.
Es waren diese Augen, die aus leeren Augenhöhlen zu mir herübersahen.
2
Ich hatte noch nie einen Toten gesehen, aber so mussten die Augen eines Toten aussehen. Während der ganzen Rede unseres Rektors saß der Junge vor mir. Ich wagte es nicht, mich zu ihm zu drehen. Zu skurril und beängstigend war die Situation. Ich hatte diesen Schüler noch nie auf dem College bemerkt. Warum träumte ich von ihm und was hatte der Traum zu bedeuten? Als der Rektor offiziell die Ferien eingeläutet hatte, brach ein Tumult los. Alle drängten nach draußen. Der Ausgang der Aula führte direkt an dem Jungen vorbei. Ich blieb sitzen und wartete, bis ihn die Meute verschlungen hatte. Auf keinen Fall wollte ich ihm näherkommen.
»Bewegst du dich mal?« Marcel war aufgestanden und sah mich ungeduldig an. Vorsichtig ließ ich meinen Blick an ihm vorbei wandern. Erleichtert stellte ich fest, dass der Junge weg war. Gemeinsam verließen wir das Collegegebäude. Draußen entdeckte ich ihn – ein paar Köpfe weiter vorn – wieder. Von hinten war nichts Außergewöhnliches zu bemerken. Jetzt war ich doch neugierig. Konnte es überhaupt sein, dass sein Gesicht so abartig aussah? Ich hatte mich sicher getäuscht. Mein Verstand musste mir einen Streich gespielt haben. Denn wenn nicht, würde ihn jeder anstarren oder schreiend davonrennen. Aber nichts dergleichen passierte. Plötzlich hatte ich es eilig. Ich musste mich vergewissern, dass er ein ganz gewöhnlicher Junge war. Meine Schritte wurden schneller.
»Beeil dich mal«, sagte ich zu Marcel. Gleichzeitig boxte ich mich durch die Horde Schüler, um den Jungen einzuholen.
»Wo willst du denn plötzlich so schnell hin? Wir kommen schon noch rechtzeitig zu Lea an den Strand«, keuchte Marcel hinter mir.
»Scheiß auf Lea. Beeil dich einfach«, rief ich zurück und achtete nicht darauf, ob er mithalten konnte. Ich musste den Jungen einholen. Endlich lichtete sich die Menge. Ich stand auf dem Hof, vor dem gusseisernen Tor und sah auf die Straße. Der Junge war weg.
»Verdammt«, fluchte ich.
»Bro, was ist denn mit dir? Erst hockst du rum wie erstarrt und dann rennst du los, als wäre der Leibhaftige hinter dir her«, japste Marcel, der ebenfalls am Tor angelangt war.
»Wer bitte ist der Leibhaftige?«, wollte ich irritiert wissen.
»Weiß nicht«, zuckte Marcel grinsend die Schultern. »Sagt man halt so.«
»Na dann«, antwortete ich in Gedanken.
»Wem wolltest du denn nach?«, fragte er noch mal gespannt.
»Ach egal, lass uns nach Hause fahren.« Ich war froh, dass Marcel nicht weiter nachbohrte. Auch das zeichnete ihn eben aus.
Unsanft schlug die Wohnungstür hinter mir zu. Wie jeden Mittag nach der Schule warf ich unserer Haushälterin ein »Hey Manuelle« zu, um danach in meinem Zimmer zu verschwinden. Eine Antwort wartete ich nicht ab. Vielleicht hatte sie es längst aufgegeben und akzeptiert, dass meine Zimmertür schneller ins Schloss fiel, als sie reagieren konnte. Wahrscheinlich interessierte sie es gar nicht. Gleichgültig warf ich den Rucksack auf den Boden. Mit einem Tritt beförderte ich ihn unters Bett. Dort würde er für die nächsten acht Wochen sein Zuhause finden. Mit dem Handy warf ich mich auf die Zudecke. Ferien! Zwei Monate keine Schule und vor allem keine Lehrer. Eigentlich sollte ich tierisch froh sein, aber worüber? Dieses Jahr war es schlimmer als je zuvor. Genau wie ich meine Lehrer nicht sehen würde, würde ich meine Freunde auch nicht treffen können. Marcel eingeschlossen. Übermorgen musste ich mit Dad in den alljährlichen ›heile Welt - Vater&Sohn - Urlaub‹ an die Adria. Die Chance hierzubleiben hatte ich heute Morgen wohl endgültig verwirkt. Der Urlaub würde, wie immer, der totale Horror werden. Mein Vater arbeitete zwei Drittel davon, um mir die andere Zeit mit seinem Männerdinggehabe auf die Nerven zu gehen. Ich verstand ohnehin nicht, warum wir an die Adria fuhren, wo wir das Meer vor der Haustür hatten. Nicht genug, entdeckte er genau dann seine Vaterrolle, wenn für mich der Urlaub schön wurde, weil ich Leute kennengelernt hatte, mit denen ich abhängen wollte. Er ging mit mir in pompöse Strandrestaurants und nannte es die Höhepunkte des gemeinsamen Urlaubs. Für mich war es stinklangweilig. Lieber hätte ich tagsüber mit ihm im Wasser getobt, Fußball am Strand gespielt oder irgendwie sonst das Gefühl gehabt, dass er etwas wegen mir machte. Ein Burger in irgendeiner Frittenbude hätte mir dabei völlig gereicht. Für ihn war das alles nichts. So lungerte ich den ganzen Tag im Hotel herum. Neidisch sah ich anderen Familien zu, die gemeinsam Spaß hatten. Wenn ich es mir recht überlegte, war für meinen Vater der einzige Unterschied zum Alltag, der Ort, an dem wir uns befanden und das essen gehen. Wenn wir in drei Wochen wieder zurück waren, fuhr Marcel in ein Ferienlager nach Spanien. Das waren weitere endlose Tage, in denen ich die Zeit totschlug. Mein alter Herr war der Meinung, es wäre zu viel des Guten, sechs Wochen zu verreisen. Dass er mir damit die beste Zeit des Jahres kaputt machte, ignorierte er völlig. Seit ich zehn war, führten wir die gleiche Diskussion. Immer mit demselben Ergebnis. Ich blieb zu Hause. Letzte Ferien war der Streit dermaßen eskaliert, dass er mir acht Wochen Nachhilfeunterricht aufbrummte. Selbst im gemeinsamen Urlaub verzichtete er nicht darauf. Wie ich es hasste. Er hatte uns nie die Chance gegeben, Vater und Sohn zu sein. Wir lebten zwar unter einem Dach, aber morgens war er aus dem Haus, bevor ich aufstand. Am Abend setzte er sich ins Wohnzimmer, um direkt nach den Nachrichten im Bett zu verschwinden. Mitunter hatte ich das Gefühl, ihm war gar nicht klar, dass da jemand in seinem Zimmer saß, der darauf wartete, er würde hereinkommen und wenn es nur wäre, um eine gute Nacht zu wünschen. Als ich noch kleiner war, hatte ich oft bei ihm gesessen, um in seiner Nähe zu sein, immer darauf bedacht, ihn nicht zu stören. Er hatte mich nie geschlagen, aber er war regelmäßig sauer geworden, wenn ich ihn angesprochen, oder versucht hatte mit ihm zu kuscheln. So hatte ich es eines Tages gelassen. Nüchtern betrachtet, glaubte ich nicht, dass er auf mich als seinen Sohn erpicht war. In seinem Leben würde ohne mich nichts fehlen.
Mit Marcels Eltern war es dagegen toll. Mit dessen Dad war ich oft beim Angeln oder am Strand. Wir hatten eine Menge Spaß. Er liebte Marcel und ich hatte das Gefühl, er liebte sogar mich. Zumindest mehr, als mein eigener Vater. Es ist komisch das zu sagen. Ich hoffe, keiner, der das liest, kann es verstehen. Wie immer bei solchen Gedanken und wenn ich auf Dad sauer war, überkam mich ein seltsames Gefühl. Heute jedoch stärker als je zuvor. Ich kannte meinen Vater nicht. Denke nach, sagte ich mir. Dir muss doch einfallen, wann er dich einmal in den Arm genommen hat, um dich zu trösten oder zu zeigen, dass er dich liebt. So angestrengt ich auch nachdachte, mir fiel nichts ein.
Es war nie passiert.
An keinem Tag hatte ich mir das so sehr bewusst gemacht, wie in diesem Augenblick. Ich weinte. Tränen rannen mir über die Wangen, in die Mundwinkel. Das Salz schmeckte genauso bitter, wie ich mich fühlte. Eine eisige Einsamkeit umhüllte mich. Eine Einsamkeit, die ich bis heute nie wieder gespürt habe. Zum Glück! Vergessen werde ich dieses Gefühl nie. Allein und verzweifelt, durchströmte mich eine schreckliche Sehnsucht nach meiner Mutter. Dad sprach nie über sie. Weder über ihren Tod, noch wie sie gewesen war. Manchmal versuchte ich, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Er wurde dann immer ungehalten. Des Öftern kam mir der Gedanke, dass ich mit ihrem Tod zu tun hatte und es ihm deshalb nicht möglich war, väterliche Gefühle für mich zu entwickeln. Ab und zu fühlte ich mich meiner Mutter derart nahe, als könnte ich sie im Raum spüren. Ich hasste diese Gedanken. Ich sehnte mich nach ihr, aber es machte mich traurig an sie zu denken, ohne eine echte Erinnerung zu haben. Auf der anderen Seite hatte ich etwas, das für das Verhalten meines Vaters sprach. So konnte ich es bei ihm aushalten. Ich hatte ein Dach über dem Kopf, jeden Tag zu essen und auch sonst mangelte es mir an nichts. Sicher gab es viele Jugendliche auf der Welt, die weitaus schlimmer dran waren. Dennoch, ein wichtiger Teil meines Lebens hatte nie stattgefunden. Oft lag ich weinend im Bett oder tyrannisierte andere, mit meinen Wutanfällen. Sogar Marcel bekam es manchmal ab, obwohl er es gut drauf hatte, mich von zu Hause abzulenken. Er war eben mein bester Freund und der Mensch, von dem ich wusste, dass er es nie böse mit mir meinte.
Die Schule machte mir zum Glück keine Sorgen. Meine Lehrer konnte ich nicht leiden, aber gute Leistungen gaben mir etwas von der Anerkennung zurück, die ich zu Hause vermisste. Meinen Vater beeindrucken zu wollen, hatte ich vor langer Zeit aufgegeben.
Unter dem T-Shirt rann mir der Schweiß über den Bauch. Aus den Gedanken gerissen, sprang ich auf. Es war noch nicht übermorgen. Zumindest bis dahin wollte ich die Zeit mit meinen Freunden verbringen.
»Kommst du essen, Jean«, rief es aus der Küche.
»Kein Hunger.«
»Wenigstens eine Kleinigkeit«, ertönte es direkt hinter mir. Manuelle stand in der Tür. Die Uhr zeigte bereits zehn vor eins. Muffig drehte ich mich um.
»Was ist an, ich habe keinen Hunger, nicht zu verstehen?«
»Nun komm schon, ich habe extra für dich gekocht.«
Der Ton, den sie anschlug, bewegte mich fast meine schlechte Laune zu vergessen. Aber nur fast.
»Sorry, aber die anderen warten schon. Ich werde später essen«, sagte ich freundlicher. Sie konnte ja nichts für meinen Vater.
»Na gut, ich stelle es in den Kühlschrank. Vielleicht hast du am Abend Appetit«, zog sie resigniert von dannen, während ich hastig meine Badeshorts überzog. Mit einem knappen »au revoir, Manuelle«, war ich zur Tür raus. Um keine Zeit zu verlieren, rannte ich, mehrere Stufen überspringend, die Treppe hinunter. Den letzten Absatz erwischte ich nicht richtig und kam ins Straucheln. Gerade noch rechtzeitig bekam ich die Klinke der Haustür zu fassen, um nicht zu stürzen. Ich war dermaßen in Fahrt, dass ich mit einem lauten Schlag, der im ganzen Treppenhaus widerhallte, dagegen krachte. Meine Schulter schmerzte und ich hob vorsichtig den Arm, um zu sehen, ob Schlimmeres passiert war. Es schien alles in Ordnung. Hastig rannte ich ins Freie. Manuelle war zuzutrauen, dass sie nachsehen würde, was den Lärm verursacht hatte. Das Letzte, was ich gebrauchen konnte, war ihre Fürsorge.
Die Sonne tauchte die Straße in ein gleißendes Licht. Heiß brannte sie auf den Asphalt, sodass sich die Luft verschwommen darauf spiegelte. Der Himmel hatte ein perfektes Blau, wie man es sich nicht ausdenken konnte. Keinem Maler der Welt würde es gelingen, ein solches Blau anzumischen. Ich blinzelte, da ich versehentlich in die Sonne gesehen hatte. Der Weg zum Strand war die perfekte Chance für eine Laufeinheit. Meine Schuhe berührten gerade den Gehweg, als ich auf jemanden aufmerksam wurde.
Ein Mann, etwa vierzig Jahre alt, nobel gekleidet. Kein Anzug oder Krawatte, aber modisch. Für die Hitze auf jeden Fall unpassend. Er war aus einem Taxi gestiegen und blickte zu mir herüber.
»He Junge, kannst du mir helfen?«, rief er mir fragend zu. Er sprach ein fast akzentfreies Französisch, konnte aber nicht verbergen, dass er Ausländer war.
»Wenn es schnell geht«, sagte ich kurz angebunden. »Was gibts denn?«, setzte ich höflicher nach, mich meiner guten Kinderstube erinnernd. Zumindest das hatte mein Vater ja hinbekommen. Nebenbei war ich neugierig, was er wollte.
»Oh, entschuldige bitte. Ich möchte dich keinesfalls aufhalten. Dachte, du wüsstest eventuell, ob hier Familie Bellier wohnt.«
»Was ist denn das für ne Frage? Das Taxi hat Sie doch hergebracht, oder?«, sagte ich schroff.
»Da hast du recht. Entschuldige bitte«, zuckte er nervös lächelnd zusammen.
»Wenn weiter nichts ist, würde ich gerne los. Ich habs nämlich echt eilig. Sie müssen sich nicht andauernd entschuldigen«, grinste ich ihn an. Zu unhöflich wollte ich auch nicht wirken. Er sah erleichtert aus und lächelte.
»Wie heißt du eigentlich?«, rief er hinter mir her, während ich mich in Bewegung setzte.
Was will er denn jetzt von mir, dachte ich und drehte mich um. Da er die Hand gehoben hatte, winkte ich zurück, gab aber keine Antwort. Hatte er Tränen in den Augen?
Seltsam!
Mein Vater hatte nichts von einem Besuch erwähnt. Zwei Tage vor unserer Urlaubsreise. Das passte gar nicht zu ihm. Fast wäre ich umgekehrt, um den Grund zu erfahren, lief aber weiter.
Am Ende der Straße sah ich zurück. Der Mann, stand immer noch an der gleichen Stelle und schaute mir nach – unheimlich. Komischer Kauz. Ich zog das Tempo an und bog um die Kurve. Schließlich hatte ich schon genug Zeit verloren.
Ich konzentriere mich auf den Asphalt unter meinen Füßen. So kann ich meine Geschwindigkeit am besten wahrnehmen. Schnell verlieren sich meine Gedanken im Nichts. Ungewöhnlich schnell fühle ich mich frei. Kurz sehe ich die Spitze meiner Sneaker, dann wieder Asphalt. Ich konzentriere mich auf meine Fußsohlen, so spüre ich Meter für Meter, der sich unter ihnen wegbewegt. Alles um mich herum verschwimmt und wird eins mit meinem Körper. Obwohl der Weg ganz eben ist, kann ich kaum atmen. Tief aus meinen Lungen, ziehe ich die letzten Sauerstoffreserven. Ich beginne zu röcheln. Mein Atem wird hektisch. Ich werde schwächer. Alles wird schwarz.
Plötzlich ein Ruck. Neue Luft strömt durch meinen Körper. Wind bläst durch meine Haare. Ich spüre ihn, bis in die Haarwurzeln. Überall kann ich ihn fühlen. Es ist ein schönes Gefühl. Licht blendet mich. Meine Luftröhre ist wieder frei. Dennoch bin ich schwach. Wie lange habe ich nicht geatmet? Um ein Haar zu lange. Die Frau – sieht mich an. Sie weint – genau wie ich. Der Asphalt unter meinen Sneakern verschwindet – Sand. Ich bin am Strand angekommen, werde langsamer. Ich atme schwer und tief ein – brauche Sauerstoff. Ich bin schneller gelaufen, als gedacht.
»Bro, wo bleibst du denn so lang?«, rief mir Marcel von Weitem entgegen. Lea und Dennis, ein anderer Junge aus unserer Klasse, waren auch schon da. Ich ließ mich erschöpft in den Sand fallen.
»Scheiße ist das warm heute«, sagte ich nach Luft schnappend. Mit einem gezielten Wurf landeten meine Schuhe direkt neben Marcels Kopf. Gleichzeitig zog ich das T-Shirt aus. »Sorry, dass ich so spät dran bin, aber mir ist gerade was echt Komisches passiert.«
Marcel sprang auf. »Ich lach nachher drüber, erst gehen wir uns abkühlen. Der Letzte ist ein Muttersöhnchen«, rief er und rannte los.
Hastig entledigte ich mich meiner Shorts und fegte hinter den anderen her. Ich war kein schlechter Läufer, deshalb schaffte ich es, zumindest Dennis zu überholen. Marcel war noch nicht wieder aufgetaucht, als ich neben ihm in die Wellen hüpfte und ihn unter Wasser festhielt. Er hatte nicht damit gerechnet, entsprechend schnell ging ihm die Luft aus. Wild zappelnd versuchte er mich abzuschütteln. Lachend ließ ich los.
»Du bist tot, Bro!«, sagte er vergnügt, als er sich wieder einigermaßen erholt hatte. Er wollte sich auf mich stürzen, griff aber ins Leere. Ich hatte seine Attacke kommen sehen und war unter ihm weggetaucht. So begann eine wilde Jagd durchs Wasser.
Am Ende lagen wir beide abgekämpft in den seichten Wellen und beobachteten das Treiben des Meeres. In Momenten wie diesen liebte ich das Leben. Was konnte es Besseres geben, als mit seinen Freunden, bei dreißig Grad, am Strand rumzuhängen? Ich betrachtete das gleißende Sonnenlicht, das sich im Wasser brach. Es formte die unterschiedlichsten Schatten auf meiner Brust. Ich schloss die Augen und sog die Luft ein. Ich hörte dem Rauschen der Wellen zu, genoss das regelmäßige auf und ab der Brandung und roch das Salz des Wassers. Zusammen mit dem Duft der Bäume und dem Geruch des Sandes ergab sich eine Mischung, die ich überall auf der Welt wiedererkennen würde.
IN GEDANKEN VERSUNKEN, BLICKTE SIE, ENTLANG DER STEINBÖSCHUNG, AUF DIE KLEINE BRÜCKE HINÜBER. DAHINTER LAG EINE WINZIGE BUCHT MIT EINEM SANDSTRAND. SIE SAß OFT HIER. DIE BRANDUNG ZU BEOBACHTEN ENTSPANNTE UND BERUHIGTE SIE. AUCH WENN AN MANCHEN TAGEN DIE GISCHT SO STARK WAR, DASS SIE BIS HINAUF AUF DIE TERRASSE DES CAFÉS SPRITZTE. SIE FÜHLTE SICH DANN BEINAHE WIE AUF DIESER GEFÄNGNISINSEL IM PAZIFIK, IN DER BUCHT VOR SAN FRANCISCO. SIE WAR NIE DORT GEWESEN, ABER SO MUSSTE ES DA SEIN.
SEIT DREIZEHN JAHREN WAR SIE GEFANGEN. GEPEINIGTE IHRER ERINNERUNGEN. ERINNERUNGEN AN IHREN SOHN. WARUM HATTE ER STERBEN MÜSSEN? NIEMALS HÄTTE SIE IHM DIESES SPIELZEUG AUF DIE DECKE LEGEN DÜRFEN. ER WAR DOCH NOCH VIEL ZU KLEIN DAFÜR. SIE HÄTTE ES VERHINDERN KÖNNEN. DIE TÜR IHRES GEFÄNGNISSES WAR ZUGEFALLEN, ALS DIE ÄRZTE GESAGT HATTEN, DASS ES ZU SPÄT GEWESEN WAR. SIE WAR GEFANGEN IN IHRER SCHULD. SIE HATTE ES NICHT GESCHAFFT, IHREN SOHN NOCH EINMAL ANZUSEHEN. »DU HAST MICH IM STICH GELASSEN«, HÄTTE ER GESAGT. SIE WAR EINFACH WEGGEGANGEN. KEINE ZEICHEN. WAS HÄTTE SIE IHREM MANN AUCH SAGEN SOLLEN? SIE KONNTE IHM NICHT MEHR IN DIE AUGEN SEHEN. WEIT WEG WOLLTE SIE SEIN, WO SIE NICHTS DARAN ERINNERN WÜRDE.
EIN TOLLER JUNGE HÄTTE ER WERDEN KÖNNEN. EINE GUTE ZUKUNFT HÄTTE ER GEHABT. SIE HATTE IHM ALLES GENOMMEN. SIE WÜRDE ES NIEMALS VERGESSEN. IN DER ERSTEN ZEIT HATTE SIE DARAN GEDACHT, SCHLUSS ZU MACHEN, SICH SCHLIEßLICH FÜR DIE GRÖßERE STRAFE ENTSCHIEDEN. SIE LEBTE MIT IHREM VERGEHEN. ES AUSZUHALTEN WAR DIE BÜRDE, DIE SIE TRAGEN MUSSTE. SIE KONNTE ES NICHT MEHR GUT MACHEN. DAS WAR DIE EINZIGE MÖGLICHKEIT DER BUßE. DARUM WAR SIE HIERGEBLIEBEN.
SEIT EINIGER ZEIT HATTE SIE DAS GEFÜHL, DASS DARAN ETWAS NICHT STIMMTE. ETWAS HATTE SICH VERÄNDERT. SIE WUSSTE NICHT WAS. IHR BLICK WAR NOCH IMMER AN DER STELLE HÄNGEN GEBLIEBEN, HINTER DER DIE KLEINE BUCHT BEGANN. SIE WAR NIE DORT GEWESEN. DENNOCH ZOG ES SIE MAGISCH AN. MANCHMAL, WENN SIE HINÜBER SAH, LIEF IHR EIN SCHAUER ÜBER DEN RÜCKEN – SO WIE JETZT.
Kälte kroch mir in den Körper. Langsam breitete sie sich aus. Über die Zehen, meine Füße die Beine hinauf. Es schüttelte mich, zurück in die Wirklichkeit. Noch immer lag ich neben Marcel in den Wellen und noch immer brannte die Sonne heiß auf uns herunter.
»Bro, was war das denn?«, sah mich Marcel irritiert an.
»Keine Ahnung«, sagte ich wahrheitsgemäß. »Hat mich irgendwie geschüttelt.«
»Wolltest mir erzählen, was dir Komisches passiert ist«, erinnerte er sich.
Ich schlug die Augen auf und drehte mich zu ihm.
»Stimmt, hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich wollte vorher gerade weg, als so einen Typ vorm Haus aus einem Taxi gestiegen ist. Hat mich gefragt, ob da die Belliers wohnen.«
»Und?«, sah er mich gespannt an, als würde er auf die Pointe warten. »Ist doch nix Ungewöhnliches.«
Ich blickte ihn fordernd an. »Überleg doch mal. Das Taxi hält direkt vor unserer Haustür. Wer wird dem Fahrer wohl gesagt haben, wo er hinfahren soll?«
Manchmal war Marcel etwas langsamer mit den Gedanken und so dauerte es einen Moment, bis er zu nicken begann.
»Stimmt auch wieder. Vielleicht war er sich wegen der Adresse nicht sicher«, schlug er vor.
»Ja und da spricht er besser einen wildfremden Jungen an, als einfach auf die Klingel zu schauen«, sagte ich verächtlich.
»Du kamst halt grade aus der Haustür«, stellte Marcel nüchtern fest, ohne auf meinen Unterton einzugehen.
»Keine Ahnung«, zuckte ich mit den Schultern. »Jedenfalls hatte er einen komischen Akzent. Sprach ziemlich gut Französisch, aber er war Ausländer. Hat sich ziemlich nach nem Deutschen angehört.«
»Deutscher?«, war Marcel überrascht. »Was will so einer denn von euch?« Verachtung spiegelte sich in seiner Stimme wider.
»Ich sag ja, keine Ahnung. Gekannt hab ich ihn jedenfalls nicht. Er hat mich noch gefragt, wie ich heißen würde und mir ewig hinterhergeschaut.«
»Vielleicht fand er dich süß. Aber er hat mich noch nicht gesehen«, grinste Marcel und streifte sich eitel mit der Hand durch das Haar.
»Blödmann«, lachte ich. »Nein, aber mal im Ernst, wenn ich drüber nachdenke, würde es mich schon interessieren. Du kennst meinen Vater! Zwei Tage, bevor wir in den Urlaub fahren, würde er doch keinen Besuch einladen. Genau genommen hatten wir noch nie Besuch. Noch dazu aus Deutschland!«
»Vielleicht ein Geschäftspartner von deinem Dad«, mutmaßte Marcel.
»Das glaub ich nicht. Soviel ich weiß, arbeitet seine Firma weder mit deutschen Geschäftspartnern, noch hat er jemals geschäftlich jemanden nach Hause eingeladen.«
»Komm schon, verdirb dir nicht den Tag mit so was«, ließ sich Marcel zurück ins Wasser sinken. Er schloss die Augen.
»Hast ja recht«, antwortete ich und legte mich ebenfalls zurück. Diesmal genoss ich nicht das Gefühl des frischen Meerwassers auf meinem Bauch, sondern war in Gedanken ganz woanders. Seit ich mich erinnern konnte, hatten wir nie Besuch bekommen. Es hört sich verrückt an, aber es ist wahr. Nie hatte er irgendwelche Freunde oder Bekannte eingeladen. Selten, dass er selbst einmal ausging.
»Und ich sage dir, da ist was faul. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche«, sagte ich nach einer Weile hartnäckig.
»Bro, kannst du mal wieder von was anderem reden? Dachte, wir sind hier um Spaß zu haben«, erwiderte Marcel leicht genervt.
»Supertoll«, sprang ich auf. »Scheißegal, was mich bedrückt, oder? Hauptsache, du hast deinen Spaß!«
»Beruhig dich halt, sei doch nicht gleich sauer«, sagte Marcel, erschrocken.
Ich beruhigte mich nicht.
»Denke schon, dass du meinst was du sagst«, ging ich wütend zurück, packte mein Handtuch und mit einem kurzen »Salut«, war ich auch schon unterwegs zur Straße.
»Jean, jetzt warte mal«, hörte ich Marcel hinter mir herrufen.
Ich tat, als würde ich ihn nicht hören und lief trotzig weiter. Kurze Zeit später spürte ich, wie er mich an der Schulter packte. Ein Schmerz erinnerte mich an den Aufprall gegen die Haustür.
»Jetzt krieg dich halt wieder ein. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Es war nicht so gemeint. Entschuldige bitte!«
»Ach ja? Du solltest in Zukunft vielleicht sagen, was du meinst, dann ist es leichter zu verstehen«, blaffte ich zurück.
Ich entriss mich seiner Umklammerung. Sicher würde er einen zweiten Versuch starten, mich zu beruhigen. Diesmal würde ich nachgeben. So schlimm war es wirklich nicht gewesen. Erneut packte mich Marcel bei der Schulter, nun jedoch so hart, dass mir Tränen in die Augen schossen.
»Du wirst hierbleiben. Wir werden einen schönen Nachmittag verbringen und ich werde mich nicht weiter bei dir entschuldigen, weil ich nichts Schlimmes getan habe. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, mir jedes Mal ein schlechtes Gewissen zu machen, nur weil du leicht erregbar bist. Ich bin dein Freund, lern das endlich!«
Ich starrte ihn an. Das war nun nicht die Art von Entschuldigung, die ich erwartet hatte. Aber noch während er redete, wusste ich, dass er recht hatte.
»Blöder Scheißkerl«, sagte ich zu ihm. Unweigerlich musste ich grinsen. »Dass du auch immer alles so auf den Punkt bringen musst.«
Marcel lächelte zurück. »Na also«, legte er seinen Arm um meine Schulter. »Lass uns zurückgehen.«
»Okay«, sagte ich, während wir uns in Bewegung setzten. »Aber könntest du den anderen erzählen, dass du mich auf Knien gebeten hast hierzubleiben?«
»Vergiss es, Bro«, lachte Marcel. »Ich werde ihnen erzählen, dass ich dir die Meinung gesagt habe und du eingesehen hast, dass du im Unrecht warst.«
»Wirst du nicht«, erwiderte ich und hob drohend den Zeigefinger.
»Wer will mich denn daran hindern?«, hob Marcel die Augenbrauen.
»Wirst du schon sehen.« Ehe er sich versah, hatte ich ihn zu Boden geworfen. Blitzschnell saß ich auf ihm, drückte seine Arme nach hinten und kniete auf seine Oberarme. Er hatte keine Chance, mich abzuschütteln. »Sag: Lieber Jean, ich bitte dich vielmals um Entschuldigung.« Marcel gab Geräusche von sich, die irgendwo zwischen jammern und kichern lagen. »Dir wird das Lachen schon noch vergehen«, drückte ich meine Knie noch fester auf seine Muskeln.
»Du tust mir weh«, kam es, wieder teils kichernd, teils schluchzend zurück.
»Was kann ich denn dafür, wenn du nervst …«, der Rest des Satzes ging in einem Aufschrei unter. Ich hatte mit meinem Knie empfindlich in seine Muskeln gedrückt. Natürlich war es Spaß, trotzdem musste es weh tun.
»Sag: Entschuldige bitte, zu mir«, forderte ich ihn erneut auf.
»Entschuldige bitte zu mir«, sagte Marcel grinsend und ich ließ mich lachend zur Seite rollen. Ich war froh, dass er mich nicht hatte gehen lassen. Nicht auszudenken, wenn ich auch noch Streit mit meinem besten Freund bekommen hätte. Als wir zu unserem Platz zurückkamen, waren die anderen verschwunden. Vermutlich ins Wasser.
»Mann, ist das ein Tag«, schwärmte Marcel, während er sich auf seine Decke fallen ließ.
»Stimmt, endlich keine Schule mehr«, bestätigte ich.
»Danke übrigens nochmals für deine Unterstützung in Mathe«, meinte Marcel. Ich hatte das Gefühl, dass er mich bewundernd ansah. »Ohne dich hätte ich es nicht geschafft dieses Jahr«, fügte er hinzu.
»Ach was«, winkte ich ab. »Das hab ich doch nicht für dich getan. Ich will mir gar nicht ausmalen, wenn du nicht mehr in meiner Klasse wärst.«
Marcel schmunzelte. »Schon klar. Trotzdem, du warst mir echt ne große Hilfe. Was wollen wir denn heute noch machen?«
Ich antwortete nicht gleich.
»Wie wär’s wenn wir später zurückkommen und uns einfach bis in die Nacht hier hinflaggen? Wir bringen etwas Verpflegung mit und chillen ne Runde.«
»Cool«, meinte Marcel verblüfft. »Das kommt ohnehin viel zu kurz, die nächsten Wochen. Wär mir aber nicht so sicher, dass dein Dad da mitspielt.«
»Ich denke mal, ich werde ihn nicht fragen«, feixte ich.
»Hast den Rebellen in dir geweckt, oder wie?«, grinste Marcel. »Okay, abgemacht. Dann treffen wir uns um neun wieder hier und wenn du einknickst, überleg ich mir was für dich«, sagte er mit gespielt, bedrohlichen Gesichtsausdruck.
»Yes Sir, Bro Sir«, sagte ich lachend.
3
Wie so oft, hatte Marcel den Umweg über meine Straße, in Kauf genommen.
»Ich hol dich in drei Stunden wieder ab«, meinte er kurz, gab mir einen Faustcheck und trottete weiter. Ich freute mich darauf, mit Marcel zum Strand zurückzukehren, um die laue Sommernacht zu genießen. Davon würde mich nichts auf der Welt abhalten.
»Wie versprochen«, rief ich hinterher.
Während ich das Treppenhaus zu unserer Wohnung hinaufstieg, kam der Gedanke an den Fremden von heute Mittag zurück. Nach der Auseinandersetzung mit Marcel hatte ich ihn ganz vergessen. Vorsichtig schloss ich die Tür auf und ließ sie hinter mir leise wieder zufallen.
Die Wohnzimmertür war geschlossen.
Ich hörte Stimmen, konnte aber nicht verstehen, was gesprochen wurde. Sicher war es nicht die feine Art, in meiner eigenen Wohnung zu lauschen, aber ich wollte wissen, wer der Typ war. Wenn es sich um einen Geschäftsfreund meines Vaters handelte, würde ich in mein Zimmer verschwinden. Auf meinen Dad hatte ich heute eh keinen Bock mehr. Ich schlich ins Esszimmer. Dort gab es eine Schiebetür mit einem Spalt, durch den man unauffällig ins Wohnzimmer schauen konnte. Hier war ich in meinem Leben schon oft gesessen. Früher hatte ich durch den Schlitz manchmal noch etwas ferngesehen. Einmal hatte ich die halbe Nacht nicht schlafen können, weil ich einen spannenden Thriller mit angeschaut hatte. Deutlich sah ich Vater und den Fremden beieinander sitzen. So nah an der Tür, konnte ich jedes Wort verstehen.
»Ich kann nicht länger warten«, hörte ich den Fremden sagen.
War es doch ein Geschäftspartner?
»Was wirst du jetzt tun?«, fragte mein Vater voller Zurückhaltung.
»Ich habe dir gesagt, dass ich nichts unternehmen werde. Ich fahre zurück nach München«, antwortete der Unbekannte resigniert, schon fast traurig.
Mit einer Sache hatte ich richtig gelegen. Er war Deutscher. Mein Vater kannte ihn wohl besser als gedacht. Es gab nicht viele Menschen, die ›du‹ zu ihm sagen durften. Der Mann wandte sich ab, um zu gehen, auch ich wollte mich schon in mein Zimmer zurückziehen.
»Er ist ja ohnehin, ganz offiziell, mein leiblicher Sohn.«
Dad sprach den Satz mit einer Genugtuung, als wäre er ihm bereits die ganze Zeit auf der Zunge gelegen. Nun, da er ihn ausgesprochen hatte, merkte er, dass es ein Fehler gewesen war. Augenblicklich fuhr der Fremde herum. Seine Augen hatten sich zu Schlitzen verengt.
»Ein DNA-Test würde die Wahrheit wohl schnell ans Licht bringen«, sagte dieser scharf. »Ich finde es ein starkes Stück, dass ausgerechnet du in meiner Gegenwart von deinem leiblichen Sohn sprichst.«
Ich war auf die Reaktion meines Ernährers gespannt. So ließ er sicher nicht mit sich reden. Niemand sprach so mit ihm.
»Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht«, hörte ich Vater sagen und konnte kaum glauben, wie kleinlaut er war. »Aber es ist nun zu spät, es wäre nicht richtig ihn aus seiner gewohnten Umgebung zu reißen«, beschwichtigte er seinen Gast, hörte sich dabei aber nicht sehr selbstbewusst an.
Was ging da vor zwischen den beiden?
»Ein Fehler?«, lachte der Deutsche höhnisch. »Ein Verbrechen ist wohl die bessere Formulierung. Ich kann dir sagen, was richtig wäre. Wenn er immer noch auf den Namen hören würde, den ich mit meiner Frau für ihn ausgesucht hatte, er in München wohnen würde und seine Mutter noch bei uns wäre. Der Himmel weiß, was sie sich angetan hat.«
Der Fremde nahm die Hände vors Gesicht. Ich verstand kein Wort von dem, was er sagte. Es verwirrte mich und langsam bekam ich das Gefühl, meinem Vater zur Seite stehen zu müssen. Es war nicht richtig, dass er in seinen eigenen vier Wänden in die Enge getrieben wurde. Irgendetwas hielt mich zurück. Nachdem sich Dad wieder gefasst hatte, erklang erneut seine Stimme. Sie zitterte. So hatte ich ihn noch nie erlebt.
»Jean hat ein gutes Zuhause. Du hast dich dreizehn Jahre nicht um ihn gekümmert. Etwas spät, um Ansprüche zu stellen«, sagte Vater angriffslustig.
Paff, das hatte gesessen. Wie ein Faustschlag hallte mein Name in meinem Kopf. Was war ich für ein Idiot! Natürlich ging es um mich. Der Mann war wegen mir nach Frankreich gekommen. Deshalb hatte er mir hinterher gesehen und gefragt, wie ich heiße.
»Komm schon«, sagte der Fremde aufgebracht. »Wem willst du hier etwas vor machen? Du weißt genau, dass ich die ganzen Jahre nicht gewusst habe, wo Alex steckt. Er ist mein Sohn und ich liebe ihn über alles. Wenn ich vor dreizehn Jahren bereits eine Ahnung von dem hier gehabt hätte, hätte ich ihn schon damals sofort zurückgeholt. In keiner Weise hätte ich unseren Alex im Stich gelassen!«
»Dann geh und mach sein Leben nicht kaputt«, sagte Dad leise aber bestimmt.
Noch nie hatte ich jemanden so mit meinem Vater reden hören. Für jeden, den ich kannte, war er eine Respektsperson, sogar für Marcels Dad. Ich wusste nicht, was ich denken sollte. War ich Alex? Unmöglich. War ich gestohlen worden? Niemals. Vater war unausstehlich, aber doch kein Verbrecher. Was sollte der Fremde sonst für einen Grund haben, hierher zu kommen? Noch dazu war es ein Gespräch, nur unter den beiden. Es gab niemanden, dem er etwas vormachen musste und er hatte auch nicht widersprochen. Auf jeden Fall spürte ich Wut in mir hochkochen. Aber warum? In meinem Kopf war ein einziger Ameisenhaufen. Meine Gedanken liefen auf kleinen Füßchen kreuz und quer durcheinander. Ich hatte keine Chance, sie zur Ordnung zu rufen.
»So, wie du unseres kaputt gemacht hast?«, fragte der Fremde. »Ich habe die ganzen Jahre darunter gelitten, dass Alex vermeintlich gestorben war und meine Frau nicht zurückkehrte, oder was dachtest du, wie es mir ging? Ich werde dennoch verschwinden, weil du in einem Punkt recht hast. Ich möchte Alex’ Leben nicht durcheinanderbringen. Ich gehe nur aus einem einzigen Grund. Dem Jungen zuliebe. Aber Alex ist schlau. Er wird herausfinden, was damals passiert ist. Ich hoffe, du wirst den Preis bezahlen, für das, was du getan hast!«
Vater entgegnete nichts. Es war alles gesagt und ich hatte genug gehört. Rasch schlich ich mich in mein Zimmer. Kurz darauf, hörte ich die Wohnungstür ins Schloss fallen. Ohne dass ich es steuern konnte, trat ich ans Fenster. Es dauerte nicht lange und der Fremde kam aus der Haustür. Während er sein Handy ans Ohr hielt, blieb er stehen. Er sah an der Fassade herauf. Reflexartig zog ich den Vorhang vor mein Gesicht. Mit den Gedanken weit weg, sah ich ihn die Straße auf und ab gehen. Immer wieder hatte ich das Gefühl, dass er verstohlen zu mir heraufblickte. Manchmal blieb er stehen und rieb sich die Augen. Ich dachte, dass er müde von der langen Reise sein musste. Heute weiß ich, dass es Tränen waren, die er wegwischte. Wäre mir das damals klar gewesen, hätte sich die Geschichte vielleicht anders entwickelt. Vielleicht wäre ich sofort nach unten gelaufen, um ihn zurückzuholen. Wenn ich es recht überlege, hätte ich dadurch sogar ein Menschenleben retten können. Na ja, nur wenn man nicht an Schicksal glaubt. Bis zum heutigen Tag bin ich mir nie ganz klar darüber geworden, warum ich ihn damals habe wegfahren lassen. Marcel würde sagen, weil mein Kopf manchmal mehr mit denken beschäftigt ist als mit handeln. Tatsächlich schaute ich wie erstarrt zu ihm hinunter. Es dauerte eine ganze Zeit, bis sein Taxi eintraf. Als er einstieg, verirrte sich sein Blick ein letztes Mal zu mir herauf. Er verzog den Mund zu einem traurigen Lächeln und hob die Hand, als wolle er sich von mir verabschieden. Dann stieg er in den Wagen. Ich schaute ihm nach, bis er nicht mehr zu sehen war. Erst jetzt merkte ich, dass ich ebenfalls die Hand gehoben hatte. Traurig ließ ich sie wieder sinken.
Keine Ahnung, wie lange ich am Fenster gestanden hatte.
»Du bist ja schon zu Hause«, hörte ich die Stimme meines Vaters.
Ich antwortete nicht, als ich mich umdrehte, sondern sah ihm forschend in die Augen.
»Ich habe alles gehört. Wer war der Mann?«, platzte es aus mir heraus. Warum sollte ich meine Gedanken quälen, wenn ich alles von ihm direkt erfahren konnte. Zögernd kam er herein und setzte sich aufs Bett.
»Dein Onkel«, sagte er ernst. Ich konnte keine Anzeichen entdecken, die mir verrieten, ob er es mit einer Notlüge versuchte oder mir die Wahrheit erzählte.
»Er ist der Bruder deiner verstorbenen Mutter«, sagte er ernst. »Als du geboren wurdest, war seine Frau, mit ihrem ebenfalls gerade geborenen Sohn, bei uns zu Besuch«, sprach er weiter. Ich musterte ihn scharf dabei. »Es gab einen tragischen Unfall. Ihr Sohn verstarb, noch während ihres Aufenthaltes hier.«
»Aber er hat gesagt, ich wäre sein Sohn!«
Vater nickte. »Das behauptet er auf einmal. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist nach so langer Zeit.«
Ich sah ihn bestimmt an. »Du hast ihm nicht widersprochen, als er das behauptet hat.«
Er lächelte. »Er hat aus gutem Grund versprochen nichts zu unternehmen. Es war nicht nötig, sich mit ihm zu streiten!«
Ich war noch immer misstrauisch.
Er stand auf und streifte mir sanft lächelnd über die Stirn, »mach dir keine Sorgen, er wird uns nicht weiter belästigen.«
»Dad«, sagte ich, noch bevor er die Tür erreicht hatte. »Du würdest mich nicht anlügen, oder?«
Er schüttelte lächelnd den Kopf und ging hinaus.
Ich war verzweifelt. War das die Erklärung, warum sich mein Vater so wenig für mich interessierte? War der Besuch die Erklärung, warum mein Kampf von meinem Vater akzeptiert und geliebt zu werden von vornherein verloren gewesen war? Oder war es tatsächlich der crazy Onkel aus Deutschland? Es hatte alles so echt geklungen, was der Mann gesagt hatte. Warum sollte er einfach wieder gehen, wenn er verrückt genug war, extra nach Frankreich zu kommen, um mich zu sehen? Warum war Dad im Gespräch darauf eingegangen, dass der Fremde mein Vater war? Wollte er ihn wirklich nur nicht reizen, oder hatte er mich dreist belogen? Durfte ich überhaupt daran zweifeln, was er sagte? Er war mein Dad. Auch wenn ich oft wütend auf ihn war, ich vertraute ihm … eigentlich. Ich musste mit jemandem darüber reden und war froh, dass ich mein Handy hatte.
[Besuch ist grade gegangen], schrieb ich, um zu sehen, ob Marcel antwortete.
[und?], kam sofort zurück. Ich musste lächeln. Sicher war Marcel die ganze Zeit, vor seinem Handy gesessen und hatte gespannt auf eine Neuigkeit gewartet.
[Gar nicht so einfach], begann ich. [Könnte kurz dauern.] Ich schrieb ihm von Anfang an, was ich mit angehört hatte und drückte auf senden. Marcel würde erst einmal beschäftigt sein mit lesen. Ich ging in die Küche, um mir aus dem Kühlschrank etwas zu trinken und den Rest Ragout, vom Mittag zu holen.
»Willst du nicht warten? Es gibt doch bald Abendessen«, tönte es hinter mir. Ich war aber schon wieder auf dem Rückweg, was vermutlich auch besser war.
»Kein Bedarf«, rief ich zurück und verschwand in meinem Zimmer.
[Hältst du es für möglich?], hatte Marcel zurückgeschrieben. Ich überlegte.
[Keine Ahnung. Kann grade nicht klar denken. Schätze, ich muss es erst mal sacken lassen.]
[Das glaub ich. Können ja nachher drüber reden. Steht doch noch mit neun, oder?], erschien gleich die Antwort.
[sicher], schrieb ich zurück. [Muss mich halt raus schleichen. Ist mir aber egal, wenn ich Ärger bekomme.]
[alles klar], meinte Marcel. [Muss aufhören, gibt Essen. Bis nachher.]
[Ja, bis nachher], tippte ich. Am liebsten wäre ich gleich los, aber es war erst sieben. So setzte ich mich auf mein Bett, starrte vor mich hin und stocherte gedankenverloren im Ragout. Irgendwann legte ich mich zurück. Trotz der ernsthaften Gedanken, die mir im Kopf schwirrten, lächelte ich. So konnte ich nachdenken.
Als ich das nächste Mal auf meine Uhr sah, schrak ich hoch. Die Zeiger standen auf fünf nach neun. Ich war eingenickt. Schnell packte ich ein paar Sachen in meinen Rucksack und schlich mich leise aus meinem Zimmer. Mein Herz schlug kräftig, bis ich unten aus dem Haus trat.
»Bro, wo bleibst du denn so ewig«, rief mir Marcel entgegen.
»Entschuldige, Mann«, sagte ich mit ehrlicher Stimme. »Bin eingepennt. War totales Glück, dass ich gerade noch aufgewacht bin.«
Marcel verdrehte die Augen. Er schüttelte grinsend den Kopf. »Da darf er schon mal raus abends und dann knackt er weg.«
»Na ja, ich weiß nicht, ob Dad schon weiß, dass ich noch mal raus darf«, zwinkerte ich ihm zu.
Der Strand war noch ziemlich belebt um diese Uhrzeit. Keine Touristen und überwiegend Jugendliche. Es gab hier nur wenige Autoparkplätze. So war das Ufer für Fremde oder Leute, die weiter entfernt wohnten, nicht interessant. Am Strand angekommen, gingen wir über den Sand zu unserem Stammplatz hinüber. Seit wir ohne Eltern hierher durften, kamen wir immer an die gleiche Stelle und noch nie war der Platz belegt gewesen. Auch diesmal nicht.
»Macht mich echt fertig, dass ich dich heute Nachmittag angeblafft habe, weil dir die Sache mit dem Fremden nicht aus dem Kopf ging. Glaub mir, wenn ich gewusst hätte, dass es so was Ernstes ist, ich hätte niemals so geredet«, entschuldigte sich Marcel, kaum dass wir uns niedergelassen hatten.
»Vergiss es«, unterbrach ich ihn. »Ich hab dir gesagt, dass es vergessen ist. Also brauchst du dir keine Gedanken zu machen.«
Marcel lächelte. »Hast ja recht«, sagte er. »Trotzdem! Aber was meinst du jetzt? War es dein Vater oder wirklich nur dein Onkel?«
Ich antwortete nicht darauf, hatte die Frage aber natürlich gut verstanden. Nur wusste ich keine Antwort. Ich blickte in den dunklen Himmel und lauschte dem Meer.
»Um ehrlich zu sein, hab ich keine Ahnung«, sagte ich nach einer Weile und drehte meinen Kopf in seine Richtung. Er sah mir direkt in die Augen. »Kannst du dir vorstellen, dass man jemanden spüren kann, obwohl man ihn nicht sieht oder gar nicht weiß, ob es ihn überhaupt gibt?«
»Hast du?«, fragte er.
Ich zuckte mit den Schultern. Jetzt war es Marcel, der sich auf den Rücken legte und in den Himmel starrte. So lagen wir eine Weile, als er irgendwann das Gespräch weiterführte.




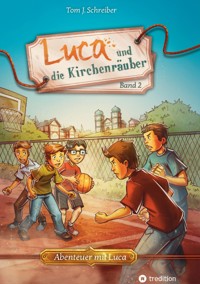














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









