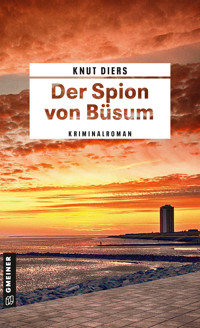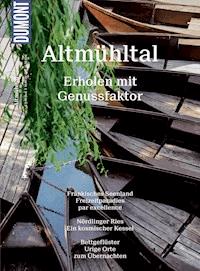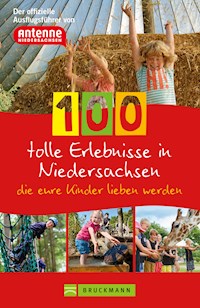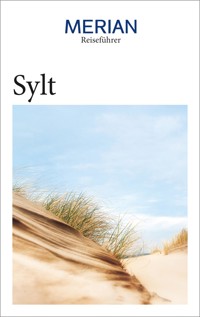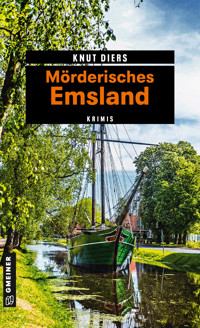Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zwei Städte, zwei Länder - und ein Burgschreiber mittendrin Grüezi und willkommen in Laufenburg - der Stadt, die zweimal existiert. Hier Deutsche, da Schweizer - getrennt durch den Rhein, vereint im Herzen: Laufenburger sind Grenzgänger mit Herz. Reiseschriftsteller Knut Diers ist als Burgschreiber tief in das doppelte Stadtleben eingetaucht. Er entdeckte Menschen, die Brücken bauen, Traditionen, die verbinden, und Augenblicke, die bleiben. Mal heiter, mal nachdenklich, immer mit Herz und einem Schuss Ironie erzählt er von Waldgeistern, Wanderern und Wortliebhabern, von Visionären und Vogelstimmen, von Feuerwehren, Demokratie und Energie. Entstanden ist ein literarischer Grenzgang zwischen Baden und Aargau zum Schmunzeln, Staunen und Wiederkommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Iris.
Ehefrau, Mit-Abenteurerin und kluge Begleiterin – nicht nur beim Wandern durchs Gebirge oder beim Radeln durchs flache Rheintal. Unterstützerin und Kritikerin, die nie um ein ehrliches Wort verlegen ist. Designerin des „Burgschreiber-2025“-T-Shirts und Laden-Zusammenhalterin daheim.
Mit dir gehe ich nicht nur über Brücken zwischen Deutschland und der Schweiz, sondern liebend gerne durchs Leben.
Inhalt
Hallo – Hoi, hoi – Grüezi
1
Auffe Burch
Beim Blick über den Rhein zum Schlössle keimt Sehnsucht auf
2
Über Brücken – überbrücken
Was die Laufenburger so alles verbindet
3
Aussteigen ist gegen die Ehre
Rikschafahren mit dem „Tschätty“ vom Stadtseniorenrat
4
Die Landschaft öffnet sich – immer neu
Fröhliches Stehpaddeln auf dem Rhein bei Laufenburg
5
Alles andere wäre ein R(h)einfall
Laurhy und der (Burgschrei-)Bär sind auf dem Stehpaddelboard unterwegs
6
Von wegen einfach nur „Rum-ta-ta“
Musik-Hochburg? Na klar, Laufenburg!
7
Etwas für Überläufer
Die „Laufenburger Acht“ verknüpft auf sechs Kilometern beide Rheinufer
8
Von Hand und mit Liebe
Schmackhafte Tradition auf beiden Seiten: Bäckerei Hahn und die Schoggi-Werkstatt
9
Die Sprache der Metalle
Erwin Rehmann – Künstler, Handwerker und Wohltäter
10
„Das Holz findet mich“ – Zeitreisen mit einem Löffel
Im Atelier von Roland Köpfer
11
Zwei Hydrantenschlüssel – eine Atemluft
Zu Besuch bei den beiden Feuerwehren
12
Oh je – der Bürgermeister in Handschellen
Fasnacht vereint: Tradition seit 1386
13
Wo ist der süßeste Löwe?
Auf Safari zwischen Pflastersteinen und Pralinés
14
Wo sogar der Flachmann ein Mänteli kriegt
Sulz: in der KulturWerk-Stadt
15
Wie hoch ist die Sprachbarriere am Rhein?
Was Dialekte und Identität bedeuten
16
Mehr Demokratie wagen
Bürgermeister in Deutschland – Stadtammann in der Schweiz
17
Von Osterhasen, schmutziger Wäsche und Lachsen
Die Brunnen und der Stollen unter der Altstadt
18
Geld und gute Orte
Vom Einkaufen bis zum Essengehen dies- und jenseits der Grenze
19
Die neue Speicherstadt
Europas größte Batterie und Nabel der Künstlichen Intelligenz
20
Ewig hält am längsten
Im Repair-Café der Rappensteinhalle – wie viele Geräte lassen sich heilen?
21
Zug um Zug
Die drei Bahnhofsgebäude von Laufenburg – drei Hausgeschichten
22
Doppelstockbetten unter der Schule
Zivilschutz in der Schweiz top – und in Deutschland?
23
Hoi, hoi, Heuberg
Ein überraschend vielfältiges Naturstück – mit Sauriern?
24
Was der Dinkelberg mit der Bachhöhle macht
Wandern mit dem Schwarzwaldverein – Routentipps vom Wegewart
25
Vom Winde verwehte Wolken
Der Cheisacherturm bei Sulz – ein lohnendes Ziel für Fern- und Nahblickende
26
Importiertes Löwengebrüll
Vogelstimmen und Anekdoten von Urs Heinz Aerni aus Zürich
27
Bettgeschichten
Vier Gastgeber – vier Episoden
Dank
Vita
Der Autor und Burgschreiber als Rikschafahrer.
Hallo Hoi, hoi Grüezi
Zwischen Basel und Bodensee, zwischen Zürich und dem Feldberg liegt Laufenburg – ein kleines Städtchen am Rhein. Denkste! Weil es so schön und besonders ist, gibt es Laufenburg gleich zweimal: eines im Badischen, also rechtsrheinisch auf deutscher Seite, und eines im Schweizer Kanton Aargau, also linksrheinisch. Sie waren einmal eins, getrennt hat sie Napoleon. Das war 1802. Doch wer weiß das schon – und warum ist das wichtig?
Mit viel Natur drumherum, Rad- und Wanderwegen ist Laufenburg ein Ausflugsziel erster Güte. Das haben andere auch. Aber: Mit erstaunlich viel Kultur – von der ältesten Fasnacht am Rhein über klassische Konzerte bis zu Poetry Slam in der Kultschüür – bietet Laufenburg beste Unterhaltung. Und: Wegen der hohen Lebensqualität ziehen viele bewusst in eines der beiden Städtchen.
Das eigentlich Unglaubliche ist jedoch, wie selbstverständlich hier das Gemeinsame gepflegt und gelebt wird. Grenzenlos im besten Sinn: Das sind die vielen Freundschaften, das ist das „Ziehen an einem Strang“ – vom Künstler über den Feuerwehrmann bis zum Stadtoberhaupt. Immerhin ist die Schweiz aus deutscher Sicht EU-Ausland – und umgekehrt. Der Slogan „zwei Länder – eine Stadt“ klingt nett. Doch er ist nicht nur ein Werbespruch, sondern wird hier täglich gelebt. Liebes Europa, du könntest dir davon ruhig eine Scheibe abschneiden – und sie vielen anderen Grenzorten einfach als Anregung vorhalten.
Daher war es für mich als Reiseschriftsteller aus dem Norden Deutschlands eine Ehre, drei Monate lang als Burgschreiber mittendrin sein zu dürfen. Die Menschen waren so wunderbar warmherzig und offen – auf beiden Rheinseiten. Was ich erlebte, reicht von rührend bis skurril. Eine Auswahl:
Ich legte eine Prüfung als Rikscha-Fahrer ab und kutschierte Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind, auf der rollenden Sitzbank kreuz und quer durch Stadt und Landschaft – sehr unterhaltsam.
Ich übernahm gelegentlich die Aufgabe, zwei Hasen im Garten vor Sonnenuntergang mit Futter in ihren Stall zu locken, damit sie nachts nicht vom gefräßigen Marder Besuch bekommen.
Die Zuneigung eines blinden Hundes bei meinen Gastgebern war grandios.
Lange vor meiner Anreise erreichte mich eine E-Mail aus Kolumbien: Wir würden uns ja bald in Laufenburg sehen, und ob ich die Einführung bei einer Vernissage übernehmen könne. Konnte ich.
Intensive Workshops mit einer 7. und 9. Klasse (eine auf Schweizer, eine auf deutscher Seite) machten mir unerwartet viel Freude. Wir gingen auf Zeitreise, die Schülerinnen und Schüler schrieben, was sie in zehn Jahren täten. Ein anderes Mal interviewten sie mich gekonnt zu meinem Schriftstellerleben.
Dann baute ich mit einem meiner Gastgeber in seiner Heimwerkstatt aus einem Buch eine Bettlampe – was für eine leuchtende Erinnerung an Laufenburger Nächte.
So sind literarische Miniaturen entstanden: Geschichten vom Repair-Café bis zur Löwensafari, von politischen Versammlungen hüben und drüben, von Straßenrand-Beobachtungen und persönlichen Begegnungen, die alle auf ihre Weise im Kleinen das Große spiegeln. Vielleicht ist das der Reiz: Mein Blick als Nordlicht von außen vermischte sich mit dem Blick von innen – wie zwei Flüsse, die ineinanderfließen.
Dabei wirft Laufenburg Fragen auf, die weit über die Region hinaus spannend sind: Was eint, was trennt? Was erschaffen Künstler als bleibende Denkanstöße – ob mit Skulpturen, bei Poetry-Slams oder in Mundart-Liedern? Und wie wirkt diese Stadt vom Fluss aus betrachtet? Als Stehpaddler war ich gern mit meinem Board auf dem Rhein unterwegs. Einmal sogar mit Laurhy, dem Maskottchen von Laufenburg – unser kleiner Dialog ist nicht nur für Kinder erstaunlich tiefgründig.
Und dann die Zukunft: Hier steht Großes bevor. Auf Schweizer Seite wird der größte Batteriespeicher Europas gebaut. Im „Oberstübchen“ entsteht ein Zentrum für Künstliche Intelligenz. Das ist tatsächlich so „spannend“ wie der „Stern von Laufenburg“. Schon seit mehr als 100 Jahren ist das der größte Stromverteiler in Europa – ausgehend vom Wasserkraftwerk im Rhein. Heute wird von hier die Stromversorgung von Portugal bis zur Ukraine geregelt. Mit der ältesten Fasnacht am Rhein, den Osterbrunnen und Löwenstatuen bleibt zugleich die Tradition lebendig.
So, nun ist aber Zeit, den Rucksack aufzusetzen. „Hoi, hoi, Heuberg“, rufe ich. Kommen Sie mit!
Laufenburg ist doppeltes Erleben – viel Freude dabei.
Knut Diers
Die Burgruine von Laufenburg gewährt besten Rundumblick.
1
Auffe Burch
Beim Blick über den Rhein zum Schlössle keimt Sehnsucht auf
Täglich diese vielen Gäste. Von 6 bis 20 Uhr ist „meine“ Burg geöffnet. Und alle wollen hoch, gucken, staunen, fotografieren. Als Burgschreiber brauche ich aber doch Ruhe. Gut, die meisten sind ja nett und grüßen, manche sogar ehrfürchtig, als ob ich hier oben noch in Rüstung lebte. Kettenhemd und so, nein, das mag ich nicht.
Es ist nur noch eine Ruine, in der ich wohne. Zum Glück: Wenigstens nachts habe ich Ruhe. Da kommt niemand. So kann ich meine vielen Gedanken, die ich über die beiden Laufenburgs, die Habsburger – das sind schließlich meine Burgherren (gewesen?) – und die heutigen beiden Städtchen mache, niederschreiben.
Dabei ist es eher zum Niederknien, wie freundlich und fröhlich hier alle sind. Und das nicht nur zur Fasnacht! Laufenburgerinnen und Laufenburger haben das Herz am rechten Fleck, wie man so sagt. Doch befindet sich das Herz bei den meisten Menschen links. Aber nun gut.
Also sitze ich auf meiner Burg in Laufenburg (Schweiz) und schaue hinab. Dass ich hier oft sitze, ist schon wahr, aber dass ich hier wohne, entstammt der Fantasie eines Burgschreibers, der dieses Wort zu wörtlich nimmt. Gastgeber habe ich unten in den beiden Laufenburgs, und da wohne ich auch.
Im Spital läuft alles am Schnürchen
Also, was sehe ich? Rechts das Spital. Es hat diese Kastenform, ähnelt eher einem viel zu großen, vieläugigen Würfel, der vergeblich versucht, sich zwischen Bäumen zu verstecken. Viele Fenster, alle gleich, als hätte ein besonders pedantischer Fensterbauer hier seine Meisterprüfung gemacht. Postkartenansichten meiden soweit möglich diese Perspektive mit dem Spital.
Doch hat der Würfel innere Werte. Ich weiß das, weil wir neulich mal reinmussten – Abteilung Notfall. Meine Frau war mit dem rechten Fuß dramatisch umgeknickt. So ein Umknicken, das in Zeitlupe passiert, während man noch denkt: „Das geht bestimmt gut aus“ – und gleichzeitig weiß: „Nein, tut es nicht.“
Sie rief an, sprach mit dem Arzt, und als wir kamen, lag sie keine zwei Minuten später bequem auf einer Liege im Vierbettzimmer statt in einem Wartezimmer, in dem immer einer hustet, einer stöhnt und einer in sein Handy flüstert, als wäre er beim Geheimdienst. (Es gibt übrigens zwei Arten von Menschen im Wartezimmer: Die, die stumm in ein Magazin von 2013 starren – und die, die ihr ganzes Krankheitsarchiv in voller Lautstärke telefonisch durchgehen.) Freundlich waren sie, die Menschen im Spital. Sehr freundlich. In Deutschland – ach, lassen wir den Satz lieber unvollendet. Ein Schweizer, der weit nach meiner Frau das Nachbarbett bekam, nörgelte nach kurzer Zeit, dass er nun schon ewig warten würde. Geduldig erklärte die Pflegefachfrau, dass Notfälle hereingekommen seien, von denen er hier nichts mitbekommen würde. Wir schüttelten nur den Kopf. Der müsste mal nach Deutschland. Ja, ja. Am Abend rief der Arzt sogar noch mal an. Fragte nach, gab Tipps, stellte sogar die Röntgenbilder per QR-Code zur Verfügung. Wo sonst gibt es das? Ich sag’s ja.
Blicke ich nach Süden, sehe ich den roten Bahnhof und das hübsche Schulhaus Bergmatt. Die 200.000 Gulden Entschädigung von 1907, die das neue Wasserkraft-Elektrizitätswerk gezahlt hat, sind hier in die Ausbildung investiert worden. Auf deutscher Seite floss das Geld einfach ins Stadtsäckle. Von Bildung stand da nichts. Außerdem dient das Schulhaus heute unten herum noch für den Zivilschutz im Kriegsfall. Auf deutscher Seite hingegen: nichts dergleichen.
Kaffee, Brezeln, Apéro und etwas Weltgeschichte
Dann ist das Café Maier zu sehen. Es hat eine lange Tradition und inzwischen zehn Filialen in der Region. Als Familienbetrieb wurde es schon 1898 gegründet. Es machte von sich reden, weil die Brezeln nicht nur schmackhaft waren, sondern auch einige Zeit hielten. Diese Brezeln überstehen Tage, notfalls auch Wochen – wie gute Tiefkühlkost. Und weil solche Unternehmer-Originale, wie man sie heute nennt, das Geschäft durch große Taten voranbrachten, war das auch bei Familie Maier so.
Sie kaufte auf der Weltausstellung in Paris die erste elektrische Knetmaschine. Das war im Jahr 1900. Dann 1935 – erster Dampfbackofen, der mit Kohle befeuert wurde. Heute kommt der Strom für die Backstube vom Fotovoltaik-Dach, eine Hochdruck-Wasserstrahlschneidemaschine ist im Einsatz und es gibt 200 Mitarbeiter.
Für den Burgschreiber ist die Nähe zu Konditorei, Confisserie, Sonntagsbrunch und Mittagsmenü in der Baslerstrasse 1 natürlich fast überlebenswichtig. Vielleicht nehme ich demnächst mal ihren Apéro- und Cateringservice in Anspruch – bei den vielen Gästen täglich auf meiner Burg. Aber dann bleiben die ja noch länger ...
Türme, Glocken und ein alter Gerichtssaal
Jetzt schauen wir mal zum Nachbarturm, dem Wasenturm und daneben dem Wasentürmchen. Wasen ist ein altes Wort für „Grünland, feuchter Boden“. Vom ersten Turm, schon seit 1270 in Betrieb, schlägt zur vollen Stunde die helle Glocke so oft, wie es die Uhrzeit vorgibt. Der hübsche Turm mit der runden Durchfahrt wäre auch ein möglicher Sitz für mich gewesen, aber natürlich erst nach 1985. Denn bis dahin war ein Teil des Inneren ab 1901 das Bezirksgefängnis. Da wohnt man ja nicht freiwillig. Ich habe mir das mal angesehen: Karge Pritschen, Wandsprüche, die nicht Goethe geschrieben hat, und Foltereisen.
Das Wasentürmchen, ebenfalls 1270 errichtet, war Teil der ersten westlichen Stadtmauer. Oben drauf sind noch zwei Glöckchen angebracht. Die obere läutet fünf Minuten vor Beginn des Gottesdienstes, denn die Gläubigen damals hörten wegen des starken Rauschens des Rheins an der Stromschnelle angeblich nicht das Glockengeläut der Stadtkirche St. Johann. Der erzürnte Pfarrer ließ also dieses Betglöckchen anbringen, dicht genug an den Häusern der (Un-) Gläubigen. Die Glocke darunter ist nur bei einem Todesfall im Ort zu hören. „Wem die letzte Stunde schlägt …“ Dabei ist ein Glockenschlag zu vernehmen, wenn ein Kind stirbt. Es sind zwei bei einer Frau und drei bei einem Mann. Der Stadtführer erzählt lächelnd, der Mann brauche also drei Anläufe, bis ihn der liebe Gott im Himmel aufnimmt. Einer aus der Gruppe widerspricht: „Nee, damals galt der Mann einfach als wichtiger.“ Ich schweige.
Ganz nah liegt auch das Bezirksgericht, seit 1803 hier in Betrieb. Im historischen Gerichtssaal von 1771, der heute noch für Verhandlungen genutzt wird, hängt ein riesiges Porträt aus österreichischer Zeit von Maria Theresia. Klar, sie war eine Fürstin aus dem Hause Habsburg, lebte von 1717 bis 1780 und musste die Teilung Laufenburgs durch Napoleon nicht mehr miterleben. Neben ihr in dem weißen Saal mit der Rokoko-Stuckdecke von Lucius Gambs hängt ein Bild ihres Mannes Franz I. Stephan. Sie hatten eine gute Arbeitsteilung. Der Kaiser widmete sich erfolgreich den Finanzen der Habsburger. Maria Theresia, selbst nie gekrönt, führte die Regierungsgeschäfte, und zwar fortschrittlich. Sie führte die Steuerpflicht auch für Adel und Klerus ein. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren mussten nun zur Schule gehen. Leibeigenschaft und Fronarbeit wurden eingeschränkt. Alles die Verdienste von Maria Theresia. Sohn Joseph II. hängt als großes Gemälde hinter den Richtern. Er schaffte immerhin die Folter ab. Darüber sind die Angeklagten, die unter dem Habsburger Adler über der Tür den Gerichtssaal betreten, sicher heute noch froh.
Ein Kraftwerk quer zum Rhein
Schnell weiter Richtung Südwesten, denn da kommt neue Energie, umweltfreundlich durch Wasserkraft. 1909 bis 1914 entstand das Rheinkraftwerk als erstes quer zum Fluss. Es war das leistungsstärkste in ganz Europa. 310 Millionen Kilowattstunden im Jahr wurden damals schon erzeugt. Nach der Erneuerung 1994 waren es jährlich 700 Millionen Kilowattstunden, genug für 200.000 Haushalte. Die nutzbare Wassermenge, die rund elf Meter hinabstürzt, liegt bei 1370 Kubikmetern pro Sekunde. Im Moment ist es allerdings nur die Hälfte, was mir das Stehpaddeln erleichtert (dazu mehr in einem anderen Text). Der nachhaltig erzeugte Strom war jedoch das endgültige Aus für die Salmenfischer und die Flößerei. Des einen Leid, des anderen Freud.
Zurück zu meiner Burg, die leider nur noch eine fensterlose Ruine ist. Die Gäste lesen auf dem Plan, wie sie früher wohl einmal aussah. Es gab einen Palas (das ist ein großer Saalbau), die Burgmauer mit Schalentürmen, ein Gerichtsgebäude, die Pfalz mit Kasematten, einen Geschützturm und natürlich die nahe Stadtkirche. Göttlichen Beistand haben wir ja immer noch (nötig). Sie steht wie eine eins direkt neben meiner Burg: Die Stadtkirche St. Johann wird 1253 erstmals erwähnt als „capella Loufenberg“. Der Glockenturm ist von 1593, die barocke Haube von 1656. Die Stuckarbeiten und Deckengemälde kamen hundert Jahre später hinzu. Wer heute diesen heiligen Ort betritt, wird begeistert sein von dem ganzen Ensemble.
Ich hatte das Glück, zur Fasnacht am lustigsten Gottesdienst teilzunehmen, den ich je erlebt habe. Bei der ökumenischen Narrenmesse erzählt die evangelische Pastorin zwei Witze. Einer geht so: Ich war in Rom. – Toll, und was hast du so gesehen? – Vatikan und so weiter – Und? Wie hat dir die Sixtinische Kapelle gefallen? – Oh, die habe ich nicht gesehen, die war wahrscheinlich gerade auf Tournee.
Pater Solomon Obasi, der aus Nigeria stammt, versteht den Wechselgesang so, dass dabei abwechselnd Männer und Frauen aufstehen. Das hält fit. Auch das ist ganz lustig. Und dann die Diakonin – sie hält eine Art Büttenrede. Und die Blechbläser und Trommler der Fasnacht mit ihrer Tschättermusik geben sogar zwei Zugaben. Es wird heftig geklatscht und gejohlt. Eine fröhliche Messe also, die dem Herrgott sicher gefallen hätte.
Der Blick nach Norden – Neid aufs Schlössle!
Doch nun schwenkt mein Burgschreiberblick nach Norden aufs rechte Rheinufer über das Meer der dunkelroten Dächer zur Laufenbrücke, erstmals errichtet im Jahre 1207. Aus jener Zeit stammt auch der Hauptturm, in dem ich wohne. Die Brücke musste schließlich bewacht werden. Es gab ja weit und breit keine andere Rheinquerung. Die deutsche Seite war turmlos, kann das sein? Dazu kommen wir gleich. Flößer, die Mengen an zusammengebundenen Baumstämmen auf dem Wasserweg durch die Stromschnellen hier unten bugsieren wollten, verdammten diesen Ort. Viele Flößer ertranken in den Todesstrudeln. Genauso gab es Fischer, die bei ihrem Lachs- oder Salmfang gegen die Tücken dieser nur etwa 15 Meter breiten Rheinstelle arg zu kämpfen hatten.
Doch genau das war der Grund für die Habsburger, hier eine Brücke über den Rhein zu bauen. Es war nicht nur die schmalste weit und breit. Der Mittelpfeiler konnte auf einem Felsen im Fluss ruhen. Die Spannweite nach links und rechts war gut mit längeren Balken zu überbrücken. Das Land gehörte zwar dem Reichsstift Säckingen, doch das störte die Herren nicht. So entstand am Laufen – der Stromschnelle – ein Handelsplatz erster Güte. Zölle gab es schließlich damals schon.
Schießscharten und dicke Mauern
Mein Turm auf der südlichen Brückenseite war ein Wehrturm und nicht bewohnt. Oben war eine Plattform mit Zinnen und Satteldach sowie vermutlich einem auskragenden Wehrerker. Schießscharten und 1,5 Meter dicke Mauern gehörten natürlich dazu. Beim Aufräumen 1910 fand man Eisenkugeln sowie Pulverladeschaufeln für die Geschütze. Mal schauen, was ich jetzt finde, wenn ich erstmal aufräume.
Gab es auf der deutschen Seite auch einen Wehrturm? Wer sich einmal den Kupferstich von Matthäus Merian dem Älteren von 1644 genauer ansieht, entdeckt auch dort einen massigen Turm. Doch wo stand er genau?
Mein Kollege, der Verwaltungsratschreiber Georg Gerteis, von 1963 bis 1990 im Amt, ist sich sicher, dass dieser Turm auf dem Gelände des heutigen Schlösslegeländes gestanden hat. Auch der Stadtchronist Prof. Adolf Döbele sieht das so. Später musste der massive Turm unweit der Kirchhofmauer einem schwächeren weichen.
Für mich ist das ein wunder Punkt. Ich blicke heute von meiner Burgruine hinüber ins deutsche Laufenburg. Und was sehe ich? Das weiße Schlössle, eine Herrschaftsvilla ersten Ranges, in der oben klassische Musik erklingt und unten italienische Speisen serviert werden. Mmh. Was soll ich sagen? Neidische Blicke sind unvermeidbar. Ich möchte hinauf ins Schlössle. Neulich war ich mal da.
Also, das war allererste Sahne. Gut, die gab es dann erst im Anschluss im Tiramisu des italienischen Restaurants. Aber oben im Panoramasaal erklang vierhändige Musik. Zwanzig Finger gaben ihr Bestes, dazu ein paar Fußtritte – also, für die Pedale des Klaviers. Der Steinway-Flügel, erst vor einiger Zeit mit reichlich Spenden finanziert, glänzte vor Freude. Was der Förderverein „Kultur im Schlössle“ so alles auf die Beine stellt, setzt Maßstäbe bis Basel, Freiburg und Aarau oder Zürich.
An dem Abend spielten Shahane Zurabova aus Armenien und Gabriela Fahnenstiel. Zurabova stammt aus einer Musikerfamilie. Sie hat als Solistin und Kammermusikerin viele Auftritte in Konzertreihen und Festivals weltweit und sowie auch in der Region hingelegt, hat Meisterkurse bei renommierten Musikern besucht. Gleiches gilt für Gabriela Fahnenstiel. Ihr leidenschaftliches Spiel ist legendär. Die beiden überraschten zunächst mit einer Sonate von Wolfgang Amadeus Mozart. Der lebte von 1756 bis 1791. Da war Laufenburg noch österreichisch, denn es gehörte den Habsburgern beidseits des Rheins.
Vom 1. Januar 1802 an galt die Teilung durch Napoleon in einen badischen und einen Schweizer Teil. Die weiteren Stücke des Klavierabends von Johannes Brahms, Antonín Dvorák und Franz Schubert spielten sozusagen zeitlich alle in der geteilten Stadt.
Mary Codman als Glücksfall für die Stadt
Jetzt suche ich noch danach, wem dieses Schlössle überhaupt zu verdanken ist, und stoße auf den Namen Mary Codman. Diese Amerikanerin war eine Perle, ein Glücksfall für Laufenburg. Als die 1839 in New York geborene Frau mit ihrem Mann eine Reise durch Europa macht, fährt sie am Rhein entlang. Das Stadtbild mit dem Laufen, der Stromschnelle, fasziniert sie. Da beide aus reichen Familien stammen, ist es kein Problem, mal eben den ehemaligen Sommersitz des Basler Bankdirektors La Roche zu kaufen. Denn am Haus stand das Schild „zu verkaufen“.
Es ist ein villenartiges Gartenhaus mit zugehörigem Hang. Das war 1894. Zwei Jahre später stirbt Marys Mann. Nun startet die gebildete, kulturinteressierte Frau durch, genießt das kulturelle Leben in Berlin, Zürich und Wien. Sie hat Kontakt zu Richard Strauß und Béla Bartók, die beide auch öfter im Schlössle sind. Der ungarische Pianist und Komponist Robert Freund wird schließlich vom Freund zum Ehemann. Die beiden heiraten.
Damals wehte auf dem Dach des Schlössle die badische Fahne neben dem amerikanischen Sternenbanner. Und bei mir? Ich habe auch einen Fahnenmast auf meiner Burg. Da flattert der rote Löwe von Laufenburg auf gelbem Grund. Übrigens: Meine Burg steht auf dem Schlossberg, auch wenn es hier keines mehr gibt. Und – meine Burg ist ein ganz bisschen höher als das Schlössle drüben. Ätsch!
So, nun ist aber Zeit, sich ins Burgschreiberzimmer zurückzuziehen. Im Norden Deutschlands sagt man etwas flapsig: „Ich bin auffe Burch.“ Das ist ein wenig Plattdeutsch und eine Prise Hannöversch, aber vielleicht trotzdem verständlich für alle am Hochrhein.
Mitten auf der Laufenbrücke: Nepomuk im Fasnachtsfieber.
2
Über Brücken – überbrücken
Was die Laufenburger so alles verbindet
Da steht er also. Mitten auf der Brücke. Nepomuk. Sternenkranz über dem Kopf. Man sieht sofort: ein Heiliger. Aber das ist noch nichts, denn zu Fasnacht stand er da im bunten Narrenschuppenkostüm mit Kappe. Aber so ist das ja oft: Die einen kennen einen vom Büro, die anderen von der Karnevalsparty – und man fragt sich, wer man „eigentlich“ ist.
Dieser Nepomuk jedenfalls, geboren 1350 in Pomuk bei Pilsen (ja, da, wo heute Tschechien ist – und nein, das Pils wurde erst rund 500 Jahre später erfunden), war Jurist und Priester. Er wurde wegen irgendwelcher Machtquerelen anstelle des geflohenen Erzbischofs 1393 auf Geheiß des Königs in Prag von der Karlsbrücke in die Moldau gestoßen und ertrank.
Die Legende erzählt dann von fünf Sternen, die über dem Toten aufleuchteten. Sie formten angeblich das Wort „tacui“. Latein für: „Ich habe geschwiegen.“ Es bezog sich darauf, dass Johannes von Pomuk dem König verschwieg, was dessen Frau ihm in der Beichte erzählt hatte. Mehrmals bravo! Schweigen kann so gut tun. Zu langes Schweigen allerdings nicht, denn 336 Jahre wartete die katholische Kirche, bis sie Nepomuk dann heilig sprach. Seitdem gilt er weltweit als Brücken- und Wasserheiliger.