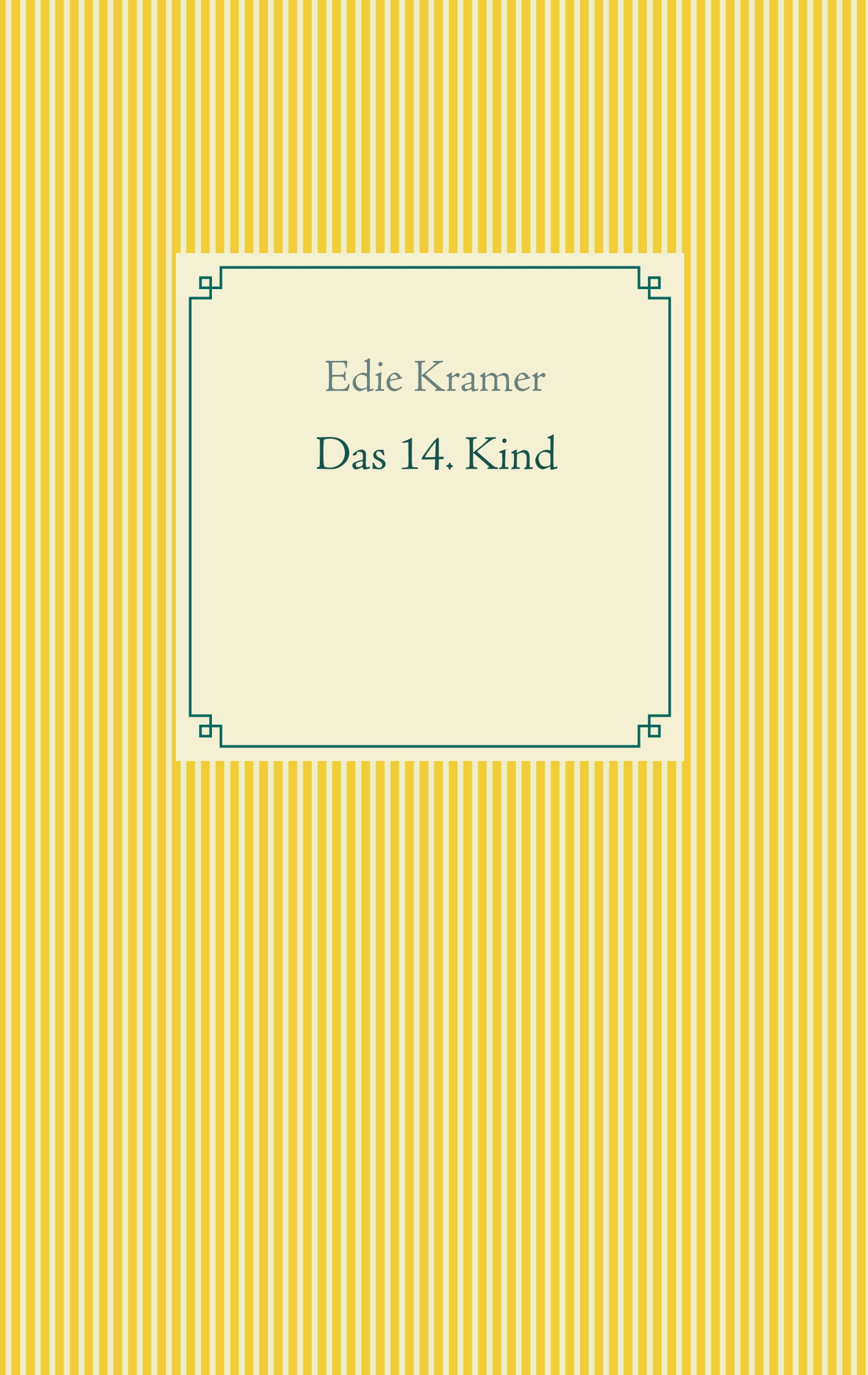Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lea und Nathalie sind beste Freundinnen. Sie wohnen Tür an Tür, gehen in die gleiche Schulklasse. Eines Tages hört Lea Geräuscheaus der Nachbarwohnung, die sie verstören. Sie weiß nicht, was sie machen soll. Maßlos enttäuscht von ihren Eltern, entwickelt sie einen Plan, um ihrer Freundin zu helfen. Sie riskiert dabei mehr, als sie zu diesem Zeitpunkt einschätzen kann. Zwanzig Jahre später treffen die Freundinnen in Paris aufeinander.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Epilog
Prolog
Heute werde ich es tun. Es ist Donnerstag. Morgen ist der letzte Schultag vor den Sommerferien. Zeugnisausgabe. Ich weiß schon, dass ich eine Vier in Mathe und in Bio kassieren werde. Meine Mutter wird ein Gesicht ziehen, als hätte ich sie persönlich beleidigt, die Vieren gegen die Zweien in ihrem dämlichen Belohnungssystem aufrechnen und mir mit gekränkter Miene mitteilen, dass ich leider keine Belohnung zu erwarten habe. Unsere Klassenlehrerin ist auch enttäuscht von mir. Ja, sie hat recht, ich habe anderes im Kopf. Und das ist eigentlich schuld an meinen schlechten Noten.
Ich bin bereit. Noch zwei Stunden, und es ist so weit. Abends im Bett bin ich wieder und wieder den Ablauf durchgegangen. Ich konnte sowieso kaum schlafen. An nichts anderes mehr denken. Heute früh, beim Aufstehen, haben mir die Beine gezittert.
In der Schule kriege ich schon länger nicht viel mit. Die Mathetante hat schon gefragt, ob etwas nicht stimmt bei mir zu Hause. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich will nicht auffallen. Ich brauche einen kühlen Kopf. Niemand darf mir etwas anmerken.
Ich muss es, ich werde es tun. Es wird nichts schiefgehen. Es ist mein heimliches Geburtstagsgeschenk für sie.
Nächste Woche wird sie fünfzehn. Dann sind wir wieder für acht Monate gleich alt. Ich sehe sie immer noch vor mir, wie ihre Augen vor Freude blitzten, als sie sechs wurde, sie mich endlich »eingeholt« hatte. Die Woche darauf – es war ein furchtbar heißer Sommertag – wurden wir eingeschult. Sie hätte noch ein Jahr mit der Schule warten können, hatte aber den Einschulungstest bestanden. Außerdem stellte sich schnell heraus, dass sie schon lesen konnte. Dank der Sesamstraße, die sie keinen einzigen Tag versäumte. Auf dem Klassenfoto von unserem ersten Schultag stehen wir nebeneinander, mit unseren Schultüten voller Süßigkeiten, die in der Hitze langsam dahinschmelzen, und lächeln mit breiten Zahnlücken in die Kamera. Da waren wir schon ein Jahr befreundet. Sie war mit ihren Eltern in die Wohnung neben uns gezogen. Wir hatten uns ein paar Tage auf dem Spielplatz gegenseitig beäugt. Dann ist sie auf mich zugestapft und fragte, ob ich ihre Freundin sein wolle. Ich nickte, und die Sache war geklärt.
Als wir in die dritte Klasse kamen, fing es an.
Nächste Woche werde ich ihr irgendeine DVD, vielleicht einen französischen Film, sie liebt französische Filme, zum Geburtstag in die Hand drücken. Es wird mir schwerfallen, mir nichts anmerken zu lassen. Keine Andeutungen zu machen. Vor ein paar Tagen habe ich mir ausgemalt, dass ich ihr danach alles erzähle und sie mir um den Hals fällt. Total bescheuert. Vielleicht kommt irgendwann, in ein paar Jahren, der richtige Zeitpunkt, um es ihr zu sagen.
Oder nie.
Die kleine Kamera habe ich von Onkel Michael geliehen. Sollte der eigentliche Teil meines Plans schiefgehen, werde ich ihm die Aufnahme in einem verschlossenen Umschlag zur Aufbewahrung geben. Nein, ich werde ihm auf jeden Fall die Videoaufnahme anvertrauen. Bis alles vorbei ist. Dann werde ich das Filmmaterial zerstören. Oder besser nicht? Darüber kann ich jetzt nicht nachdenken.
Ursprünglich wollte ich ausschließlich filmen und ihren Vater, das widerliche Schwein, mit dem Video unter Druck setzen. Dann habe ich Angst gekriegt. Angst, dass er mir etwas antut.
Ich habe Onkel Michael nicht gesagt, worum es geht. Er ist der einzige Verwandte, auf den ich mich hundertprozentig verlassen kann. Er ist völlig anders als meine Mutter. Er nimmt mich ernst.
Ihr Zimmer grenzt an meines. Ich habe es geprobt: Die Kamera auf das Stativ geschraubt, die zusammengeklappten Stativbeine mit Gafferband an einen Besenstiel geklebt, damit die Länge stimmt. Jeden Handgriff habe ich wieder und wieder geübt, seit Wochen.
Ich darf nicht vergessen, die Kamera anzustellen.
Unser Mietshaus liegt am Rand der Siedlung. Von unseren Fenstern aus schaut man auf eine ungepflegte Rasenfläche mit verwitterten Spielgeräten, den schäbigen Maschendrahtzaun. Dahinter liegt die stillgelegte Fabrik. Es gibt keinen Grund, Jalousien herunterzulassen oder Gardinen zuzuziehen.
Damals begann sie, an ihrer Nagelhaut zu beißen, bis es blutete.
Manchmal kam sie mir übertrieben fröhlich vor, dann wieder starrte sie Löcher in die Luft, reagierte patzig, ließ mich abblitzen. Ich weiß nicht mehr, was ich damals verstand. Es ist lange her.
Ihre Mutter kommt seit Jahren spät von der Arbeit zurück. Sie betreut alte Leute, kauft ein, räumt auf, macht ihnen das Abendessen.
Ich wollte es meiner Mutter sagen, traute mich nicht, schämte mich, ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil meine Mutter unsere Freundschaft nie gerne gesehen hat. »Es gibt so viele nette Mädchen in deiner Klasse, was findest du nur an der?«, meckerte sie ständig.
Wir kamen in die dritte Klasse, es war wieder ein heißer Sommer. Ihr Vater kam immer häufiger angetrunken nach Hause. Rülpsend schloss er die Wohnungstür auf und stolperte hinein. Es stank nach Bier und Kneipe, wenn man nach ihm ins Treppenhaus musste.
Die Wände in unserer Siedlung sind dünn. Was nebenan passiert, hört man bis in den letzten Winkel unserer Wohnung. Es ist immer das Gleiche: Erst so eine bedrohliche Stille, dann ist alles Brüllen, Toben, Splittern.
»Macht doch was«, schrie ich beim ersten Mal meine Eltern an. Wir hockten in der Küche vor unserem üblichen Abendbrot. Meine Mutter zuckte bei jedem Krachen zusammen. »Das geht uns nichts an«, sagte mein Vater und biss in sein Wurstbrot, als wäre er ein Wolf, der einen Hasen schlägt.
Mir war heiß und schlecht vor Wut.
Einmal habe ich mit den Fäusten an die Wand getrommelt, bis meine Mutter mich wegzog. »Willst du etwa, dass er auch zu uns rüberkommt und randaliert?«, herrschte sie mich an. Ich hasse meine Eltern, ich hasse sie, wenn ich nur daran denke.
Donnerstags kommt ihr Vater früher als üblich nach Hause.
Als ich das ekelhafte Schnaufen zum ersten Mal hörte ... Ich war allein zu Hause, wollte aufspringen ... ein Loch in die Wand schlagen ... an ihrer Haustür klingeln. Irgendetwas tun. Ich war allein zu Hause, wusste nicht, wohin mit mir. Meine Eltern kamen nie vor 18 Uhr von der Arbeit zurück. Aber ich saß wie gelähmt auf meinem Bett. Noch Tage später konnte ich meinen Kopf kaum drehen, so steif war mein Nacken.
Wenn sie ihre Tage hat, haut er ihr eine runter und verschwindet wieder aus der Wohnung. Den Anblick ihres Blutes erträgt er nicht. Wir haben gleichzeitig unsere Menstruation bekommen. Blass und mit Bauchkrämpfen saßen wir in der Schulbank. Wir mussten nicht drüber reden. Ich kann ihr immer ansehen, wann sie ihre Tage hat.
Danach, all die Jahre, habe ich laut Musik gehört oder meine Oma in der Nähe besucht. Meinen Eltern habe ich nichts gesagt, ich konnte nicht, sie sind wie Fremde für mich geworden, da ist kein bisschen Vertrauen. Von ihnen war keine Hilfe zu erwarten. Manchmal ist sie donnerstags abgehauen. In die Stadt gefahren. Dann verprügelte er sie abends. In der Schule behauptet sie, sie wäre hingefallen, wenn sie einen Bluterguss im Gesicht hat. Niemand fragt weiter nach. Sie trägt selbst an heißen Tagen Oberteile mit langen Ärmeln, damit man ihre blauen Flecken nicht sieht. Mit wütenden Blicken hält sie mich in Schach, wenn ich etwas sagen will.
All die Jahre wollte ich ihr helfen, sie trösten. Manchmal bin ich ihr tags darauf aus dem Weg gegangen. Ich konnte ihr nicht in die Augen sehen.
Mit zwölf wollte ich ihn im Treppenhaus zur Rede stellen. An diesem Donnerstag sollte alles anders werden. Er sollte bereuen, für immer die Finger von ihr lassen. Ich war so naiv. Ich baute mich vor ihm auf, als er die Treppe heraufkam. »Was willst du?«, zischte er mich wütend an. Ich bekam kein Wort heraus. Sein saurer Bieratem war eklig. Alles an ihm war abstoßend, seine Klamotten rochen nach altem Schweiß. Er schob mich beiseite, wie ein ekliges Insekt, das man nur widerwillig berührt, und verschwand in der Wohnung. Mit zitternden Beinen stand ich da und starrte auf die verschlossene Wohnungstür.
Am nächsten Morgen war ein Schweigen zwischen ihr und mir – unendlich wie das Universum. Es war, als würde sie lautlos schreien: Misch dich nicht ein! Ich war wütend. Sie sollte wissen, dass ich sie liebte, dass ich ihr helfen wollte. Danach habe ich nichts mehr unternommen, aus Angst, ihr zu schaden.
Ich ließ sie fallen, konnte sie nicht mehr ertragen.
Sie kam nicht mehr zu uns rüber, ich ging morgens früher aus dem Haus. Ich wollte ihr nicht begegnen. Sie wurde nicht versetzt, ich war erleichtert. Donnerstags verließ ich unsere Wohnung, traf andere aus meiner Klasse. Ich hing ein paar Monate mit Tom ab, in den ich nicht wirklich verliebt war. Viel mehr als ein bisschen Händchenhalten war da nicht. Ich glaube, Jungs sind nichts für mich.
Seit letztem Jahr sind wir wieder befreundet. Eines Nachmittags stand sie einfach wieder vor der Tür. Wir gehen ins Kino. Wir gucken Videos bei mir, joggen, machen Pläne für später. Meine Mutter redet nicht mit ihr. Es ist mir egal. Über die Donnerstage, ihren Vater, reden wir nicht. Das ist die unausgesprochene Bedingung. In vier Jahren gehen wir zusammen nach Berlin – lassen die beschissene Siedlung hinter uns. Ich werde auf sie warten, ein soziales Jahr machen oder sowas, bis sie ihr Abi hat.
Seit Wochen übe ich jeden Handgriff. Es muss alles schnell gehen. Falls etwas schiefgeht, werde ich ihm mit der Filmaufnahme drohen, ihn damit erpressen. Sollte ich erwischt werden, habe ich auf jeden Fall die Filmkassette, die alles beweist.
Es muss klappen.
Ich kenne ihr Zimmer nur durch die Probeaufnahmen. Nie haben wir bei ihr rumgehängt. Es war immer klar, dass wir zu mir gehen.
Ihr Vater sieht unauffällig aus, wie ein stinknormaler Langweiler. Er wirkt auch nicht sonderlich kräftig. Ich verstehe nicht, wieso ihre Mutter nicht zurückschlägt. Wieso sie ihn nicht längst rausgeworfen hat. Warum sieht sie nicht, was dieses Schwein ihrer Tochter antut? Sie wirkt von Weitem wie ein Kind, ist viel jünger als er, aber bei der Arbeit schafft sie es, die alten Leute vom Rollstuhl ins Bett zu hieven!
All die Jahre kannte ich sie nur mit schulterlangen Haaren. Letzte Woche stand sie mit raspelkurzer, grellblonder Punkfrisur vor der Tür. Sie war mit der Papierschere und einem billigen Färbemittel zu Werk gegangen. »Meine Mutter hat entsetzt aufgeschrien, als sie vom Einkaufen kam!« Ihre Stimme voller Genugtuung. Ich war echt geschockt bei ihrem Anblick, ließ mir aber nichts anmerken. Mir war schon klar, dass sie nicht toll damit aussehen wollte.
Endlich wird sie rebellisch, dachte ich, bekam es aber dann mit der Angst zu tun. Ich wollte nicht, dass er sie deswegen am Ende krankenhausreif schlägt und meine Aktion verhindert.
Unten knallt die Haustür ins Schloss. Das ist er. Ich kenne seinen Schritt. Sie ist zu Hause. Er schließt die Wohnungstür auf. Mein Herz klopft bis zum Hals. Meine Hände zittern, aber nur ein wenig. Jetzt habe ich noch fünf Minuten. Er säuft vermutlich immer erst noch ein Bier in der Küche.
Mein Fenster ist bereits geöffnet. Ich warte, bis er ihr Zimmer betritt. Ich werde mir die Filmaufnahme nicht anschauen, niemals. Ich werde höchstens zwei oder drei Minuten lang filmen. Wenn ich die Kamera reingeholt habe, muss jeder Handgriff sitzen.
Die Angelschnur mit dem kleinen Karabinerhaken um das Treppengeländer in Knöchelhöhe legen, den Karabiner an der Wand einhaken. Den Karabiner habe ich mit einem Grinner-Knoten an der Perlonschnur befestigt. Das hält – ich habe es ausprobiert. Der Grinner-Knoten hat eine hohe Knotenfestigkeit und wird beim Angeln verwendet. Das habe ich in einem Fachbuch für Angler in der Stadtbücherei gelesen und dort, in einer stillen Ecke, geübt. Den Metallhaken auf Höhe der ersten Stufe habe ich schon vor Tagen angebracht. Dann nur noch die verschiebbare Schlinge am anderen Ende der Schnur einhängen. Über die Handgriffe muss ich nicht nachdenken. An meinem Türrahmen habe ich sie lange geübt.
Wegen des gesprenkelten Bodens sieht man die Angelschnur nicht auf den ersten Blick. Außerdem ist es ziemlich düster im Treppenhaus – die Lampe auf unserem Treppenabsatz ist seit Monaten kaputt. Das Treppenhaus ist verkommen, seit Jahrzehnten nicht mehr renoviert worden. Ständig ziehen Leute ein und aus, die Wände sind verschrammt.
Es wird niemandem auffallen, wenn ich mit dem Hammer die Stelle eindelle, wo der Haken angebracht war. Ich werde keine Spuren hinterlassen. Außerdem: Wer wird schon Verdacht schöpfen, wenn ein besoffener Kerl die Treppe runterfällt? Er soll sich die Beine brechen, ins Krankenhaus kommen, damit sie Ruhe vor ihm hat. Und wir zusammen nach Südfrankreich fahren können.
Mir wird heiß. Was ist, wenn er sich abfängt, gar nicht bewusstlos auf dem Treppenabsatz liegen bleibt? Mich festhält, wenn ich mich an ihm vorbeidrücken will? Nein, daran darf ich nicht denken.
Ich will nicht in der Wohnung sein, wenn er gefunden wird. Das ganze Zeug – Schnur, Karabiner, Haken, die Zange zum Entfernen des Hakens und den kleinen Hammer werde ich im Baggersee in der Nähe verschwinden lassen. Mit dem Rad bin ich schnell wieder zurück in der Siedlung. In letzter Zeit bin ich oft in meiner Sporthose zum Baggersee und zurück geradelt. Als würde ich trainieren. Danach lasse ich mich im Eiscafé blicken. Am späten Nachmittag sind da immer ein paar aus der Schule.
Mir ist kalt. Es gibt kein Zurück. Es ist für meine liebste Freundin.
1
Hastig überfliegt sie das Geschriebene. Sie will keine Mail mit Tippfehlern abschicken, aber in zwei Minuten beginnt ihre Lieblingsserie.
Klinikum Köln-Nord. Ein Höhepunkt ihres Tages. Oft der einzige Höhepunkt. Sie liebt diese Serie, ausschließlich wegen dieser tollen Krankenschwester, Schwester Helene. Schwester Helene ist fast eine Art Seelenverwandte geworden. Eine mitfühlende Person, die einen kühlen Kopf bewahrt, meist die richtige Diagnose stellt. Im Gegensatz zu den aufgeblasenen Ärzten. Und dazu noch gutaussehend.
Sie richtet sich auf, atmet tief durch und wandert mit der Maus über die Zeilen. Ihre Schultern schmerzen dumpf. Die Physiotherapeutin im Heim hat ihr ein paar Übungen gezeigt. Die soll sie regelmäßig machen, aber sie hat die Abläufe schon wieder vergessen.
Ich bewege mich den ganzen Tag und dann noch Gymnastik! Hilft doch sowieso nicht.
Fünf Minuten, zweimal täglich, würden schon was bringen, hat sie gemeint.
Die hat gut reden. Wenn eine Bewohnerin während der Physiotherapie aufs Klo muss, klingelt sie einfach. Unsereiner macht die Drecksarbeit.
Sie kann sich nicht erinnern, wann sie sich das letzte Mal rundum wohlgefühlt hat. Vielleicht vorletztes Jahr, als sie mit Ulrike an Weihnachten nach Mallorca geflogen ist. Da haben sie es ordentlich krachen lassen, sogar tanzen waren sie. Haben sich was gegönnt. Das türkisfarbene Kleid hat sie seitdem kein einziges Mal mehr angehabt.
Passt vermutlich gar nicht mehr.
Sie schiebt den Gedanken an die zehn Kilo, die sie in den letzten zwei Jahren zugelegt hat, schnell beiseite. Nur, dass ihre Knie höllisch wehtun, kann sie nicht mal im Schlaf ignorieren.
An die Hausverwaltung Ritterstraße 39a, sehr geehrte Damen und Herren, schon vor Wochen habe ich Ihnen mitgeteilt, dass sich in unserem Mietshaus Ratten im Keller eingenistet haben. Ratten übertragen Krankheiten! Bisher ist nichts passiert. Außerdem sind mehrere Briefkästen aufgebrochen und demoliert worden. Das Treppenhaus wird nicht regelmäßig geputzt. Alles verwahrlost. Veranlassen Sie endlich das Nötige.
Hochachtungsvoll
Irene Drechsler
Sie rümpft die Nase. Das »hochachtungsvoll« missfällt ihr, stimmt ja auch gar nicht, dass sie die Hausverwaltung hochachtet, aber was soll sie stattdessen schreiben? So schreibt man halt. Vielleicht kommt es sogar ein wenig herablassend rüber.
Bestimmt lassen die wieder wochenlang nichts von sich hören.
Sie drückt auf Senden, fährt den Computer herunter und macht das Licht hinter sich aus. Im Wohnzimmer greift sie nach der Fernbedienung und lässt sich aufs Sofa fallen. Ein scharfer Schmerz fährt ihr ins Kreuzbein.
Verdammt nochmal. Ich bin kaum über fünfzig und ein Wrack. Die Arbeit macht mich fertig. Und das verfluchte Sofa gehört schon lange auf den Müll. Wie alt ist das eigentlich? Völlig durchgesessen und so verdammt niedrig. Ich komm ja kaum hoch.
Sie schüttelt ein dickes Samtkissen mit Katzenapplikation auf und schiebt es sich stöhnend in den Rücken. Gerade geht der Vorspann zu Ende.
Geschafft!
Sie seufzt schwer, legt ein kleineres Seidenkissen auf den Couchtisch und die Beine darauf.
Der Meyer wird immer schwerer, den krieg ich kaum noch alleine aus dem Bett. Die reizenden Kollegen haben selbst sooo viel zu tun und gucken schräg, wenn man sie mal um Hilfe bittet. Na ja, die Sibel nicht, das ist einfach ’ne Gute.
Wenn sie Dienst hat und um 17 Uhr ihre Serie nicht gucken kann, zeichnet sie die Folge auf und schaut die verpasste Folge direkt, wenn sie nach Hause kommt, bei einer Tasse Kaffee oder einem Glas Wein. Aber es fühlt sich besser an, sie zur »richtigen« Sendezeit zu sehen. Sie kann sich das nicht erklären, die Serie ist schließlich keine Livesendung. Sie fühlt sich Sophie, Sophie van Haaren, die Schwester Helene spielt, dann einfach näher.
Manchmal kann sie es einrichten, sich im Zimmer einer bettlägerigen, meist dementen Bewohnerin mit Fernsehgerät aufzuhalten. Als Erstes schaltet sie den entsprechenden Sender ein, reicht, während die Serie läuft, der alten Dame zu trinken oder wechselt die Vorlage. Kommt zufällig Besuch rein, eine Angehörige oder eine ehemalige Nachbarin, dann wirkt sie beschäftigt und behauptet beiläufig, dass sie weiß, dass Frau Sowieso schon früher gerne Krankenhausserien geguckt hat.
Ärgerlich ist, wenn Sophie eine längere Szene hat und ausgerechnet dann ihr Piepser losgeht. Weil jemand aufs Klo muss oder eine Mandarine geschält haben möchte. Dann schaut sie notgedrungen die Aufzeichnung zu Hause.
Sophie van Haaren ist ihre absolute Lieblingsschauspielerin. Seit vier Jahren spielt sie die patente Krankenschwester, die mit ihrer Intuition immer richtig liegt. Köstlich, wenn ihr die arroganten Ärzteschnösel Abbitte leisten müssen.
Vor Jahren war Sophie van Haaren, damals sah sie noch recht jugendlich aus, in einer Serie als verwöhnte Pferdenärrin im Nachmittagsprogramm zu sehen gewesen. Das war eher was für Teenies. Als Pferdemädchen hatte Sophie sie ein wenig an die Nachbarsgöre, mit der ihre Tochter immer so dicke war, erinnert. Die arrogante Rotznase, die sie immer vorwurfsvoll anguckte und nicht grüßte. Ja, eine Ähnlichkeit war da.
Wie hieß die noch mal? Egal, auf jeden Fall nicht Sophie. Die Nase stimmte auch nicht.
Sie war ihr damals schon aufgefallen. Aber erst durch die Rolle als Krankenschwester hat sich ein Gefühl der Nähe zu ihr entwickelt. Eine fast zärtliche Verbundenheit, die Isie spürt, sobald Sophie im weißen Kittel die Szene betritt.
Wenn in einer Folge medizinische Begriffe auftauchen, mit denen sie nicht vertraut ist, kritzelt sie diese an den Rand ihrer Fernsehzeitung und schaut anschließend im Pschyrembel, einem klinischen Wörterbuch nach, das seit ihrer Ausbildung zur Altenpflegerin im Bücherregal steht. Sie stellt sich dann vor, dass Sophie das Gleiche getan tat, um sich auf ihre Rolle vorzubereiten.
Vor Kurzem gab es da diese Folge, in der ein älterer Patient heftige Schmerzen in der Seite hatte. Alle dachten, er hätte sich nur eine Rippe gebrochen. Er wurde geröntgt, aber da war nichts. Der Oberarzt hielt den Mann für einen Simulanten, wollte ihn heimschicken. Schwester Helene nahm die Schmerzen des alten Herrn ernst, schlug eine Ultraschalluntersuchung des Bauchraumes vor, und es wurde ein kleines Nierenzellkarzinom entdeckt. Dank Schwester Helene konnte der Mann operiert und gerettet werden.
Irene schaut auf ihre Armbanduhr: Zwanzig Minuten sind vergangen und Schwester Helene ist nur einmal kurz bei der Medikamentenausgabe zu sehen gewesen. Doktor Krämer, dieser karrieregeile Schmierlappen, hat versucht, sie anzubaggern. Ekelhaft.
Sie bewundert die Gelassenheit, mit der Sophie diese Rolle spielt, wo sie doch lesbisch sein soll. Aber sie ist schließlich Schauspielerin. Die Kroymann hat doch früher auch eine Pfarrersfrau gespielt. Wäre ja blödsinnig, wenn lesbische Schauspielerinnen nur Lesben spielen dürften.
Da hätten sie nicht viel zu tun.
In einer Talkshow hat Sophie das mal ganz beiläufig erwähnt, allerdings ohne zu verraten, ob sie liiert ist. Sie soll irgendwo in der Südstadt wohnen. Ulrike, ihre frühere Kollegin, behauptet das jedenfalls. Ulrike ist auch lesbisch unterwegs, hat mal versucht, bei ihr zu landen, aber bei ihr war da nichts. Eigentlich in keine Richtung. Sie vermisste nichts. Na gut, manchmal würde sie gerne mit jemandem kuscheln, mehr aber auch nicht.
Aber treffen würde ich die Sophie van Haaren schon gerne.
Sie stellt sich vor, wie sie der attraktiven Schauspielerin von ihrer aufreibenden Arbeit im Altenheim erzählt. Dass sie mit ihr über die Zustände in der Stadt redet. Dass sie sofort einen Draht zueinander spüren, im Laufe der Zeit Freundinnen werden.
Als der Titelsong einsetzt, schreckt sie aus ihren Tagträumen auf.
Was, die Folge war zu Ende, ohne dass Sophie ein weiteres Mal aufgetaucht ist! Was sollte das denn? Wurde sie jetzt aus der Serie gemobbt?
Irene stützt sich auf dem Couchtisch ab, hievt ihren Körper in die Vertikale, schaltet den Fernseher aus und schlurft steifbeinig in die Küche. Am liebsten würde sie sofort beim Sender anrufen. Ihr Magen flattert vor Empörung. Wütend zerrt sie eine Pizza aus dem Gefrierfach, reißt die Folie herunter und schiebt sie in die Mikrowelle. Sie gießt sich den Rest Rotwein aus der angebrochenen Flasche von gestern in das schon benutzte Glas, das neben dem Spülbecken steht und nimmt einen kräftigen Schluck. Sie weiß nicht, wohin mit ihrer Wut. Am liebsten hätte sie Ulrike angerufen. Aber die war mit ihrer Neuen auf den Kanaren.
»Babsi mag Mallorca nicht«, äfft Irene den Tonfall ihrer ehemaligen Kollegin nach. Die konnten ihr beide gestohlen bleiben.
Fünf Jahre war sie mit Ulrike zusammen in Urlaub gefahren, im Sommer waren sie nach Mallorca geflogen. Cala Ratjada. Sie hatten es so gut miteinander gehabt. Schöne Strandtage, abends ein bisschen Party. Im Herbst hatten sie sich eine Woche in einem Hotel in der Eifel verwöhnen lassen. Lecker Essen, Pool, Massage. Alles prima. Bis diese Barbara neu ins Team kam und alles kaputt machte. Als sie die beiden knutschend in der Umkleide überraschte, war ihr schon klar, dass die gemeinsamen Abende und Urlaube mit Ulrike Schnee von gestern waren. Schon klar, Ulrike war ewig Single gewesen und sehnte sich nach einer Beziehung. Sie selbst hatte sie abblitzen lassen. Für sie kam eine Beziehung nicht infrage, nicht nach allem, was sie erlebt hatte. Egal, ob Mann oder Frau.
Trotzdem hatte sie die veränderte Situation auf der Arbeit nicht ertragen können, den ständigen Anblick von Babsi und das blöde Geturtel der beiden. Sie ließ sich krankschreiben, suchte sich eine neue Arbeitsstelle. Ulrike reagierte irgendwie bekümmert, aber auch erleichtert. Die neue Liebe ging vor.
Seit ein paar Monaten telefonieren sie wieder, treffen sich ab und zu auf einen Kaffee, wenn Babsi mal nicht zur gleichen Zeit wie Ulrike Dienst hat.