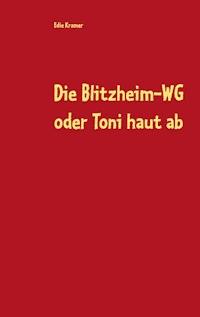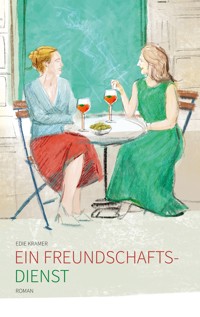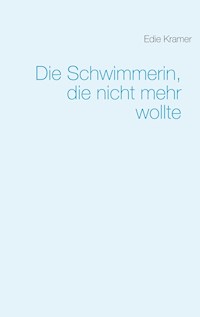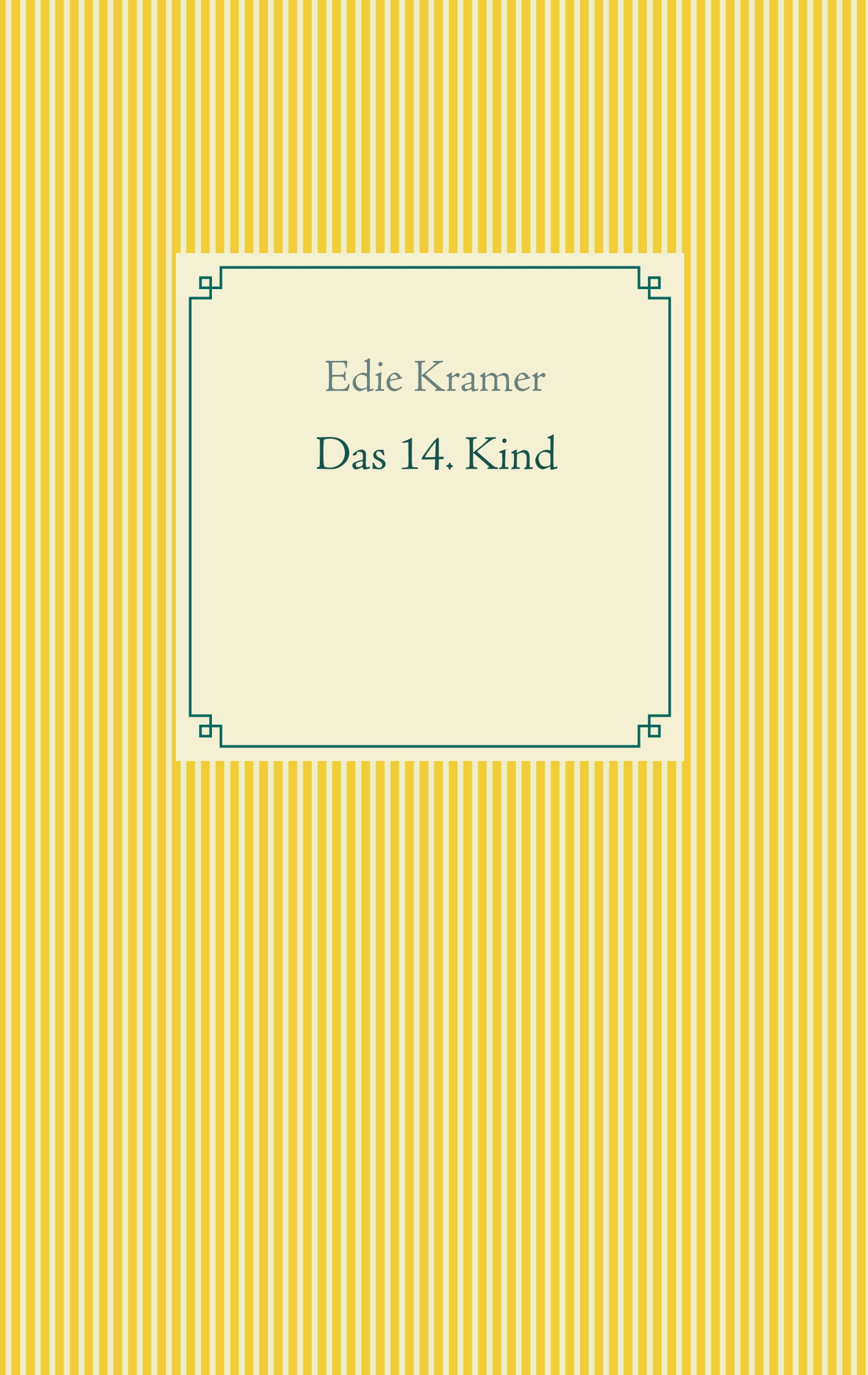
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Anna Rauscher ist das 14. und letzte Kind ihrer Eltern. Sie liebt das gutbürgerliche Leben: Mit der Mutter auf dem Markt einzukaufen, mit ihr im Café zu sitzen. Anna träumt davon, einmal Sängerin zu werden, mit dem Lieblingsbruder nach München zu ziehen. Aber die Goldschmiede des Vaters läuft nicht mehr so gut - sie kann nicht weiter zur Schule gehen, sie muss dem Vater im Laden helfen, als dieser seinen Angestellten entlässt. Als der Vater unerwartet tot im Laden umfällt, fällt auch die Familie auseinander. Anna muss als Wäscherin in ein Grandhotel nach Wiesbaden, die Mutter zieht zu einem Sohn nach Berlin. Anna verlässt mit schwerem Herzen ihre Heimatstadt und ist auf sich selbst gestellt. Nie wieder wird sie nach Schwäbisch Gmünd zurückkehren. In einem Weinlokal in Mainz lernt sie Fritz kennen, der als Matrose dem Kaiser dient. Obwohl sie nie heiraten wollte, bleibt sie mit Fritz bis an ihr Lebensende zusammen. In der neuen Heimatstadt Mainz erlebt und überlebt sie beide Weltkriege.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
I
»Heimat ist etwas Verlorenes, hat mit Erinnerungen zu tun, mit Kindheit, mit den frühen Erfahrungen, die ein Mensch macht, und ist etwas, was man als Erwachsener immer auf sehnsüchtige Weise sucht.«
Edgar Reitz
In den amtlichen Nachrichten der Gmünder Rems-Zeitung wird im Juli 1889 die Geburt von Anna Rauscher, dem 14. Kind des Gold- und Silberwarenhändlers Johann Rauscher und seiner Frau Elisabeth geb. Lehmann vermeldet.
*
Am 12. Juli, es ist ein schwülwarmer Sommerabend, gleitet die kleine Anna als Hausgeburt, völlig unkompliziert, aus dem Schoß ihrer Mutter – die erfahrene Hebamme wird kaum gebraucht –, während der Vater am Marktplatz im Wirtshaus Bier trinkt und mit anderen Mitgliedern seiner Zunft schafkopft. Noch bei jeder anstehenden Geburt in seinem Haus hat er das Weite gesucht. Kinderkriegen ist Weiberkram, es reicht ihm, dass er die Mäuler stopfen muss.
Als er kurz vor Mitternacht das Schlafzimmer seines Hauses in der Augustinerstraße betritt, das kleine Bündel neben seiner schnarchenden Ehefrau liegen sieht, seufzt er kurz, löscht das Licht der kleinen Stehlampe, schließt die Tür hinter sich und entscheidet, dass dies das letzte seiner Kinder sein soll.
»Jetzt ist Schluss! Ein für alle Mal!«, brummt er vor sich hin.
Für seine Lust gäbe es schon eine Lösung, da hat er keine Sorge. Schluss mit »Seid fruchtbar und mehret euch«. Enthaltsamkeit aus Rücksicht auf die Gesundheit der Ehefrau, das akzeptierten die Pfaffen so halbwegs. Elisabeth würde vermutlich nichts vermissen. Er schläft in dieser und allen künftigen Nächten in der ehemaligen Dienstbotenkammer. Seitdem die älteren Töchter im Haushalt ordentlich mit anpacken können, ist die Dienstmagd in andere Hände vermittelt worden. Das Zimmer steht leer. Er wird sich dort oben behaglich einrichten. Schluss mit dem Genörgel über sein Schnarchen. Den Muttermilchgeruch hat er auch satt.
Johann Rauscher hat in der ältesten Stauferstadt des Reiches, der Stadt am Fuße der Schwäbischen Alb, im Arenhaus sehr erfolgreich seine Lehre als Goldschmied absolviert. Drei Jahre hat er bei einem Goldschmied am Münsterplatz gearbeitet, bevor er ein eigenes Geschäft in der Bocksgasse eröffnete. Er ist stolz auf seine schmucke Heimatstadt, die bereits seit den Gründerjahren des Deutschen Reiches einen herausragenden Platz in der Silberverarbeitung innehat. Es erfüllt ihn mit Genugtuung, sich einen Namen gemacht zu haben. Er hat es geschafft, er ist eine Persönlichkeit in Gmünd. Sein Vater arbeitete bis zu seinem plötzlichen Herztod vor ein paar Jahren als einfacher Silberarbeiter bei der Ott-Pauserschen Fabrik.
Ab und an gönnt er sich eine Fahrt nach Stuttgart, wo er einen neuen Anzug schneidern lässt, genießt einen oder zwei Tage ohne Kindergeschrei und das Gemecker seiner Frau und überlässt das Geschäft seinem Angestellten, dem Herrn Fassbender. Er fertigt selbst nur noch gelegentlich Schmuckstücke an, lieber kauft er hervorragende Gold- und Silberwaren bei anderen Mitgliedern seiner Zunft und hat sich zusätzlich auf den Verkauf von Uhren aller Art spezialisiert. Das Geschäft läuft gut, aber ständig steht im Haus eine Reparatur an. Irgendein Kind braucht immer neue Schuhe. Und ein Prinzip im Hause Rauscher lautet: Kleidung wird von den Kleinen aufgetragen, Schuhe niemals. Und um Elisabeth bei Laune zu halten, muss er für ihre großbürgerlichen Extravaganzen oft tief in die Tasche greifen.
Nach der Geburt von Ernst, dem zweitjüngsten Kind, vor nur eineinhalb Jahren ließ sie Tapeten aus dem Elsass kommen und Wohn- und Esszimmer sowie das Schlafzimmer neu dekorieren. Ihm waren die alten Biedermeiertapeten der Vorbesitzer gut genug gewesen.
Das Leben seiner Frau verläuft nicht, wie sie es sich erhofft hat – da hat er keinen Zweifel. Da gibt es keine verträumten Nachmittage am Klavier oder Reisen nach Wien oder Rom. Einmal im Jahr besuchen sie mit den beiden jüngsten Kindern ihre Eltern in Dresden. Der Schwiegervater, ein pensionierter Lehrer, ist ein umgänglicher Mann. Seine Ehefrau, sehr an Frauenrechten interessiert, trägt es ihrem Schwiegersohn nach, dass er ihrer Tochter ein Kind nach dem anderen macht. Sie lässt ihn spüren, dass sie ihn für primitiv hält und spart auch nicht mit sarkastischen Kommentaren, was seine Unkenntnis in Sachen Verhütung anbelangt. Dem gläubigen Katholiken Johann Rauscher ist es bisher nicht in den Sinn gekommen, den gottgewollten Kindersegen zu verhindern. Aber mit Anna soll jetzt Schluss sein.
*
Die kleine Anna wächst schnell zu einem verständigen Kind heran. Sie sitzt gerne in der Küche und schaut der Mutter und ihren älteren Schwestern beim Spätzlemachen oder beim Maultaschenfüllen zu. Schon mit zwei Jahren kann sie Linsen von kleinen Steinchen säubern, sie genießt es, etwas Nützliches zu tun und dafür gelobt zu werden. Aber sie liebt es noch mehr, gemeinsam mit der Mutter, in dem schweren Tapetenbuch zu blättern und mit ihren Fingerchen über die feinen Seiden- und Brokatstoffe zu streichen. Die Mutter freut sich, in ihrer jüngsten Tochter endlich eine Verbündete gefunden zu haben.
Und Anna teilt eine weitere Leidenschaft ihrer Mutter: die Marktbesuche. Jeden Mittwoch und Samstag findet auf dem Münsterplatz der Grüne Wochenmarkt statt. Bauern aus der Umgegend verkaufen ihre Erzeugnisse und Anna lernt von der Mutter, wo es die besten Eier, die schmackhaftesten Hühner und Vaters Lieblingskartoffeln gibt. Wie man einer Forelle über den Bauch streicht um zu fühlen, ob sie auch wirklich frisch ist. Die Mutter spricht unentwegt zu ihr, Anna saugt alles begierig auf, nichts entgeht ihr.
Nach dem Marktbesuch heißt die Mutter ihre älteren Töchter, den Einkauf nach Hause zu bringen und mit den Vorbereitungen für das Mittagessen zu beginnen, um mit ihrer Jüngsten im besten Café der Stadt noch eine Schokolade zu trinken. Den älteren Schwestern gefällt diese Sonderbehandlung ganz und gar nicht, sie triezen Anna, wo sie nur können. Reißen ihr an den Zöpfen, wenn die Mutter nicht hinschaut, lassen ihre Haarschleifen oder Strümpfe verschwinden, sodass Anna wegen Schlamperei gescholten wird. Anna kommt es gar nicht in den Sinn, ihre Schwestern zu verpetzen, es ist einfach zu schön, allein mit der Mutter Zeit zu verbringen, den ganzen Trubel zu Hause zu vergessen. Die Kellnerinnen mit ihren Servierschürzen und Häubchen scharwenzeln um die Mutter herum.
»Was darf ich Ihnen bringen, gnädige Frau? Für das Töchterchen eine heiße Schokolade mit Sahne?«
Die Mutter gibt immer ein großzügiges Trinkgeld, Anna will das später auch so halten.
Solange Anna noch nicht zur Schule muss, darf sie morgens solange sie will im Bett liegen bleiben. Um sieben Uhr lauscht sie den Glocken der umliegenden Kirchen, die ihr kleines Herz mit Ehrfurcht und Freude füllen. Nie schlagen die Glocken gleichzeitig. Wenn sie die Haustür zuschlagen hört, die älteren Geschwister die Wohnung verlassen, schlüpft sie in ein Paar Filzpantoffeln und in einen himmelblauen Morgenmantel, der fast bis zum Boden reicht, und rennt hinunter in die Küche. Sie küsst die Mutter auf beide Wangen und freut sich auf einen schönen heißen Kakao und ein Milchbrötchen mit Butter.
Jeden Oktober, zum Gmünder Krämermarkt, kommt Tante Hedwig aus Rosenheim zu Besuch. Die Kinder müssen noch enger zusammenrücken, denn sie besteht auf einem Zimmer für sich allein. Anna würde gerne mit ihr in einem Zimmer schlafen, die Tante erzählt unglaubliche Geschichten. Sie weiß nicht so genau, ob Tante Hedwig eine Tante oder eine Cousine ihres Vaters ist. Sie ist verwitwet, voller Falten im Gesicht und redet bei Tisch ohne Pause.
Annas Lieblingsgeschichte ist die vom Besuch der Tante im Schloss Neuschwanstein. Sie wollte diese Märchenburg nach dem Tod König Ludwigs besichtigen. Das Schloss war gerade für die Öffentlichkeit geöffnet worden. Angeblich hatte Tante Hedwigs Vater dem Ludwig Geld geliehen und der hatte nicht zurückgezahlt. Also verlangte die Tante freien Eintritt.
»König Ludwig hat 7,5 Millionen Gulden Schulden gemacht, um sein Märchenschloss zu finanzieren. Als hätte er nicht schon genug Geld verpulvert! Nein, nachdem er die Kabinettskasse geplündert hatte, musste er auch noch Anleihen aufnehmen! Und mein armer Vater ist so dumm und leiht ihm Geld. Und ich soll jetzt Eintrittsgeld zahlen!«
Bei jedem Besuch in Gmünd beschreibt die Tante erneut – und sie fuchtelt dabei wild mit den Armen herum – ihren Auftritt an der Kasse des Schlosses. Sie hielt den ganzen Betrieb auf. Eine Riesenschlange bildete sich, weil sie so lange auf die Bediensteten einschrie, bis sie schließlich weggeführt wurde. »Niemals werde ich Geld ausgeben, um dieses Protzschloss von innen zu sehen!«, schimpft sie voller Empörung.
Anna hängt der Tante an den Lippen und fürchtet gleichzeitig um die Bleikristallgläser, die in Reichweite der Tante stehen. Sonst herrscht immer absolute Stille bei Tisch, darauf besteht der Vater, auch wenn er selbst schmatzt und gelegentlich sogar rülpst. Aber Tante Hedwig hat er noch nie zurechtgewiesen.
Wenn es nach Anna ginge, könnte die Tante viel öfter zu Besuch kommen. In der Schule hat Anna gelernt, dass Gmünd seit 1566 Jahrmärkte abhalten darf, es gibt einen im Frühling und einen im Herbst. Aber im Frühjahr fährt Tante Hedwig immer nach Meran. Der Krämermarkt zieht Publikum aus nah und fern an, sämtliche Zimmer der Gasthäuser sind zu diesen Zeiten belegt und abends findet man kaum einen Platz in den Wirtsstuben.
Was Anna auch an Tante Hedwig liebt: Sie ist großzügig, lädt die kleineren Kinder in den Flohzirkus und zu den Liliputanern ein, spendiert Magenbrot und türkischen Honig. Die Großen ziehen lieber allein los und freuen sich über das Taschengeld der Tante. Anna aber, immer an der Hand der Tante, steht mit offenem Mund vor den Wohnwagen der Liliputaner und betrachtet die kleinen Menschen, die von Weitem aussehen wie Kinder und doch alte Gesichter haben, und ihre kleinen Möbel. Sie sucht auf dem Globus daheim im Herrenzimmer das Land Liliput. Die Mutter lacht bloß, als sie danach fragt.
Als Anna das erste Mal auf der Schiffschaukel sitzt, gegenüber ihrer Mutter und ihrem Lieblingsbruder Ernst, schaudert es sie. Sie klammert sich mit einer Hand fest an die grobe Metallkette, mit der anderen krallt sie sich an der Tante fest. Ihr Bruder besteht nur aus Lachen und Schreien. Er hat das gleiche feine, dunkelblonde Haar wie sie, das ihm ständig in die Augen fällt. Anna sieht die Häuser und Kirchen vorbeifliegen und wieder und wieder die blitzenden Augen ihres Bruders. Vor und zurück, vor und zurück. Ihr wird schwindelig, sie ist froh, als sie wieder festen Boden unter den Füßen hat. Aber das Bild ihres vor Glück schreienden Bruders hat sich fest in sie eingebrannt.
Die Jahrmarkttage vergehen wie im Flug und dann ist Tante Hedwig abgereist, wird erst im nächsten Jahr wiederkommen, um wieder von ihrem Besuch auf Schloss Neuschwanstein zu erzählen, als hätten die Rauschers die Geschichte noch nie gehört.
*
Die Jahre bestehen aus Ostern, Pfingsten, Fronleichnam, Weihnachten. Die Märkte kommen und gehen. Am Karfreitag wandert man hoch zu St. Salvator, im Herbst fährt die Familie zu Onkel Heinz zum Schlachtfest auf die Alb. Beladen mit Würsten und einem Sack Linsen kehren sie nach Gmünd zurück.
*
In der Schule sitzt Anna neben Else, die so ganz anders ist. Else stiehlt schon mal einen Apfel auf dem Markt, lügt ihre Mutter an und geht selten rechtzeitig nach Hause.
»Die Else ist kein Umgang für dich. Hübsch ist sie ja, mit ihrem Stupsnäschen, aber die Familie taugt nichts. Na ja, der Vater ist ein Tunichtgut. Lass es dir gesagt sein: Die Else endet mal als Flittchen!«, warnt die Mutter.
Anna spürt, dass die Else mehr sich selbst gehört, sie ist hin und her gerissen zwischen ihrer Bewunderung für die Freundin und der Angst, dass die Mutter recht haben könnte.
Dem Vater geht Anna aus dem Weg. Er ist sowieso selten zu Hause. Er riecht streng nach Tabak und Bier, und sie ekelt sich, wenn er schwer schnaufend spätabends die Treppe zu seiner Kammer hochsteigt. Sonntags in der Messe sieht sie zu, dass sie nicht neben ihm sitzen muss.
Wenn er einen ihrer Brüder mit einem Rohrstock schlägt, weil der mit zerrissener Hose nach Hause gekommen ist oder irgendwo beim Ballspiel eine Scheibe eingeworfen hat, spürt Anna jeden Hieb, als würde sie selbst bestraft. Sie hält dieses Sausen des Stockes auf den nackten Hintern, das Aufstöhnen und Schreien nicht aus, rennt ins Mädchenzimmer hoch, wirft sich aufs Bett und versucht, an etwas Schönes zu denken. Am schlimmsten ist es, wenn Ernst etwas ausgefressen hat und Prügel bezieht.
Der Vater geht morgens ins Geschäft, kommt zum Mittagessen zurück ins Haus und verschwindet nach seinem Mittagsschlaf, wie immer im Dreiteiler, eine silberne Taschenuhr in der Weste, zurück in den Laden. Den Abend verbringt er im Kreis seiner Zunftbrüder im Wirtshaus. Die Mutter zieht sich immer mehr ins Nähzimmer zurück, überlässt den Mädchen den Haushalt. Sie trauert um ihre Eltern, die beide kurz hintereinander weggestorben sind.
»Jetzt komm ich nicht mal mehr nach Dresden«, beklagt sie sich bei Anna, die nicht weiß, womit sie die Mutter aufheitern könnte.
Anna hilft viel in der Küche. Mittags schabt sie Berge von Spätzle vom Brett, sie kocht im Sommer dreierlei Gsälz aus roten und schwarzen Johannisbeeren und Brombeeren, backt jeden Samstag Apfel- und Streuselkuchen, wie sie es von der Mutter gelernt hat. Ihre wunderbare Altstimme klingt oft durchs Haus. Beim Singen ist sie ganz bei sich, ihr Kopf wird dann so leicht und froh. Weihnachten darf Anna die gemeinsam gesungenen Lieder anstimmen.
Die bei allen beliebte Gesangslehrerin Frau Steuber lobt Anna jeden Dienstag während der Musikstunde.
»Ach Anna, aus dir könnte eine wunderbare Mezzosopranistin werden!«
Wenn Anna abends die Bettdecke über den Kopf zieht, damit sie das Geschnaufe ihrer Schwestern nicht hört, träumt sie von ihrer Gesangsausbildung in Stuttgart, malt sich aus, wie sie in wunderschönen Kleidern auf der Bühne steht und man ihr zujubelt.
»Mutter, ich würd so gerne Sängerin werden!«
Anna schmiegt sich auf dem kleinen Biedermeiersofa an die Mutter und atmet ihren sauberen Geruch nach Kölnisch Wasser ein.
»Kind, schlag dir das aus dem Kopf. Dafür ist kein Geld da. Letzten Sommer erst haben wir deine Schwester Maria verheiratet. Was glaubst du, was das gekostet hat?«
Die Mutter seufzt, nimmt den Stickrahmen wieder auf, das Gespräch ist beendet.
*