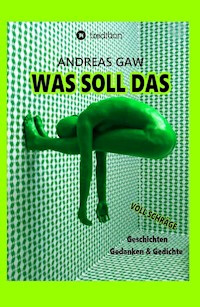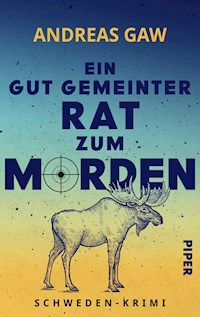
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Spannungsvoll
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Unfall oder Mord? Ein lustiger Schwedenkrimi voller Spannung zwischen Elchen und Köttbullar – Für alle LeserInnen von Jonas Jonasson
»›Und wo ist dein Man jetzt?‹, fragte ich.
›Er liegt draußen im Auto. Im Kofferraum.‹, antwortete sie nüchtern. ›Kannst du ihn für mich verbuddeln?‹«
Seit Vanessa und ihr Mann Chris, die in Deutschland finanzielle Probleme hatten, nach Schweden ausgewandert sind, scheint sich für das Paar alles zum Besseren zu wenden. Doch das Glück währt nicht lange. Die Ehe kriselt, und Chris wird zusehends gewalttätig. Eines nachts stürzt er die Treppe hinunter und bricht sich das Genick. Ein Unfall? Oder hat Vanessa ihn ermordet? Für einige ihrer Freundinnen wird Vanessa zur Heldin. Ein Vorbild für alle Frauen, die ihre Kerle loswerden wollen. Und unversehens gerät sie in einen Strudel aus Lügen, Gewalt und Mord ...
»Wer Sinn für makabren Humor hat ist mit diesem Buch bestens bedient.« ((Leserstimme auf Netgalley))
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Ein gut gemeinter Rat zum Morden« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Redaktion: Antje Steinhäuser
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Emily Bähr, www.emilybaehr.de
Covermotiv: Freepik (mvorona; pch.vector; rawpixel.com)
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
1. Kapitel
Ich weiß wirklich nicht mehr, ob ich ihm den entscheidenden Schubs gegeben habe oder ob er von allein das Gleichgewicht verlor. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn hätte festhalten können. Seine Arme packen, ihn irgendwie auf der obersten Treppenstufe halten. Ich habe es aber auch gar nicht versucht.
Stattdessen sah ich ihn fallen. Zum einen ging alles so schnell. Zum anderen sah es aus wie in Zeitlupe. Sein Oberkörper pendelte kurz vor und zurück, als er den Halt verlor. Seine Arme wedelten albern durch die Luft, als er versuchte, den Schwerpunkt zurück nach oben zu verlagern. Ein hektisches Hampelmännchen. Ohne Erfolg. Wie eine übergewichtige Schaufensterpuppe krachte mein Mann rücklings auf die Stufen. Er rollte sich nicht ab oder machte eine elegante Drehung, um seitlich aufzukommen. Nichts dergleichen. Er war ja kein Stuntman. Wahrlich nicht.
Chris donnerte einfach auf die Stufen und glitt dann, mit dem Kopf voran, auf dem Rücken liegend, die Stiege hinunter bis zum Flurfußboden. Doink, doink, doink. Stufe für Stufe. Wie der kleine dicke Mann aus Paulchen Panther, wenn er zum Beispiel hinter einem Laster hergezogen wird. Doink. Doink. Er dotzt ein paarmal auf und kommt dann irgendwann zur Ruhe. Obwohl Chris’ Hinterkopf jede Stufenkante mitgenommen hatte, bis der ultimative Aufprall auf den Flurdielen erfolgte, konnte ich von meinem Standpunkt oben am Treppenende keine Verletzung ausmachen. Kein Blut zu sehen, so wie er am Ende dalag, mit verdrehten Armen und Beinen. Ein Hundertvierzig-Kilo-Crashtestdummy. Fehlte nur der orangefarbene Overall.
Keine Ahnung, wie lange ich ihn von oben herab betrachtete. Chris war zwar ein paar Zentimeter kleiner als ich mit meinen einssechsundsiebzig, aber er hatte mir immer das Gefühl gegeben, dass ich zum ihm aufzuschauen hätte.
»Vanessa«, hatte er irgendwann mal zu mir gesagt, »Vanessa, Liebling, es kommt nicht auf die Körpergröße an, sondern darauf, was man im Köpfchen hat!«
Ich hätte ihm eine scheuern können.
Und dann hatte er besänftigend hinzugefügt: »Das war jetzt natürlich nicht auf dich bezogen.«
Von wegen. Ich bin zwar der Meinung, dass man anhand des Schulabschlusses (und ich hab immerhin Abitur, während Chris mit Hängen und Würgen die Mittlere Reife geschafft hat) keineswegs die Intelligenz ablesen kann, doch mein Gatte hatte nie eingestehen wollen, dass es Menschen gibt, die auch nur ein My (nach dem griechischen Buchstaben µ) gebildeter waren als er. Wenn ich bei Wer wird Millionär? eine Frage beantworten konnte, zu der Chris die Antwort nicht wusste, hieß es immer nur: »Das haste wohl gerade zufällig irgendwo gelesen, was?«
Und nun, als ich seinen leblosen Körper so daliegen sah, war er wirklich klein. Ein unförmiges Häufchen Torso, mit kurzen, fleischigen Extremitäten. Und das bezieht sich nicht nur auf seine Arme und Beine.
Eine Weile betrachtete ich fast teilnahmslos den kleinen dicken Mann da unten am Fuß der Treppe. Dann ging ich langsam die Stufen herunter. Ich forderte mich selbst auf, eine Gefühlsregung zu zeigen. Schock, Entsetzen oder Mitleid. Aber nichts dergleichen stieg in mir hoch. Da lag der Mann, mit dem ich fast zwanzig Jahre meines Lebens verbracht hatte, und ich konnte mir keine einzige Träne rausquetschen. Unten angekommen, ging ich auf Zehenspitzen vorsichtig um ihn herum. So, als ginge man über eine Kuhweide voller Kuhfladen und wolle es vermeiden, auch nur ein klitzekleines Stück Kuhkacke mit dem Fuß zu berühren.
Die kleinen Knopfaugen in seinem großen, fast kahlen Kopf waren weit aufgerissen. Ich hatte sein Gesicht schon immer irgendwie mit einer Comicfigur assoziiert, denn Mund, Augen und Knubbelnase waren dicht zusammen in die Mitte seines Antlitzes gedrängt, während Wangen, Stirn und Kinn sich als weites, freies Feld darstellten. Selbst bei Mr. Magoo, in der gleichnamigen Zeichentrick Serie, stimmten die Proportionen einfach besser. Ja, da lag er nun vor mir, mein toter Cartoon-Gatte.
Oder vielleicht war er gar nicht tot. In der Sekunde, als er fiel, war ich mir sicher, dass er den Sturz nicht überleben würde. Aber was, wenn doch? Dann müsste ich vielleicht einen Krankenwagen rufen. Andererseits, sollte er schon das Licht am Ende des Tunnels sehen und an der Grenze zu den ewigen Jagdgründen stehen, dann wäre er sicher schon längst beim Großen Häuptling im Himmel, wenn die Ambulanz irgendwann hier einträfe.
In Schweden dauert es mitunter Ewigkeiten, bis ein Rettungswagen zur Stelle ist. Insbesondere im Winter. Und insbesondere dann, wenn die Sanitäter gerade Kaffeepause, also fika, wie es auf Schwedisch heißt, machen, während der Notruf eingeht.
»Lugnt – immer mit der Ruhe«, würden Björn oder Mats oder wer auch immer sagen, und in aller Seelenruhe ihren starken, schwarzen Kaffee austrinken. Dann würde das Team zum Rettungswagen gehen, vielleicht einer der Helfer noch schnell mal austreten, und gemächlich und den Straßenverhältnissen entsprechend lostuckern. Vom Krankenhaus in Mora bis zu uns waren es gute zwanzig Kilometer.
Sollte Chris also schon halb über den Jordan sein, wäre ein Notruf vergebliche Liebesmüh.
Und wenn er doch nur schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt war? Wie findet man so etwas heraus? Meine Erfahrungen mit durch Treppenstürze hervorgerufenen Frakturen oder Ähnlichem hielten sich in Grenzen. »Vielleicht sollte ich mal seinen Puls fühlen«, kam mir mit Verzögerung der naheliegendste Gedanke.
Zaghaft griff ich nach Chris’ speckigem Handgelenk. Das fühlte sich zumindest schon mal recht leblos an. Einen Puls konnte ich nicht ertasten. Was aber nicht viel zu bedeuten hatte, denn ich war noch nie gut darin gewesen, einen Puls zu fühlen.
Als Michael, unser Sohn, sechs Jahre alt war, bat er mich, mal zu testen, wie oft sein Herz pro Minute schlagen würde. Ich sah auf meine Armbanduhr und fummelte lange an seinem Handgelenk herum, bis ich die Ahnung von einem Pulsschlag spürte. Dann wartete ich, bis der Sekundenzeiger auf der Zwölf war, und wollte mit dem Zählen beginnen. Und schon hatte ich den Puls wieder verloren.
»Wie es scheint, bist du tot«, sagte ich damals im Scherz. Michael rannte heulend aus dem Zimmer, und ich ärgerte mich, dass ich diesen, für Kinderohren eher unsensiblen Spruch losgelassen hatte. Jedenfalls: Puls am Handgelenk fühlen war nicht meine Spezialität.
An Chris’ Halsschlagader hatte ich aber auch kein Glück. Entweder war ich wirklich zu dämlich für derlei Aktionen, oder Chris war tatsächlich nicht mehr unter uns. Letzter Test. Pupillen. In diversen Arztserien im Fernsehen haben diverse Ärzte schon oft diversen Patienten mit diversen Taschenlampen in diverse Augen geleuchtet, um eine Pupillenreaktion zu erkennen. Das konnte also nicht so schwer sein. Ich ging durch den Flur, meinen Gatten zurücklassend, in die Küche und öffnete den eingebauten Vorratsschrank neben der Spüle.
Praktisch, diese alten Schwedenhäuser. Überall Wandschränke. Das fand ich schon immer gut. Neben einer Großpackung Spaghetti von »Willys Supermarket« fand ich unsere Maglite. Eine Riesentaschenlampe, für die man eigens eine Tasche kaufen müsste. Schwer, aber gut in der Hand liegend.
»Damit kannste locker wen erschlagen!«, fielen mir ironischerweise Chris’ Worte wieder ein, als ich mich mit der Monsterlampe über seinen leblosen Körper beugte. Knips an. Licht in die Augen. Keine Reaktion. Wild leuchtete ich in diverse Richtungen. Der Schatten seiner Nase an der Wand sah aus wie ein Indianerzelt. Aber Pupillenreaktionen gab es keine. Alles deutete darauf hin, dass der Sturz für ihn tödlich gewesen sein musste.
Ich legte die Taschenlampe auf die erste Treppenstufe, kniete mich neben Chris und streckte die Hand aus, um ihm ein letztes Mal sanft über die wenigen verbliebenen Haare zu streicheln. Er war sechsundvierzig, ein Jahr älter als ich, und, wie gesagt, fast völlig kahl. Allerdings lugte das fleischfarbene Ei damals bereits durch seine Wolle, als wir uns vor über zwanzig Jahren kennengelernt hatten.
Die Veranlagung zum Kopf-FFK war also schon lange da gewesen. Doch das hatte mich im Grunde nie gestört. Irgendwie stand ich sogar auf diesen Bruce-Willis-Typ. Allerdings nur, wenn auch das Gesicht charakterschwere, männliche Gesichtszüge aufwies. So war es bei Chris in seinen jungen Jahren. Mittlerweile aber waren die Charakterfalten Pfannekuchengnubbeln gewichen.
Meine Hand zuckte ein paarmal unkontrolliert zurück, als sie sich seinem Kopf näherte. Irgendwie sah er mich böse an, so mein Eindruck beim Blick in seine leeren Augen. Tief durchatmen, und dann das tun, was man in jedem guten Western macht, wenn man eine Leiche findet: Die Augenlider zudrücken. Eins, zwei, drei … Daumen und Zeigefinger abspreizen … ansetzen … leichter Druck nach unten. Und zu waren die Augen.
Erst jetzt gelang es mir, Chris über den Kopf zu streichen. Sind Tote nicht kalt? Das dachte ich jedenfalls immer. Aber Chris war warm wie eine Pellkartoffel. Wie lange dauert es denn, bis eine Leiche auskühlt? Eine Stunde? Zwei? Genaugenommen hatte ich nicht mal annähernd so etwas wie ein Zeitgefühl. Keine Ahnung, ob Chris vor drei Minuten oder vor drei Tagen die Treppe hinuntergefallen war. Naja … drei Tage sicher nicht, denn dann wäre ich zwischendurch auf dem Klo gewesen, und daran hätte ich mich erinnert. Außerdem wäre das Blut dann garantiert schon getrocknet.
Blut?! Jetzt erst bemerkte ich eine untertassengroße, rote Pfütze, die sich rund um seinen Hinterkopf ausbreitete. Mehr nicht. Aber immerhin. In Filmen läuft immer total viel Blut aus den Opfern. Männer haben in der Regel etwas über fünf Liter Blut. Übrigens auch eine richtige Antwort meinerseits auf eine Frage in der Sendung von Günther Jauch. Den konnten wir auch hier in Schweden sehen, denn wir hatten unsere Satellitenschüssel auf Astra 19,2 eingestellt und bekamen deutsches Fernsehen. Wenn also gut fünf Liter Lebenssaft auslaufen, gibt das schon eine stattliche Blutlache.
Mir war mal ein halb voller Wischeimer umgefallen. Die ganze Küche war geflutet. Das kommt von der Menge her ungefähr hin. Aber bei Chris war es nur ein kleiner Kranz um den Schädel. Gleichmäßig, kreisförmig verteilt. Wie ein winziger, dunkelroter Heiligenschein.
Und erst in dem Moment, als sich bei mir dieses Bild einstellte, realisierte ich, was passiert war. Ich begann zu zittern, musste mich abstützen. Dann sank ich neben meinem toten Mann zusammen und fing an zu weinen. Alles musste raus. Rotz, Wasser, Spucke. Alles. Trauer und Frust.
Die letzten Jahre unserer Ehe waren alles andere als Urlaub auf Wolke Sieben. Es war der Wurm drin, schon bevor wir fünf Jahre vor Chris’ Treppensturz nach Schweden gezogen waren.
Eine zähe Aneinanderreihung leerer Versprechungen.
»Alles wird besser, wenn wir erst mal in Schweden sind!«, versuchte er mich von einer großartigen Zukunft zu überzeugen.
Und dann, nach dem Umzug ins Land der Elche: »Du wirst sehen Vanessa, wenn ich erst mal einen Job habe, wird alles gut!«
Und dann: »Du, Schatz, der Job ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich suche mir etwas Neues. Und dann, das verspreche ich dir, wird alles gut!«
Und dann schmiss er seine Arbeit in einer kleinen Kfz-Werkstatt hin und hatte direkt wieder tolle Pläne.
»Ich mache mich selbstständig. Das wird ganz groß! Wart’s nur ab, Liebling … alles wird super.«
Ich habe abgewartet. Ihn unterstützt. Abgewartet. Bin arbeiten gegangen, während Chris überlegte, wie er sich selbst verwirklichen könne.
»Du, Schatz. Ich hab da eine prima Geschäftsidee. Da kann ich echt Kohle bringen. Klar, wir müssen erst mal etwas investieren, aber dann wird es richtig viel Geld bringen! Versprochen!«
Und gebrochen.
Und ich hatte mich immer wieder dazu gezwungen, an die Hirngespinste des Meisters zu glauben. Schon allein wegen unserem Sohn. Solange er noch nicht aus dem Haus war, betrachtete ich es als meine Aufgabe, die Familie zusammenzuhalten.
Und dann machte Michael sein Abitur und begann zu studieren. Er zog aus. Zunächst nach Uppsala. Später bekam er ein Stipendium für ein Jahr Wirtschaftswissenschaften in Oxford. Super Sache, das.
Micha war also aus dem Haus. Mission erfüllt. Das Projekt »Familie Zusammenhalten« hatte nicht mehr die Number-One-Priorität. Und so, wie ich das leblose Familienoberhaupt vor mir liegen sah, würde sich daran auch nichts mehr ändern.
Ich fummelte unter dem Gummizug meines Slips nach einem Papiertaschentuch und putze mir die Nase und die Tränen aus den Augen. Blöderweise genau in dieser Reihenfolge. Ekelig. Etwas Rotze hing an den Wimpern. Ich schielte und sah … Chris hatte sich bewegt. Oder doch nicht? Sein linker Arm lag anders als gerade eben noch. Oder?
Vorsichtig gab ich seinem Körper einen kleinen Schubs mit der Zehenspitze. Er wabbelte ein wenig, wie Götterspeise, aber nur durch meinen Kick, und nicht von selbst. Tief durchatmen. Aufstehen.
Als ich mich mühsam erhob, hörte ich ein leises, langgezogenes Pfeifen. So, als würde jemand vorsichtig Luft aus einem Ballon ablassen. Ich verharrte in halb aufgerichteter Position und wagte einen Blick hinunter zu meinem Abgelebten. Konnte es sein, dass er eben leicht gestöhnt hatte? Oder entwichen ihm bereits Leichengase? Schon zu Lebzeiten war das Furzen eines seiner liebsten Hobbys. Nicht etwa heimlich, still und leise. So wie manch ältere Damen, die einen fahren lassen, und dann leicht husten, in der Hoffnung, die anwesenden Gasopfer können das Furzgeräusch und den Huster nicht voneinander unterscheiden oder einer bestimmten Person zuordnen. Nein. Chris machte gerne eine Show aus seinen Flatulenzen.
»Hier, zieh mal dran!«, sagte er regelmäßig zu unserem Sohnemann und hielt ihm seinen ausgestreckten Zeigefinger hin. Und wenn Klein-Michael dann am Finger seines Papas zog, ließ Chris eine lautstarke Stinkbombe aus seiner Hose gleiten.
Mit »Danke mein Lieber. Du hast mich vor dem Platzen gerettet«, beschloss er danach immer sein kleines Fäkal-Ritual.
Aber auch sonst, ob im Restaurant, im Bus oder im Kaufhaus, Chris konnte überall die Luft stinken lassen. Sein Zaubertrick.
»Das ist was ganz Natürliches! Schon Luther hat gesagt ›Warum rülpset und furzet ihr nicht? ‹, gab Chris breit grinsend nach flächendeckenden Bepupsungen gern von sich.
Im Grunde wartete ich darauf, dass der Tote jeden Moment seine Augen öffnen würde und zur Begründung des Leichengas-Entfleuchens ein »Der musste noch raus!« konstatierte. Aber Chris sagte nichts. Schon wollte ich mich von ihm abwenden, als er plötzlich doch die Augen öffnete. Mein Herz blieb stehen. Heilige Scheiße. Ich hatte doch den Pupillentest gemacht. Kontrollblick meinerseits. Kein Zweifel. Chris’ Augenlider zuckten. Und jetzt? So fürchterlich schlimm wäre es nicht gewesen, wenn er in dieser Nacht das Zeitliche gesegnet hätte. Aber womöglich hatte Chris sich bei dem Sturz die Wirbelsäule gebrochen. Sollte er überleben, könnte das ein Leben im Rollstuhl bedeuten. Und ich müsste ihn am Ende noch pflegen und ihm den Hintern abwischen. Kein verlockender Gedanke. Ein kleiner Teufel erschien auf meiner Schulter und deutete auf ein gobelinartiges, besticktes Kissen mit Jagdmotiven, welches neben dem Telefontischchen im Flur auf einem Hocker lag.
»Nimm es, und drück’s ihm auf die Fresse!«, forderte mich seine Stimme auf.
Und ich machte tatsächlich die vier Schritte zum Hocker hin. Und ich nahm tatsächlich das Kissen. Und ich ging zurück zu Chris. Und ich beugte mich, mit dem Kissen in der Hand, nach vorn, hinunter zu seinem Gesicht. Und … ich drückte ihm das Jagdmotiv … nicht auf die Fresse, sondern zögerte.
Sicher, in der letzten Zeit war er nicht mehr meine große Liebe gewesen. Nicht mal mehr eine kleine. Aber umbringen würde ich ihn nicht. Wobei ich mir eigentlich nicht ganz sicher war, ob ich es nicht bereits getan hätte. Was, wenn ich ihm vorhin, oben auf der Treppe, tatsächlich den letztlich auslösenden Push gegeben hatte. Nicht absichtlich. Aber vielleicht unterbewusst mit Absicht.
Streng genommen wäre das aber kein Mord. Ein Ersticken mit einem Kissen schon. Ob mit, oder ohne Jagdmotive. Langsam richtete ich mich wieder auf. Das Gobelinkissen entglitt meiner Hand und landete neben Chris’ Kopf. Seine Augen waren geschlossen. So, wie ich sie zugedrückt hatte. Alles nur Einbildung? Ja. In dem Moment war ich sicher, dass kein Fünkchen Leben mehr in meinem Gatten … oder in dem Fall wohl ab jetzt Ex-Gatten war.
Ein Moment absoluter Klarheit. Das war das zwangsläufige Ende unserer Beziehung. Bis dass der Tod euch scheide, das hatten wir vor dem Traualtar geschworen. Zwar bin ich kein religiöser Mensch, gehe nicht regelmäßig zur Kirche und zahle auch keine Kirchensteuer. Aber ich war mir immer schon absolut sicher, dass es zwischen Himmel und Erde eine Macht gibt, die größer ist als unsere Vorstellungskraft. Für mich ohne Zweifel. Allein der Gedanke, dass das Universum unendlich ist, überwältigt mich. Etwas, das nie aufhört. Wahnsinn. Es gibt, da bin ich sicher, eine universelle Energie, die uns lenkt. Mit unseren Gedanken und Taten zahlen wir auf ein Energiekonto ein. Und je nach dem, ob wir eher positiv waren, also gute Menschen, oder eher negativ, so wird entsprechend am Ende die Auszahlung sein.
Seinen Mann die Treppe runterzuschubsen, ob mit, oder ohne Absicht, schlägt sicher nicht auf der positiven Seite zu Buche. Ich musste pinkeln. Er war ja nun schon tot. Weglaufen konnte er nicht mehr. Also entschied ich, erst mal aufs Stille Örtchen zu gehen und mich dann um den Rest zu kümmern.
Ich trippelte in unser kleines Badezimmer, welches Chris schon lange renovieren wollte. Eine Badewanne wäre schön, da waren wir uns einig. Stattdessen stand in der Ecke noch immer eine wackelige Duschkabine, deren Plexiglaswände durch das kalkhaltige Wasser zu Milchglasscheiben geworden waren. Erst vor ein paar Tagen hatte ich für mich entschieden, das Projekt »neues Bad« selbst in die Hand zu nehmen. Seit zwei Jahren hatte Chris sich lediglich mit ein paar Skizzen des Raumes beschäftigt, und mit Bleistift auf Papier mögliche Standorte einer neuen Badewanne markiert. Mehr nicht.
Ich hob mein Nachthemd hoch, zog den Slip runter und pflanzte mich auf die Schüssel. Das Pinkeln tat irgendwie gut. Als der Strahl endete, zupfte ich etwas Klopapier von der Rolle und tupfte mich ab. Rot. Na super. Meine Tage. Das hatte mir gerade noch gefehlt. Ich war ohnehin schon überfällig und hatte insgeheim gehofft, dass so allmählich mal die Wechseljahre einsetzen würden, und der monatliche Nervkram ein Ende hätte. Aber augenscheinlich noch nicht in diesem Monat.
Also fingerte ich Tampons und Slipeinlagen aus dem Schränkchen unter dem Waschbecken und holte die Hygieneartikel aus den jeweiligen Verpackungen.
Dann überkam mich plötzlich eine große Müdigkeit. Keine Lust, mich unten herum zu sichern. Einfach nur hier sitzen, mehr wollte ich nicht. Und das tat ich dann auch. Sicher eine halbe Stunde lang. Es ging mittlerweile bestimmt schon auf Mitternacht zu.
Zunächst drehten sich meine Gedanken um rein praktische Dinge in Bezug auf den Toten im Flur. Ich müsste nun wohl doch einen Krankenwagen rufen. Und die vom Krankenhaus würden dann sicher auch die Polizei mitbringen. Okay. Dann war es halt so. Da ich selbst nicht wusste, ob ich etwas getan hatte, könnte man mir sicher auch nichts nachweisen. Aber sie würden mich befragen. Ob wir einen Streit gehabt hätten, und so.
Hatten wir einen Streit gehabt? Sicher. Wie fast jeden Tag. Aber nicht die Art von lautstarkem Streit, den viele Paare haben. Ankeifen. Rumbrüllen. Oder gar Handgreiflichkeiten. Nein. Bei uns liefen Auseinandersetzungen nach einem anderen Muster ab. Meist begann es damit, dass Chris irgendetwas an mir auszusetzen hatte. Keine großen Dinge. In der Regel Kleinigkeiten, die ihn im Grunde nie interessiert hatten, aber auf einmal zu einem Problem wurden. Genau wie an diesem Abend.
Er war aus seiner Werkstatt, die er sich in einem, ans Haus grenzenden Schuppen eingerichtet hatte, zum Abendessen reingekommen. Ich hatte gekocht. Sein Lieblingsgericht, der schwedische Klassiker: Köttbullar und Kartoffeln. Obwohl wir nun schon über fünf Jahre in Schweden lebten, hatte Chris immer noch nicht kapiert, dass es auf Schwedisch »Schött-Bullar« und nicht »Kött-Bullar« ausgesprochen wird. Das »K« in Kombination mit dem Umlaut »Ö« spricht der Schwede als »Sch«. Anfangs hatte ich Chris ab und zu noch korrigiert, wenn er Worte falsch aussprach. Aber bald merkte ich, dass es ihn ärgerte, wenn ich ihn verbesserte. Also ließ ich es.
»Ah… Kött-Bullar…«, sagte er, das »K« betonend, als er sich an den gedeckten Tisch setzte.
Ich schaute zu ihm rüber, überlegte kurz, ob ich etwas sagen sollte, hielt dann aber den Mund.
Chris sah mich herausfordernd an.
»Was ist?«, fragte er mit bissigem Unterton.
»Nichts«, antwortete ich und steckte meine Gabel in eine Kartoffel.
»Du wolltest mich schon wieder korrigieren, stimmt’s?«, hakte er nach.
Ich hatte keine Lust auf irgendwelche Diskussionen, also schüttelte ich nur den Kopf.
Wortlos stopften wir unser Abendessen in uns hinein.
Diese Ruhe vor dem Sturm kannte ich schon. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Chris irgendetwas finden würde, das er mir vorwerfen könnte. Eine Viertelstunde später, als ich in der Küche den Abwasch machte und er am Küchentisch mit seinem Smartphone rumspielte, war es dann soweit.
»Wo ist eigentlich meine Armbanduhr?«, fragte er.
»Keine Ahnung«, erwiderte ich wahrheitsgemäß und ließ die Abwaschbürste in der Spüle in einem Topf kreisen.
Chris deutete auf die Arbeitsplatte neben der Kaffeemaschine.
»Ich hatte sie abgemacht und da hingelegt, als ich vorhin raus bin. Hast du sie weggeräumt?«
Ich verneinte mit einem gebrummten »Mmm – mmm«.
»Immer räumst du meine Sachen weg, und ich muss dann suchen.«
Es ging schon wieder los. Schneller als gewöhnlich kam Chris an diesem Abend von einem speziellen Fall zu der Verallgemeinerung »immer«. Seine Schlagworte waren »immer« und »nie«.
So etwa wie: »Nie hörst du mir zu. Das machst du immer so.«
Und, um in seinem Jargon zu bleiben, antwortete ich: »Ich hab noch nie deine Uhr weggeräumt. Und heute schon gar nicht.«
Es folgten die üblichen Erklärungsversuche seinerseits: »Wahrscheinlich erinnerst du dich nicht mehr.« Und »Vielleicht hast du sie ja mit dem Altpapier zusammen in den Müll geworfen.« Und außerdem »Wenn du nur mal kurz nachdenken würdest, dann wüsstest du, wo du meine Uhr hingelegt hast.«
Mittlerweile war ich mit dem Abwasch fertig. Ich drehte mich zu ihm um, blieb aber an der Spüle stehen und spielte mit.
»Ich hab deine blöde Uhr nicht weggeräumt. Ich hab sie auch nicht gesehen. Wer weiß, wo du sie abgemacht hast. Vielleicht in der Werkstatt.«
Und das Ping-Pong-Spiel ging weiter.
»Ich werde mich ja wohl noch erinnern, wo ich meine Uhr abgemacht habe. Nämlich hier, in der Küche.«
»Und ich werde mich ja wohl noch dran erinnern, dass ich sie nicht weggeräumt habe.«
Dann kam die nächste Streit-Phase. Wie üblich wurden nun Situationen aus der Vergangenheit als Beweismittel herangezogen. Diesmal sein Geburtstag von vor drei Jahren. Wir erwarteten Gäste und Chris hatte sich im Schlafzimmer zwei Krawatten rausgesucht und auf das Bett gelegt. Danach war er ins Bad gegangen. Derweil hatte ich in meinem Kleiderschrank herumgestöbert und mich zunächst für ein dunkelgraues Cocktailkleid entschieden, welches in die engere Wahl kommen sollte. Ohne mich wirklich umzudrehen, warf ich das Kleid aufs Bett und setzte meine Suche nach passender Abendgarderobe fort. Was ich nicht bemerkt hatte, war, dass Chris’ Krawatten von meiner Vorauswahl verdeckt worden waren. Als mein Gatte zurück ins Schlafzimmer kam, stellte er fest: »Meine Krawatten sind weg. Hast du meine Krawatten gesehen?«
Hatte ich nicht.
»Ich habe eben gerade zwei Krawatten rausgelegt. Die einfache Braune, und die Dunkelblaue mit den schmalen Streifen. Hast du die irgendwie weggeräumt?«
Hatte ich nicht. Ich hatte ja lediglich mein Kleid auf das Bett geschmissen, ohne zu bemerken, was es verdeckte.
Chris deutete mit ausgestrecktem Zeigefinger auf mein Cocktailkleid und sah mich böse an.
»Da haben sie gelegen. Und jetzt sind sie nicht mehr da!«
Um ihn zu beruhigen, schob ich das Kleid beiseite. Blöderweise hatten sich seine Schlipse aber irgendwie an der Spitze, die den weit ausgeschnittenen Rücken zierte, verhakt. Das Ergebnis: Die Krawatten schoben sich mit zur Seite, was ich in dem Moment natürlich nicht realisierte.
»Hier sind sie nicht«, sagte ich lapidar und widmete mich wieder meinem Schrank. Chris hüpfte wie Rumpelstilzchen durch die Wohnung, zweifelte an seinem Verstand, und band schließlich gar keine Krawatte um.
Der Abend mit den Gästen war eine zähe Katastrophe. Mein Mann hatte schlechte Laune und kippte sich einen Wodka nach dem anderen hinter die Binde. Und das Finale Grande kam dann in der Nacht, als ich beim Wegräumen meines Kleides seine Binder entdeckte. Meine Bemühungen, das Ganze als »total unglückliche, aber irgendwie auch lustige Verkettung von ungeplanten Umständen« darzustellen, scheiterten.
Allerdings: Chris rastete nicht aus; er schrie mich auch nicht an. So etwas machte er nie. Er hatte eine andere Art der Bestrafung. Zwei, drei bissige Sätze.
»Das hast du mit Absicht gemacht. Du wolltest mich lächerlich machen. Aber du wirst schon sehen, was du davon hast.«
Und dann herrschte Funkstille. Ich konnte mich entschuldigen, jammern, weinen, flehen … nichts half. Chris würde mindestens vierundzwanzig Stunden gar nicht mit mir sprechen. Und dann so eins, zwei Tage nur das Nötigste. Seine Art von Bestrafung. Und in der Regel funktionierte das bei mir. Am Ende gab ich mir die Allein-Schuld und war dankbar, wenn Chris irgendwann entschied, wieder zur Normalität zurückzukehren. So viel zur Backstory. Denn in Sachen »verschwundene Uhr« passte nun die alte Geschichte »verschwundene Krawatten« haargenau in sein Plädoyer.
»Ach. Und was war damals mit den Krawatten? Wer hat denn Stein und Bein geschworen, nichts damit zu tun zu haben? Hmm? Und am Ende warst du es doch!«
»Nun komm doch nicht mit dieser alten Geschichte«, gab ich zurück, »ich hab dir tausend Mal gesagt, dass es mir leid tut. Aber deine Armbanduhr hab ich wirklich nicht gesehen. Ehrlich.«
Üblicherweise würde die Klärung der Sachlage nun erst mal ausgesetzt, und eine Grundsatz-Diskussion eingeleitet. Am Ende würde Chris unsere ganze Beziehung in Frage stellen, und leise, kopfschüttelnd, aber immer noch so, dass ich es hören könnte, sagen: »Manchmal weiß ich gar nicht mehr, warum ich dich überhaupt geheiratet habe.«
Um das zu umgehen, verließ ich die Küche, machte meine Abendtoilette und ging ins Bett. Ausgestanden war das Ganze aber noch lange nicht. Während ich im Schlafzimmer noch in einer schwedischen Modezeitschrift blätterte, schaute mein Mann eine Etage tiefer fern. Irgendwann machte ich das Licht aus und wollte schlafen. Was nicht ging, da meine Blase mich aufforderte, noch einmal aufs Klo zu gehen. Natürlich hatte ich keine Lust dazu. Wälzte mich noch gute zehn Minuten hin und her, gab dann aber doch dem Harndrang nach. Aufstehen. Abmarsch Richtung Pipi-Box.
Als ich aus dem Schlafzimmer kam, hatte Chris gerade seinen Fernsehabend beendet und stiefelte die Treppe hoch, mir entgegen. Auf der obersten Treppenstufe kam es zur Begegnung. Eigentlich wollte ich irgendwas beiläufig Nettes, wie »Na, was haste Schönes geguckt?« sagen, an ihm vorbeihuschen und im Bad verschwinden. Doch er ließ mich nicht. Chris versperrte die Treppe.
»Ich hab nachgedacht …«, begann er, und das bedeutete in der Regel nichts Gutes. »Wir müssen uns unterhalten!«, fuhr er fort.
»Gleich«, sagte ich, »ich muss nur schnell Pipi.«
»Du wirst es ja wohl noch einen Augenblick aufhalten können«, bestimmte mein zu-der-Zeit-noch-lebender Gatte. Doch ich hatte es ja schon lange genug aufgehalten. Es war klotechnisch für mich höchste Eisenbahn.
»Ich mach auch ganz schnell«, erwiderte ich leicht flehend, aber ich merkte, dass ich auf einmal richtig sauer auf Chris wurde. So sauer, wie ich, denke ich, noch niemals zuvor auf ihn war. Und dann ging alles ratz-fatz. Bei dem Versuch, mich an ihm vorbeizudrängen, könnte ich ihn geschubst haben. Oder er hatte das Gleichgewicht verloren, als er mich eben nicht vorbeilassen wollte. Oder … was weiß ich. Wackel, zappel, Arme rudern. Doink, doink, doink. Und unten lag er.
Wenn ich das so der Polizei erzählen würde, dachte ich auf der Schüssel sitzend und abwesend auf die Packung OB in meiner Hand starrend, könnten doch einige Zweifel an meiner Unschuld aufkommen.
Um mich zu sammeln, brauchte ich noch ein paar Minuten. Als ich die Toilette verließ, schloss ich kurz die Augen und betete, dass alles nur ein Traum war. Keine Leiche im Flur, sondern maximal ein schnarchender Chris im Bett. Aber meine Gebete wurden nicht erhört. Der beleibte Körper, der meinem Mann gehörte, lag unverändert an derselben Stelle.
Ich machte große Gazellenschritte, stiegt über ihn weg und ging nach oben ins Schlafzimmer. Jogginghose und Sweater an, und dann wieder runter. Ich griff zum Telefonhörer und wählte die Nummer des Notrufs.
»Ja hej. Vanessa Hellberg här. Något hände. Ni måste komma.« Es ist etwas passiert. Ihr müst kommen.
Etwa eine Dreiviertelstunde später war der Krankenwagen bei uns. Die Polizei im Schlepptau. Der Sanitäter konnte erwartungsgemäß nur den Tod feststellen. Ein uniformierter Gesetzeshüter fragte mich, wie das Ganze denn passiert sei. Ich erklärte kurz und ohne Ausschweifungen: Chris ist die Treppe runtergefallen.
Erstaunlicherweise schien dem Beamten diese Antwort zu genügen. Die Polizei machte nicht einmal Fotos. Man rief einen Leichenwagen, und mein dicker Chrissy wurde abtransportiert. Ein weiterer Polizist kam zu mir, fragte, ob er jemanden anrufen solle, damit ich nicht allein hier bleiben müsse. Erst jetzt fiel mir auf, dass ich mich die ganze Zeit über sehr kühl und teilnahmslos verhalten hatte. Wäre es nicht besser, die trauernde Hinterbliebene zu spielen? Mich nervte es schon immer, wenn in TV-Krimis die Angehörigen von Mordopfern theatralisch zusammen brachen. Und in meinem Fall war es wahrscheinlich jetzt ohnehin zu spät, um sich urplötzlich in Tränen aufzulösen. Das würde mich eher verdächtig machen. Also setzte ich auf die »Ich stehe unter Schock«- Nummer.
»Ja … nej … det går bra … jag vet inte …«, stammelte ich. Ja, nein … es geht gut … ich weiß nicht.
Die beiden Polizisten schauten sich an. Ich stünde offensichtlich unter Schock, raunte der eine dem anderen zu. Bingo. Ich war wohl überzeugend. Trotzdem konnte es nicht schaden, noch einmal nachzulegen. So schüttelte ich heftig den Kopf und betonte, dass alles gut sei. Alles okay. Es ginge mir gut. Echt. Es wäre alles nur … ach, ich weiß auch nicht.
Dann zitterte ich ein bisschen. Polizist 1 rief nach dem Sanitäter. Er hatte Sorge, dass ich zusammenbrechen würde. Man beschloss, mich ins Bett zu bringen, und mir ein Beruhigungsmittel zu verabreichen. Damit war ich einverstanden.
Polizist 2 versprach, die Haustür abzuschließen, und den Schlüssel durch das angekippte Küchenfenster zurück in die Wohnung zu werfen. Ich hörte noch die Bitte, ich möge mich am nächsten Tag auf dem Revier melden. Dann schlief ich ein.
Das Diazepam, oder was auch immer mir der Sani gegeben hatte, wirkte hervorragend. Die klare Wintersonne lugte über mein Fensterbrett ins Schlafzimmer und weckte mich am späten Vormittag. Ich fühlte mich entspannt und ausgeruht, was vielleicht am Beruhigungsmittel lag, vielleicht aber auch daran, dass die Nacht über kein dicker Chris neben mir geschnarcht hatte.
Der gestrige Abend lag Lichtjahre zurück. Ich wollte am liebsten im warmen, kuscheligen Bett bleiben, um nicht mit einem Gang durchs Haus die Geschehnisse erneut aufleben zu lassen. Meine linke Brust juckte ein wenig. Es gibt Schnee, sagte eine Stimme in mir. Der blödeste Spruch überhaupt. Keine Ahnung, wer den erfunden hatte. Aber sowohl meine Mutter als auch meine Großmutter, und alle meine Freundinnen kannten den vermeintlichen Zusammenhang zwischen Schneegestöber und Busenkribbeln.
Es half alles nichts. Es wurde Zeit zum Aufstehen. Mit leicht steifen Beinen tippelte ich vom Schlafzimmer in den Flur und verharrte dann oben am Treppenabsatz. Nichts deutete auf das hin, was am Vorabend hier passiert war. Kein Blut, nicht mal eine Spur davon, war auf dem Boden auszumachen. Vielleicht hätte Dexter mit Luminol und Schwarzlicht etwas zum Vorschein gebracht. Meine Pupillen jedenfalls, waren nicht für die Kriminaltechnik geeignet.
Ich schloss die Augen, aber es gelang mir beim besten Willen nicht, mich an die exakte Lage von Chris’ totem Körper zu erinnern. Er war einfach nicht mehr da. Weder physisch, noch spirituell.
Jetzt brauchte ich erst mal einen Kaffee. In der Küche befüllte ich den Perkolator, die genialste Kaffeemaschine, die es gibt, mit Wasser und Löfgrens Lila mittelstarkes Kaffeepulver. Während das Lebenselixier von Getränk aufgebrüht wurde, verschwand ich kurz im Bad. Auf einmal hatte ich Lust auf eine Zigarette.
Als ich vor zwanzig Jahren mit Klein-Micha schwanger war, hatte ich mit dem Rauchen aufgehört. Davor war ich zwar auch keine Kettenraucherin gewesen, aber die Zigarette zum Morgenkaffee hatte ich immer gebraucht. Ich wusste, dass Chris ab und zu heimlich geschmökt hatte. Nie im Haus. Aber gelegentlich in seiner Werkstatt oder wenn er mit Freunden unterwegs war. Seine Winterjacke hing im Flur am Garderobenhaken. Die Innentasche war ausgebeult und ich lag mit meiner Vermutung richtig: Hier waren noch ein paar Kippen zu finden. Und sein Handy. Ich nahm beides und ging zurück in die Küche.
Der Kaffee war fertig. Etwas Milch dazu, und mit einer dampfenden Tasse in der Hand setzte ich mich an den Küchentisch. Füße hoch, auf den Stuhl gegenüber. Dort, wo mein Ex immer gesessen hatte. Mir fiel auf, dass der Nagellack an meinen Zehen schon ganz schön traurig aussah. Neu malen, setzte ich auf meine geistige To-Do-Liste. Der heiße, braune Saft tat gut. Ich holte eine Zigarette, eine Lucky Strike, aus der Schachtel, steckte mir den Glimmstängel in den Mund und ließ das Feuerzeug, welches Chris ebenfalls in der Schachtel hatte, klicken. Schon der erste Zug setzte jahrzehntealte Erinnerungen frei.
Meine beste Freundin zu Unizeiten, Catrin, mit der ich zusammen Grafikdesign studiert hatte, war damals meine »Rauch-Schwester«. Catrin und ich waren quasi unzertrennlich. Wir waren x-mal gemeinsam im Urlaub, sahen uns fast jeden Tag, und wenn nicht, telefonierten wir miteinander. Unsere Schwesternschaft lockerte sich erst, als ich Chris, und sie Arnim kennenlernte. Männer bringen alles durcheinander. Jedenfalls hatten Catrin und ich eine Art Ritual. Wann immer wir irgendwo zusammen waren, ob an einem Waldsee oder in der Stadt an einem Brunnen, egal ob es uns dort gefallen hatte oder nicht, eine von uns sagte unter Garantie: »Los, das müssen wir abrauchen.« Heißt: Kippe an, in die Runde gucken und sagen: »Schön hier!« Oder alternativ: »… also hier müssen wir nicht wieder hin.«
Meine Lungenflügel explodierten. Aber im positivsten Sinn, den man sich für dieses Wort vorstellen kann. Kaffee und Zigarette. Eine Kombination, die sich der Teufel ausgedacht haben musste, aber trotzdem einfach himmlisch.
»I’m too sexy for my shirt – too sexy for my shirt – so sexy it hurts!« Right Said Fred, riss mich aus meinen Rauchwölkchen. Der Klingelton von Chris’ Handy. Ich schaute aufs Display und las das Wort älskling – Liebling – und damit war augenscheinlich nicht ich gemeint, denn ich rief ihn ja in dem Moment gar nicht an. Eine leichte Übelkeit überfiel mich. Sicher vom Nikotin. Aber sicher auch von der Befürchtung, der Verdacht, den ich schon eine Weile hegte, könnte sich bestätigen.
»… I’m too sexy …« Dann Stille. Aufgelegt.
Älskling. Hm. Älskling könnte Malin sein, die junge Schwedin, die Chris vor ein paar Monaten beim Angeln kennengelernt hatte. Im Sommer war Jörg, ein alter Schulfreund von Chris, aus Deutschland, bei uns zu Besuch gewesen. Jörg – mehr ein Würgelaut als ein Name. Egal. Jedenfalls, die beiden sind regelmäßig zum Angeln gefahren. Mein damals-noch-lebender-Gatte war eigentlich nie ein großer Angel-Fan gewesen, und, wie er betonte, nur Jörg zuliebe mitgegangen.
»Er wohnt in Berlin. Da gibt’s keine Natur. Und wenn er Spaß dran hat … So oft ist Jörgi ja auch nicht hier.«
Auf einem dieser Angelausflüge haben Jörg-Würg und Chrissy dann einen älteren Polen kennengelernt, der mit seiner Anfang dreißigjährigen Tochter Zackenbarsche aus dem See ziehen wollte. Der Pole, verheiratet mit einer Schwedin, lebte schon seit den Achtzigern in Schweden, und seine Tochter war hier geboren. Lange Rede, kurzer Sinn: Die Angelfreunde nebst Angelfreundin unterhielten sich nett, trafen sich am nächsten Tag wieder, und nachdem Jörgi abgereist war, hatte Chris auf einmal seine Leidenschaft fürs Angeln entdeckt.
Und ich, blauäugig wie ich war, habe mich sogar darüber gefreut, dass mein Gemahl nun ein Hobby hatte und ab und zu mal an die frische Luft kam. Von dem Fisch namens Malin, den er sich wohl an Land gezogen hatte, hab ich natürlich nichts gemerkt. Wie auch? Seine Tarnung war perfekt. Seine Hemden rochen nicht nach dem Parfum einer anderen, sondern nach Fisch. Die ultimative Kaschierung von fremden Gerüchen. Und selbst Sex hätten die beiden unbemerkt haben können, wenn man vorgibt, vom Angeln zu kommen und nach Fisch zu stinken.
Ein einziges Mal hab ich diese Fischfrau getroffen. Chris und ich waren in Mora beim ICA-Supermarkt. Wochenendeinkäufe machen. Üblicherweise war ich diejenige, die das Lebensmittelshopping immer schnellstmöglich hinter sich zu bringen versuchte. Für mich gibt es zwei Arten von Shopping. A) Das praktische, und B) das Genuss-Shopping. Unter A) fallen Klopapier, Zwiebeln, Milch, Joghurt und Käse und so weiter. B) sind Handtaschen, Schuhe, Parfum, aber auch ein guter Wein und zum Beispiel Fasan aus der Delikatessenabteilung. A) muss schnell gehen, B) darf ewig dauern.
Aber Chris war ein Supermarkt-Junkie. Wenn es eine neue Sorte Joghurt gab, blieb er fünf Minuten vor dem Kühlregal stehen und las die Etiketten. Ihn interessierten Fragen wie »Ist das Mangoaroma künstlich, oder kann das Produkt tatsächlich Spuren von echten Mangos enthalten?« mehr als der Preis. Aber an diesem Tag trieb er mich quasi vor sich her, Richtung Kasse. Immer einen Seitenblick in die abgehenden Gänge werfend. Fast waren wir schon an den Süßigkeitenregalen vorbei, als wir mit Malin zusammenstießen. Zunächst erschrak die junge, schlanke, fast hagere Frau und sah sich hektisch um, doch dann: »Ach, was für ein Zufall«, gab sie breit grinsend von sich.
»Ja, ja. Was für ein Zufall. Nein. So ein Zufall aber auch …«, blubberte Chris zurück.
Meine Nachfrage ergab: Die beiden kannten sich nur total, total flüchtig. Schnelle, förmliche Verabschiedung, und nix wie raus aus dem ICA, war seine Taktik.
Im Auto, auf dem Heimweg, stellte Angelmeister Chris ungefragt noch unzählige Male fest, dass Malin wirklich nur eine echt total flüchtige Bekannte sei, und das Treffen im Supermarkt … »Nein, so ein Zufall aber auch.«
Und ich ließ es auf sich beruhen, ohne Verdacht zu schöpfen. Jetzt gehe ich davon aus, dass sein Drängen zur Kasse damit zu tun hatte, dass er seine Angelfreundin bereits im Laden erspäht hatte, und ein Zusammentreffen von mir und ihr tunlichst vermeiden wollte.
Und jetzt hatte älskling angerufen. Doch damit wollte ich mich jetzt nicht beschäftigen.
Okay, dachte ich, was liegt heute an? Ich drückte meine Zigarette aus, nahm einen Schluck Kaffee und steckte mir danach direkt die nächste an. Seit sich Chris vor einiger Zeit in seiner kleinen Werkstatt mehr mit seiner Selbstfindung, als mit Geldverdienen beschäftigt hatte, war mein Job die einzige Einnahmequelle der Familie. In Deutschland hatte ich als Grafikdesignerin gearbeitet. Und hier in Schweden war meine Beschäftigung nun Kassiererin im Baumarkt Byggmax. Tolle Karriere.
Es war Montag, und ich hatte die Nachmittagsschicht und keinen Bock drauf. Dass der Ehemann gestorben war, sollte wohl Grund genug für eine Krankmeldung sein. Ein Anruf in der Zentrale, und ich bekam vom Chef die ganze Woche frei. Das ist das Schöne in Schweden. Die allermeisten Vorgesetzten, angefangen beim Kiosk um die Ecke bis hin zu großen Konzernen, haben Verständnis für Krisensituationen der Mitarbeiter. Und solange es die Personallage zulässt, wird niemand darauf bestehen, dass man zur Arbeit kommt, wenn man ein persönliches Down hat.
Gut. Das mit dem Job wäre geklärt. Jetzt würde ich duschen, und dann wollte ich mich auf den Weg zur Polizei machen.
»Pling – Pling.«
Chris’ Handy hatte eine SMS bekommen. Eine Nachricht von älskling.
Din tant jobbar på eftermiddagen, eller? Ska vi träffas kl. 3? AmSä?
Deine Tante (damit war wohl ich gemeint) arbeitet doch heute Nachmittag, oder? Sollen wir uns um drei treffen? AmSä?
AmSä! Das war unsere Abkürzung für Amåsäng. Ein kleiner, idyllischer Platz am Nordzipfel des Siljan Sees.
Dass sich mein Verstorbener mit dieser polnischen Schwedentusse traf, war schon eine Sache. Aber noch dazu an der Stelle, die er und ich als romantisch auserkoren hatten. Und dann benutzte sie auch noch unsere Abkürzung. Frechheit. Ich war angefressen. Fast hätte ich meinem Impuls, ihr zu antworten und zu schreiben »Dein Stecher ist tot«, nachgegeben. Doch dann dachte ich, dass ich sie eigentlich auch noch ein bisschen zappeln lassen könnte. Also simste ich zurück: »Okej, älskling. Vi ses« – alles klar. Wir sehen uns. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Sollte die Tusse doch heute Nachmittag am See auf ihn warten. Hoffentlich würde es einen fetten Eisregen geben. Sie würde dann zu ihrem Auto zurückrennen, über eine vereiste Wurzel stolpern, hinfallen und erfrieren. Oder so ähnlich. Na ja. Nass werden und zittern wäre auch schon ein Anfang.
Aufgeraucht, Kaffee ausgetrunken, geduscht, angezogen. Und dann los, zur Polizei. Die Vernehmung war tatsächlich reine Formsache. Alle auf dem Revier zeigten sich mir gegenüber von ihrer nettesten Seite. »Möchtest du einen Kaffee, Vanessa? – Kann ich was für dich tun, Vanessa? – Ruf an, wenn was ist, Vanessa!«
Ich unterschrieb das Protokoll. Niemand verdächtigte mich, etwas mit dem tödlichen Sturz von Chris zu tun gehabt zu haben. Todesursache: Genickbruch. Unfall.
Nach einer halben Stunde stand ich draußen auf dem Parkplatz der Polizeiwache, lehnte an meinem Auto und rauchte eine Lucky Strike. Die Uhr sagte 14:32. Hm. Wenn ich jetzt direkt losfahren würde, wäre ich kurz vor drei an der AmSä-Stelle. Nicht lange nachdenken. Auf ging’s.
Da ein Traktor auf der schlecht geräumten Landstraße mehrere Kilometer vor mir her zuckelte, bog ich erst kurz nach drei in den Waldweg, der zum See führte. Eine Reifenspur zog sich vor mir durch den Schnee. Hinter einem großen Holzstapel am Wegesrand stellte ich meinen Wagen ab, stieg aus und ging zu Fuß bis zum Rand des Waldes. Auf dem kleinen Parkplatz neben dem Anleger stand ein roter VW Golf. Am Steuer saß eine Frau: Malin. Eine große Holztafel, die eine Karte vom Siljan-See und der Umgebung zeigte, gab mir Deckung. Von meiner Position aus konnte ich das Auto beobachten, ohne selbst gesehen zu werden. Vielleicht fünf Minuten verharrte Malin mehr oder weniger regungslos in ihrem Wagen. Dann stieg sie aus und sah sich um.
Tja, Fräulein, kein Chrissy weit und breit, dachte ich fast schadenfreudig. Ich könnte jetzt hingehen und ihr sagen, dass sie sich einen neuen Lover suchen kann. Denn ihr Angelfreund würde hier, und auch überall anders, sicher nicht mehr auftauchen. Malin zog ihr Handy aus dem Mantel und wählte eine Nummer. Mist. Ich hatte Chris’ Telefon auf dem Küchentisch liegen lassen. Das hieß, wenn ich nach Hause komme, hätte er wohl ein Dutzend Anrufe in Abwesenheit. Augenscheinlich genervt steckte Malin ihr Handy wieder ein, stieg zurück in den Golf und fuhr davon.
Als ich sicher war, dass sie den AmSä-Platz nicht mal mehr im Rückspiegel sehen könnte, kam ich aus meinem Versteck und ging zum See. Hier hatten Chris und ich die einzigen schönen Momente der letzten Jahre gehabt. Hier, auf dem Steg, hatten wir in der Abenddämmerung gesessen, die Füße im Wasser. Er nahm mich in den Arm und versicherte mir, dass alles gut wird. Kurz zuvor hatte er seinen Job als Mechaniker in einer kleinen Autowerkstatt in Mora gekündigt.
»Die Schweden haben keine Ahnung von Autos!«, gab er als Begründung an.
»Aber sie bauen Volvo«, hielt ich dagegen.
»Okay. Volvo. Gutes Auto. Geb ich zu. Aber da in dem Konzern ist kein einziger schwedischer Ingenieur. Das Knowhow haben die Schweden alles aus dem Ausland.«
Ich nickte nur, obwohl ich wusste, dass das nicht wahr ist. Aber ich wollte den Moment hier am See genießen, und nicht streiten.
»Aber ich spreche ja gar nicht von Volvo«, erklärte Chris mir weiter,»es geht um die Kollegen bei Svenssons Bil. Alles Pfuscher. Schrauben ein bisschen an den Autos rum, und dann ist auch schon wieder fika.« Die schwedische Kaffeepause. Eine willkommene Arbeitsunterbrechung, die den Schweden tatsächlich heilig ist. Mehrmals am Tag lässt das Personal in sämtlichen Betrieben in ganz Schwedenland von jetzt auf gleich die Stifte, Schraubenzieher oder Stethoskope fallen, und begibt sich zum rituellen Kaffeetrinken. Ganz gleich, ob der Patient im OP kurz vor dem Abnippeln ist, oder zwanzig Kunden vor dem Postschalter warten. Fika ist fika. Die Pause wird durchgezogen. Wer trotzdem weiterarbeitet, macht sich schnell unbeliebt. Wie mein Gatte.
»Aber ich lasse mir nicht von denen sagen, wie ich zu arbeiten habe. In Deutschland hätte es so was nicht gegeben!«
Nein, dachte ich, aber in Deutschland ist deine kleine Werkstatt trotzdem Pleite gegangen. Chris drückte mich an sich heran und lächelte.
»Das ist ja jetzt vorbei. Weißt du, ich habe das alles genau durchgerechnet. Ich werde hier eine eigene Autoreparaturwerkstatt aufmachen. Chris Hellbergs Bil-Service. Autoreparatur mit deutscher Präzision. Du wirst sehen. Das werden die Schweden lieben.«
Er schwadronierte weiter und weiter. Voller Begeisterung, wie toll er das machen würde. Und sein Optimismus steckte mich an. Als wir da so saßen, hatte ich tatsächlich das Gefühl, es könne sich tatsächlich alles zum Guten wenden.
Doch das tat es nicht. Chris steckte unsere ganzen Ersparnisse in seine kleine Werkstatt, aber die Kunden blieben aus. Ich nehme an, dass sich sein arrogantes Auftreten bei seiner ehemaligen Firma rumgesprochen hatte. Die Ex-Kollegen, denen er Unfähigkeit vorwarf, haben sicher nicht sprachlos rumgesessen. Sie werden jedem gesagt haben, dass man sein Auto bei »so einem« wie diesem Deutschen bloß nicht zur Reparatur geben soll. Und die Schweden halten zusammen. Die einzigen Kunden, die Chris in den paar Monaten, in denen seine Werkstatt geöffnet hatte, waren Ausländer gewesen. Ausländer mit schlechter Zahlungsmoral. Der Bankrott war vorprogrammiert.
Doch daran wollte ich nicht glauben, damals, auf dem Steg im Sonnenuntergang. Die Nähe und die Hoffnung waren wichtig. Mehr nicht. Und jetzt war beides fort. Ich ging den Waldweg zurück zu meinem Auto, doch ich fuhr nicht sofort los. Gedankenverloren saß ich auf dem Fahrersitz, im Autoradio lief Let her go von Passenger.
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Alles auf Anfang. Was würde jetzt aus mir werden? Seit schätzungsweise fast einem halben Jahr hatte Chris mich betrogen, und ich hatte nichts davon gemerkt. Erst, als er es mir sagen wollte. Gestern Abend auf der Treppe. Wie war das noch mal? Ich versuchte angestrengt, mich zu erinnern. Ich kam also aus dem Schlafzimmer, weil ich aufs Klo musste. Und Chris kam die Treppe hoch und versperrte mir den Weg.
»Ich hab nachgedacht …«, hatte er begonnen, und das bedeutete in der Regel nichts Gutes. »Wir müssen uns unterhalten!«, fuhr er fort.
»Gleich«, sagte ich, »ich muss nur schnell Pipi.«
»Du wirst es ja wohl noch einen Augenblick aufhalten können«, bestimmte mein zu-der-Zeit-noch-lebender Gatte.
Plötzlich wurden meine Erinnerungen klarer. Ich sah ihn vor mir.
Seine Augen sagten mir, dass er jetzt wirklich etwas Wichtiges loswerden wollte. Also blieb ich stehen und wartete auf seine Bekanntmachung.
»Eigentlich habe ich auf den richtigen Zeitpunkt gewartet,« fuhr er fort, »aber für so was gibt es wohl nie einen richtigen Zeitpunkt.«
Ich verstand nicht, worauf er hinauswollte.
»Ich liebe dich nicht mehr!«
Es begann in meinen Ohren zu pfeifen. Das hatte er jetzt nicht wirklich gesagt, oder?
»Es gibt da …«, druckste er herum.
Das Pfeifen wurde immer lauter. Ich hatte das Gefühl, mein Kopf platzt. Ein paar Sekunden für mich, war alles, was ich jetzt haben wollte. Nur ein paar Sekunden.
»Können wir gleich weiterreden?«, sagte ich, »ich muss jetzt echt aufs Klo!«
»Das machst du immer!«, keifte Chris mich an. »Immer, wenn ich was mit dir besprechen will, machst du ’nen Rückzieher.«
Besprechen, dachte ich, was will er denn besprechen? Dass er mich womöglich betrügt, und dass ich das so hinnehmen müsse? Piep! Der Ton in meinem Kopf war kaum noch auszuhalten.
»Lass mich jetzt bitte vorbei. Ich möchte erst mal auf’s Klo«, versuchte ich möglichst sachlich meine Bedürfnisse zu formulieren. Dann versuchte ich, mich an ihm vorbeizuquetschen.
Chris wurde sauer. Er packte mich am Oberarm. Richtig fest. So was hatte ich von ihm noch nie erlebt.
»Mann! Von welchem Stern bist du denn?«, brüllte er mich an. Mehr war nicht zu verstehen. Der Pfeifton überdeckte komplett alle anderen Geräusche. Ich sah, dass Chris Mund auf und zu ging. Ich verstand nicht, was er schrie. Ich wollte nur noch weg. Weg!
Klopf! Klopf! Es hämmerte kräftig gegen die Seitenscheibe meines Autos. Ich erschrak. Draußen stand Malin. Sie riss die Tür auf und sah mich an, als sei ich ein Monster.
»Du hast ihn umgebracht!«, donnerte sie mich an.
Dann griff sie meinen Arm und zerrte mich aus dem Auto. Ich war völlig überrumpelt. Sie stand plötzlich über mir, während ich auf dem Waldweg im Schnee lag.
»Du hast ihn umgebracht!«
»Es war ein Unfall!«, schrie ich unter Tränen. Die Frau spuckte mich an. Doch plötzlich stand nicht mehr Malin über mir, sondern Chris.
»Du hast mich umgebracht!«
»Es war ein Unfall! Ich wollte nur an dir vorbei. Ich musste pinkeln.«
»Und deshalb hast du mich gestoßen? Nur, weil du aufs Klo wolltest?«
»Du hast mir wehgetan. Ich habe fette Blutergüsse am Oberarm.«
»Scheiß auf deinen Oberarm. Du hast einfach nicht wegzugehen, wenn ich mit dir rede!«
»Es tut mir leid!«, wimmerte ich.
»Was?«, hakte Chris nach, »dass du mir nicht zuhören wolltest, oder, dass du mich die Treppe runtergeschubst hast?«
»Beides!«, brüllte ich, »Beides!«
Chris holte zum Schlag aus, und ich kniff die Augen zusammen.
Dann hörte ich ein Auto davonfahren. Zitternd rappelte ich mich aus dem Schnee hoch und zog mich auf den Fahrersitz meines Wagens. Malin war weg. Und die Vision von Chris verblasste langsam.
»Ich wollte doch nur an dir vorbei und aufs Klo!«, jammerte ich laut, »mehr nicht. Und dann ist es irgendwie passiert!«
Hektisch zog ich meine Jacke aus und schob den Ärmel meines Pullis hoch. Am Oberarm hatte ich einen dicken Bluterguss.
Asaf Avidan and the Mojos sangen im Radio:
One day, baby, we’ll be old
Oh Baby we’ll be old
And think of all the stories that we could have told.