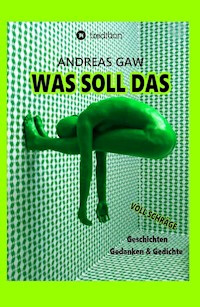3,99 €
Mehr erfahren.
Lars ist Journalist und leidet unter Depressionen. Seine Frau hat ihn betrogen und verlassen, seinen Job ist er auch los, und überhaupt: Es ist alles ätzend. In einer Esoterik-Gemeinschaft, die sich "Töchter des Mondes" nennt, sucht er Hilfe für seine seelische Krise. Anfangs scheint die Gruppe ihm gutzutun, doch bald merkt Lars, dass er in eine gefährliche Sekte geraten ist. Außerdem sind die Mondtöchter in diverse illegale Geschäfte verstrickt. Als Lars den Machenschaften auf den Grund geht, gerät er zwischen die Fronten von Drogenhändlern, arabischen Clans, gewaltbereiten Amazonen und schließlich auch noch der Polizei. Sein Leben ist in Gefahr. Einzige Hilfe ist Sara, die ihre Mutter sucht, welche von den "Töchtern des Mondes" verschleppt wurde. Doch jedes Mal, wenn es scheint, als würde sich alles aufklären, müssen die beiden feststellen: "Schlimmer geht immer!"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
SCHLIMMER GEHT IMMER
***
ANDREAS GAW
Vielen Dank an Birgit :-)
© 2024 Andreas Gaw
Website: www.allyoucanread.net ISBN: 978-3-384-20905-4
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Andreas Gaw, Villavägen, 36257 Ryd, Sweden.
Die Rechtschreibprüfung wurde final noch einmal mit einem KI – Rechtschreibtool durchgeführt. Bei Beschwerden, bitte an die KI wenden ;-)
Covergestaltung copyright 2024 Andreas Gaw
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Prolog – Die 80er und was danach geschah…
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Epilog
Der Autor:
Schlimmer geht immer
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Prolog – Die 80er und was danach geschah…
Der Autor:
Schlimmer geht immer
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
Prolog – Die 80er und was danach geschah…
Vor einiger Zeit habe ich von meinem seltsamen Studentenleben in den verrückten 80ern erzählt. „Legalize Erdbeereis“ war das Motto meiner Geschichte. Viel ist seitdem passiert.
Ich war tatsächlich ein paar Jahre mit meiner großen Jugendliebe Anne zusammen. Wenn ich, was leider sehr selten vorkommt, in meine alte Studentenstadt zurückreise, gehe ich nach wie vor in den Stadtwald und suche die alte Eiche, in die wir damals ein Herz und die Worte „Anne und Lars forever“ eingeritzt hatten. Allen Befürchtungen Annes zum Trotz hat der Baum es überlebt. Unsere Liebe leider nicht. Anfangs hatten wir eine echt tolle Zeit des Verliebtseins. Unzertrennlich. Bonnie und Clyde, Romeo und Julia, Dick und Doof, wobei ich bei Letzterem beide Attribute für mich in Anspruch nehmen kann. Irgendwann verflogen dann die Schmetterlinge im Bauch. Anne hatte sich für einen Medizinstudienplatz beworben und wartete auf Zusage, während ich mich durch die Sozialwissenschaften kämpfte. Als die Uni in München sie für das Studium der Humanmedizin zuließ, zögerte sie auch nicht lange und zog nach Bayern. Echt ey. Bayern. Zu den Lederhosen. Okay… sie spielt kein Fußball, aber trotzdem kam mir sofort der alte Tote Hosen-Song in den Sinn: „Ich würde niemals zum FC Bayern München gehen!“ Egal. Aber ich konnte ihren Entschluss natürlich verstehen.
Etwa ein Jahr lang führten wir eine Fernbeziehung. Zunächst besuchten wir uns im Wochenwechsel gegenseitig, doch als bei mir die Diplomprüfungen anstanden und auch Anne im Studium zunehmend Stress hatte, nahm die Frequenz der Besuche ab. Damals spürte ich schon, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein würde, bis unsere Beziehung in die Brüche gehen würde. Das ging dann allerdings doch schneller, als ich vermutete. Ein Verdacht, sie könne in München jemand anderen haben, lag in der Luft. Anne bestritt das, doch mein Bauchgefühl sagte mir das Gegenteil. Ich beschloss, ihr einen unangekündigten Besuch abzustatten. Also fuhr ich mit dem Zug nach Bayern, mein Auto war mal wieder in der Werkstatt – die goldene Zitrone - und ich quartierte mich in einer Jugendherberge in der Nähe des Olympiastadions ein. Anne wohnte nicht weit entfernt in einem Studentenwohnheim. Als ich sie abends überraschen wollte, marschierte ich genau in dem Moment um die Straßenecke, als ein dunkelblauer Mercedes vor dem Wohnheim hielt. Ein Mann im Anzug stieg aus, ging um den Wagen und öffnete die Beifahrertür. Old-school-Gentleman. Anne schwebte aus dem Auto direkt in seine Arme. Küssen, Knutschen, Tralala. Dann verschwand das Pärchen im Wohnheim. Ich schlich mich hinterher, lauschte an ihrer Tür und versuchte durch das Schlüsselloch zu schauen. Sehen konnte ich nichts, aber hören konnte ich das mir vertraute leise Stöhnen meiner Freundin. Okay. Alles klar. Mehr wollte ich nicht mitbekommen. Aber das hätte ich auch nicht, da mir der Hausmeister des Wohnheims in dem Moment einen heftigen Arschtritt verpasste, welcher mich bäuchlings auf das Linoleum des Flures knallen ließ.
„Moach, des doa di rausscherst, du dreck'ger Perverser!“, war seine Art, mir zu sagen, ich möge bitte das Gebäude verlassen.
An einem Kiosk holte ich mir ein paar Dosen Bier und platzierte mich auf einer Parkbank in der Nähe, mit Blick auf Wohnheim und Mercedes. Zum Glück war es eine milde Herbstnacht, sodass ich nicht fror, selbst wenn ich ein paarmal kurz wegdöste. Ein Obdachloser namens Harry leistete mir kurz Gesellschaft und verschwand, nachdem er mir zwei Bier und einen Fünfer aus dem Kreuz geleiert hatte.
Im Morgengrauen kam der Anzugträger aus dem Haus. Anne stand winkend am Fenster, als er wegfuhr. Kurz überlegte ich, sie zur Rede zu stellen, verwarf dann aber die Idee, als ich beim Aufstehen von der Parkbank das Gleichgewicht verlor. Schwerfällig quälte ich mich zur Jugendherberge und pennte den ganzen Tag.
Am Abend begab ich mich wieder auf meinen Beobachtungsposten. Das gleiche Spiel wie am Vorabend. Wagen hält, der Kavalier öffnet die Tür, die Turteltauben begatten sich schon fast auf der Straße und verschwinden dann im Wohnheim. Ich hatte genug gesehen. Einem kurzen Impuls folgend ließ ich die Luft aus den Mercedesreifen, mehr aber auch nicht.
Die Nacht verprasste ich Geld in Schwabing und am nächsten Tag fuhr ich heim. Einerseits war ich traurig, enttäuscht und niedergeschlagen, andererseits spürte ich in mir eine fast fatalistische Stimmung. Alles ist scheiße. Anne ist scheiße, die Welt ist scheiße, ich bin scheiße. Na und, dann ist es halt so. Tausend fixe Ideen, wie ich denn nun weiter taktisch vorgehen sollte, verwarf ich so schnell, wie sie in mir aufkeimten. Ich meldete mich nicht bei Anne, bis sie selbst zwei Tage später anrief.
„Ich hab schon ein paarmal probiert, dich zu erreichen“, polterte sie los. „Ich mach’ mir Sorgen. Wo warst du denn?“
Ich schwieg.
„Lars!“, ihr Ton wurde schärfer. „Lars, was ist los? Sag was? Wir müssen reden.“
Ja, dachte ich, das müssen wir. Und zwar darüber, dass du dich von einem bayerischen Schlipsträger durchvögeln lässt, während ich treudoof in der Provinz sitze.
Aber das sagte ich nicht. Stattdessen:
„Ja. Du hast recht. Wir müssen reden. Anne, ich habe da jemanden kennengelernt. Tut mir leid, aber ich habe mich verliebt.“
Schweigen.
„Hallo…“, sagte ich. „Hallo, bist du noch da?“
Anne schluchzte. Dann folgte eine Tirade von Vorwürfen, wie ich denn sowas tun könne, ob sie mir denn nichts mehr bedeuten würde, was für ein elendes Schwein ich sei, und noch weitere Vergleiche mit Tieren vom Bauernhof. Schließlich legte sie auf.
Ich war fix und fertig. Da hatte ich doch wirklich die Schuld auf mich genommen. So etwas kann nur ein ausgemachter Volltrottel tun. Naja, das war ich dann wohl auch. Lars, der Idiot. Ich fand keine rationale Begründung für mein Handeln. Ich hatte es einfach so gesagt. Spontan und ohne nachzudenken. Ich glaube, ich habe Anne in dem Moment noch mehr geliebt, als je zuvor.
Fast vier Wochen lang war Funkstille. Danach telefonierten wir noch ein paar Mal. Sachlich, nüchtern, ohne Emotionen. Wir schickten und gegenseitig unsere Sachen, die noch bei dem jeweils anderen in der Wohnung waren, zurück und versprachen uns, Freunde zu bleiben und den Kontakt nicht abreißen zu lassen. Leere Versprechen. Ich habe Anne seitdem nie wieder gesehen und auch nie wieder gesprochen. Bis heute weiß sie nicht, dass ich mir die Geschichte mit der neuen Freundin nur ausgedacht hatte.
Die nächsten Jahre blieb ich Single. Ich machte mein Diplom und anschließend ein Volontariat bei einer kleinen Provinzzeitung. Dort lernte ich Marion kennen, eine Redakteurin im Politikressort. Sie war taff und selbstbewusst. Das gefiel mir. Ich war nach wie vor der Träumer. Das gefiel ihr. Wir heirateten. Ich bekam eine Festanstellung bei der Zeitung. Wir kauften ein kleines Häuschen am Stadtrand und bemerkten kaum, wie die Jahre vergingen. Als die Zeitung von einem größeren Verlag aufgekauft wurde, bekam ich das Angebot, für ein Reisemagazin dieser Verlagsgruppe zu arbeiten. Ein cooler Job. Man reist in der Weltgeschichte herum, schreibt auf, was man so sieht, und bekommt dafür auch noch Geld. Ich war viel unterwegs, lernte Spanisch, Französisch und sogar Schwedisch. Oft war ich bis zu vier Wochen am Stück auf Reisen. Eines Tages kam ich aus Südamerika zurück und hatte ein Dejà-Vu. Marion hatte eine Affäre mit einem Anzugträger, in diesem Fall ein BMW-Fahrer. Diesmal musste ich die Schuld nicht auf mich nehmen, denn sie kam mir zuvor und trennte sich von mir. Es folgte die Scheidung und am Ende behielt sie das Haus und ich stand mit ein paar tausend Mark auf dem Konto auf der Straße.
Meinen Job wurde ich auch los, denn der Anzugträger war ein hohes Tier im Verlag, und selbstverständlich würde ich nicht mehr mit Marion in derselben Firma arbeiten können.
Ein kompletter Neuanfang musste her. Also zog ich nach Berlin und bekam dort Depressionen.
Als Deutschland am 4. Juli 2006 bei der Fußball-WM im Halbfinale gegen Italien ausschied, spielte ich mit dem Gedanken, mir das Leben zu nehmen. Allerdings nicht wegen des WM-Aus, sondern weil meine Panikattacken mir die Hölle auf Erden bescherten…
Erstes Kapitel
„Herr Schubert…“, sagte die vollbusige Krankenschwester und weckte mich aus meinem Dämmerschlaf. Ihr hübscher Busen weitete den weißen Kittel und ich wünschte mir in Zukunft immer mit einem derartigen Anblick aus den Träumen geholt zu werden. Im selben Moment fragte ich mich, warum sich eine Krankenschwester in meiner Wohnung aufhielt. Und ich fragte mich, ob eine männliche Krankenschwester wohl „kranker Bruder“ heißt. Egal. Vorsichtig versuchte ich, mich umzuschauen. Es war fast unmöglich den Kopf zu bewegen, denn ich trug eine Halskrause. Jeder Versuch, mich zu drehen, wurde mit starken Schmerzen quittiert. Aber zumindest stellte ich fest, dass ich nicht in meinen eigenen vier Wänden, sondern augenscheinlich im Krankenhaus war.
„Herr Schubert? Hören sie mich?“, fragte die Schwester leise.
Ich wollte „ja“ sagen, doch brachte nur ein „griggelgrrr“ heraus, was wohl auch daran lag, dass ich einen Schlauch im Mund hatte. Also blinzelte ich nachdrücklich, um zu bestätigen, dass die pralle Dame meine ganze Aufmerksamkeit hätte.
„Gut“, antwortete sie. „Frau Doktor kommt gleich.“
Wenn diese Schmerzen nicht wären, dachte ich, wäre das ein schöner Traum. Gleich würde eine Ärztin ins Zimmer kommen, ihren Kittel ablegen und in Strapsen für mich tanzen. Mit diesem Bild vor Augen musste ich wohl kurz eingenickt sein, denn ein erneutes „Herr Schubert“ holte mich zurück ins Krankenzimmer.
Eine ältere Frau mit schiefer Nase, kurzen grauen Haaren und Stethoskop um den Hals, anscheinend die Ärztin, beugte sich über mich.
„Wissen sie, warum sie hier sind?“, wollte Frau Doktor wissen.
Meinen gequirlten Laut interpretierte sie richtig als „nein“ und begann mit einer Erklärung für meinen Zustand.
„Sie haben Glück gehabt. Oder Pech, ganz wie man will. Ein Busch hat ihren Sprung vom Dach ihres Hauses abgefangen. Wenn man sich schon das Leben nehmen will, dann sollte man vorher ein wenig genauer hinsehen. Naja, jedenfalls sind sie mit Knochenbrüchen und einer Gehirnerschütterung davongekommen. Innere Organe sind nicht schwerwiegend verletzt. Sobald die Frakturen zu heilen beginnen, werden wir sie in eine andere Abteilung verlegen. Da treffen sie auch eine sehr kompetente Kollegin von mir, die sich um die Gründe für ihren Suizidversuch kümmern wird. Parallel dazu bekommen sie eine Reha.“
Die Dame tätschelte kurz meine Wange, lächelte beruhigend und sagte: „Das wird schon wieder.“
Dann flog sie davon und ich döste mit dem Gedanken „Ich habe keinen Suizidversuch unternommen, echt nicht“ ein.
Mein Körper heilte gut. Nach wenigen Wochen war ich in der Reha und in einer Therapie bei Frau Doktor Himmel. Es fiel mir schwer, die Ereignisse des Abends, als ich vom Haus gesprungen sein soll, zu rekonstruieren. An die letzten 24 Stunden vor dem vermeintlichen Sprung konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Dennoch war ich mir sicher, dass ich nicht vorhatte, Selbstmord zu begehen.
„Es kann passieren, dass das Unterbewusstsein die Stunden um einen solchen traumatischen Punkt herum ausblendet“, beruhige mich die Psychologin.
Sie saß mir gegenüber, auf einem alten Jugendstilstuhl, während ich mich in einen bequemen Sessel fläzte. Ich mochte es, wenn sie ihre Beine übereinander schlug und der Stoff ihrer Nylons dabei ein leises „bsss“ von sich gab. Ich schätze die Ärztin auf Anfang 50, also älter als ich. Frau Himmel hatte ein gewinnendes Lächeln und ich hatte das Gefühl, dass ich in ihren Händen gut aufgehoben wäre. Hier, dachte ich, bin ich der Himmel näher als der Hölle. Gerne hätte ich ihr erzählt, was genau passiert war, aber wann immer ein Fragment der fraglichen Nacht in meinem Kopf auftauchte, und ich versuchte, es zu fassen, war es sogleich wieder verschwunden. Also blieb mir nichts anderes übrig, als darauf zu beharren:
„Ich wollte mich nicht umbringen. Ich bin nicht vom Dach gesprungen.“
Frau Himmel nickte und machte sich ein paar Notizen. Dann sah sie mich eine Weile schweigend an, bis sie das wiederholte, was sie mir in den Tagen zuvor auch schon einige Male gesagt hatte:
„Die Polizei hat einen Abschiedsbrief in ihrer Wohnung gefunden. Sie waren alkoholisiert und hatten Drogen im Blut. Sie haben die Telefonseelsorge angerufen. Dreimal. Und immer wieder aufgelegt, als sie jemanden in der Leitung hatten. In ihrem Zimmer lagen überall alte Fotos von ihrer Ex-Frau und von einer blonden Studentin…“
„Anne. Meine Jugendliebe“, erklärte ich.
„Sie haben eine Geschichte von Depressionen und Panikattacken“, fuhr die Ärztin fort, „und die Polizei hat auf ihrem Computer entdeckt, dass sie Mitglied in zwei Online-Suizid-Chatgruppen waren. Herr Schubert, Lars, unter diesen Umständen fällt es wirklich schwer zu glauben, dass sie nicht vom Dach springen wollten.“
„Aber ich weiß, dass ich das nicht vorhatte. Ich weiß es!“, gab ich vielleicht etwas zu laut zurück.
Doktor Himmel schenkte mir ein mitleidiges Lächeln.
„Und genau daran will ich mit ihnen arbeiten. Was ist denn das Letzte, woran sie sich vor dem… sagen wir „Unfall“… erinnern können?“
„Das habe ich doch gestern schon gesagt.“ Entgegnete ich ungeduldig: „Diese beiden Frauen haben mich verfolgt.“
Frau Himmel schaute auf ihre Notizen.
„Die beiden…“, sie zögerte, „Hexen, wie sie sagten. Also „Hexen“ im Sinne von „bösartigen Frauen, oder?“
„Nein, ja…“, ich stammelte, „es waren keine guten Menschen, aber sie waren
– es klingt vielleicht merkwürdig, aber sie waren so was wie Hexen.“
In dem Moment wurde mir klar, wie verrückt sich das anhören musste, was ich gerade gesagt hatte.
„Naja, Hexen hört sich jetzt vielleicht verrückt an“, versuchte ich zu relativieren, „aber sie hatten so eine Art magischen Zirkel…“
Je mehr ich versuchte, mich klar auszudrücken, desto weiter manövrierte ich mich in ein Geschwafel, welches nur aus dem Mund eines Geisteskranken kommen konnte. Würde ich so weiter schwadronieren, käme ich direkt in die Klapsmühle, das war mir klar. Also bat ich die Sitzung abzubrechen, da ich Kopfschmerzen hätte. Sicher auch nicht die schlauste Ausrede, denn in Filmen haben die Idioten, die Wahnvorstellungen von sich geben, auch immer Kopfschmerzen. Gerne hätte ich in klaren und kurzen Sätzen beschrieben, was genau ich meinte, aber leider wollte mein Gehirn keine brauchbaren Formulierungen zulassen. Ich gab mich für diesen Tag geschlagen.
„Schon okay“, sagte die Ärztin, „wir machen morgen Vormittag weiter. Sie haben ja jetzt erstmal Reha-Schwimmen und dann schlafen sie sich schön aus. Es wird schon. Sie brauchen einfach etwas mehr Geduld.“
Wir verabschiedeten uns freundlich und ich marschierte zum Schwimmbad. Ein Physiotherapeut machte einige Übungen im warmen Wasser mit mir. Ich musste zwar pinkeln, konnte aber noch aufhalten. Außerdem hatte ich die Befürchtung, dass im Wasser ein Indikatorstoff gelöst sein könnte, der das ganze Becken pink färbt, wenn mein Urin die entsprechende chemische Reaktion in Gang setzt. Nach der Gymnastik durfte ich noch etwa 15 Minuten allein schwimmen, verkürzte aber auf fünf, da die Blase kurz davor war, den Struggle mit mir für sich zu entscheiden. Nach der Wassernummer gab es Abendessen. Zwei Scheiben Graubrot mit Käse, eine Tomate und ein Glas Tee. Diesmal rötlich gefärbt, aber vom selben Geschmack wie der gelbe und der grüne an den vergangenen Tagen.
Als ich gegen halb 9 in meinem Zimmer im Bett lag, wollte ich versuchen, zumindest für mich selbst im Kopf die Sache mit den Hexen so zu formulieren, dass sie nicht völlig bescheuert klang.
Ich begann mit: „Ich weiß, dass es keine Hexen im eigentlichen Sinne gibt. Aber es gibt Menschen, die sind Anhänger von bestimmten okkulten…“ Meine Müdigkeit nahm zu. Ich musste mich konzentrieren.
Also nochmal: „Es gibt Menschen, die sind Anhänger von bestimmten okkulten Riten und Gebräuchen. Ich bin an eine Gruppe geraten, in der…“ Kurz nickte ich weg. Verdammt. Ich hatte doch gerade eine gute Formulierung. Also: „Ich bin an eine Gruppe geraten, die mit Drogen… die mit Drogen… an eine Gruppe von Hexen… die Riten und Anhänger mit Menschen und… mit Menschen und… und… und…“
Das war's. Die Müdigkeit hatte gewonnen.
Am nächsten Morgen erinnerte ich mich nicht mal mehr an den Anfang des Satzes. Aber wenigstens wusste ich noch, dass ich mit viel Konzentration in der Lage war, meine Situation verständlich zu beschreiben. Und genau das wollte ich in der kommenden Therapiestunde tun. Frau Himmel würde dann kapieren, dass ich nicht verrückt war, und dass ich schon gar keinen Selbstmordversuch unternommen hatte.
Ich musste grinsen. „Na dann: toi toi toi, Lars“, sprach ich mir selbst Mut zu,
„Du weißt ja, dass du schon immer das Talent hattest, dich selbst in die Scheiße zu reiten, oder? Mach doch bitte heute mal eine Ausnahme.“
Ich klopfte an die Tür zum Therapiezimmer. Frau Himmel bat mich rein.
Sie trug eine dunkle, hochgeschlossene Bluse und ihre Haare waren zu einem Dutt zusammen gesteckt. Die Ärztin sah streng aus, wie eine Oberlehrerin. Als ich mich setzte, nahm ich mir fest vor, diesmal so konkret wie möglich zu formulieren. Krimis, bei denen ein Opfer unter Amnesie leidet, hatte ich noch nie gemocht. Sicher, es mag sowas wie Gedächtnisverlust geben, aber darauf eine Geschichte aufzubauen hielt ich meist dennoch für zu unrealistisch. Jetzt war ich in einer ähnlichen Situation. Aber Amnesie hatte ich nicht. Zum Einen konnte ich mich ja an meinen Namen, mein Leben und meine Freunde erinnern, zum anderen waren auch die Ereignisse der letzten Wochen in meinem Kopf. Ich sah die Bilder vor meinem geistigen Auge. Aber es gelang mir nicht, das Geschehene in Worte zu fassen. Und je angestrengter ich es versuchte, desto schneller erloschen die Bilder. Es war so, als ob man aus einem Traum aufwacht und in der Sekunde des Erwachens noch alles ganz deutlich sieht. Versucht man aber das, was man noch an Eindrücken im Kopf hat, zu sortieren und in Worte zu fassen, so verblassen die Erinnerungen an den Traum im Nu. Und schließlich fällt einem beim besten Willen nicht mehr viel ein. Hätte man zum Beispiel geträumt, man sei in Hollywood auf einer Oscar-Party gewesen, und dort hat man Smalltalk gehalten mit Quentin Tarantino, Julia Roberts, Brad Pitt, Sharon Stone und noch ein paar anderen, und dann irgendwann in der Nacht ist man zusammen mit Kim Basinger in deren Mercedes Cabrio zu ihrer Villa nach Bel Air gefahren, so weiß man kurz nach dem Aufwachen nur noch maximal: Party, viele Leute, Auto mit Frau… und im besten Fall: „Die Tussi, deren Muschi man sehen konnte, wenn sie die Beine übereinander schlug, war auch dabei.“
Wie verhext. Zum Beispiel erinnerte ich mich an „weißes Pulver“ und
„Erbsensuppe“. Sehr unkonkret, aber ich glaube, dass es sein könnte, dass mir jemand etwas ins Essen gemischt hat. Vielleicht war meine Schwäche, das Erlebte in Worte zu fassen, auf irgendwelche Substanzen, die mir verabreicht worden waren, zurückzuführen. Ich hatte mal gelesen, dass Junkies, die beispielsweise Klebstoff schnüffeln, unter extremen Atrikolla… Arttikulla… Artikulationsproblemen leiden. Es fühlte sich voll scheiße an, dass ich, sagen wir mal, eine schöne Obstschüssel im Kopf hatte, aber aus meinem Mund kam nur Saft. „Blöder Vergleich“, dachte ich und sagte:
„In meinem Kopf sind Pellkartoffeln und aus meinem Mund kommt nur Kartoffelbrei.“
Frau Himmel sah mich fragend an.
Ich versuchte eine Erklärung: „Ich wollte nur beschreiben, wie es sich anfühlt, wenn ich etwas Konkretes sagen möchte, aber es nicht auf den Punkt formulieren kann. Vielleicht liegt es an den Drogen, die ich da in der Suppe hatte.“
Shit. Ich faselte von außen betrachtet schon wieder nur Dünnpfiff.
„Sie meinen, man gibt ihnen hier Drogen ins Essen?“, hakte die Ärztin nach.
„Nein. Nein. Nicht hier. Sondern da.“ Erwiderte ich.
„Da? Wo?“, wollte sie wissen.
„Bei… bei…", ich zögerte.
Es lag mir auf der Zunge, die Hexen zu erwähnen, aber mir war klar, dass sich alles, was ich jetzt sagen würde, immer behämmerter anhören müsste. Also schüttelte ich nur den Kopf und erklärte, dass es mir nicht mehr einfiele, wo das mit den Drogen war.
Frau Himmel machte Notizen. Dann sah sie mich lange verständnisvoll an, als wolle sie sagen: „schon gut, ich kenne mich mit Bekloppten aus“.
Endlich ergriff sie das Wort:
„Folgender Vorschlag. Wir vergessen mal alles, was in der Nacht, als Sie anscheinend vom Haus gesprungen sind, passiert ist. Und auch die Wochen davor. Ich möchte mit Ihnen zurückgehen bis zu dem Zeitpunkt, als Sie nach Berlin zogen. Wollen Sie mir darüber erzählen?“
Ich nickte und sammelte mich. Dann begann ich:
„Ja. Gerne. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Nach Berlin kam ich kurz nach meiner Scheidung. Ich hatte das Gefühl, dass ich unbedingt einen Ortswechsel bräuchte…“
Und dann begann ich zu erzählen. Ohne Artikulationsschwierigkeiten. Flüssig und verständlich.
Nachdem sich Marion von mir getrennt hatte und ich meinen Job verlor, wohnte ich für ein paar Wochen bei einem Kumpel. Zunächst hatte ich mir überlegt, mir ein Zimmer irgendwo in der Nähe meines Studienortes zu suchen. Allerdings sah es in der Provinz mit Jobs nicht gut aus, und so reifte in mir der Entschluss, dass ich mein Glück in einer Großstadt versuchen sollte. Durch meine Arbeit bei dem Reisemagazin hatte ich ein paar Kontakte, unter anderem nach Berlin. Ein Kollege, der in der Hauptstadt für ein Stadtmagazin arbeitete, versprach mir, er würde mir
ein paar Aufträge „durchreichen“, so dass ich mich finanziell über Wasser halten könne, bis ich irgendwo etwas Besseres gefunden hätte. Also packte ich meine sieben Sachen und zog nach Marzahn. Mein Budget ließ nichts anderes als eine Zweiraumwohnung in einem Plattenbau zu. Aber ich nahm mir vor, es mir hier richtig gemütlich zu machen und neu durchzustarten. Soweit man in der „Platte“ mit Blick auf graue Häuserfassaden von Wohlfühlen sprechen kann, richtete ich mich einigermaßen heimelig ein. Anfangs bekam ich auch tatsächlich den einen oder anderen Artikel, den ich für meinen Kollegen schreiben durfte. Das war okay.
„Kindertagesstätte Luftikus in Hellersdorf bekommt neue Leiterin“ – „Die BVG gibt Pläne für den S-Bahn-Ausbau bekannt“ – „Entlaufener Yorkshireterrier nach 3 Wochen zu Frauchen zurück gekehrt“ und so weiter. Top Stories! Solange ich etwas zu tun hatte, war mein psychischer Zustand halbwegs in Ordnung. Doch in den Pausen zwischen zwei Aufträgen geriet ich immer wieder in Phasen des „traurigen Grübelns“. Das war nicht gut. Aber es passierte. Anfängliches Selbstmitleid à la
„Warum hat Marion mich betrogen?… Ist das die Strafe für irgendetwas, was ich getan habe? … Das Geld wird knapp… Ich werde noch auf Hartz IV enden… Ich bin sooo arm dran…“ gingen allmählich in Depressionen über. Hätte man mir ein paar Monate zuvor gesagt, dass ich an freien Tagen kaum aus dem Bett kommen würde, hätte ich nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich doch nicht. Ich bin aktiv. Ich habe Hobbys. Ich würde mich niemals so gehen lassen. Doch genau das passierte. Natürlich dachte ich erstmal nicht an so etwas wie Depressionen. Das bekamen andere, nicht ich. Dennoch. Ein permanentes Gefühl innerer Leere stellte sich ein. Ständig war ich müde, konnte mich schwer konzentrieren und hatte keinen Appetit mehr und immer wieder Kopfschmerzen und Durchfall. Irgendwann fragte ich dann doch Dr. Google, wie sich Depressionen äußern würden. Und der sagte:
Ein andauerndes Gefühl von Traurigkeit oder Leere.
Übermäßige Schläfrigkeit, Energielosigkeit, Gefühl von Antriebslosigkeit
Appetitverlust
Schlafstörungen und trotz permanenter Müdigkeit
Konzentrationsschwierigkeiten
physische Probleme wie Kopfschmerzen,Verdauungsstörungen
etc.
Nee, echt jetzt? Das passte alles, aber ich fand, das war nicht fair. Ich beschloss, mich einfach mal ein wenig mehr zusammenzureißen. Leichter gesagt, als getan. Aber für eine Woche etwa schaffte ich es, morgens aus dem Bett zu kommen und auch geregelte Mahlzeiten einzunehmen. Die Schreibjobs allerdings bereiteten Schwierigkeiten. Texte, die mir früher einfach von der Hand gingen, wurden zu unglaublichen Anstrengungen. Und das Ergebnis ließ am Ende meist zu Wünschen übrig. Etwa so: „Der Hund war wohl weggelaufen, kam dann aber wieder. Da hat sich der Besitzer wohl gefreut und wohl gehofft, dass der Hund nicht nochmal wegläuft.“
Anfang der darauffolgenden Woche rief mich mein Kollege vom Stadtmagazin an. Ich solle doch bitte mal in die Redaktion kommen, wir müssten reden. Ich ahnte nichts Gutes. Weiterhin leer und niedergeschlagen trottete ich zu meinem Auto. Der alte Golf würde bestimmt auch bald seinen Geist aufgeben, malte ich in Gedanken schon wieder schwarz. Der Motor sprang an und machte „komische“ Geräusche. Oder bildete ich mir das nur ein? Etwa zweihundert Meter tuckerte ich durch's Wohngebiet, als mir plötzlich schwarz vor Augen wurde. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Völlig benommen visierte mein Tunnelblick eine Parklücke an der Straßenseite an und ich manövrierte den Golf von der Straße. Dass ich dabei keine anderen Autos gerammt hatte, grenzte an ein Wunder. Keuchend quälte ich mich aus dem Wagen. Frische Luft. Ich brauchte frische Luft. Nach etwa fünfzehn Minuten, in denen ich nichts weiter tat, als mich am Auto festzuhalten, immer wieder tief durchzuatmen und zu hoffen, dass ich nicht ohnmächtig würde, normalisierte sich mein Zustand wieder. Was war das denn gerade für eine Scheiße, dachte ich. Heute hatte ich sogar mal halbwegs gut gefrühstückt. An leerem Magen konnte es also wohl nicht gelegen haben. Keine Ahnung. Der Kreislauf oder sowas. Alles gut. Also setzte ich mich wieder in den Golf und fuhr los. Diesmal kam ich keine 50 Meter. Schwindelgefühl, Atemnot, Schwarz vor Augen. Rechts ran fahren. Meine Güte, was war denn da los mit mir? Als ich nach etwa einer halben Stunde wieder einigermaßen klar denken konnte, schaute ich auf die Uhr. Halb zwei. Mein Kollege von der Redaktion und ich hatten keine feste
Zeit ausgemacht, aber ich wusste, dass er an diesem Tag um 16 Uhr Feierabend hatte. Und es wäre schon blöd, wenn ich nicht rechtzeitig bei ihm wäre.
Einen dritten Versuch, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, unternahm ich nicht. Ich hatte ein wenig Panik, dass mir wieder schwindelig werden könnte, sobald ich hinter dem Lenkrad saß. Der nächste S-Bahnhof war nur ein paar hundert Meter entfernt und ich entschied, die Öffentlichen zu benutzen. Auf dem Bahnsteig war noch alles gut, aber schon beim Einsteigen in die Bahn spürte ich ein Unwohlsein in mir aufkeimen. Zitterig setzte ich mich auf einen Platz in der Nähe der Tür. Der Zug fuhr los und mir wurde schwarz vor Augen. Ich rang nach Luft. Es sind nur zwei Minuten Fahrt von meiner Station zur nächsten, aber es kam mir vor, als würde der Zug im Schneckentempo schleichen und für die kurze Distanz Stunden brauchen. Eine Frau mit hässlicher Brille schaute mich abschätzig an. Sie hielt mich sicher für besoffen. Als die S-Bahn endlich am nächsten Bahnhof hielt, wollte ich nur noch raus. Ich schubste andere Fahrgäste beiseite, erntete wüste Beschimpfungen und war endlich wieder draußen an der Luft. Mit Mühe schaffte ich es zur nächsten Bahnhofsbank, dann brach ich förmlich zusammen. Ein Häufchen zitterndes Elend. Lange saß ich einfach nur so da, unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Nach einer Weile legte ich mich ausgestreckt auf die Bank und begann, etwas ruhiger zu atmen. Was für eine gequirlte Scheiße ging denn hier bitteschön ab?
„Sie hatten klassische Panikattacken“, stellte Frau Doktor Himmel sachlich fest.
„Ja“, sagte ich. „Das habe ich dann später auch rausg efunden. Aber bis es soweit war, lief noch eine Menge Wasser die Spree herunter.“
Vom S-Bahnhof ging ich zu Fuß nach Hause. Meinem Kollegen sagte ich am Telefon, dass ich nicht kommen könne, weil ich Magenprobleme hätte. Den nächsten Versuch, in die Stadt zu kommen, wollte ich am kommenden Tag unternehmen, aber auch das Unterfangen scheiterte wie schon tags zuvor an Paniken. Auch Anlauf Nummer drei führte mich nur bis zu meinem Auto, aber nicht weiter. Kaum hatte ich den Golf
aufgeschlossen, setzte die Atemnot ein. Eine weitere Entschuldigung wegen Magenproblemen nahm mir der Redakteur nicht mehr ab und ließ mich wissen, dass ich in Zukunft keine weiteren Aufträge von ihm bekommen würde.
Meine Paniken, von denen ich zu der Zeit noch nicht wusste, dass es sich um solche handelte, wurden immer häufiger. Schon das Einkaufen im Supermarkt wurde zur Qual. Wenn ich länger als drei Minuten in der Schlange an der Kasse warten musste, wurde mir Schwarz vor Augen. Dann blieb mir nichts weiter übrig, als meinen Einkaufswagen stehen zu lassen und so schnell wie möglich aus dem Geschäft zu rennen. Schon bald konnte ich mich in meinem nächstgelegenen Supermarkt nicht mehr sehen lassen. Zu oft war ich aufgefallen, wie ich einen vollen Wagen in irgendeinen Gang geschoben hatte und anschließend aus dem Laden flüchtete. Zum Glück gab es ja Bringdienste. Diese nutzend musste ich nicht aus dem Haus und wurde dennoch mit allem Lebensnotwendigen versorgt. Doch irgendwann war ich selbst in meiner Wohnung nicht mehr vor den Anfällen sicher. Wenn ich auf der Toilette saß, „drehte“ sich das Badezimmer. Wollte ich vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer, musste ich mich im Flur an den Wänden abstützen, um nicht umzufallen. Ein Schwindelgefühl wurde zu meinem täglichen Wegbegleiter. Mit sehr, sehr viel Mühe gelang es mir irgendwann, einen Arzt aufzusuchen. Ein Allgemeinmediziner. Dieser tippte auf ein Problem in meinem Gleichgewichtsorgan und schickte mich zu einem HNO-Arzt. Der HNO konnte aber nichts Auffälliges feststellen und schickte mich zu einem Neurologen. Ein Mediziner aus Ghana, der nur schlecht Deutsch sprach. Ghana-Män verordnete ein EEG und stellte „gewisse Anomalien“ in meinem Gehirn fest. Eine genauere Erklärung blieb er mir schuldig.
„Und jetzt?“, hakte ich bei den Gahnesen nach. „Was ist denn nun mit mir? Mir geht es echt dreckig. Ich bin fix und fertig.“
„Und was wir sollen machen?“, fragte der Arzt teilnahmslos.
„Irgendwas!“, heulte ich fast. „Bitte.“
Meinem Flehen, irgendetwas zu unternehmen, da ich am Ende meiner Kräfte war und die ständigen Schwindelattacken kaum noch aushalten würde, kam er mit einem Rezept über Alprazolam, einem Arzneistoff aus der Gruppe der Benzodiazepine, nach. Nie im Leben wollte ich Psychopharmaka nehmen, aber in dem Fall nahm ich
die Verschreibung dankend an. Dann kam seine Sprechstundenhilfe ins Behandlungszimmer und legte dem Arzt meine Krankenkassenkarte und das Rezept für die Medikamente auf den Schreibtisch. Er unterschrieb das Rezept, schaute dann eine Weile auf die Karte, schüttelte den Kopf und bat die Schwester zu gehen.
„Ist irgendwas mit der Karte nicht in Ordnung?“, fragte ich.
„Oh nein. Karte das okay ist“, antwortete er. „Es ist nur… Krankenkasse von Dich nicht zahlt alles. Du zuzahlen musst wegen die Elektrountersuchung.“
„Und wieviel ist das?“, wollte ich wissen.
„Bei Krankenkasse, das dann 223 Euro 50 sind.“
„Naja… 'ne Menge Geld. Aber wenn es dann so ist, dann ist es wohl so.“
„Muss nicht.“ erklärte der Neurologe. „Kann ich machen 100 Euro. Geht privat. Ist billiger für dich. Du hast 100 Euro?“
Aus meinem Portemonnaie gab ich ihm zwei Fünfziger, welche er schnell wie ein Zauberkünstler in seinem Jackett verschwinden ließ.
„Kann ich bitte eine Quittung bekommen?“, fragte ich vorsichtig und wollte das Rezept an mich nehmen. Hastig riß er mir die Verschreibung aus der Hand.
„Wenn Quittung, dann kostet 200. Und Rezeptzettel kommen mit Post.“
Zwar fühlte ich mich irgendwie erpresst, hatte aber bei meinem Gesundheitszustand nicht die Kraft, zu diskutieren. Also willigte ich ein, ihm das Geld ohne Quittung zu überlassen, und bekam im Gegenzug die Medikamentenverordnung.
Die Tabletten brachten mir ein wenig Linderung, aber der dadurch ausgelöste leichte, permanente Dauerdämmerzustand konnte ja langfristig auch nicht die Therapie gegen meinen Schwindel sein. Ein paar Wochen später beschloss ich, das Medikament abzusetzen. Ich hatte kein gutes Gefühl dabei, mich täglich mit Chemie vollzustopfen. Kaum hatte ich damit aufgehört, die Tabletten zu nehmen, setzten die Anfälle mit gewohnter Wucht erneut ein. Einige Tage hielt ich das durch. Dann manifestierten sich Gedanken wie „Ich kann nicht mehr - ich will nicht mehr“ in meinem Kopf.
„Würden sie das als Suizid-Gedanken bezeichnen?“, wollte Frau Himmel wissen.
„Nein.“ Entgegnete ich, „Eigentlich nicht. Wissen Sie, ich hatte vor vielen, vielen Jahren mal eine richtig heftige Grippe. Also nicht nur so 'ne Erkältung. Es war wirklich Grippe. Der Virus. Fast eine Woche hatte ich nie unter 39 Fieber. So elend und fix und fertig hatte ich mich vorher noch nie gefühlt. Und dann noch dieser Husten. Teilweise waren die Hustenschübe so heftig, dass ich schon Sterne gesehen hatte. Und da dachte ich auch: „Ich kann nicht mehr – ich will nicht mehr.“ Weil mich das alles so aus der Bahn gehauen hat. Aber an Selbstmord habe ich natürlich nicht gedacht.“
„Weil Sie eine Erklärung für ihren Zustand hatten. Und die Hoffnung, dass diese Grippe ja auch bald vorbeigehen würde. Viele Menschen, die unter Panikattacken leiden, sehen aber oft kein Ende und können sich auch nicht erklären, warum ausgerechnet sie davon so heftig betroffen sind. Es gibt in solchen Situationen genug Beispiele von Suizidgedanken.“
Ich schüttelte den Kopf.
„Mag sein,“ antwortete ich, „aber zu dem Zeitpunkt war das bei mir noch nicht der Fall.“
Frau Himmel wurde hellhörig.
„Noch nicht?“, hakte sie nach.
Mit einem leisen „hm hm“ bestätigte ich ihre Vermutung und fuhr fort:
Am 4. Juli 2006 saß ich in meiner Wohnung in Marzahn und schaute das Fußball- WM-Halbfinale Deutschland gegen Italien im Fernsehen. Nachdem ich die Alprazolam-Tabletten abgesetzt hatte, fand ich heraus, dass es noch eine einfache Möglichkeit gab, den Schwindel und alles, was damit zusammen hing, zu unterdrücken. Alkohol. Und zwar reichlich. Wenn der Zustand des „Besoffenseins“ einsetzte, waren die Paniken für eine Zeit lang abgeschaltet. Nach fünf Bier und einer halben Flasche Wodka ging das Spiel in die Verlängerung. Ich war, um es mal
niedlich auszudrücken, reichlich angeschüsselt. Aber ich fühlte wenigstens keine Paniken. Die reguläre Spielzeit war Null zu Null zu Ende gegangen. Auch in der Nachspielzeit fielen, bis zwei Minuten vor Schluss keine Tore. Deutschland hatte sich innerlich schon auf das Elfmeterschießen eingestellt. Und die Deutschen hatten gute Torschützen. Die Chance im Elfmeterschießen das Halbfinale zu gewinnen, war gar nicht mal schlecht. Aber für die Italiener war die Verlängerung erst vorbei, wenn der Schiedsrichter abpfeifen würde. Kein Gedanke an „noch zwei Minuten, dann haben wir die Verlängerung überstanden“. Und so spielten sie auch. Und dann: Peng! Vorletzte Minute der Verlängerung. Tor. Eins zu Null. Deutschland konsterniert. Gelähmt. Und Italien: Peng! Letzte Spielminute. Zwei zu Null. Das war's. Deutschland war raus. Das Sommermärchen beendet. Meine Fresse. Auf den letzten Metern verkackt!
Ich schenkte mir noch ein Glas Whiskey ein und ging auf den Balkon. Durch den Innenhof der Plattenbauten zogen feiernd ein paar lautstark grölende Italiener. Aus diversen Wohnungen des Blocks waren Rufe zu hören: „Verpisst euch, ihr scheiß Ithaker!“ Es flogen Flaschen. Der geballte Frust der Anwohner, überwiegend Hartz IV Empfänger, entlud sich. Viele der armen Seelen hatten, ob ihr Schicksal nun selbst gewählt war, oder nicht, keine Perspektive oder Hoffnung im richtigen Leben. Fußball ließ sie für ein paar Stunden aus ihrem Käfig ausbrechen und ihre Situation vergessen. Ein Sieg ihrer Mannschaft, ob nun in der Bundesliga oder bei der Weltmeisterschaft, bescherte eine Art kollektives Erfolgserlebnis in dem ansonsten so tristen Leben. Aber eine Niederlage katapultierte sie nur noch schneller und noch tiefer zurück in das Loch, aus dem sie gekommen waren.
Ich wurde nachdenklich, kippte den Whiskey in mich hinein, schenkte mir noch einen ein, zündete eine Zigarette an und schaute über die Balkonbrüstung. Wenn ich jetzt springen würde, dachte ich, dann wäre der ganze Mist, der sich in mir und meinem Kopf abspielt, vorbei. Damals wohnte ich im sechsten Stock. Unterhalb des Balkons verlief ein geteerter Fußweg. Eine sehr gute Chance, den Sprung nicht zu überleben. Wenn ich mit dem Kopf voraus springen würde und mich nicht unabsichtlich in der Luft drehte, dann könnte ich auf der Stelle tot sein. Es gibt nichts Schlimmeres als einen missglückten Suizidversuch mit anschließender Querschnittslähmung
und/oder einer Matsch-Birne, welche einen am Ende nur noch sabbernd im Rollstuhl verrotten lässt. Im Moment fühlte ich mich zwar besoffen, aber wenigstens panikfrei, doch ich wusste, dass morgen Früh alles wieder von vorn losgehen würde. Und ein Brummschädel wegen der Sauferei käme auch noch dazu. Also, jetzt mal schnell über's Geländer hüpfen könnte die Lösung sein. Ein weiterer Schluck Whiskey. Obwohl, Mut antrinken musste ich mir eigentlich nicht. Ich war erstaunlich ruhig und besonnen. Es heißt: Selbstmörder sind egoistisch und würden keinen Gedanken an diejenigen verschwenden, die sie zurücklassen. Meine Eltern lebten nicht mehr. Die würden sich also nicht ärgern, wenn auch ich nicht mehr da wäre. Und mein kleiner Bruder Torsten? Ja. Das wäre blöd. Ich denke schon, dass ich ihm etwas bedeute. Aber er ist der taffere von uns. Torte hatte Jura studiert und arbeitete in London für irgendeinen Großkonzern. Zweimal hatte ich ihn in den vergangenen Wochen angerufen. Beide Male war es gerade unpassend und er versprach mir, mich so bald wie möglich zurückzurufen. Naja, das war wohl nicht möglich, denn der Rückruf kam nie. Keine böse Absicht, wie ich ihn kenne. Einfach zu viel um die Ohren. Sollte ich tot sein, würde er meine Beerdigung bezahlen und zur Tagesordnung zurückkehren. Und gab's sonst noch jemanden? Meine Ex Marion. Sicher wäre sie geschockt. Anfangs. Aber dann würde sie meinen Freitod als Bestätigung dafür nehmen, dass es richtig war, mich zu verlassen. Ihren „Mädels“ würde sie sagen: „Lars hatte schon über viele Jahre psychische Probleme. Ich hab es einfach nicht mehr ausgehalten. Das versteht ihr doch, oder?“ Und die Mädels würden unisono nicken und Marion erklären, sie habe alles richtig gemacht. Das Einzige, was mich dann ärgern würde, wäre, dass das mit den jahrelangen Problemen nicht stimmt und ich mich nicht mehr rechtfertigen könnte, wenn ich tot wäre. Denn eigentlich war es eher umgekehrt. Andererseits… Wenn ich tot wäre, würden mir Marion und ihre Hühner sowieso am Arsch vorbeigehen. Dann wäre ich derjenige, der von irgendeiner Wolke auf sie runterpupst. Was war mit meinen Freunden? Zu Anne hatte ich keinen Kontakt. Vermutlich würde sie es gar nicht mitbekommen, wenn ich nicht mehr wäre. Die Jungs aus meiner Studentenzeit? Gesehen haben wir uns seit Ewigkeiten nicht mehr. Und die Telefonate, die wir anfangs noch häufig führten, nachdem ich bei der kleinen Zeitung angefangen hatte, haben aufgehört. Mittlerweile gab es nur noch ab und zu mal ein „like“ für ein
Urlaubsfoto auf Facebook. Das war's. Also da müsste ich mir auch keine Sorgen machen. Und überhaupt. In meinem ganzen Leben war ich im Grunde nie egoistisch. Immer für andere da. Dann könnte ich ja wenigstens mal bei meinem Tod an mich selbst denken, oder?
Das wäre dann für mich geklärt. Keine Schuldgefühle. Es könnte alles so einfach sein. Hops und weg. Ein letzter Schluck Whiskey. Man soll keine halbvollen Gläser stehen lassen. Dann könnte mein letzter Flug beginnen.
Zweites Kapitel
Es war ein sonniger Frühlingstag. Das schöne Wetter nutzte ich für einen kleinen Spaziergang über das Klinikgelände. Frau Himmels Kommentar zu meinem Bericht vom WM-Halbfinal-Abend ging mir nicht aus dem Kopf.
„Wenn Sie damals schon so kurz davor waren zu springen, kann es dann nicht sein, dass sie es beim zweiten Mal wirklich getan haben?“
Ich war verunsichert. Damals hatte die Deutsche Nationalmannschaft sich schon auf das anscheinend Unausweichliche, das Elfmeterschießen, eingestellt. Die Italiener nicht. Sie hatten sich entschieden, noch einmal die letzten Reserven zu aktivieren und sich nicht geschlagen zu geben. So war es bei mir auch. Wohl wissend, dass mein besoffener, schmerzfreier Zustand am kommenden Tag vorüber sein würde und ich erneut die gleiche Kacke vor mir hätte, entschied ich mich gegen das Springen und stattdessen dazu, etwas zu unternehmen. Ich würde mich nicht unterkriegen lassen. Die Erinnerung an diese Nacht war plötzlich wieder glasklar. Ich spürte förmlich noch einmal das Gefühl von Entschlossenheit, wie am 4. Juli auf meinem Balkon. Suizid war keine Option mehr. Ich würde kämpfen. Doch genauso klar wie die Gedanken an die Halbfinalnacht waren, so unklar war meine Erinnerung an den Abend, als ich angeblich vom Dach gesprungen war. „Wenn Sie damals schon so kurz davor waren zu springen, kann es dann nicht sein, dass sie es beim zweiten Mal wirklich getan haben?“
„Konzentriere dich, Alter!“, zwang ich mich. „An was kannst Du Dich erinnern?“
Mit fest zusammen gekniffenen Augen bemühte ich mich die Bilder dieses Abends zu visualisieren.
In meiner Wohnung herrschte Chaos, als hätte jemand oder ich aus Wut und Verzweiflung alles umgestoßen, was nicht an der Wand festgeschraubt war. Dann sah ich mich mit einem Zettel in der Hand. Mein Abschiedsbrief? Es klingelte an der Haustür. Ich öffnete und… das Nächste, an das ich mich erinnere, ist, wie ich auf dem Dach stand. Zwei Frauen vor mir, die mich an die Kante drängten.
„Spring!“, sagte die Eine der beiden. „Spring!“, wiederholte die Andere. „Du wirst sehen, dann ist alles gut!“
Und anschließend sprang ich.
Wirklich? Oder hatten die Zwei nachgeholfen? Falls es sie überhaupt gab. Diese Hexen.
„Mal rein hypothetisch…“, gab ich mir selbst zu bedenken. „Kann es sein, dass ich mir das echt nur eingebildet habe?“
Man liest ja oft, dass Leute Stimmen hören, die sie dazu bewegen, etwas zu tun oder zu lassen. Vielleicht verbinden diese Leute die Stimmen ja auch mit Personen. Visionen von Menschen, die so real erscheinen, dass man glaubt, sie seien wirklich da. Könnte ja sein, dass sich mein Unterbewusstsein die Hexen nur ausgedacht hat, damit ich eine Rechtfertigung für meinen Sprung hatte. Andererseits:
„Nein. Ich wollte mich nicht umbringen. Ich wurde gezwungen zu springen!“ Je mehr ich über die Möglichkeit nachdachte, dass mein Gehirn mir einen echt miesen Streich gespielt hatte, umso mehr zog ich auch das in Zweifel, von dem ich vor ein paar Tagen noch felsenfest überzeugt war: nämlich, dass ich das Geschehene zwar gut visualisieren konnte, es mir lediglich versagt war, mich klar auszudrücken.
Ich konnte mich zum Beispiel ganz genau daran erinnern, wie ich nachts von einem
großen Häuserkomplex, vielleicht eine Kaserne oder so, weglief. Geduckt, über eine weite Rasenfläche bis zu einer Mauer. Dann gingen überall Scheinwerfer an. Es fielen Schüsse und ich hatte Todesangst. Irgendwie konnte ich mich an einem Baum hochziehen, der unweit der Mauer stand. Hunde bellten. Von dem Ast, auf dem ich balancierte, bis zur Oberkante der Mauer waren es noch etwa zwei Meter. Eine Kugel schlug unmittelbar neben mir in den Stamm ein. Scheiße, das war knapp, dachte ich. Jenny hatte nicht so viel Glück.
Sekunde mal. Ich schreckte aus meinen Erinnerungen hoch. Wie war das doch gleich? „Jenny hatte nicht so viel Glück“. Moment mal? Jenny? Jenny? Genau. Jenny! Sie wurde angeschossen. Und sie hat mir geholfen. Sie wusste über alles Bescheid.
„Ich muss Jenny finden!“, sagte ich zu Frau Doktor Himmel. „Jenny wusste über alles Bescheid.“
„Über was alles?“, fragte die Ärztin nach.
Ich überlegte laut:
„Das kann ich eben nicht so genau sagen. Über die Schüsse. Und über das, was da in dem Gebäude geschehen ist. Sie war ein Jahr in England, in den 90ern. Und Jenny trank gerne Becks Bier. Das fand ich cool. Bei der Polizei war sie…“
„Diese Jenny war Polizistin?“, wollte Frau Himmel wissen.
„Nein, nein.“ Ich schüttelte den Kopf. „Es ging nur um die Anzeige, die wir machen wollten. Weil man ja auf uns geschossen hatte. Und ich weiß noch, dass wir "Tod im Spiegel" im Fernsehen geschaut haben und beide den blöd fanden.“
Da war es wieder. Lars labert los. L- L- L. Ohne sinnvolle Zusammenhänge. Ein eindeutiges Zeichen für „der hat 'nen Schaden“. Wenn ich so weitermachen würde, käme die Himmel sicher wirklich ratzi-fatzi auf die Idee, mich in die geschlossene Abteilung verlegen zu müssen. Natürlich
würde ich nicht klein beigeben. Ich würde auf meiner Geschichte beharren, was die Ärzte als Zeichen einer tiefen Persönlichkeitsstörung ansähen. Und dann. Britzl brutzl. Strom in Kopp. Lobotomie, und Lars sitzt den Rest seines Lebens sabbernd in der Ecke und pinkelt sich jedes Mal ein, wenn irgendwo eine Tür zuklappt. Keine Perspektive, mit der ich mich anfreunden wollte. Also sagte ich:
„Sorry. Ich rede da gerade etwas unstrukturiert. Es fällt mir tatsächlich noch schwer, die Gedanken an die Zeit vor meinem Sprung…“
Mist. Ich hatte „Sprung“ gesagt. Himmel machte sich direkt Notizen. Warum passt die so gut auf? Natürlich meinte ich nicht „Sprung“. Es war doch nur… Also korrigierte ich:
„… Ich meine Sturz, oder so, also, wie gesagt, es ist alles noch ein bisschen schwammig. Bin wohl doch stärker auf den Kopf geknallt, als ich gedacht hatte.“
Ich lachte schräg. Es sollte ein Scherz sein, aber mein Lachen klang eher wie ein hysterisches Gelächter eines Psychopathen. Nicht gut.
„Das nehmen wir auch an.“ sagte die Ärztin.
„Wir?“, fragte ich nach. „Majestätsplural?“
Die Himmel grinste.
„Nein. So eingebildet bin ich nicht. "Wir" bedeutet, die anderen Ärzte und ich. Sie hatten eine schwere Gehirnerschütterung. Da kann schon mal etwas durcheinander wirbeln. Vielleicht sollten wir diese Woche noch einmal ein EEG machen. Was halten sie davon?“
Ich zuckte mit den Schultern. „Wenn's schee macht.“
Wieder kritzelte die Psychologin etwas in ihr Notizbuch. Dann schlug sie vor, dass wir dabei bleiben sollten, „das Pferd nicht von hinten aufzuzäumen“, sondern weiter chronologisch in meiner Geschichte vorgehen und uns an die Ereignisse der jüngeren Vergangenheit heranzutasten.
Ich war einverstanden, bat aber dennoch darum, dass wir unbedingt versuchen sollten, Jenny zu finden.
„Ich bin mir sogar sicher,“ sagte ich, „dass Jenny und ich uns am Tag von meinem Sturz noch gesehen haben. Wir waren sehr gut befreundet.“
„Und warum sucht sie dann nicht nach ihnen?“, wunderte sich die Himmel laut. „Die Polizei hat den Vorfall ja aufgenommen. Sie kamen ins Krankenhaus. Wenn Jenny es gewollt hätte, hätte sie herausgefunden, wo sie sind. Es sei denn…"
Mir war klar, worauf sie hinaus wollte. Es sei denn, diese Jenny existiert gar nicht, beziehungsweise nur in meiner Fantasie. So langsam sollte ich wirklich besser darauf achten, was ich wann erzähle. Am Ende könnte meine Unüberlegtheit wirklich auf Britzl-Brutzl hinauslaufen. Also beschloss ich, mich erstmal allein um meine Erinnerungen an Jenny zu kümmern. Vielleicht würde mir ja etwas einfallen, was mich zum Beispiel an ihre Wohnung erinnert, und ich könnte sie so ausfindig machen. Allerdings wunderte es mich tatsächlich, dass sie anscheinend nicht versucht hat, mich zu finden. Es sei denn, die beiden Frauen, Hexen, waren auch bei ihr.
Mir wurde leicht schwindelig. Wieder war ich an dem Punkt, wo ich für eine Sekunde dachte: „Es sind womöglich doch alles nur Hirngespinste!“
Besser wäre es wohl jetzt, tatsächlich erstmal zu kooperieren und mich zusammen mit der Ärztin meinen vergangenen letzten Jahren zu widmen.
„Egal. Also gut.“ sagte ich. „Wo waren wir stehen geblieben?“
„Sie sind am WM-Abend nicht gesprungen, sondern haben sich dafür entschieden, gegen die Panikattacken und Angststörungen anzukämpfen.“, half sie mir auf die Sprünge.
Okay. Dann erzählte ich also weiter. Meine Erinnerung an diese Zeit war zumindest noch voll da.
Nach meinem Entschluss, mich nicht aufzugeben, wollte ich zunächst noch einmal den Ghana-Män-Neurologen aufsuchen. Zwar musste ich eine knappe Woche auf einen Termin warten, aber da ich mich entschieden hatte, sozusagen als Unterstützung meiner Bemühungen, die Psycho-Tabletten wieder zu nehmen, schaffte ich die Zeit ohne allzu große Schwierigkeiten. Zudem hatte mein Entschluss auch eine gewisse Kraft in mir freigesetzt, welche mir in den Monaten zuvor fehlte. Zunächst konsultierte ich mal wieder Dr. Google. Meine Recherche unter Berücksichtigung meiner Symptome brachte mich irgendwann tatsächlich auf die Spur: Es könne sich um Panikattacken und Angststörungen handeln. Darauf hatte noch keiner der Ärzte getippt, was mich im Nach hinein wunderte. Je mehr ich über die Problematik las, desto mehr war ich mir sicher, dass genau diese psychische Erkrankung mein Problem war. Allerdings, je mehr ich las, desto mehr stiegen auch wieder die Paniken in mir hoch. Immer wenn „schwarze Emotionen“ aufkamen, Gedanken an meine finsteren Stunden aufkeimten, Erinnerungen an die Nächte, in denen ich wach lag, von Paniken und Ängsten geschüttelt, und betete, dass dieses Gefühl endlich aufhören möge, versuchte ich, all das so schnell wie möglich zu verdrängen. Die meiste Zeit des Wartens auf den Termin, wenn ich nicht gerade recherchierte, verbrachte ich mit Joggen. In meinem Fall hieß das allerdings nicht, gemütlich durch den Park zu laufen, sondern wie ein Blöder rumzurennen, vor Anstrengung keine doofen Gedanken zu zulassen und abends vor Erschöpfung ins
Bett zu fallen.
Ghana-Män empfing mich mit einem kurzen „dassaschoowadda“, was wohl soviel heißen sollte wie „da ist er ja schon wieder“. Ich verzichtete auf Höflichkeiten und kam direkt auf den Punkt.
„Was genau,“ wollte ich wissen, „ist ihre Diagnose gewesen?“
Ghana-Män warf einen Blick in seine Unterlagen. Fast gelangweilt sagte er:
„Mit Gehirn ist Anomalie. Aber nicht so schlimm sehr. Geht weg mit nehmen Tabletten.“
Ich wurde leicht sauer.
„Ich sage es noch einmal: Was ist ihre genaue Diagnose gewesen?“, bohrte ich.
„Was Diagnose ist, sein andere Sache. Du musst nicht wissen. Tabletten, und wird gut.“ Wiederholte sich der Neurologe.
Ich wurde richtig sauer.
„Dann frage ich noch einmal so, dass sie verstehen, worauf ich hinaus will“, herrschte ich ihn an. „Also: was du mache mir für Diagnose. Was du schreibe, schreibe in Akte. Und nicht sage Tablettewaddagutte. Kapiert?!“
Jetzt wurde Ghana-Män sauer.
„Ich mich nicht muss lassen verarsche von dir. Weil ich habe dunkle Haut? Du bist Rassist!“
## „Ich bin ganz bestimmt kein Rassist!“, hielt ich dagegen, „und es geht mir auch nicht um die Hautfarbe, und auch nicht um das schlechte Deutsch, wobei es helfen soll,
wenn man in Deutschland praktiziert, dass man auch die Sprache kann. Mir geht es allein um Kompetenz. Und wenn sie nicht mal im Ansatz eine Diagnose haben, und dann einfach nur Tabletten verschreiben, dann sehe ich keine Kompetenz!“
Der Arzt erhob sich abrupt von seinem Stuhl. Bislang hatte ich ihn immer nur sitzend gesehen. Selbst bei der ersten Untersuchung war er nie aufgestanden, sondern lediglich mit seinem Drehstuhl um den Schreibtisch herum gerollt. Ghana- Män war ein Riese. Sicher über 2 Meter groß. Ich zuckte etwas zusammen.
„Raus aus mein Praxis!“, brüllte er, „Raus du Toastbrot. Tafi maƙaryaci.“
Er öffnete seine Schreibtischschublade und für einen Augenblick hatte ich die Befürchtung, er würde eine Machete herausholen, und mir meinen weißen Kopf absäbeln. Mit der Machete lag ich falsch, aber es ging schon in die richtige Richtung, denn ich schaute direkt auf eine Flasche Pfefferspray. Er schrie weiter „raus, raus“. Dann drückte er auf den Sprayknopf. Geistesgegenwärtig schob ich seine Hand nach oben, so dass ein Großteil des Pfeffernebels an die Decke schoss und der Rest in seine Richtung. Ghana-Män keuchte, und ich nutze den Moment seiner Benommenheit, um mir mein Krankenblatt zu schnappen und aus der Praxis zu rennen. Im Weglaufen hörte ich noch wilde Schreie in einer mir unbekannten Sprache. Ich hetzte vorbei an zwei verwirrten Arzthelferinnen und war in Nullkommanix auf der Straße. Erst ein paar Hundert Meter weiter wagte ich, mich umzudrehen, um zu sehen, ob der Arzt die Verfolgung aufgenommen hatte, was nicht der Fall war.
Da ich noch immer Probleme mit dem S-Bahn-Fahren hatte, beschloss ich, zu Fuß nach Hause zu gehen. Mir fielen seine Worte wieder ein: „Raus, du Toastbrot.“ Alter, wer ist denn hier rassistisch? Unterwegs suchte ich mir eine Parkbank und las in meiner Akte. Der Arzt hatte sie auf Englisch geführt, was er augenscheinlich besser beherrschte als Deutsch. Kurz überflog ich die Unterlagen und mir sprangen sofort ein paar Begriffe ins Auge: panic attacks, anxiety states, possibly suicidal, immobilize. Also: Panikattacken, Angstzustände, mögliche Suizidgefahr, Ruhigstellen.
Ich schnappte nach Luft. Die Diagnose gab es schon vor Wochen. Und dieses
Arschloch hatte mir einfach nur Tabletten aufgeschrieben, und ab dafür. Dann fiel mir noch eine, an die Seite des Blattes gekritzelte Bemerkung auf: „White smart shit
– thinks he's something better.“ Weißer Klugscheißer – hält sich wohl für was Besseres.
Meine Fresse, was sollte das denn nun wieder bedeuten? Und wie es meine Art ist, fing ich sofort an, die Schuld für seine Einschätzung bei mir zu suchen. Hatte ich bei unserem ersten Termin irgendetwas gesagt, was ihn zu dieser Schlussfolgerung hatte kommen lassen? Denke nicht. Ich war damals viel zu verzweifelt, um ein entsprechendes Auftreten an den Tag zu legen. Nein. Keine Ahnung, worauf er seine Einschätzung begründete. Immerhin hatte er von mir Toastbrot Kohle kassiert, ohne Quittung, an der Steuer vorbei. Wenn er das täglich bei drei Patienten so macht (ich rechnete im Kopf), wären das etwa 6000 Euro im Monat extra. Nicht schlecht, mein lieber Scholli.
Und dann dachte ich: Wenn er mich anscheinend für einen Klugscheißer oder Ähnliches gehalten hat, wollte er mir womöglich mit seiner Behandlung bzw. „Nicht- Behandlung“ eins auswischen? Hat er einen Selbstmordversuch wohlwollend in Kauf genommen, nur weil er mich nicht leiden konnte?
Panik stieg in mir hoch. Ich klappte die Akte zu und rannte, so schnell es ging, nach Hause.
„Haben sie jemals wieder Kontakt zu dem Neurologen gehabt?“ wollte Frau Dr. Himmel wissen.
„Ja.“ sagte ich. „Etwa eine Woche später rief er mich zuhause an und drohte, er würde mich anzeigen. Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Diebstahl… Soweit ich ihn verstanden hatte. Also, falls Dawegnemme Diebstahl heißt.“
„Und, kam es zur Anzeige?“, fragte die Ärztin nach.
„Nein, kam es nicht.“, antwortete ich. „Denn ich habe im Gegenzug gedroht, ihn bei der Ärztekammer anzuzeigen. Zum Beispiel wegen unterlassener Hilfeleistung und auch wegen Steuerbetrugs. Ich war mir nämlich sicher, dass ich nicht der Einzige war, der ihm Geld gezahlt hatte, ohne eine Quittung zu bekommen.“
Nachdem er mich noch ein paar Mal in einer mir unverständlichen Sprache am Telefon beschimpft hatte, legte er auf. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Angezeigt habe ich ihn allerdings auch nicht. Von einem Bekannten wusste ich nämlich, dass das ein ganz schöner Aufwand ist. Der Kumpel hatte damals in Köln Stress mit einem Arzt und hat sich mit der Ärztekammer in Verbindung gesetzt. Nach unendlichem Papierkram musste er schließlich mehrfach zu Anhörungen nach Düsseldorf. Und so, wie ich mich nach dem Trouble mit dem Neurologen gefühlt habe, hätte ich gar nicht die Kraft gehabt, mich mit irgendwelchen Gremien auseinanderzusetzen.
Dr. Himmel nickte und forderte mich auf, weiter zu erzählen.
Der Ärger über die vorenthaltene Diagnose wurmte mich noch eine ganze Weile. Aber da ich mir nun letztlich doch ziemlich sicher sein konnte, dass es sich nicht um eine Gleichgewichtsstörung handelte, sondern um Angstzustände und so, wollte ich versuchen, gezielter vorzugehen. Also versuchte ich, einen Therapieplatz zu bekommen. Gar nicht so einfach. Zwei weitere Wochen hangelte ich mich mittels Alprazolam über den Abgrund, bis ich einen Psychologen fand. Nur