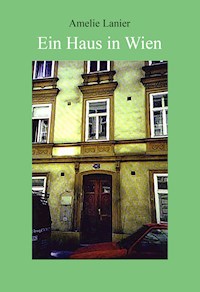
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wien, Wien, nur du allein! Viele denken an die Hauptstadt Österreichs als einen einzigen großen Kulturtempel, wo alle Klavier spielen, in einem fort in Ausstellungen, Konzerte oder ins Theater laufen und das ganze Jahr über vom Opernball träumen. Alles ein Schmarrn. Die meisten Bewohner Wiens all das gar nicht und sie sind vollauf damit beschäftigt, mit ihrem Gehalt bis zum Monatsende durchzukommen, sich mit Behörden herumzuschlagen, etwaig vorhandene Kinder aufzuziehen und sich bei all dem die Stimmung nicht ganz verderben zu lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amelie Lanier
Ein Haus in Wien
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort: Warum dieses Buch?
EINLEITUNG oder Das Klosett als zentrales Element der abendländischen Wohnkultur
Teil 1: Was zu einem Wiener Zinshaus so alles dazugehört
Teil 2. Die Bewohner
Teil 3. Wer bei mir alles aus und ein ging und was wir getrieben haben
Teil 4. Weitere Anekdoten aus der Schützengasse
Teil 5. Das Ende
ANHANG: Übersetzung von mundartlichen Ausdrücken und Ergänzungen
Impressum neobooks
Vorwort: Warum dieses Buch?
Die Idee zu diesem Buch entstand bei mir im Dezember 2001 in Kuba.
Ich fuhr mit einem Autobus aus der Stadt Bayamo in Richtung Küste. Der Bus war, wie fast alle Transportmittel in Kuba, sehr klapprig und kaputt. Ich hatte rechtzeitig eine Fahrkarte gekauft und daher einen Sitzplatz ergattert. Selbst wenn ich keine Karte gehabt hätte, so wäre ich vermutlich dem Sitzplatz nicht entkommen: Die Kubaner sind nämlich gegenüber Fremden sehr rücksichtsvoll, weil sie gelernt haben, daß der Tourismus die Haupt-Devisenquelle von Kuba ist. Das ist aber wahrscheinlich nicht der einzige Grund. In der Tradition Kubas ist der Fremde, sofern er nicht direkt als militärischer Gegner, Unterdrücker oder Kolonialherr auftritt, immer eine Bereicherung und ein willkommener Gast, der einem Kunde von der äußeren Welt bringt. Die Einheimischen behandeln einen Touristen deshalb zuvorkommender, als es meiner Ansicht nach notwendig wäre. Oft hatte ich Diskussionen mit Kubanern, wenn ich ein Verkehrsmittel bestieg und jemand für mich aufstand und mir Platz machen wollte. Nein, bleiben sie doch sitzen, sagte ich. Das ist Ihr Land! Ich bin hier nur Gast. Aber eben deshalb sollen Sie sich hier wohlfühlen! entgegnete der/die Kubaner/in. Aber ich kann doch auch stehen! sagte ich. Ich bin noch nicht so alt und klapprig, daß mir das Schwierigkeiten bereiten würde. Ich auch nicht, meinte der/die Einheimische. Und so tauschten wir Höflichkeiten aus, lachten, und kamen miteinander ins Gespräch.
Der Bus in Bayamo fuhr – natürlich – nicht zur fahrplanmäßigen Zeit los. Immer mehr Leute zwängten sich hinein. Ich saß relativ weit hinten. Und in dem überfüllten Bus standen vor mir zwei Männer, die große weiße Säcke der Art bei sich hatten, in denen sonst landwirtschaftliche Produkte wie Kaffeebohnen, Getreide, Kartoffeln oder ähnliches transportiert werden. Die Säcke waren ungefähr 1 m 30 cm hoch und enthielten eckige Gegenstände. Als der Bus endlich losgerattert war und Bayamo verlassen hatte, fragte ich den einen der beiden: Sag einmal, was ist denn in diesen Säcken drin? Bücher, erklärte er mir. Ich bestelle diese Bücher bei einem Buchhändler in Bayamo, und wenn eine genügend große Menge von ihnen da ist, so benachrichtigt mich das Buchgeschäft und dann fahr ich nach Bayamo und hol sie mir ab.
Der Bus brach ungefähr 25 Kilometer nach Bayamo zusammen. Der Fahrer und ein Mechaniker versuchten ihn zu reparieren. Die meisten Passagiere stiegen aus, um eine Zigarette zu rauchen oder sich die Füße zu vertreten. Die zwei Burschen setzten sich auf freigewordene Sitze. Der eine erzählte mir, daß er Lehrer in einem Dorf war. Und er strebte eine Zukunft als Schriftsteller an. Er war der Ansicht, daß man zuerst viel in sich aufnehmen und lernen müßte, um dann richtige, wertvolle Literatur zu produzieren. Das Wichtigste, so erklärte er mir, sei, das spirituelle Herz, „el corazón espiritual“, zu bereichern. Man müsse von allen und allem lernen. Die erste Quelle der Inspiration seien die Menschen selbst. Jeder Mensch ist reich an Wissen und Erfahrung, sagte er mir. Jeder ist eine Welt für sich. Man kann bei uns von den Menschen im Dorf so viel lernen! Was sie alles zum Erzählen haben! Über die Batista-Zeit und auch über die jüngere Vergangenheit unter Castro. Aber die hohe Politik sei nur ein geringer Teil ihrer Erlebniswelt. Die Welt der Liebe, die wirtschaftliche Situation, die Volkskultur seien eine reiche Quelle der Inspiration. Er sei so froh und dankbar, Lehrer in einer an Traditionen so reichen Gegend zu sein. Das Dorf bietet viel mehr als die Stadt, sagte er mir. Es ist origineller, ursprünglicher. Die Menschen hier waren immer mehr viel mehr auf ihren eigenen Erfindungsgeist verwiesen, um existieren zu können. Sie bekamen wenig Hilfe von außen, vor allem vor der Revolution.
Die nächste Quelle des Wissens seien die Bücher. Es gebe so viele interessante Bücher, geschrieben von Menschen, die der Welt etwas von ihrem Wissen vermitteln wollten. Auch diese Quelle der Erkenntnis müsse man nützen, so gut wie möglich. Deshalb bestelle er immer Bücher aus Havanna, und holte sie in sein Haus im Dorf. Wenn er alle ausgelesen hätte, so käme schon die nächste Lieferung.
Kuba druckt sehr viele Bücher. Es ist das dritte Land in Lateinamerika, nach Mexiko und Argentinien, in der Bücherproduktion. Vielleicht hat es Argentinien inzwischen überholt. Und die Bücher sind relativ billig, weil die sozialistische Regierung meint: Bücher soll sich bei uns jeder leisten können! Sie sind auch eines der wenigen Nicht-Lebensmittel-Produkte, die für kubanische Pesos erhältlich sind. Aber dennoch stellte eine solche Menge Bücher eine bedeutende Ausgabe für den Dorflehrer dar. Er konnte sich sicherlich nicht viel anderes mehr leisten.
Die dritte Quelle des Wissen sei die Natur, fuhr er fort. Die Natur ist reich, und sie gibt dir ihre Schätze ohne jegliche Gegenleistung. Du mußt sie nur entdecken! Die Vögel singen für dich. Die Pflanzen wachsen für dich und verströmen ihren Duft. So viele von ihnen kannst du brauchen, als Nahrung, als Tee, als Droge, als Medizin, oder nur, um dich an ihnen zu erfreuen, wegen ihrer Schönheit oder ihres Duftes. Du mußt es nur lernen, sie richtig zu verwenden.
Er erzählte mir, daß er sich seit geraumer Zeit vorbereite, aber bald sei er so weit und würde sein erstes Buch schreiben.
Schließlich kam ein Lastwagen, der die gestrandeten Bus-Passagiere mitnahm. Ich half den beiden, die schweren Büchersäcke auf die Ladefläche des Lastwagens aufzuladen und so gelangten wir in die Ortschaft, wo er und sein Freund – der einfach nur ein Dorfbewohner war, der ihm half, die Bücher nach Hause zu transportieren – hingelangen wollten. Wir aßen noch einen Imbiß zusammen, dann verabschiedeten wir uns. Ich nahm den nächsten Bus entlang der Hauptstraße, und er und sein Freund trugen die schweren Büchersäcke ein paar Kilometer bis in ihr Dorf, in ziemlicher Hitze, so um die 30 Grad.
Die Begegnung mit dem kubanischen Lehrer vom Fuße der Sierra Maestra gab mir sehr zu denken. Er hatte recht bei allem, was er sagte. Es ist nicht genug, immer nur aufzunehmen. Gut, ich habe einige wissenschaftliche Bücher veröffentlicht, über Themen, die nur einen sehr beschränkten Personenkreis interessieren. Aber wie viele interessante oder unterhaltsame Menschen habe ich kennengelernt, was habe ich alles von ihnen gelernt! Wie viel habe ich gesehen und gehört, und das will ich alles für mich behalten, als meine Privatsache? Und das, obwohl gerade meine Generation sich sehr wenig Gehör in der Welt verschafft hat? Ich schämte mich ein wenig vor dem kubanischen Dorflehrer, der sich unter so schwierigen Bedingungen sein Ziel gesetzt hatte und es stur verfolgte. Vielleicht hat er schon sein erstes Buch geschrieben. Und ich?
So entstand zumindest der Stachel, einmal ein Buch zu schreiben über die Lehren aus Gesellschaft, Kultur und Natur – das Thema ergab sich fast von selbst, als feststand, daß ich aus meinem Haus ausziehen mußte.
Das Haus, von dem dieses Buch handelt, ist im 3. Wiener Gemeindebezirk gestanden. Ich habe 21 Jahre in diesem Haus gewohnt und nichts von dem, was ich darüber berichte, ist erfunden. Ich habe lediglich die Namen geändert, da vermutlich nicht alle Beteiligten sämtliche sie betreffenden Geschichten einer breiteren Öffentlichkeit preisgeben wollen und sogar manche von ihnen einiges, das ich zur reinen Erbauung oder auch Aufklärung des Lesers in dieses Buch aufgenommen habe, als Rufschädigung empfinden könnten.
Die Anonymität, die ich daher den handelnden Personen großzügig verleihe, entspringt meinem Taktgefühl mindestens ebensosehr als der Angst vor rechtlichen Folgen!
Letzteres hat mich dazu bewogen, auch denjenigen, die schon verstorben sind, ebenfalls eine andere Identität zu verleihen.
EINLEITUNG oder Das Klosett als zentrales Element der abendländischen Wohnkultur
1. Das Haus
Das Haus, um das es geht, war schon zu dem Zeitpunkt, als ich es zum erstenmal betrat, ein Anachronismus. Und zwar deswegen, weil es dem hohen Zweck, den jedes Stück Eigentum, also auch ein Haus, besitzt, nämlich seinem Besitzer etwas einzubringen, eigentlich nicht genügte. Mit anderen Worten, die Eigentümer verdienten nicht viel damit, hatten dafür aber jede Menge Ärger. Ein besonderes Geschäft war es nicht, dieses Haus in der Schützengasse.
Das war vermutlich nicht immer so. Gebaut wurde dieses Haus meiner Einschätzung nach irgendwann in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, als die voranschreitende Industrialisierung Wiens Massen von Arbeitern erforderte, die ja auch irgendwo wohnen mußten. In den 2-Zimmer-Wohnungen dieses Hauses tummelten sich sicherlich keine illustren Persönlichkeiten, mit denen das Wien der Jahrhundertwende gerne in Verbindung gebracht wird, sondern eher schlecht ernährte und schlecht gekleidete Gestalten, wie sie in Petzolds Buch "Das rauhe Leben" dargestellt werden. Das Haus in der Schützengasse war nicht für wohlbestallte Bürger gebaut worden, auch nicht für Kulturschaffende, sondern für das Salz der Erde: Das Proletariat.
Das Haus war ungefähr 20 Meter breit und ganze 5 Meter tief, mitsamt den Außenmauern. Es hatte etwas von einer großen aufgestellten Schokoladetafel an sich. In der Mitte war die Wendeltreppe, die in jedem Stockwerk in einen ca. 2 Quadratmeter großen Treppenabsatz mündete, von dem sich 2 Türen in die Wohnungen öffneten. In jedem Stockwerk befanden sich 2 Wohnungen, bestehend aus einem Vorraum, der gleichzeitig Küche war, und von dem/der aus man in eines und durch dieses in ein zweites Zimmer gelangte. Auf der einen Seite waren beide Zimmer gleich groß, auf der anderen – auf der ich wohnte – war das hintere halb so groß wie das vordere: ein sogenanntes Kabinett. Die kleinere Wohneinheit hatte insgesamt 33 Quadratmeter, die größere 41.
2. Das Klosett
Normalerweise hatten Häuser dieses Alters und dieser Ausstattung die Toiletten am Gang, und oft eines für mehrere Wohnungen. Das führte zu ständigen Reibereien zwischen den Parteien, die ein und dasselbe Häusl benutzen mußten. Einmal ließ der eine das Licht brennen – das alle gemeinsam bezahlten –, dann benützte einer das Klopapier vom anderen, dann wiederum war das Klo zugeschissen und keiner wars gewesen, wollte es daher auch nicht putzen, usw. usf.
Ein Freund von mir mußte auf Anweisung seiner Klo-Mitbenutzer vor dem Verrichten größerer Geschäfte zu diesem Zweck bereitliegende Zeitungsausschnitte in die Klomuschel legen, damit selbige durch seine Geschäfte unberührt und dadurch das Klobürstl scheißefrei blieb! Er bekam diesbezüglich genaue Anweisungen von seiner Klo-Teilhaberin. Diese, eine ältere Frau mit sozialdemokratischen Überzeugungen (die auch noch einen Mann hatte, aber die Klo-Verhandlungen liefen ausschließlich über sie ab), hatte ihn erst nach langem Hin und Her in „ihr“ Klo aufgenommen, nachdem sie ihn zunächst in das andere Klo am Gang verbannen wollte, das von einem älteren Herren adeliger Abstammung benützt wurde. „Scheißens ihm nur eini in sein Klo, dem Herrn Baron! Der braucht net glauben, daß er was Besseres ist!“ ermunterte sie ihn zum Klassenkampf. Der ältere Herr versuchte über die Klassensolidarität, meinen Freund aus seinem Häusl loszuwerden: „Schauen Sie, Herr Berger, wir, unter Akademikern, können ja offen reden: Ein alter Mann braucht ein eigenes Klo!“ So wurde mein armer Freund zum Pingpong-Ball, an dem sich die weltanschaulichen und herkunftsmäßigen Gegensätze seiner beiden Nachbarn sozusagen einen Schlagabtausch lieferten. Solange, bis sich die Sozialdemokraten seiner erbarmten, nachdem ihn die Frau in die hausüblichen (oder eher kloüblichen) Sitten eingeweiht hatte. Weißt du, sagte er seufzend, als er mir das alles erzählte, ich mache halt aus der Not eine Tugend. Aus den Zeitungsausschnitten, die immer fertig und in der richtigen Größe dort liegen – die Sozialdemokraten sorgten immer für ausreichende Mengen –, suche ich mir die vom Staberl(1) heraus und auf die laß ich dann was fallen, was meiner Meinung über ihn den adäquaten Ausdruck verleiht!
Die Touristen, die Wien Jahr für Jahr mit ihrer werten Anwesenheit beglücken, erfreuten sich an den Fassaden der Zinshäuser, der berühmten Altbausubstanz Wiens, stießen Schreie des Entzückens aus: "oh, isn't it wonderful!!" und hatten natürlich keine Ahnung davon, was in den hübschen Häusern für Klokriege tobten.
Das alles blieb den glücklichen Bewohnern der Schützengasse erspart. Das Haus war vermutlich von Anfang an zu klein für dergleichen Luxus. Beim Stiegenhaus wurde so gespart, daß für die Klos kein Platz mehr war. Also mußte man sie notgedrungen in die Wohnungen verlegen. Die elegante Lösung dieses Dilemmas bestand in einem Holzkasten in der Küche, der das Klo beherbergte. Ein Freund von mir verglich ihn mit einem aufgestellten Sarg: Bei der Amelie geht man immer in einen Sarg hinein, wenn man pinkeln muß!
Dieses Klo war, wie man sich vorstellen kann, auch nicht gerade geräumig angelegt. Die Mauer war zu einer Art Gebetsnische ausgehöhlt, in die die Klomuschel hineingepfropft war. Selbige stand in rechtem Winkel zur Eingangstüre des "Sarges". Diese Türe des Holzkastens hatte in geschlossenem Zustand eine Entfernung von ca. 2 Zentimetern zur Klobrille, als ich in die Wohnung einzog. Damals stand das Haus bereits seit 90 oder 100 Jahren. Seither hatten also alle, die dieses Klo benützten, entweder bei offener Tür erledigt, was sie zu erledigen hatten. Oder mit extrem zur Seite gekniffenen Knien, was auf die Tätigkeit, um die es geht, nicht gerade förderlich wirkt. Oder, wie mir eine Freundin, die dieses Klo noch im Urzustand benützte, später einmal gestand: Mit extrem gegrätschten Beinen ließ sich die Sache auch noch bei geschlossener Türe abwickeln.
Man konnte dieses fehlkonstruierte Klo nicht nach vorne erweitern, weil dort die Eingangstüre war. Sie hätte sich dann nicht mehr öffnen lassen.
Ich löste das Problem, indem ich die Gebetsnische durch Abschlagen einiger Ziegel erweiterte, die Klomuschel drehte und den Sarg in Richtung Küchenfenster verlängerte. (In Richtung Eingangstür gings ja nicht.) Für dieses ehrgeizige Projekt benötigte ich eineinhalb Jahre, weil der Hausverwalter es mit allen Mitteln hintertrieb. Der Umbau war nämlich für ihn mit Unkosten verbunden, und deswegen bediente er sich zu seiner Verhinderung aller ihm zur Verfügung stehender Möglichkeiten, des Hausinstallateurs und eines Baumeisters.
Unkosten hatte die Hausverwaltung nicht am Ende deswegen, weil die bequeme Gestaltung des Klos irgendwie in ihren Zuständigkeitsbereich gefallen wäre. Keineswegs. Was in der Wohnung ist, war zumindest nach den damaligen österreichischen Mietgesetzen das ausschließliche Problem des Mieters. Nur was sich den Zwischen- und Außenwänden und in Decke und Fußboden abspielt, fällt in die Zuständigkeit der Hausverwaltung. Aber hier lag der Hund begraben. Der Hauptabflußstrang war nämlich undicht, und wie sich bei seiner schließlich doch erfolgten Reparatur herausstellte, glich er einem Schweizer Käse. Wie sich ebenfalls im Laufe der Zeit herausstellte: Die Stützbalken der Decke waren schadhaft und deshalb reparaturbedürftig.
Vorher jedoch rieselte jedesmal der Putz(2), wenn man die Klo- bzw. Sargtür öffnete, weil die alten Sandputze, die in Häusern dieses Alters verwendet wurden, ihren Zusammenhalt verlieren, sobald sie naß werden. Außerdem hatte einer meiner Vorgänger – anstatt das Übel bei der Wurzel zu packen und die Quelle der Feuchtigkeit zu suchen – allzu schadhafte Teile des Verputzes mit Zementputz erneuert. Dabei hatte er den Spülkasten eingemauert, und zwar dergestalt, daß der Deckel nicht mehr exakt draufpaßte und sich deshalb in labilem Gleichgewicht befand.
Die Benützung des Klos gestaltete sich also folgendermaßen: Man öffnete die Tür. Da das den hölzernen Sarg – der in Boden und Decke eingestemmt war – in leichte Schwingungen versetzte, begann der Putz zu rieseln. Man bürstete die Klobrille ab, um sich nicht in den Schutt zu setzen und setzte sich hin. Daraufhin – weil das offenbar den Spülkasten in Schwingungen versetzte, fiel einem der emaillierte – und daher kalte! – Deckel desselben ins Kreuz(3)(. Man entfernte ihn und stellte ihn auf den Boden. Die Tür ließ sich, wie gesagt, nicht schließen. Nun konnte es losgehen.
Ein untragbarer Zustand.
Zunächst schlug ich den Putz ab.
Das hätte ich nicht tun sollen.
Erstens aus rechtlichen Gründen. Der Hausverwalter konnte nämlich jetzt behaupten – und das tat er auch – der Putz wäre völlig in Ordnung gewesen und ich hätte ihn zu meinem rein privatem Vergnügen entfernt. Er konnte jede Verpflichtung, den Putz erneuern zu lassen, von sich weisen.
Zweitens aus bauphysikalischen Gründen. Der lose Putz war nämlich auch ein Schutz gegen die Feuchtigkeit gewesen. Kaum war er weg, regnete es bei mir im Klo jedesmal, wenn meine Nachbarin oberhalb die Spülung betätigte.
Ich rief bei der Hausverwaltung an und forderte eine Reparatur. Ich könne mein Klo nur mehr mit Regenschirm benützen.
Man versprach, Abhilfe zu schaffen.
Am nächsten Tag erschien bei meiner Nachbarin, nennen wir sie von nun an Gudrun, ihrer Beschreibung zufolge ein Installateurslehrling mit einem Gegenstand in der Hand, den sie als "Gummiquastl" bezeichnete.
Es handelte sich um einen Holzstab mit einem Gummipfropfen am Ende, den man zum Freilegen verstopfter Abflüsse bei Waschbecken oder Dusche zu verwenden pflegte. Er war schon für diesen Zweck ungeeignet, aber für ein Klo vollends unbrauchbar, weil sich der kreisrunde Pfropfen gar nirgends ansetzen läßt..
Er solle hier ein verstopftes Klo wieder in Gang bringen, meinte der 15- bis 16jährige junge Mann. Gudrun entgegnete ihm mit der nötigen Schärfe – über die diese Frau durchaus verfügt – daß es sich nicht um Verstopfung, sondern im Gegenteil um unerwünschte Durchlässigkeit handle, und er verschwand wieder, um sich ein angemesseneres Werkzeug zu besorgen.
Am nächsten Tag erschien er mit dem Werkzeugkasten, stemmte den Boden von Gudruns Klo auf und tauschte das defekte Verbindungsrohr zwischen Klomuschel und Hauptabflußstrang aus. Dann betonierte er den Boden wieder zu. Dazwischen lag ein Wochenende, an dem Gudrun mein Klo benützen mußte.
Für diese Tätigkeit borgte der Installateurslehrling sich meine Wasserwaage aus. Das tat er nicht deswegen, weil er sicher sein wollte, daß der Fußboden von Gudruns Klo nachher gerade war. Nein, er hatte seine Aluminiumlatte zum Verstreichen des Estrichs vergessen, und bediente sich dafür meiner Wasserwaage. Der Boden war nachher schief, und die Wasserwaage hatte Kratzer.
Wie sich später herausstellte, war der Durchmesser dieses neuen Rohres um einige Zentimeter geringer als derjenige der Einmündungsöffnung in den Abflußstrang. Die verbleibende Öffnung hatte der junge Mann mit Gips „abgedichtet“.
Gips ist kein Dichtungsmaterial und auch die Dachrinne mündete in den Hauptabflußstrang. Außerdem existierte bei dieser Öffnung des Abflußrohres, der „Muffn“, ein sogenanntes Gegengefälle: Der Abfluß der Klomuschel lag niedriger als die „Muffn“. Mit anderen Worten, das Rohr zwischen Klosettabfluß und Abflußstrang des Hauses neigte sich in Richtung Klomuschel. Wenn es regnete, so strömte Regenwasser durch den Gips in die Wand. Weniger zwar als vorher, es tropfte nicht, und es handelte sich nur um Regenwasser, aber dennoch. Die Wand blieb feucht. Es stellte sich später heraus, daß auch der Hauptabflußstrang selbst, wie schon erwähnt, löchrig war.
Inzwischen hatte ich als Folge meiner Freilegungstätigkeiten festgestellt, daß durch die jahrelange, vielleicht jahrzehntelange Feuchtigkeit die Decke tragenden Balken, die sogenannten „Tram“, völlig vermodert waren. In der Nähe der Außenwand verjüngten sie sich, als ob sie ein Biber angenagt hätte, und sie wiesen dort auch eine sehr ungesund dunkle Farbe auf. Ich konnte mit ausrechnen, daß es nur eine Frage der Zeit war, wann Gudrun samt Klomuschel bei mir unten landen würde.
Ich rief wieder einmal bei der Hausverwaltung an, schilderte den Sachverhalt und verlangte die Behebung des Gebrechens.
Einige Wochen (Wochen, nicht Tage!) später erschien ein von der Hausverwaltung geschickter Baumeister. Er betrachtete die modrigen Tram mit prüfendem Blick. Er überlegte anscheinend krampfhaft, wie er das augenscheinliche Gebrechen in meinen Zuständigkeitsbereich verweisen konnte. Dann fiel ihm auf, daß ich bei der Mauer weiter unten einige Ziegel entfernt hatte. Na, kein Wunder, meinte er, wenn sie unten die Ziegel abschlagen, daß dann oben die Balken hin werden!
Einen Moment lang traute ich meinen Ohren nicht. Dann öffnete ich die Wohnungstür und sagte leise und mit äußerster Selbstbeherrschung: „Hinaus!“
Nach Beratungen mit Freunden und der Mieterschutzvereinigung – der ich bald einmal beitrat, weil ohne das wären die auftretenden Probleme nicht zu bewältigen gewesen – entschloß ich mich, eine Anzeige bei der Baupolizei zu machen.
Der Vertreter der Baupolizei erschien und schüttelte angesichts des Zustandes des Klos den Kopf. Er teilte mir mit, die Hausverwaltung gut zu kennen, da es schon oft zu Beanstandungen in von ihr verwalteten Häusern gekommen war, und erstatte Anzeige gegen die Verwaltung.
Währenddessen stand bereits das Klo offen in der Küche, da ich den Holzkasten entfernt hatte, um meinem Installateur – der etwas dicklich ist – Raum für das Drehen der Klomuschel zu verschaffen. Außerdem hätte die gedrehte Muschel in dem bestehenden Spülkasten genauso viel Enge verursacht bei der Verrichtung einschlägiger Tätigkeiten, wie in ungedrehtem Zustand. Es war klar, daß man bei Veränderungen auch die hölzerne Kasten-Konstruktion mit einbeziehen mußte.
Zu diesem Zeitpunkt rechnete ich nicht mit den beschriebenen Komplikationen. Ich dachte, daß es eine Frage von Wochen sein würde, bis die offensichtlichen Mängel an Rohren, Wand und Balken behoben sein würden.
Beim Lösen der Klomuschel, die mit Zement am Boden befestigt war, brach von dieser unten ein Stück ab. Sie wackelte. Der Installateur meinte, es sei nicht sinnvoll, eine neue Klomuschel zu montieren, solange die anderen Reparaturen noch ausständig seien. Sie könnte dabei beschädigt werden. Also ließen wir die alte und wackelige Klomuschel als Provisorium stehen, bis das Klo, die Tram und die Wand saniert würden.
Den völlig verrosteten Spülkasten montierte er ab. Auch hier meinte er: Wenn alles fertig ist, bring ich dir einen neuen. Aus Kunststoff, der kann dann auch nicht mehr rostig werden.
Wie gesagt, wir beide meinten, es würde nicht lange dauern, bis das ganze in Ordnung käme.
Wenn ich die Tür öffnete, sah der vor der Tür Stehende zuerst mich, dann die Klomuschel. Diesen Anblick genossen im Laufe der folgenden anderthalb Jahre Briefträger, Nachbarn, der Gaskassier, Zeugen Jehovas, Besucher und der Rauchfangkehrer.
Wollte jemand, der bei mir auf Besuch war, das Klo benützen, so schloß ich während der Zeit der Benützung die Tür von der Küche ins Wohnzimmer und verweilte während der Dauer der Klobenützung im Wohnzimmer. Nicht, ohne dem Klobenützer vorher Instruktionen zu erteilen: Vorsicht! Das Klo wackelt. Da ist ein Kübel, füll ihn vorher voll, damit du nachher gleich hinunterspülen kannst.
Besonders neckisch war das alles, wenn ich Feste veranstaltete – was in eineinhalb Jahren ja hin und wieder vorkommen kann. Im Wohnzimmer bildeten sich Schlangen. Der Kübel kam nicht zur Ruhe.
Manchmal war jemand auf Besuch und ich kochte für die betreffende Person. Bitte setz dich doch und leiste mir Gesellschaft! sagte ich und wies mit einladender Handbewegung auf die Klomuschel. Aber Vorsicht! Sie wackelt!
Die ganze Situation wurde noch dadurch erschwert, daß ich oft Mitbewohner hatte. Nein, es waren nicht die Freuden der Liebe, die mir immer wieder Gesellschaft bescherten. Es handelte sich ausnahmslos um Notlagen, die Leute als Mitbewohner in meine Wohnung führten. Ich hatte damals einen recht unsoliden Freundeskreis. (Daran hat sich leider bis heute nicht viel geändert, trotz teilweise wechselnden Personen. Allerdings nistet sich heute keiner mehr bei mir ein.) Diese Notlagen hatten verschiedenste Ursachen: Ein schlechtes Verhältnis zu den Eltern, Umzug vom Land in die Stadt, vom Ausland nach Österreich, überhaupt chronische Wohnungslosigkeit, Beziehungskrisen, oder höchst verrückte Kalkulationen, die sich nachteilig auf die Wohnsituation auswirkten. In allen Fällen: Kein Geld, und der Umstand, daß es in unserer Gesellschaft eben keine Selbstverständlichkeit ist, ein Dach über dem Kopf zu haben. Wenn man nicht aufpaßt, kann es einem leicht abhanden kommen.
So lebte mit Unterbrechungen mehrere Wochen ein Pärchen bei mir. Sie stammte aus einer niederösterreichischen Kleinstadt, er aus einer Landeshauptstadt. Er hatte wegen Drogenhandel einige Zeit im Gefängnis verbracht und sich nachher bei ihr eingenistet und von ihr parasitiert, obwohl bei ihr auch nicht gerade viel vorhanden war. Sie hatte sich für ihn aufgeopfert, um dieses gefallene Geschöpf wieder in die Gesellschaft zu integrieren.
So weit, so gut. Das wäre mich ja alles nichts angegangen. Sie wohnte nämlich in einer Ein-Zimmer-Gemeindebauwohnung(4), die sie sich mit einer Mischung aus Intervention (seitens des damaligen Direktors der Österreichischen Nationalbank) und Theater (Ich bring mich um, weil ich hab nix zum Wohnen!!) über die Gemeinde Wien organisiert hatte. Aber das Geld war, wie gesagt, knapp bei ihr und so kam sie auf die Idee, sich eine Einkommensmöglichkeit darüber zu erschließen, daß sie diese billige Gemeindewohnung für einen Monat oder 2 Monate an einen amerikanischen Universitätsprofessor vermieten würde, um sich Einkünfte zu verschaffen.
Soweit ich mich erinnere, zahlte sie ca. 900 Alpendollar(5) für die Wohnung und der Universitätsprofessor ihr 5.000 oder 5.500. Also, so rechnete die verrückte Schachtel, ein Reingewinn von 4.500 Schilling! Oder 4.000, abzüglich Strom und Gas.
Ich hab sie, nennen wir sie ab jetzt Ulli, noch gefragt, als sie mir von diesem Geniestreich erzählte: Wo wohnst du in dieser Zeit? Du und er?
Darauf hat sie gesagt: Kein Problem, hab ich schon mit einer Freundin aus meinem Heimatort besprochen, wir können bei ihr wohnen.
Besagte Freundin wohnte in einem Krankenschwesternheim in einer Bett-Kochnische-Kombination, wo schon eine einzelne Person Platzangst kriegt. Da sind diese zwei Subjekte dann auch noch eingezogen. Das hat ca. 2-3 Tage gehalten, dann hat die gute Frau sie verständlicherweise hinausgeschmissen.
Dann hat Ulli bei mir angeklopft. Was sollte ich machen, ich hatte 1981 selbst monatelang keine Wohnung, ich wollte nicht wen anderen vor der Tür stehen lassen. Die beiden gaben sich natürlich keiner vernünftigen Beschäftigung hin, wie man aus der bisherigen Beschreibung unschwer erschließen kann. Ihr hauptsächlicher Zeitvertreib bestand darin, sich den ganzen Tag mit einer zur Wasserpfeife umgebauten Blumenvase mit Haschisch zuzutörnen. Da ich Nichtraucher bin, wünschte ich nicht, daß in den Zimmern geraucht wird und wies ihnen die Küche-Klo-Kombination als Raucherzimmer zu.
Ich hielt mich damals nicht viel zu Hause auf, sondern auf der Universität, in Büchereien, in Kantinen, Mensen und Wirtshäusern. Zum Glück, weil die beiden waren aufgrund des Blödsinns, den sie daherredeten, unerträglich. Sie beschäftigten sich mit Schamanismus.
Wenn ich am Abend mein trautes Heim betrat, bot sich mir regelmäßig der gleiche Anblick: Einer von beiden saß, oder besser: hing auf der Klomuschel, der andere am Badewannenrand. (Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich in der Vorraum-Küche-Klo-Kombination von 9 Quadratmetern eine Badewanne und einen Durchlauferhitzer einbauen lassen.) Auf dem Eiskasten stand die Blumenvase. Beide blickten mich mit verträumtem Blick an, als käme ich von einem anderen Stern, und lächelten milde.
Es kostete mich einige Mühe, die beiden wieder loszuwerden. Sie drangen dann noch einmal in meiner Abwesenheit in meine Wohnung ein und versauten sie gründlich.
Und das alles, obwohl die besagte Gemeindebauwohnung von Ulli über ein funktionsfähiges Klo und eine abgetrennte Dusche verfügte!!
Schließlich zeitigte die Intervention der Baupolizei Früchte und die Reparatur wurde in Angriff genommen. Zunächst demontierten die Handwerker einer Baufirma wieder einmal Gudruns Klo und stemmten ein großes Loch in meine Decke bzw. ihren Fußboden. Dann zogen sie anstelle der vermoderten Balken Stahlbetonträger ein, füllten die Zwischenräume und verputzten das Ganze wieder.
Während dieser Zeit war Gudrun selbstverständlich wieder auf mein Klo angewiesen. Ich gab ihr wieder einen Wohnungsschlüssel und versicherte sie meiner Gastfreundschaft. Tu dir keinen Zwang an. Mein Klo ist dein Klo!
Gudrun war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr allein auf ihren 33 Quadratmetern. Sie hatte sich mit einem ausgesprochen gut aussehenden ägyptischen Rosenverkäufer zusammengetan. Dieser junge Mann, nennen wir ihn Said, war sofort bei ihr eingezogen und teilte seither alle Wohnungs-Freuden und -Leiden mit ihr.
Er erschien während dieser 4 oder 5 Tage, die die Reparatur der Zwischendecke in Anspruch nahm, allmorgendlich um 8 Uhr in Gudruns Schlafrock (blau-gelb kariert) bei mir am Bett, weckte mich auf und bat mich, in den nächsten 10 Minuten die Küche NICHT zu betreten, da er auf dem Klo säße.
Auch diese Episode ging zu Ende, die Decke war repariert und ich gewann die Alleinverfügbarkeit über mein stilles Örtchen wieder, obwohl dieses während dieser Zeit eigentlich nicht als still bezeichnet werden konnte.
Irgendwann danach wurde auch die Mauer aufgestemmt und der löchrige Hauptabflußstrang ersetzt.
Zuletzt erschienen zwei jugoslawische Maurer und verputzten die Mauer inklusive der Gebetsnische neu und sehr gut. Sie schlugen die Hände zusammen vor Mitgefühl über meine Wohnverhältnisse. Und das bei einer Österreicherin, einer Frau, einer Studentin! So was gibt es ja nicht einmal bei uns auf dem Balkan!
Sie verschafften mir auch eine neue Klomuschel auf Kosten der Hausverwaltung, weil sie angaben, sie hätten die alte bei den Verputzarbeiten ruiniert. Und sie riefen mich ans Fenster und zeigten mir, daß aus dem Haus gegenüber gerade eine Klomuschel abtransportiert wurde – mit einer intakten hölzernen Klobrille! Ich sauste hinunter, bemächtigte mich der Klobrille, putzte und montierte sie später und sie hat mich von da an fast 20 Jahre auf meinem Lebensweg begleitet.
Ich malte das Klo aus – schwarz-rot –, stellte den Kasten wieder auf, erweiterte ihn mit Spanplatten, ergänzte die Stufe am Fußboden, der Installateur brachte einen neuen Spülkasten und von da an war die Benützung des Klos eine reine Wonne. Ich veranstaltete gleich ein Fest zur Feier des Anlasses, ein Klo-Einweihungs-Fest. Später verflieste ich den Fußboden auch noch.
Viele Besucher, vor allem aus Osteuropa, haben später den Kopf über dieses eigenartige Räumchen geschüttelt und gemeint, so etwas hätten sie noch nie gesehen bzw. in Wien aber wirklich nicht erwartet, usw.
Sie wußten gar nicht, was für einen Luxus es darstellte und wie holprig der Weg zu diesem von ihnen vorgefundenen Zustand gewesen war!
Es wurde und wird in Literatur und Publizistik viel über die anale Phantasie und Fluchkultur der Wiener geschrieben. Und darüber, wie häufig und leichtfertig das Wort "Scheiße!" in dieser Stadt verwendet wird.
Aber ist es denn ein Wunder, bei solchen Zuständen?!
Teil 1: Was zu einem Wiener Zinshaus so alles dazugehört
Das Mietverhältnis
Das Verhältnis zwischen Hausherr und Mieter kommt mit dem schweren Geburtsfehler unserer Eigentumsordnung in die Welt und kann sich davon dann nicht mehr erholen. Irgendwie brauchen sie einander, Vermieter und Mieter, aber sie können es einander nie recht machen.
Der Hausbesitzer hat das Haus entweder bauen lassen, oder gekauft, oder geerbt. Aber abgesehen davon, wie er zu diesem Eigentum gekommen ist und wieviel er darin investiert hat: Es soll ihm etwas einbringen. Dafür, daß er ordentliche Einkünfte aus diesem Eigentum hat, sollen die Mieter sorgen. Der Hausbesitzer ist im Idealfall so eine Art Rentier, dessen Immobilie sich sozusagen von selbst erhält und ihm zusätzlich schöne Einkünfte verschafft, ohne daß er sich dafür besonders anstrengen muß. Oft ist es auch so, aber nicht immer. Es gibt nämlich viele Faktoren, die diese Rentiers-Idylle stören.
Der erste Faktor ist immer der Mieter selbst. Der Mieter muß irgendwo wohnen, hat keine eigene Wohnung, also muß er eine mieten. Soweit, so gut. Aber kaum ist der Mietvertrag abgeschlossen, die Wohnung bezogen, schon stellt sich in manchen Fällen Unzufriedenheit ein. Die bloße Erlaubnis, eine Wohnung auf bestimmte Zeit benutzen zu dürfen – das übliche ist bei uns heute der befristete Mietvertrag – erscheint ihm zu teuer erkauft. Es beginnen Spitzfindigkeiten, mit Hilfe von Juristen, die dem Mieter, sofern er sie sich leisten kann, genauso zur Verfügung stehen wie dem Eigentümer. Die Wohnung ist kleiner als angegeben, das Haus wurde vor 1945 gebaut, die Heizung entspricht nicht dem im Mietvertrag angegebenen Standard, die Wohnung ist zu niedrig usw. Alles Gründe, um eine Herabsetzung des Hauptmietzinses einzuklagen.
Die Miete setzt sich zusammen aus dem Hauptmietzins und den Hausbetriebskosten, als da sind: Ganglicht, Reinigung des Stiegenhauses, Kaminkehrer, Ungeziefervertilgung, Hausversicherung, Einkünfte des Hausbesitzers, Verwaltungskosten, Liftkosten, sofern ein Lift vorhanden, usw. Ist also am Hauptmietzins nicht zu rütteln, so kann man immer noch die Betriebskostenabrechnung beeinspruchen und eine Herabsetzung der Betriebskosten einklagen.
Dann gibt es noch Mieter, die aus Alkoholismus, Sorglosigkeit, Schusseligkeit, völliger Illiquidität oder ähnlichen Gründen die Miete nicht pünktlich zahlen können oder wollen. Das geht zwar auf jeden Fall zu ihren Lasten, denn das Recht auf Verwertung des Eigentums, in diesem Falle also: Kassieren der Miete, steht weit über dem Bedürfnis nach Wohnraum. Im Juristendeutsch heißt das so, daß die Miete eine "Bringschuld" ist, die der Mieter unaufgefordert monatlich zu leisten hat, anderenfalls er das Wohnrecht verliert.
Zivilrechtlich wird es auch so ausgedrückt, daß beide Seiten einen Vertrag unterschrieben haben. Wenn eine Seite diesen Vertrag verletzt, durch Nichtzahlen der Miete, so wird der Vertragspartner seiner Verpflichtung entbunden und muß ihn daher auch nicht mehr in seiner Immobilie dulden. Da sieht man noch einmal den Vorteil, den das Recht für die Abwicklung der Interessensgegensätze hat: Der eine hat was, was der andere braucht. Ausgangspunkt ist also eine völlige Ungleichheit. Aber dann, im Vertrag, stehen sich beide als Gleiche gegenüber, die sich in völliger Freiwilligkeit und Mündigkeit über den Vertragsgegenstand, in diesem Falle die Wohnung, ins Benehmen setzen.
Also, der Mieter zahlt nicht und wird hinausgeschmissen. Ja, wenn das so einfach ginge! stöhnen die Hausbesitzer im Chor. Das Delogierungsverfahren dauert nämlich auch seine Zeit, und in dieser Zeit besetzt der (eigentlich Nicht-Mehr-)Mieter die Wohnung, zahlt aber weiterhin nicht. Hat der Mieter womöglich noch kleine Kinder, erschwert das die Sache noch mehr. Die kann man nämlich nicht ganz so einfach auf die Straße setzen wie erwachsene Menschen. Daß letztere auf Parkbänken und unter Brücken nächtigen, stört nämlich den Gesetzgeber wenig, aber bei minderjährigen Bürgern treten andere Gesichtspunkte dazu, Jugendschutz, Sorgepflicht, und so weiter. Im Grunde sind es ja noch unfertige Bürger, aus denen sich bei der notwendigen Wartung und Erziehung einmal tüchtige Menschen werden können – aus der Sicht des Staates: Steuerzahler, Eltern, Soldaten. Also gehören sie geschützt, damit sie nicht vor der Zeit verderben.
Sehr viel sind dieser gesetzliche Schutz und die damit einhergehenden Rechte nicht wert. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Also, Kinder erschweren die Delogierung.
Aber irgendwann wird der Hausbesitzer die säumigen Mieter doch los. Bis dahin hat er allerdings Unkosten und Verdienstentgang gehabt. Und dann bleibt das Bewohnen einer Wohnung meist nicht ohne Folgen. Die Mieter, diese Mistkerle, haben sie benutzt, vernutzt, „heruntergewohnt“, ruiniert! Die Kinder haben auf den Spannteppich gemacht, das Meerschweinchen am Vorhang genagt, die Wände haben Flecken, ein Fenster ist beim Ehestreit in die Brüche gegangen, kurz: Die Wohnung muß renoviert werden, selbstverständlich auf Kosten des Wohnungs- oder Hausbesitzers, weil der Mieter hat ja kein Geld.
Um den Hausbesitzer vor solchem Unbill zu schützen, existiert die Einrichtung der Kaution. Landesüblich sind drei Monatsmieten. Aber auch die löst das Problem nicht. Scheiden Hausherr und Mieter in Unfrieden, also mittels Delogierung, so bleibt die Kaution zwar dem Vermieter, ist aber meistens zu gering für die Unkosten, die bei der Sanierung der Wohnung anfallen.
Trennen sie sich einvernehmlich, so will der Mieter die Kaution zurück. Der Hausherr würde sie gerne behalten, versucht also dem Mieter irgendwelche Beschädigungen nachzuweisen. Der wiederum kontert, das sei schon vorher kaputt gewesen, und droht mit dem Kadi. Ein Gerichtsverfahren kostet allerdings meistens mehr, als die Kaution ausmacht. Die Drohung ist also ein Papiertiger.
Manchmal zahlt sie der Hausbesitzer dennoch zähneknirschend zurück und berappt die die Renovierung der Wohnung stöhnend aus seiner eigenen Tasche.
Und was passiert dann, wenn sie wieder hergerichtet ist? Das ganze geht von vorne los, man muß wieder Mieter finden und weiß nie, ob man sich dabei nicht genau so eine Bagage einhandelt, wie man sie gerade mit Mühe und Not losgeworden ist. Und, um es nicht zu vergessen, mit beträchtlichen Unkosten!
Wenn man den Hausbesitzern zuhört und sich ihre Klagen zu Gemüte führt, so könnte man meinen, sie seien so etwas wie die Caritas inmitten einer undankbaren Welt, die ihre Aufopferung nicht würdigt. Dabei muß ihnen für ihre ganze Mühsal immer noch ein ordentlicher Gewinn übrig bleiben, sonst wäre diese Gesellschaftsklasse ja schon längst vom Antlitz der Erde verschwunden.
Es gibt natürlich auch Wohnungen und Wohnungen. Ein Teil des am Markt angebotenen Wohnraums ist von Haus aus, wie man so schön sagt, so beschaffen, daß nur einkommensschwache Personen in ihn einzuziehen bereit sind. Viele Wohnungen sind klein, eng oder niedrig, feucht oder finster, liegen im Erdgeschoß, mit Blick auf die Koloniakübel im Hof (Geruch wird mitgeliefert) oder sonstwie muffig. Das Klo ist am Gang, oder die Wände sind dünn, man hört von den Nachbarn alles durch, von der Klospülung über Kindergeplärr bis zum Geschlechtsverkehr. Oder an einer Hauptverkehrsstraße, wo man tagsüber die Fenster nicht öffnen kann und nachts auch keine Ruhe hat. Man kann in solche Wohnungen dann noch Illegale einziehen lassen, abgewiesene Asylanten oder polnische Schwarzarbeiter, mit 3 bis 4 Betten pro Zimmer – aber das Risiko, daß hier die Miete nicht gezahlt wird oder andere Scherereien entstehen, steigt proportional zu den Bemühungen, aus irgendwelchen trostlosen Löchern einen ordentlichen Profit herauszuholen.
Die besseren Wohnungen, in die die „besseren“ Mieter einziehen, sind zwar saniert, hell und durchschnittlich bis gut ausgestattet. Aber die vermögenderen Mieter kennen ihre Rechte besser und sind auch bereit, selbige einzufordern. Selbst wenn sie pünktlich zahlen und nicht schmutzen, können sie dennoch dem beklagenswerten Vermieter das Leben schwer machen.
Sofern sie sich überhaupt einstellen. Denn seit der Aufhebung der Mietzinsbindung sind die Mieten in die Höhe geschnellt, während die Arbeitsplätze eher weniger geworden und die Gehälter nicht flächendeckend gestiegen sind. So kann es vorkommen, daß Wohnungen lange leer stehen. Sie sind dann totes Kapital für ihren Besitzer, der die Betriebskosten weiterhin zahlen muß.
Aber selbst wenn zwischen Mieter und Vermieter die größtmögliche Harmonie herrscht, was die schadens- und störungsfreie Benützung der Wohnung und das Zahlen der Miete angeht, so gibt es dennoch genug Umstände, die diese Harmonie stören können. Dazu gehören die Nachbarn, die Witterung und der Zahn der Zeit. Es kommt zu Rohrbrüchen, Wasserschäden, das Dach kann undicht werden. Eine Heizung, ein Herd waren einmal neu, aber irgendwann geben sie den Geist auf. Wer ist für die Reparatur zuständig? Der Mieter oder der Vermieter? Was steht im Mietvertrag? Sie hätten das Kleingedruckte lesen sollen! Ist der Schaden versichert und wenn ja, zahlt die Versicherung?
Alle diese Reparaturen sind ebenso lästig wie notwendig, wenn sie im Eigenheim auftreten. Sobald sich jedoch das Eigentumsverhältnis dazugesellt, kommt es zu Verwicklungen, die manchmal sogar in den Medien landen.
Bei der bisherigen Betrachtung habe ich so getan, als stünden sich Mieter und Vermieter unmittelbar gegenüber, um ihr Verhältnis zu gestalten und ihre Gegensätze auszutragen. Ich habe den wichtigen Puffer ausgelassen, der zwischen den beiden steht: Die Hausverwaltung.
Die natürlichen Feinde des Mieters: Hausbesitzer und Hausverwalter
Durch die Einführung der Person des Hausverwalters gewinnt die Angelegenheit sehr an Dynamik. Die Hausverwalter sind of Juristen – im Falle des unsrigen war es so – und manchmal auch selbst Hausbesitzer, aber das soll uns hier nicht stören.
Der vorgestellte Idealfall – von Seiten des geplagten Hausbesitzers – ist der, daß der Hausverwalter alles erledigt, Reparaturen organisiert, Mieter sucht, Verträge abschließt, Klagen und Delogierungen abwickelt, und dem Hausbesitzer monatlich seine Einnahmen überweist. Dafür wird er bezahlt.
Allerdings gibt dieser Freibrief, den der Besitzer dem Verwalter erteilt, letzterem einige Möglichkeiten für Mißbrauch, die im Falle des unsrigen weidlich ausgenützt wurden.
Der Umstand, daß einem das Wohnungseigentum sozusagen doppelt gegenübertritt, einmal als es selbst, einmal als sein Vertreter, gibt ihnen die Möglichkeit, das Spiel „Guter Polizist – böser Polizist“ zu spielen und den Mieter mit seinem Anliegen von einem zum anderen laufen zu lassen, bis ihm die Luft ausgeht. Auch diese Möglichkeit wurde im Falle der Schützengasse ausgereizt.
Der Hausverwalter, nennen wir ihn Dr. Miesling, war optisch eine sehr jämmerliche Figur. Obwohl er ein hübsches großes Haus in einem prestigereichen, bereits von den Habsburgern frequentierten Kurort südlich von Wien besitzt, – wie mir ein Maurer, der in der Schützengasse Reparaturen durchführte, einmal erzählt hat –, und sicher auch sonst nicht zu den Ärmsten zählt, kam er immer so daher, daß man ihm fast einen Schilling(6) hätte schenken wollen. Er trug schlechtsitzende Anzüge von der Stange und machte den Eindruck, als ob er sich nicht ordentlich ernähren würde. Er wirkte anämisch. Und erst sein Büro! Es befand sich in einer Altbauwohnung, in der sichtlich jahrzehntelang nichts erneuert worden war, und war muffig und finster. Der Lack auf den Türen und Türstöcken war nicht mehr weiß, sondern vor Alter gelbbraun. Das Wartezimmer war das Vorzimmer, darin standen Möbel, die nur deshalb nicht vom Sperrmüll sein konnten, weil es in Wien diese Einrichtung nicht gibt. Geld wurde jedenfalls sicher nicht dafür gezahlt. Vermutlich hatte er sich an Möbeln bedient, die Mieter in Wohnungen zurückgelassen hatten.
Das Wartezimmer war immer bumvoll, weil die Mieter in den von Dr. Miesling verwalteten Häusern stets viel Anlaß zu Beschwerden hatten. Viele der Wartenden waren Ausländer. Die waren noch leichter übers Ohr zu hauen als die Einheimischen. Es roch nach rohen Zwiebeln und ähnlichem. Das wäre nicht weiter schlimm gewesen, wenn in dem Büro hin und wieder gelüftet worden wäre. Solches fand jedoch riechbarerweise nie oder nur sehr selten statt.
Und wir warteten. Ich glaube, Mieslings Tag der offenen Tür war Mittwoch. Er saß in seinem Zimmer und tat beschäftigt. Oft war gar niemand bei ihm im Zimmer. Er versuchte, die Leute durch langes Warten von der Beschwererei abzuhalten. Und er hatte sicher teilweise Erfolg dabei. Es ist ja für einen arbeitenden Menschen nicht so einfach, sich an einem Werktag freizunehmen und stundenlang in einem Büro auf die Audienz beim Hausverwalter zu warten.
Nachdem ich ein oder zweimal an diesem unerfreulichen Ort mehrere Stunden verbracht hatte, erledigte ich alles nach Möglichkeit nur mehr schriftlich, am besten gleich über einen Anwalt.
Die Sekretärinnen in diesem Büro verhielten sich ähnlich unverschämt, nach dem Motto: „Wie der Herr, so’s Gscherr(7)“. Einmal rief eine von ihnen bei mir an und ersuchte mich, fast in Befehlsform, meinen Nachbarn Achmed aus dem Erdgeschoß zum Telefon zu rufen, da sie ihm dringend etwas mitzuteilen hätte. Als ich ihr entgegnete, ich sei keine öffentliche Sprechstelle und stünde für die Kommunikation zwischen Dr. Miesling und meinen Nachbarn nicht zur Verfügung, legte sie auf. Später erzählte mir Achmeds Sohn, aus dem Büro Dr. Miesling sei ein Brief gekommen, in dem behauptet wurde, laut Auskunft der Frau Lanier hätte Achmed inzwischen längst ein Telefon und er solle doch die Nummer schnellstens dem Büro Dr. Miesling bekanntgeben.
Als die Feuchtigkeit in Achmeds Erdgeschoßwohnung so überhandnahm, daß bei einem Spanplattenkasten die Rückwand vermoderte, war Dr. Miesling sich nicht zu gut, persönlich zu erscheinen und Achmed zu erklären, das hätte nichts mit der Wand zu tun. Man dürfe Kästen nicht vor Wände stellen, da fingen alle an zu modern.
Als ich bereits im Begriff war, der Schützengasse den Rücken zu kehren, erwähnte ich einem Freund gegenüber zufällig den Namen Miesling. Der Miesling! rief mein Freund, das ist ja ein Gauner! Wem sagst du das! antwortete ich.
Es stellte sich heraus, daß Dr. Miesling ein Haus verwaltete, in dem mein Freund eine Eigentumswohnung geerbt hatte. Das Haus war das Hinterhaus, hatte einen Hof und ein Vorderhaus, welches aus Mietwohnungen bestand, und die Wohnungseigentümer des Hinterhauses waren auch kollektive Eigentümer des Vorderhauses und erhielten nach Quadratmeteranteilen des Hinterhauses ihren Teil aus den Mieteinnahmen des Vorderhauses. Mein Freund wußte das nicht. Er besaß die Wohnung im Hinterhaus bereits seit 3 Jahren, als ihm eine Nachbarin auf diesen Umstand aufmerksam machte. Eigentlich unabsichtlich, sie fragte ihn nur, ob er seinen diesjährigen Anteil an den Mieteinnahmen schon erhalten hätte. Als mein Freund im Büro von Dr. Miesling anrief und fragte, was es mit den Mieteinnahmen der letzten 3 Jahre auf sich hätte, sagte die Sekretärin frech: Jetzt kommen sie daher! Das hätten sie vorher sagen müssen. Das finden wir jetzt sicher nicht mehr! (Das war im Jahr 2002, wo der kleinste Handwerksbetrieb bereits seine Abrechnung mit dem Computer machte.) Am nächsten Tag war sich Dr. Miesling wiederum nicht zu gut dafür, die betroffene Nachbarin persönlich anzurufen und unfreundlich anzufahren, ob sie nichts besseres zu tun habe, als im Stiegenhaus mit den Nachbarn zu schwatzen und sich in Sachen einzumischen, die sie nichts angingen.
Das Geld landete einen Monat später kommentarlos auf dem von meinem Freund angegebenen Konto. Es handelte sich immerhin um eine Summe von ca. 60.000 Schilling (4360 Euro).
Das lichte Gegenstück zu Dr. Miesling war die Hausbesitzerin, Frau Dr. Zimmerherr. Ihr wichtigster Wesenszug war, daß ich ihr nie begegnet bin. Ich kannte ihre Mutter, die noch ein paar Jahre nach meinem Einzug die Ordination im Erdgeschoß benützte. Ebenso kannte ich ihre Tochter, die ein paar Jahre lang in der Schützengasse wohnte. Auch ihren Sohn habe ich einmal kennengelernt, als er sich bei mir eine Kehrschaufel ausborgte, um das vom Kaminkehrer verursachte Chaos notdürftig zu beseitigen. Aber Frau Dr. Zimmerherr selbst habe ich nie zu Gesicht bekommen, 21 Jahre lang. Ich weiß nicht, ob sie groß oder klein, dick oder dünn, blond oder dunkelhaarig ist. Sie war die graue Eminenz dieses Hauses und die gute Fee, an die man sich wenden mußte, wenn mit Dr. Miesling gar kein Weiterkommen mehr möglich war.
Meine Nachbarin, die immer sehr gut informiert war (sie hatte die Wohnung dank der Vermittlung einer gemeinsamen Freundin von ihr und Frau Dr. Zimmerherr erhalten), erzählte mir einmal, wie Dr. Miesling zum Hausverwalter der Schützengasse wurde. Lange Zeit hatte die Belange des Hauses nämlich der Mann von Frau Dr. Zimmerherr erledigt, und er hatte auch die jährliche Abrechnung gemacht.
Aber es hatte immer Schwierigkeiten mit einem Mieter aus dem 1. Stock gegeben, mit dem Querulanten Hölzlmauer. Bei der Abrechnung hatte dieser immer beanstandet, daß hier ein Schilling zu viel verrechnet worden sei, dort 50 Groschen nicht richtig begründet seien, usw.
Und da war es Herrn Zimmerherr eines Tages zu blöd geworden, und er hatte sich geweigert, sich weiter von Hölzlmauer papierln(8) zu lassen. Und da mußte ein Hausverwalter her.





























