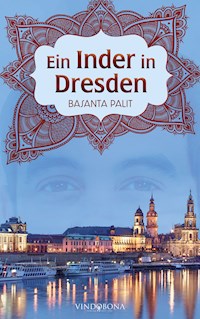
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vindobona Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nabin Sen forscht zu Zeiten der DDR als indischer Stipendiat an der TH Dresden. Er lernt Menschen kennen, die ihm ihre spannenden Lebensgeschichten erzählen – von Liebe, Eifersucht, Vergewaltigung und Mord, Tod und Wiedergeburt; von der Begegnung mit Gautama Buddha bis hin zur Flucht aus Nazideutschland nach Indien zu Mahatma Gandhi. Im Gegenzug erzählt Nabin fesselnde Geschichten aus seiner Heimat, leistet einem Studenten Beistand in seelischer Not und trägt zur Aufklärung eines Verbrechens bei. Er verliebt sich in eine deutsche Studentin, doch sie flüchtet in den Westen und vereitelt eine Heirat. Nabin erlangt den Titel eines Doktoringenieurs. Kaum auf dem Rückflug in die Heimat, hilft er einer deutschen Frau bei ihrer Flucht aus der DDR zu ihrem Geliebten nach Indien ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum 2
Widmung 3
1 - Stipendium aus Deutschland 4
2 - Endlich in Deutschland! 16
3 - Ohne Fleiß kein Preis 29
4 - Tödliche Verwechslung 42
5 - Mustafa im Thüringer Wald 60
6 - Leben nach dem Leben 74
7 - Liebesglück eines Flüchtlings 88
8 - Versöhnung an der Ostsee 109
9 - Fast eine Liebeserklärung 122
10 - Beistand in der Not 138
11 - Von der Dunkelheit ins Licht 152
12 - Der Abschied 169
13 - Rückflug unter Angst 186
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2022Vindobona Verlag
ISBN Printausgabe: 978-3-949263-35-4
ISBN e-book: 978-3-949263-36-1
Lektorat: Dr. Annette Debold
Umschlagfoto: Hongqi Zhang (aka Michael Zhang), Zzorik, Anyaivanova | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: Vindobona Verlag
www.vindobonaverlag.com
Widmung
Meiner Frau Ursula widme ich dieses Buch.
Sie hat mich zum Schreiben immer inspiriert.
Ferner hat sie mein Manuskript mit Interesse
gelesen, fehlerhafte Stellen korrigiert
und einige Ausdrücke verbessert.
1 - Stipendium aus Deutschland
Es war im Jahr 1958. Eines Vormittags im Frühling rief mich Herr Ananda Das, der Direktor meiner Fachhochschule North Bengal Polytechnic Institute, von seinem Büro aus an und bat mich, zu ihm zu kommen. Ich arbeitete als hauptamtlicher Dozent im Fachbereich Elektrotechnik.
Zur Begrüßung sagte er: „Guten Tag Herr Sen, bitte nehmen Sie Platz!“ Er schaute mich an. Es schien mir, als suchte er für das, was er mir mitteilen wollte, eine Formulierung mit Überraschungseffekt. Nach kurzer Pause fragte er mich unverblümt: „Möchten Sie nach Deutschland?“
„Herr Das, soll das ein Scherz sein?“, antwortete ich.
„Nein, das ist kein Scherz. Mit etwas Glück haben Sie eine echte Chance, sich in Deutschland weiterbilden zu lassen. Es gibt einige Stipendien, die es hauptamtlichen Dozenten ermöglichen, an einer einjährigen Weiterbildung in der deutschen Industrie teilzunehmen. Sind Sie daran interessiert?“
„Natürlich bin ich interessiert, sogar sehr. Aber wer gibt wem die Stipendien und warum?“
„Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, das heißt die Regierung Westdeutschlands, stiftet die Stipendien. Sie wissen sicher, Deutschland wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in zwei Teile gespalten.“
„Ja, ich weiß.“
„Nun, seit der Unabhängigkeit Indiens bieten einige westliche Länder Indien Stipendien für junge Ingenieure und Wissenschaftler an. Die Gelder werden für die Weiterbildung in Industriebetrieben, an Universitäten oder an Technischen Hochschulen gezahlt. Diese Geste der ausländischen Regierungen ist als Entwicklungshilfe für Indien zu betrachten.“
„Wo muss man sich für das Stipendium bewerben?“
„Die Bewerbung ist an das Ministerium für Erziehungswesen der indischen Zentralregierung in Neu-Delhi zu richten.“
Herr Das gab mir die Bewerbungsformulare und fügte hinzu: „Es ist meine Pflicht, jüngere Dozenten zu fördern. Sie sind nicht verheiratet. Somit haben Sie beim Auslandsaufenthalt eine Sorge weniger.“
Ich bedankte und verabschiedete mich vom Direktor. Als ich sein Büro verließ, breitete sich in mir die freudige Hoffnung aus, nach Westdeutschland reisen zu können. Aber ich war mir unsicher, ob ich überhaupt eine Chance hätte, aus den vielen Bewerbern aller Bundesländer Indiens ausgewählt zu werden.
Ich, Nabin Sen, siebenundzwanzig, stamme aus Westbengalen, einem Bundesland Indiens. Mein Beruf ist Diplom-Ingenieur. Mein Vater wünschte, dass ich an einer Technischen Hochschule in Indien weiterstudieren und dort einen Doktortitel erwerben sollte. Eine Weiterbildung in meinem Fachbereich im westlichen Ausland mit eigenen Mitteln kam nicht infrage, weil mein Vater nicht in der finanziellen Lage war, mich bei einem mehrjährigen Auslandsaufenthalt finanziell zu unterstützen. An ein Stipendium aus dem Ausland hatte ich nicht zu träumen gewagt. Und jetzt kam die fröhliche Nachricht von Herrn Ananda Das! Ich füllte das Bewerbungsformular aus, reichte es bei der Direktion ein und fing an mir über Deutschland Gedanken zu machen.
Das Ministerium für Erziehungswesen der indischen Zentralregierung in Neu-Delhi prüfte sorgfältig die Bewerbungen aus dem ganzen Land und traf die Entscheidungen. Nach einem Monat erhielt ich einen Brief von einem Untersekretär des Ministeriums. Er bat mich, für eine Abklärung im Zusammenhang mit meiner Bewerbung nach Neu-Delhi zu kommen. Dieser Brief beunruhigte mich. Ob das Ministerium meine Bewerbung ablehnen würde? Im Ministerium wurde ich von Herrn Biplab Rao, dem Untersekretär, freundlich empfangen. Wir hatten eine kurze Unterredung.
„Herr Sen, Sie sind ein Dozent der Fachhochschule. Wollen Sie weiterhin im Lehrberuf bleiben?“, fragte mich Herr Rao.
„Ja“, antwortete ich kurz.
„Warum?“, fragte Herr Rao.
„Ich unterrichte gern. Mir gefällt der Umgang mit den Studierenden. Ich habe die Absicht, später Fachbücher zu schreiben.“
„Wünschen Sie sich nicht, einmal an einer Technischen Hochschule im Ausland zu forschen und eine Dissertation zu schreiben?“
„Natürlich, sehr gern, wenn mal eine solche Chance kommt“, sagte ich.
„Warum haben Sie sich dann nicht für ein Forschungsstipendium beworben?“
„Unser Direktor hat mir nur die Unterlagen für das Industriestipendium gegeben“, sagte ich und ahnte, dass unser Direktor, Herr Das, die Informationen zum Forschungsstipendium verbotenerweise zurückhielt.
„Ihr Direktor hat unsere Stipendiumsangebote stets entweder in die Schublade gesteckt oder in den Papierkorb geworfen. Er hat uns bisher keinen von seinen Dozenten empfohlen. Uns hat er auch nicht geschrieben, warum er niemanden vorschlagen kann.“
Herr Rao unterbrach seine Rede und ging, ein Schriftstück in einem Ordner zu suchen. Er kam mit einem Brief zurück und setzte seine Bemerkung über meinen Direktor fort: „Kürzlich haben wir ihn schriftlich nach dem Grund für seine mangelnde Kooperationsbereitschaft gefragt. Daraufhin hat er stillschweigend Ihre Bewerbung an uns weitergeleitet. Zu unserem Schreiben hat er jedoch keine Stellung genommen, leider.“
Er stand wieder auf und legte den Brief in den Ordner zurück. Dann setzte er sich und sagte: „Es wäre schade, wenn wir die ausländischen Stipendien zurückgeben müssten, obwohl wir in unserem Land genügend qualifizierte Kandidaten dafür hätten. Darum begreifen wir das Verhalten Ihres Direktors nicht.“
Herr Rao machte eine Pause, um sich eine Zigarette anzuzünden. Seine entspannte Haltung zeigte, dass die Geschichte mit meinem Direktor abgeschlossen war. Er fuhr fort: „Nun komme ich auf Ihren Fall zurück. Sie haben sehr gute Noten in allen Studienabschnitten. Nach unserer Auffassung sollten Sie sich eher wissenschaftlich und nicht industriebetrieblich weiterbilden lassen. Sind Sie damit einverstanden, wenn wir Ihnen ein Forschungsstipendium zuteilen?
„Ja, mit großer Freude.“
„Herr Sen, wir haben Sie nach Neu-Delhi kommen lassen, um Ihren Direktor zu umgehen. Sie können nun zu Ihrem Arbeitsort zurückfahren. Sie werden demnächst wieder von uns hören. Ihre Reisespesen werden wir Ihnen bald überweisen.“
„Herr Rao, ich bedanke mich sehr für Ihre Bemühungen.“
„Bitte sehr. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg“, sagte Herr Rao und reichte mir seine Hand zum Abschied.
Sofort nach meiner Rückkehr zum Institut bestellte Herr Das mich in sein Büro. Nach der Begrüßung fragte er: „Was wurde in Neu-Delhi besprochen?“
„Der Untersekretär hat mir gesagt, ich wäre geeignet für eine Forschungsarbeit. Er hat mich gefragt, ob ich mit einem entsprechenden Stipendium einverstanden wäre.“
„Waren Sie bei Herrn Rao?“
„Ja.“
„Was haben Sie ihm gesagt?“
„Ich habe ihm gesagt, dass ich sehr gerne eine Forschungsarbeit machen würde.“
„Haben Sie sich nicht für eine Industriepraxis entschieden?“
„Schon, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nichts davon, dass es auch Stipendien für Forschungsarbeiten gibt.“
Ich schwieg über die abwertende Bemerkung des Untersekretärs über ihn. Er löcherte mich auch nicht weiter mit Fragen. Ich hatte das Gefühl, er war neidisch darauf, dass ich die Chance auf ein ausländisches Stipendium bekommen hatte. Zum Schluss sagte er bloß: „Ich hoffe, Sie erhalten überhaupt ein Stipendium.“
Nach vier Wochen kam der Bescheid aus dem Ministerium, das mir ein Forschungsstipendium erteilte. Ich bekam die Gelegenheit, mit einem Stipendium der Deutschen Demokratischen Republik, kurz DDR, eine Forschungsarbeit an einer Technischen Hochschule der DDR durchzuführen. Sogar eine Doktorarbeit war möglich. Ich freute mich außerordentlich. Auf diese Weise ging auch der Wunsch meines Vaters in Erfüllung. Ich nahm das Stipendium an und unterschrieb den Vertrag. Im Stillen bedankte ich mich bei der Regierung der DDR. Nach den Vertragsbedingungen hatten die Stipendiaten selbst die Hinreise zu planen und die Reisekosten zu tragen. Die Regierung der DDR war hingegen verpflichtet, die Rückreise zu organisieren und zu finanzieren.
Nachdem die administrative Arbeit um das Stipendium abgeschlossen war, beantragte ich beim Passbüro einen Reisepass und bei der Botschaft der DDR in Neu-Delhi ein Aufenthaltsvisum. Gleichzeitig buchte ich über ein Reisebüro ein Kabinenbett in einem französischen Passagierschiff, das mich von Bombay nach Marseille befördern sollte. Nach einer gewissen Zeit erhielt ich das Transitvisum für die Landreise durch Frankreich und Westdeutschland nach Ostberlin.
In meiner Begeisterung kaufte ich ein Lehrbuch mit dem Titel „Deutsch für Anfänger“. Ich beabsichtigte, mich in meiner Freizeit mit der deutschen Sprache ein wenig vertraut zu machen. Ferner kaufte ich einen Bildband über Deutschland, um die Landschaften kennenzulernen. Deutschland mit seinen Bergen, Meeren, Seen, Flüssen, Wäldern und Dörfern schien mir ein sehr schönes und grünes Land zu sein. Hinsichtlich der deutschen Sprache gab ich jedoch meine Absicht auf, einige Wörter und Sätze im Selbststudium zu lernen. Ich fürchtete, die Wörter falsch auszusprechen und die falsche Aussprache später nicht mehr korrigieren zu können. Mit der Durchsicht des Lehrbuchs war mir klar geworden, dass die deutsche Sprache für die Bengalen keine einfache Sprache sein würde.
Mit einem Schlag wurde meine Vorfreude auf die Auslandsreise und das Stipendium getrübt: Ich erhielt eine furchtbar traurige Nachricht. Meine Lieblingscousine Anupama, dreiundzwanzig, war krebskrank. Sie hatte einen Tumor in der Bauchspeicheldrüse, und es hieß, dass die Krankheit unheilbar sei. Was für ein Schicksalsschlag! Mir verschlug es die Sprache. Ich wurde traurig, und meine Augen füllten sich mit Tränen.
Anupama und ich waren entfernt verwandt. Sie war meine Lieblingscousine und um vier Jahre jünger als ich. Wir erlebten unsere Kindheit und Jugend zusammen und waren bis zu meinem Abitur unzertrennlich. Ihre Familie wohnte in unserer Nähe. Sie war nicht nur eine Cousine, sondern auch meine Spielkameradin, meine Anhängerin, Begleiterin und überdies meine Bewunderin. In der Kindheit hatte ich sie auf den Schoß genommen, beim Pferdespiel auf dem Rücken getragen. Wir waren zusammen auf Bäume geklettert, hatten miteinander gestritten und gelacht. Wenn sie weinte, hatte ich sie getröstet und ihr ein Bonbon geschenkt. In den späteren Jahren hatten wir Badminton gespielt, waren spazieren gegangen, hatten gemeinsam gelesen, gesungen und uns gegenseitig viel erzählt. Ich half ihr beim Lösen von Hausaufgaben. Einmal hatte ich sie vor dem Ertrinken gerettet. Sie konnte damals nicht gut schwimmen. Sie geriet im Fluss an eine Stelle, die ziemlich tief war. Sie hatte mit ihren Füßen den Boden nicht finden können und war in Panik geraten. Ich schwamm zu ihr hinüber und brachte sie zu einer flacheren Stelle. Wir waren auch schauspielerisch tätig. Auf dem ringsum eingemauerten Flachdach unseres Hauses spielten wir mit anderen Nachbarskindern die Szenen aus den indischen Epen ‚Ramayana‘ und ‚Mahabharata‘. Bei diesen Kinderspielen übernahm sie die Rolle meiner Frau. Das heißt, sie spielte die Rolle der Heldinnen Sita und Droupadi, wenn ich die Rolle der Helden Rama und Arjuna übernahm.
Ich nannte sie Anu und sie mich Dadamoni, was auf Bengalisch – liebevoll ausgedrückt – so etwas wie älterer Bruder bedeutet. Jahre später, nachdem wir die Schule abgeschlossen hatten, sahen wir uns nur während der Semesterferien. Ich ging zum Studieren in eine andere Stadt, und nach einigen Jahren verließ auch sie unsere Kleinstadt für ihr Universitätsstudium. Als ich in mein Berufsleben eintrat, sahen wir uns noch seltener. Trotz weniger Zusammenkünfte mochten wir uns gern. Auf unsere gemeinsamen Stunden warteten wir sehnsüchtig und gingen dann auch mal ins Kino. Wir diskutierten über die Filmheldinnen und Filmhelden. Jedes Mal, wenn ich Anu sah, stellte sie viele Fragen über unser Studium und unsere Zukunft. Sie wollte Lehrerin werden. Ich wollte nach dem Hochschulabschluss ins Ausland. Aber einmal, als ich von einem erhofften Auslandsaufenthalt redete, wurde sie traurig. Sie fragte: „Dadamoni, warum willst du unbedingt ins Ausland?“
„Ich möchte mich dort weiterbilden.“
„Warum kannst du das nicht bei uns?“
„Weil das westliche Ausland uns technisch weit voraus ist.“
„Wenn du weggehst, werde ich schrecklich einsam sein. Ich werde dich sehr vermissen.“ Die Stimme Anus klang traurig.
„Nein, Anu, dein Studium wird dich in Trab halten. Später in deinem Berufsleben hast du keine Zeit, an mich zu denken. Darüber hinaus wird dein Vater dich mit einem reichen Mann verheiraten. Dann gründest du eine Familie und wirst ein glückliches Leben führen.“
„Bitte hör auf! Ich heirate nicht den Kandidaten, den mein Vater aussucht. Ich weiß schon, wen ich heirate.“
Um sie zu hänseln, fragte ich: „Wen denn?“
„Ich heirate den Mann, den ich auch liebe.“
„Wer ist dieser Glückliche?“
„Ich sage es dir nicht. Du sagst auch nicht, wen du liebst und heiraten willst.“
„Anu, keine Frau wird mich lieben und heiraten, wenn sie erfährt, dass ich beabsichtige, ins Ausland zu gehen.“
„Wer liebt, kann auch warten.“
„Falls ich eines Tages im Ausland wäre und du während dieser Zeit heiraten würdest, möchte ich von dir eine Einladung erhalten.“
In diesem Augenblick brach sie in Tränen aus. Je mehr sie versuchte, sich ihr Gesicht mit ihrem Sari abzuwischen, desto mehr schluchzte sie. Schließlich sagte sie: „Ich rede nicht mehr mit dir. Du verstehst meine Gefühle nicht.“ Dann rannte sie weg.
Ich hatte offenbar mit dem Heiratsthema Anu wehgetan. Ich hatte ungeschickt gehandelt und unbeabsichtigt ihre Gefühle verletzt. Ich betrachtete Anu immer noch als meine Cousine und Spielkameradin und sah in ihr nicht die erwachsene Frau, die sie war, mit starken Empfindungen. Später hatte ich mich bei ihr für mein Benehmen entschuldigt. Sie mahnte mich: „Dadamoni, bitte rede nicht über meine Heirat! Das tut mir weh. Ich werde nur für meinen Geliebten leben und ihn eines Tages heiraten. Jetzt stelle mir bitte keine Fragen.“
All diese Erinnerungen wurden wach, als ich von Anus Krankheit hörte. Die Nachricht traf mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ich war fassungslos und tief erschüttert, als ich ein Telegramm von meinem Onkel, Anus Vater, erhielt: „Anupama wünscht sich, dich zu sehen. Bitte beeile dich, bevor es zu spät ist! Dein Onkel.“ Aus dem Telegramm ging klar hervor, dass Anus Tage oder sogar Stunden gezählt waren. Der Himmel stürzte über mir zusammen. Ich nahm den nächsten Zug und beeilte mich, direkt zu Anus Haus zu kommen. Ich brachte Blumen und eine duftende Blumengirlande mit. Anu liebte Blumen über alles. Meine Tante, Anus Mutter, öffnete die Tür. Ihre Augen waren geschwollen vom vielen Weinen. Sie sagte: „Anupama erwartet dich. Sie leidet furchtbar, aber sie ist tapfer.“ Sie führte mich in Anus Zimmer. Darauf sagte Anu ihrer Mutter: „Mami, bitte mach die Tür zu, und erlaube bitte niemandem hineinzukommen! Ich möchte allein mit Dadamoni sein.“
„Anupama, ich versichere, niemand wird dich stören“, sagte meine Tante beim Verlassen des Zimmers und machte die Tür hinter sich zu.
Ich ging zu meiner lieben Anu. Sie lag ruhig und gelassen in ihrem Bett. Sie kämpfte nicht mehr und protestierte auch nicht mehr. Sie hegte keinen Groll gegen ihr hartes Schicksal. Sie akzeptierte letztlich die Fügung, viel zu früh sterben zu müssen. Diese Haltung brachte Frieden in ihr Herz. Ihr Gesicht war friedvoll. Ich nahm es liebevoll in meine Hände und küsste ihre Stirn und die beiden Wangen. Bisher hatte ich sie nie geküsst, auch nicht auf so harmlose Weise. In Indien ist es nicht üblich, eine erwachsene Frau – außer der eigenen Ehefrau – in irgendeiner Form zu küssen. Aber heute waren mir alle gesellschaftlichen Regeln egal. Ich folgte meinem Instinkt. Beim Küssen konnte ich meine Tränen nicht unterdrücken. Zwei Tropfen fielen auf ihre Wangen. Ich versuchte, sie abzuwischen. Sie sagte: „Wische bitte deine Tränen nicht ab! Diese sind Liebestränen.“
Mit weinerlicher Stimme sagte ich: „Einmal hast du gesagt, du wärest schrecklich einsam, wenn ich ins Ausland ginge. Und jetzt willst du mich hier allein lassen.“
„Oh nein, ich will dich niemals allein lassen. Aber ich muss. Niemand kann mir helfen, hierzubleiben. Dadamoni, ich habe dich zu mir gebeten, um dir etwas sehr Wichtiges zu sagen. Ich muss das tun, um mein Herz zu erleichtern und diese Welt glücklich zu verlassen. Was ich dir sagen will, trage ich schon lange in meiner Brust.“
Anu zitterte und weinte. Darauf sagte ich: „Anu, ich bleibe heute bei dir. Bitte beruhige dich jetzt! Du hast genug Zeit, mir alles zu sagen.“
„Nein, nein, ich habe eben keine Zeit mehr. Meine Zeit läuft rasch ab. Darum will ich es dir so schnell wie möglich sagen. Ich möchte heute mein Herz ausschütten.“
Sie überlegte, wie sie ihre Aussage formulieren sollte. Ihr Gesicht färbte sich rötlich, vermutlich vor Scham. Nach einer Pause sagte sie: „Ich liebe dich. Ich möchte diese Welt als Geliebte verlassen. Darf ich dich um einen Gefallen bitten?“
„Liebe Anu, ich gebe dir alles, was ich heute geben kann.“
„Bitte umarme und küsse mich richtig, mein Geliebter!“
Ich zögerte ein wenig. Ich überlegte, wie ich sie umarmen sollte, ohne ihr physisch wehzutun. Mein Inneres riet mir, die Wünsche Anus sofort zu erfüllen, bevor es zu spät wäre. Sonst würde ich es nur bereuen. Anu streckte ihre Arme nach mir aus. Ich musste also nicht mehr überlegen, wie ich sie umarmen sollte. Ich ließ mich einfach in ihre Arme sinken. Ich konnte meine Tränen wieder nicht zurückhalten. Ich umarmte sie und küsste sie lange und leidenschaftlich. Hinterher legte ich meinen Kopf auf ihre Brust und heulte. Sie weinte auch und streichelte meine Haare. Heute erlebte ich den Sieg der Liebe. Anu war die Siegerin. Ihre Liebe siegte über ihre heimtückische Krankheit, wenn auch nur für kurze Zeit. Im Sterbebett machte sie mir ihre Liebeserklärung und liebte mich. Ich bewunderte meine Anupama für ihre lang gehegte Liebe zu mir sowie für ihren Mut und ihre Aufrichtigkeit. Ich dagegen war unfähig gewesen, Anus Liebe rechtzeitig zu erkennen. Ich hatte übersehen, dass Anu nicht mehr meine Spielkameradin war, sondern längst zu meiner Geliebten geworden war. Ich heulte, da das Gefühl des unverzeihlichen Fehlers in mir aufkam und anhielt. Später stand ich einigermaßen erleichtert auf. Anu sah glücklich aus. Ich legte die Girlande, die ich mitgebracht hatte, um ihren Hals und streute die losen und duftenden Blumen über das Bett. Ich ahmte gleichsam ein bengalisches Hochzeitsbett nach. Vor ihrer Krankheit hatte sie, wie alle unverheirateten Frauen, sicher von einer echten Hochzeitsnacht geträumt, nahm ich an. Anu war überglücklich. Sie küsste mich noch einmal und sagte anschließend: „Mein Geliebter, ich darf dich heute mit deinem Vornamen anreden. Nabu, du hast mich sehr glücklich gemacht. Jetzt habe ich das erreicht, was ich als deine Frau wollte: dich umarmen, küssen und innig lieben. Ich bin jetzt wunschlos glücklich, habe kein Begehren und keine Angst mehr. Schatz, bitte geh und ruh dich aus! Ich bin müde, aber glücklich. Ich möchte etwas schlafen. Bitte komm wieder, mein Geliebter!“
Ich hörte zum ersten Mal, dass sie mich nicht mit Dadamoni, sondern mit Nabu und Geliebter anredete. Wahre Liebe machte sie frei und stark. Bisher war sie meine Bewunderin. Aber heute war ich ihr großer Bewunderer und Liebhaber. Ich staunte über ihr reifes Verhalten. Über ihr Liebesbekenntnis empfand ich echte Freude inmitten der Trauer.
Am Abend kam ich wieder zu Anu. Sie sah leidend aus. Trotzdem lächelte sie mich an. Sie wollte noch reden. Ich kam näher zu ihr, umarmte und küsste sie. Sie sagte: „Nabu, ich wollte leben, mit dir leben, mit dir durch die Höhen und Tiefen unseres gemeinsamen Lebens gehen. Ich hätte auf deine Rückkehr aus Deutschland gewartet. Aber ich darf das alles nicht. Wie schade! Doch du hast mich heute sehr glücklich gemacht. Ich danke dir herzlich.“
„Bitte nicht danken, meine Liebe!“
Ich streichelte ihre Haare, ihren Kopf, ihr Gesicht, ihre Hände und ihre Schulter. Sie genoss meine Zärtlichkeit mit geschlossenen Augen. Durch die Berührung ihres Körpers erlebte ich ein bisher unbekanntes, glückliches Gefühl. Ich erfuhr das Wunder der Liebe. Früher hatte ich Anu tausendmal berührt. Aber die heutige Berührung war völlig anders. Eine bewusste, tief empfundene Berührung zwischen zwei Geliebten.
In der Nacht verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand. Der Arzt kam und spritzte ein Schmerzmittel. Er machte sich große Sorgen um ihren Zustand. Er befürchtete, jene Nacht könnte die letzte für Anu sein. Ich blieb bei Anu und hielt ihre Hand. Gegen drei Uhr verstarb sie. Kurz vorher wachte sie aus ihrem Dämmerzustand auf, um mir zu sagen: „Nabu, ich liebe dich.“ Sofort brachte ich meinen Mund nahe an ihr Ohr und erwiderte: „Ich liebe dich auch, mein Schatz.“ Dann küsste ich ihre Lippen. Ihre Augen leuchteten, und ihr Gesicht hellte augenblicklich auf, ähnlich wie eine Öllampe, die vor dem Erlöschen flüchtig wieder aufflammt. Am Ende war der Tod mächtiger als unsere Liebe. Er nahm mir ohne Rücksicht auf mich meine Geliebte weg. Was von ihr übrig blieb, war ihr lebloser Körper. Daran klammerte ich mich eine Zeit lang und beweinte schluchzend unser Schicksal. Sie verlor alles Irdische und ich die Frau, die mich bis zu ihrem letzten Atemzug liebte. Ich fühlte mich plötzlich sehr einsam und traurig. Die Welt sah mit einem Mal trostlos aus. Warum durfte Anupama nicht weiterleben? Warum? Warum? Diese Frage beschäftigte und quälte mich zugleich. Leider konnte ich keine Antwort finden. Aber auch wenn man eine plausible Antwort finden würde, bliebe dennoch die Trauer über den frühen Verlust einer innig geliebten Person.
Anupama war die erste Frau, die mich geliebt hatte. Ich würde sie liebevoll in meiner Erinnerung behalten. Sie war für mich, wie ihr Name auf Bengalisch bedeutet, eine einzigartige, eine einmalige Frau. Ich dankte Gott, dass ich sie in ihren letzten Stunden begleiten konnte.
Trotz meiner tiefen Trauer blieb die Zeit nicht stehen. Im August war es dann so weit. Die Reise nach Deutschland konnte beginnen. Mein Reiseprogramm sah wie folgt aus: Zuerst die lange Zugfahrt von Kalkutta nach Bombay, von dort die Schifffahrt nach Marseille und anschließend wieder eine verhältnismäßig lange Zugfahrt nach Leipzig durch Frankreich und Westdeutschland mit mehrmaligem Umsteigen.
Ich erhielt das Forschungsstipendium der DDR, obwohl ich mich ursprünglich dafür nicht beworben hatte. Ich fragte mich deshalb: War der DDR-Aufenthalt für mich eine Vorbestimmung? Egal, was mir mein Schicksal dort bringen würde, ich freute mich auf die bevorstehende Reise.
Der Fachbereich Elektrotechnik meiner Fachhochschule veranstaltete eine Abschiedsfeier für mich. Ich nutzte die Gelegenheit, mich bei allen für die freundschaftliche Unterstützung zu bedanken. Danach verabschiedete ich mich von allen Anwesenden.
2 - Endlich in Deutschland!
Der Intercity-Zug von Kalkutta (heutiger Name: Kolkata) nach Bombay (heutiger Name: Mumbai) sauste mit hoher Geschwindigkeit durch die Landschaft. Ich schaute zu, wie das Licht der Dämmerung immer weiter abnahm und die Landschaften mit ihren Bäumen in einem rasanten Tempo am Fenster vorbeiflogen. Sie schienen vor uns wegzulaufen, ähnlich wie die Zeit, die auf niemanden wartet und uns davonläuft. Das Menschenleben ist genauso. Wir eilen von einer Lebensstation zur anderen, von einem Ereignis zum anderen und von einer Erfahrung zur anderen. Das Leben geht immer weiter.
Ich war gedanklich ganz abwesend, bis ich hörte, wie sich die Tür unseres Abteils öffnete. Ich drehte meinen Kopf und sah einen Kellner des Zugrestaurants in der Tür stehen. Er wandte sich mit der Frage an mich: „Darf ich Ihnen jetzt das Abendessen servieren?“
„Was gibt’s heute zum Abendessen?“, fragte ich den Kellner zurück.
„Es gibt Basmatireis, Linsen-Dal, ein Gericht aus gemischtem Gemüse, Chicken-Curry, Tomaten-Chutney und zum Dessert süßen Joghurt und zwei Stück Gulab Jamun.“
„Nahezu ein Festessen! Ja, Sie können mir das Abendessen bringen.“
Der Kellner fragte auch die anderen drei Mitreisenden, ob er ihnen etwas servieren könne. Ein Ehepaar hatte sich ihre eigene Verpflegung in verschiedenen Plastikdosen mitgebracht. Daher brauchte es kein Abendessen vom Zugrestaurant. Ein älterer Herr, der mir vis-à-vis saß, bestellte ebenfalls das Abendessen. Wir vier Reisenden befanden uns in einem Schlafwagenabteil mit vier Betten, zwei oben und zwei unten. Tagsüber saßen wir alle vier unten, und erst in der Nacht hatte jeder ein Bett für sich zur Verfügung. In den indischen Intercity-Zügen kann man die Mahlzeiten im Abteil einnehmen. Man muss sich zum Essen nicht in den Restaurantwagen begeben, in dem es nur eine beschränkte Anzahl von Sitzplätzen gibt. Ein weiterer Vorteil des Essens im Abteil ist, dass man sich nicht von seinem Gepäck entfernen muss und damit einen Diebstahl riskiert.
Ich war im Hauptbahnhof Howrah in den Zug eingestiegen. Das ist einer der zwei großen Kopfbahnhöfe der Metropole Kalkutta. Am Bahnhof hatten sich meine Eltern und Geschwister zum Abschied zusammengefunden. Meine Mutter und meine Schwestern wirkten nicht glücklich darüber, dass ich – weit weg von ihnen – in ein unbekanntes Land verreiste. Die Brüder waren dagegen begeistert von meinem Unternehmen. Mein Vater war zwar ruhig, aber nicht traurig; denn ich sollte ja nach seinem Wunsch weiterstudieren. Früher einmal hatte er gehofft, dass ich in Indien weiterstudieren würde. Er akzeptierte nun stillschweigend meine Zukunftspläne von einer akademischen Weiterbildung in Deutschland und nahm die damit verbundene räumliche Trennung von mir hin.
Gegen Spätnachmittag verließ der Zug den Bahnhof für eine 36-stündige Zugfahrt nach Bombay. Nach der Bestellung des Abendessens versank ich wieder in Gedanken. Ich dachte an meine Familie, meine Freunde und Bekannte.
Das Abendessen schmeckte mir gut. Ich war auch hungrig. Später räumte der Kellner das Geschirr weg. Ich dankte ihm und gab ihm Trinkgeld. Draußen war die Nacht pechschwarz. Nur wenn der Zug an Dörfern, Siedlungen oder kleinen Städten vorbeisauste, sah man Lichter.
In Indien kann kaum jemand eine lange Zugfahrt machen, ohne mit den Mitreisenden zu plaudern. Grundsätzlich sind die Inder neugierig und gesprächig. Sie erzählen viel über sich, wollen aber auch von den anderen viel wissen. Ich ahnte, dass der ältere Herr im Abteil sich für ein Gespräch mit mir interessierte. Nach einer Weile brach der Herr sein Schweigen und fragte mich: „Fahren Sie nach Bombay?“
„Ja. Und Sie?“, gab ich wortkarg Antwort und stellte die Gegenfrage.
„Ich fahre auch nach Bombay, und zwar geschäftlich. Nach fünf Tagen kehre ich wieder nach Kalkutta zurück. Haben Sie auch etwas zu tun in Bombay?“, fragte der ältere Herr neugierig.
„Nein, in Bombay bin ich im Transit. Ich reise weiter mit dem Schiff.“
„Wohin?“, war die erwartete Frage.
„Nach Marseille.“
„Sie reisen also nach Frankreich.“
„Genauer gesagt durch Frankreich nach Deutschland.“ Ich gab ihm meine Reiseroute bekannt.
„Wohin geht Ihre Reise in Deutschland?“
„Mein Reiseziel ist die Stadt Leipzig in der DDR.“
Der ältere Herr nutzte sofort die Gelegenheit, mir eine Geschichte zu erzählen.
„Mein Sohn lebt in der Nähe von Frankfurt am Main und arbeitet bei einer Firma, die Landwirtschaftsmaschinen herstellt. In seinem ersten Brief hat er uns etwas Lustiges erzählt. Am ersten Morgen schlief er wegen der Reisemüdigkeit etwas länger. Neben dem Haus, in dem er eine Einzimmerwohnung über seine Firma gemietet hatte, befand sich eine Baustelle. Sein Schlaf wurde durch eine monotone Lautfolge unterbrochen, die sich immer wiederholte: ‚Dange, bite‘, ‚Dange, bite‘, schallte es durch sein Fenster, und er konnte sehen, wie ein Bauarbeiter, der auf dem Boden stand, seinem Kollegen, der sich auf einer Leiter befand, einen Ziegelstein zuwarf. Letzterer fing den Ziegelstein auf und quittierte das Entgegennehmen mit dem Wort ‚Dange‘. Das erwiderte der Kollege auf dem Boden mit dem Wort ‚Bite‘. So wiederholte sich der Vorgang für jeden Ziegelstein mit dem monotonen Spruch ‚Dange – Bite‘, bis die nötige Anzahl an Ziegelsteinen von unten nach oben befördert worden war.“
Ich sagte ihm: „Es sind zwei Wörter: Auf Englisch bedeutet ‚Danke‘‚Thanks‘und ‚Bitte‘‚You are welcome‘.“ Diese zwei Wörter hatte ich aus dem Lehrbuch behalten, das ich in Kalkutta gekauft hatte. Ich fuhr fort: „Wir Bengalen sind im Gegensatz zu den Deutschen sehr sparsam mit Dankesworten. Ich finde es schade, dass wir den Dank für gegenseitige Hilfe, Unterstützung und für das Entgegenkommen nicht immer mit Worten ausdrücken.“
Der ältere Herr ergänzte seine Geschichte und erklärte: „Mein Sohn schreibt, die Deutschen seien nicht nur höflich, sondern auch fleißig, hilfsbereit, ordnungsliebend und freundlich. Sie seien jetzt mächtig engagiert, ihr Land aus den Kriegsruinen neu und modern aufzubauen.“
„Ich danke Ihnen für Ihre Erzählung über Deutschland. Ich möchte Deutschland und die Deutschen gut kennenlernen.“
Später gingen wir ins Bett und schalteten das Licht aus. Im Bett erinnerte ich mich lang an Anupama, an meine frühere Zeit mit ihr und mein Erlebnis an ihrem Sterbebett. Ich sah sie klar vor meinem inneren Auge. Dass sie nicht mehr da war, nie mehr da sein würde, war schwer zu glauben. Den Tod von Anupama würde ich lange nicht verkraften können. Ich wurde traurig. Tränen flossen aus meinen Augen und tropften auf das Bett.
Sechsunddreißig Stunden vergingen im Intercity-Zug mit gutem Essen, Plaudern und Nachdenken. Ich dachte an die künftigen Themen meines Lebens wie Deutschland, das Sprachstudium und die Forschungsarbeit. Ich machte mir auch Gedanken über die Einschiffung in Bombay. Ich kannte die Großstadt Bombay nicht. Am besten sollte ich also mit einem Taxi zum Hafen fahren.
Der Zug traf im Hauptbahnhof „Bombay Victoria Central Terminus“ am Morgen des 13. August ein. Damals ahnte ich nicht, dass der 13. August drei Jahre später durch den Beginn des Mauerbaus zwischen Ost- und Westberlin als ein unheilvoller Tag in die deutsche Geschichte eingehen würde. Ich ging zuerst in den Wartesaal und machte mich frisch. Die Einschiffung sollte um zehn Uhr beginnen. Ich wartete eine Weile im Wartesaal und nahm später ein Taxi zum Hafen, in dem die Passagierschiffe ablegten.
Das französische Schiff hieß „Vietnam“. Die Einschreibung und all das Organisatorische beanspruchten etwas Zeit. Nachher wurde ich in die Kabine geführt. Mein Bett befand sich in einer Sechserkabine mit drei Kajütenbetten und war unten. Alle Betten waren besetzt. Später zog ich los, um das Schiff zu besichtigen und die Einrichtungen kennenzulernen. Die Schiffsreise sollte elf Tage dauern. Die Abfahrt war für achtzehn Uhr vorgesehen. Bereits vor der Abfahrt überzogen die regenreichen schwarzen Wolken den Himmel. Ein starker Wind zog auf, Monsunregen prasselte nieder. Trotzdem legte das Schiff pünktlich ab. Die Silhouette der Metropole wurde immer kleiner, bis sie auf einmal ganz hinter dem Horizont verschwand. Damit verschwand auch meine Heimat aus der Sicht.
Je weiter sich das Schiff vom Ufer entfernte, desto turbulenter wurde das Arabische Meer. Das beleuchtete Schiff im unendlich weiten, offenen schwarzen Meer sah so klein aus wie ein winziges Spielzeug auf dem dunkelhäutigen riesengroßen Bauch eines ungeheuren, auf dem Boden liegenden Dämons. Das Schiff schaukelte stark, so als ob der unermesslich große Dämon tief ein- und ausatmen und den Bauch heben und senken würde. Viele Passagiere wurden seekrank. Ich fühlte mich auch unwohl. Darum lief ich schnell in meine Kabine und begab mich ins Bett. Dort lag ich drei Tage lang flach, ohne den geringsten Appetit auf irgendwelche Nahrung zu verspüren. Der Schiffskellner ging täglich vor jeder Mahlzeit an den Kabinentüren vorbei und läutete mit einer Glocke, um die Passagiere auf die Mahlzeiten aufmerksam zu machen.
Am vierten Tag machte unser Schiff den ersten Halt im Hafen von Djibouti im französischen Somalia. Mit vielen Passagieren ging ich an Land, um die Erde unter meinen Füßen zu spüren. Ich hatte ein Oberhemd mit kurzen Ärmeln an. In der Brusttasche steckte mein Reisepass. Spazierend entfernte ich mich ein wenig weiter vom Schiff. Ein einheimischer Junge wollte von mir irgendetwas, was ich wegen der Sprachprobleme nicht verstand. Plötzlich schnappte er meinen Reisepass und rannte weg. Der Junge verwechselte wahrscheinlich den Reisepass mit einer Geldtasche. Trotz meiner physischen Schwäche nach drei nahrungslosen Tagen fasste ich den Entschluss, dem Jungen nachzurennen und meinen Reisepass zurückzuholen. Mühsam und nach Atem ringend holte ich den Jungen schließlich ein, der in die Richtung seines Dorfes flitzte, und riss ihm den Reisepass aus der Hand. Erschöpft, aber beruhigt lief ich wieder zum Schiff zurück.
Das Schiff fuhr weiter und machte den zweiten Halt im Hafen Port Suez. Einige Passagiere stiegen aus, um auf dem Landweg die Pyramiden und die Stadt Kairo zu besichtigen und spät nachts im Hafen Port Said auf das Schiff zurückzukehren. Dieser fakultative Ausflug kostete 90 US-Dollar pro Person. Ich wollte den Suezkanal sehen und entschied, im Schiff zu bleiben.
Als das Schiff im Begriff war, den Hafen Port Suez zu verlassen, ging ich schnell in meine Kabine, um meinen Fotoapparat zu holen. Vier meiner Kabinengenossen hatten sich auf den Landausflug begeben. So stand die Kabine für den ganzen Tag mir und einem zweiten Mitreisenden zur Verfügung. In der Kabine angekommen traf ich den zweiten Mann, Govind Desai, einen jungen Mann aus Bombay. Er saß auf dem Bett und sah betrübt aus.
„Was machst du hier allein? Hast du keine Lust, den Suezkanal zu sehen?“, fragte ich ihn.
„Ich habe keine Lust, etwas zu tun. Ich bin unglücklich“, sagte Govind in einem traurigen Ton.
„Warum bist du unglücklich?“, fragte ich nach dem Grund seiner Traurigkeit.
„Ich habe Sehnsucht nach meiner Frau“, gab er offen zu.
„Ist ihr etwas Schlimmes passiert?“, fragte ich besorgt.
„Nein, nein. So ist es nicht.“
Ich wollte noch mehr wissen, und darum fragte ich: „Warum machst du dann so ein trauriges Gesicht?“





























