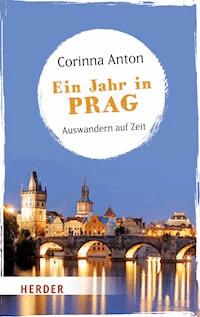
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HERDER spektrum
- Sprache: Deutsch
Es sind die anderen, die unbekannten Seiten Prags, denen Corinna Anton verfällt. Ob sie im Land der Atheisten bei Nonnen zu Gast ist, die Kirchenkatze streichelt oder schlicht an Handwerkern scheitert, ob sie die Plattenbautäler durchstreift, einen kubistischen Kiosk bewundert oder die Kunst des Biertrinkens übt – irgendwann ist klar: Ein Jahr in Prag, zwischen Mišmaš und Štamgasti, ist unvergleichlich. Auswandern auf Zeit in eine magische Stadt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Corinna Anton
Ein Jahr inPrag
Auswandern auf Zeit
Impressum
Titel der Originalausgabe: Ein Jahr in Prag
Auswandern auf Zeit
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2016
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Designbüro Gestaltungssaal
Umschlagmotiv: © TTstudio – shutterstock
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book): 978-3-451-80765-7
ISBN (Buch): 978-3-451-06862-1
Für Anna A. und Frieda M.
Inhalt
Auf dem Weg
Oktober Strč prst skrz krk!
November Nä!
Dezember Festgefroren
Januar In die Magengrube
Februar Kämpfer und Bafler
März Mišmaš
April Osterrutenemanzipation
Mai Integrationsversuche
Juni Zu Mann und Frau
Juli Im Gleichgewicht
August Sanftes Hügelland
September Zemský ráj to na pohled
Nachwort Und nun?
Auf dem Weg
Wir passen überhaupt nicht zusammen, diese Stadt und ich. Ich rauche nicht, mag kein Bier und esse kein Fleisch. In Prag habe ich schon Glück, wenn im Restaurant während der Mittagszeit nicht gequalmt wird, und der Präsident des Landes ist bestimmt nicht der einzige Tscheche, der Vegetariern und Abstinenzlern öffentlich den Tod wünscht. Außerdem mag ich Katzen und Berge; in Prag gibt es vor allem Hügel und Hunde. Und ich fühle mich wohl, wenn es sauber ist. Wenn keine Essensreste am Besteck kleben oder in einer Küche gelegentlich mal durchgewischt wird. In Prag kann man nicht immer und überall vom Boden essen.
Trotzdem sitze ich jetzt im IC-Bus der Deutschen Bahn, auf dem Weg nach Osten. Denn es gibt etwas in dieser Stadt, das mich immer wieder in ihren Bann zieht. Seit ich das erste Mal zwei Tage hier verbracht habe – vor mehr als zehn Jahren war das, während einer Konzertreise mit einem Jugendorchester – löst allein ihr Name ein schwer zu bändigendes Gefühl der Sehnsucht in mir aus. An den Aufenthalt damals kann ich mich kaum erinnern, nur an ein kleines Bild, das ich auf der Karlsbrücke für ein paar Kronen gekauft habe: Die Moldau mit ihren Brücken war darauf zu sehen, in orange-gelbes Abendlicht getaucht. Und an ein paar Stunden, die wir unter den blühenden Bäumen des Laurenzibergs (tschechisch Petřín) verbrachten. Das unbeschwerte In-der-Sonne-Liegen-und-den-Klängen-der-Stadt-Lauschen und ein magisches Glitzern, gepaart mit der mächtigen Kraft des Flusses: Das war, was ich mit Prag verband und was mich, nachdem ich so etwas Ähnliches wie erwachsen geworden war, jedes Mal unheilbar melancholisch werden ließ, wenn ich an die Stadt dachte.
Dreimal hatte es mich seitdem schon zurückgezogen. Dreimal war ich für ein paar Wochen in Prag, um ein Praktikum zu machen. Und dreimal stand ich am Ende meines Aufenthalts im imposanten historischen Hauptbahnhof, vor dem der Bus nach Nürnberg und München abfährt. Jedes Mal habe ich die lateinische Inschrift „PRAGA – mater urbium“ angestarrt, die Prag zur „Mutter aller Städte“ macht. Ich habe die Menschen beobachtet, die unter meinen Füßen zu ihren Zügen eilten und habe über die in Stein gemeißelte Jahreszahl 1918 nachgedacht (das Jahr, in dem meine Oma ihren ersten Geburtstag feierte und in dem die Tschechen zusammen mit den Slowaken ihre erste eigene Republik gründeten). Und jedes Mal habe ich geheult, weil mir der Abschied so schwer fiel.
Diesmal ist es anders. Diesmal habe ich mir vorgenommen, ein Jahr in Prag zu leben, mir unendlich viel Zeit für die Stadt zu nehmen, die Tschechen und ihre Sprache so richtig kennenzulernen. Ich habe mein Studium gerade beendet und eine Stelle bei der deutschsprachigen „Prager Zeitung“ bekommen. Aber ausgerechnet diesmal habe ich gar keine rechte Lust, so lange zu bleiben. Denn vor der Abreise habe ich mich zu Hause noch schnell in einen Typen verliebt, der nun ebenso sehnsüchtig auf meine Rückkehr wartet wie ich jeden Abend auf seinen Anruf. Ich hätte die Stelle auch ablehnen können. Aber nach nur ein paar Wochen Beziehung hielt ich es für keine gute Idee, seinetwegen auf Prag zu verzichten. Und außerdem war ich trotzig, weil ich in Deutschland nur Absagen auf meine Bewerbungen bekommen hatte. Ich durfte zwar für mickrige Zeilenhonorare als freie Journalistin arbeiten, eine ordentlich bezahlte Stelle wollte mir aber trotz besten Praktikumszeugnissen und super Masterabschluss niemand geben. Wenn Deutschland mich nicht haben will, dann will ich es jetzt auch nicht mehr, beschloss ich – vielleicht etwas überstürzt – nach einem besonders schmerzhaften „Vielen Dank für Ihre Bewerbung. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen …“.
Jetzt, nicht einmal zwei Monate später, starre ich durchs Busfenster auf Wiesen und Wälder. Die Grenze haben wir bereits passiert, ohne dass ich es bemerkt habe. Nur mein Handy heißt mich per SMS lautlos „Willkommen in Tschechien“.
OktoberStrč prst skrz krk!
In meiner ersten Prager Nacht hatte ich nur zwei Gedanken: Wo kann ich am besten gleich morgen eine Matratze kaufen, und wie transportiere ich sie mit tramvaj und metro (so die Prager Bezeichnungen für Straßen- und U-Bahn) nach Hause? Von der möblierten Einzimmerwohnung in der Nähe des Karlsplatzes (Karlovo náměstí) war ich sofort begeistert. Mein Vermieter war ein leidenschaftlicher Hobbyhandwerker und hatte sie nicht mit deutscher Gründlichkeit, dafür aber mit umso mehr Liebe zum Detail in einen gemütlichen Rückzugsort verwandelt. Tisch und Kommode hatten Holzwurmspuren und kamen offenbar vom Flohmarkt oder einer Wohnungsauflösung. Ansonsten hatten sie nichts gemeinsam. An der Wand hing eine Toskana-Landschaft neben schneebedeckten Prager Dächern. Weder der Stil der Gemälde noch ihre Rahmen passten zusammen. Das Bett stand zwischen zwei Schränken – der eine antik verschnörkelt, der andere quadratisch, praktisch, kommunistisch. Sie waren so angeordnet, dass sie ein Mini-Schlafzimmer bildeten. Ich betrat es durch eine improvisierte Schwingtür aus zwei farblich verschiedenen Holzbrettern. Das Zimmer war ein Graus für jeden Perfektionisten und eine Höhle, in die ich unbedingt einziehen wollte. Einziger Schwachpunkt war – und das merkte ich erst jetzt – die durchgelegene Matratze. Ich spürte die ganze Nacht über jede einzelne Strebe des Lattenrostes. Mein Rücken schmerzte, und ich überlegte, ob ich den Kauf einer Matratze problemlos auf Tschechisch bewältigen könnte. Mit meinem chytrý telefon (die Tschechen übersetzen Smartphone und ähnliche Begriffe oft wörtlich) googelte ich Matratzengeschäfte in der Nähe.
Die Verbesserung meiner Schlafsituation rutschte im Laufe der nächsten Tage immer weiter nach unten auf der Prioritätenliste. Zuerst wollte ich mich anmelden, damit alles seine Ordnung hat. Als EU-Bürgerin brauche ich zwar weder eine Arbeitserlaubnis noch eine Aufenthaltsgenehmigung, aber die Behörden hier wollen trotzdem informiert werden, wenn man sich mehr als drei Monate in ihrem Land aufhält. Welches Amt in meinem Fall das richtige war, blieb mir auch nach gründlicher Recherche ein Rätsel: Die Angaben, die ich im Internet fand, waren widersprüchlich und deckten sich nicht mit den Erfahrungsberichten meiner Kollegen. Offenbar war je nach Stadtbezirk eine andere Dienststelle zuständig, was aber nicht hieß, dass die auch nur annähernd in der Nähe dieses Bezirks lag. „Wir leben halt in einem Land ohne Regeln“, sagte unser Fotograf Ondřej, den ich in meiner Verzweiflung um Rat fragte. Obwohl Ondřej schon seit Jahren für die „Prager Zeitung“ arbeitet, spricht er kein Wort Deutsch. Den Versuch, schwierige tschechische Sätze zu formulieren, belohnt er dafür meist mit einem anerkennenden Nicken. Wenn er gute Laune hat. Außerdem distanziert sich Ondřej gerne von seinen Mitbürgern. Wenn er sagt, Tschechien sei ein Land ohne Regeln, dann meint er damit nämlich keinesfalls sich selbst. Er erledigt keinen Auftrag, der nicht fein säuberlich auf seiner penibel geführten und jeden Mittwoch neu ausgedruckten Excel-Liste geschrieben steht. Ich wette, er hätte beim Anblick meiner Schlafzimmerkonstruktion die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und schon nach ein paar Tagen in der Redaktion traute ich mich, meine Uhr auf 11.58 zu stellen, wenn er sich auf den Weg zum Mittagessen machte.
Bei meinem Behördenproblem konnte er mir aber nicht helfen, also versuchte ich mein Glück einfach bei der Ausländerpolizei, nicht weit entfernt von der Redaktion. Offenbar hatte ich einen guten Tag erwischt. Schon eine knappe Stunde nachdem ich eine Nummer gezogen hatte, durfte ich das Zimmer betreten, in dem ein Beamter in Uniform hinter dem Schreibtisch saß. Er begrüßte mich nicht gerade überfreundlich, aber als er merkte, dass ich ganz passabel Tschechisch sprach, wurde seine Laune spürbar besser. Konzentriert tippte er meinen Namen – ein doppeltes N kommt im Tschechischen so gut wie nie vor – in seinen Computer. Dann setzte er ein überlegenes Lächeln auf. „Aha, im Juli 2011 waren Sie also schon einmal in der Tschechischen Republik – in Jihlava“, stellte er fest. Ich weiß nicht, ob er meinen erschrockenen Gesichtsausdruck bemerkte. Ein paar Sekunden überlegte ich, was ich damals verbrochen haben könnte. Für einen Artikel über einen tschechischen Regisseur, der mit seinen Dokumentarfilmen über das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Vertreibung der Deutschen tschechische Tabus gebrochen hatte, verbrachte ich damals zwei Tage in Jihlava. Die heute etwa 50 000 Einwohner zählende Stadt zwischen Prag und Brünn war als Iglau einst Teil einer deutschen Sprachinsel. Mir ist von dem Ausflug aber vor allem das McDonald’s im Zentrum in Erinnerung geblieben, in dem ich nach einer langen Nachtbusfahrt ein Eis gefrühstückt hatte. Ein tschechischer Kollege hatte mich dazu eingeladen. Hatte ich vielleicht mein Zimmer im Hotel nicht bezahlt? Bei Rot eine Fußgängerampel überquert? Da der Polizist nichts weiter sagte, fragte ich nicht nach und nickte nur. „Da sehen Sie mal, was wir alles wissen“, grinste er jetzt. Aus Ratlosigkeit lächelte ich zurück. Wenn der Aufenthalt in Jihlava der einzige war, der in seinem Computer vermerkt war, wusste er ziemlich wenig, dachte ich. Dass ich auch schon in Olomouc und Liberec, im Böhmerwald und im Riesengebirge war und nun nicht zum ersten Mal in Prag, behielt ich aber lieber für mich und bastelte mir meine eigene Erklärung: Entweder die Hotelbetreiber in Jihlava waren die einzigen, die mich als ausländischen Übernachtungsgast ordnungsgemäß bei der Fremdenpolizei angemeldet hatten. Oder der Polizist hatte zufällig Jihlava herausgegriffen, weil er selbst von dort kam und sich freute, dass ich seine Heimatstadt kannte. Das klang plausibel, aber seine Herkunft war nicht Thema unseres Gesprächs.
„Grund des Aufenthalts?“, las er jetzt von seinem Computerbildschirm ab. Solche Fragen können zum falschen Zeitpunkt leicht eine mittelschwere Sinnkrise auslösen. Spätestens heute Abend, wenn ich noch einmal auf dem Hauch von einer Matratze liege und meinen Freund mit WhatsApp-Nachrichten bombardiere, werde ich mich wieder fragen, was ich hier eigentlich mache. Abgesehen davon, dass die Stadt mich magisch anzog, gab es schon noch andere Gründe für meine Flucht nach Osten, mehrere sogar. Einen behielt ich aber vorsichtshalber meistens erstmal für mich, ein anderer sollte mir erst im Laufe der zwölf Monate dämmern, und ein dritter war hoffnungslos idealistisch: Als Journalistin wollte ich meinen Beitrag zur Verbesserung der Welt oder zumindest der deutsch-tschechischen Beziehungen leisten, wollte schonungslos mit Vorurteilen aufräumen und den Menschen westlich der Grenze das Nachbarland im Osten mit meinen Geschichten näherbringen. Dass das mehr als 25 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs noch immer dringend nötig war, hatte ich vor meiner Abreise immer wieder erlebt. „Was willst du denn in der Tschechei?“ war noch eine der harmloseren Fragen, bei der ich nicht müde wurde, mein Gegenüber – egal, ob Hochschulprofessor oder Pfarrgemeinderatsvorsitzende – höflich darauf aufmerksam zu machen, dass diese Bezeichnung heute nicht mehr gerne gehört werde. Die Nationalsozialisten verwendeten sie, als sie sich im März 1939 das einverleibten, was sie „Rest-Tschechei“ nannten. Fast ebenso verbreitet waren Aussagen wie: „Oh, Prag soll schön sein, wir kommen dich besuchen. Aber mit unserem neuen Auto trauen wir uns nicht zu den Tschechen fahren, wir nehmen lieber den Bus.“ Einfühlsame und wachrüttelnde Artikel waren gefragt, um den Lesern zu zeigen, dass auch in Prag Menschen leben wie du und ich. Menschen mit kleinen Macken und großen Wünschen, mit verrückten Träumen und berührenden Schicksalen.
„Studium?“ Der Polizist riss mich aus meinen Gedanken. So genau wollte er es also gar nicht wissen, ich musste die Antwort auf ein Wort reduzieren. „Nein, Arbeit“, sagte ich, und damit war die Sache erledigt, die Sinnkrise vorübergehend abgewendet. Der Mann, der vermutlich aus Jihlava kam, füllte das Formular aus und überreichte mir einen kleinen Zettel aus dünnem Papier, der alles und nichts hätte sein können und sich schon bald in den Tiefen meines Geldbeutels zwischen Zehn-Euro- und Tausend-Kronen-Scheinen in Luft auflösen würde. Mit dem Zettel sollte ich innerhalb der nächsten drei Monate auf ein anderes Amt, das mir dann eine Bescheinigung über meinen vorübergehenden Aufenthalt ausstellen würde. Ich beschloss jedoch, erst einmal ein paar Wochen verstreichen zu lassen.
Es ist ohnehin nicht gesagt, dass ich es überhaupt so lange hier aushalten werde, denke ich ein paar Tage später auf dem Weg zur Straßenbahn. Aber ich will Prag eine Chance geben, deshalb beschließe ich, einen Umweg zu machen und den vielleicht letzten milden Oktoberabend für einen Spaziergang durch Žižkov zu nutzen. Das Viertel liegt östlich des Zentrums – weit genug, um von großen Touristenscharen verschont zu bleiben und nah genug, um mit tramvaj oder metro in zehn bis zwanzig Minuten den Hauptbahnhof, Wenzelsplatz oder Altstädter Ring zu erreichen. Manche Reiseführer bezeichnen Žižkov als Künstler- und Kneipen-, ehemaliges Arbeiter- oder Szeneviertel. Ich kann damit nicht viel anfangen. Für mich ist es bisher einfach die Gegend, in der sich die Redaktion befindet; die lange, unspektakuläre Jeseniova-Straße mit ihren Wohn- und Bürogebäuden auf der einen und dem grünen Parukářka-Hügel auf der anderen Seite.
So unauffällig wie möglich folge ich einem Hundebesitzer, der seinen katzengroßen Vierbeiner Gassi führt, über den geteerten Fußweg auf den Parukářka-Hügel hinauf. Zwischen jungen Müttern mit Kinderwagen und älteren Männern mit Zwei-Liter-Plastik-Bierflaschen in der Hand bleibe ich oben stehen, ein wenig außer Atem. Als ich mich umdrehe und in Richtung Stadtzentrum blicke, ist es plötzlich wieder da, das Gefühl meines allerersten Prag-Aufenthalts. Zu meinen Füßen liegt Žižkov im herbstlichen Abendlicht klein und bunt wie eine Spielzeugstadt. Darüber ragt der kolossale Fernsehturm in den roten Himmel. Er wurde in den Achtziger- und Neunzigerjahren gebaut und wird von manchen Pragern heute als „hässlichstes Gebäude Mitteleuropas“ bezeichnet. Ich finde seinen Anblick trotzdem schön. Die Stadt ist von hier oben so unendlich, so weit, so golden. Lange kann ich mich nicht trennen von dieser Aussicht. Ich muss einfach dastehen und auf die ineinander geschachtelten Häuser im Herbstlicht schauen. Dabei taste ich mit der linken Hand nach dem schlichten silbernen Ehering meiner Oma, den ich am rechten Ringfinger trage, seit sie ihn mir vererbt hat. Was sie wohl zu meinem Prag-Abenteuer sagen würde?
Erst als der Himmel dunkler und der Wind kühler wird, steige ich wieder hinunter, um Richtung Zentrum zu laufen. Ich gehe vorbei an den neuen und sanierten Mietshäusern in Sonnengelb und Lindgrün, mit Topfpflanzen auf den Dachterrassen. Und an den alten Plattenbauten in Betongrau, unverputzt. Sie haben auch mehr als 25 Jahre nach der Samtenen Revolution keinen freundlichen Anstrich erhalten. Man sieht genau, wo die einzelnen Bauteile zusammengesetzt sind. Ich überlege, ob das Absicht ist. Sozialistische Ästhetik? Oder fehlt das Geld für Putz und Farbe? Ihre Balkone haben manche Bewohner hübsch dekoriert. Andere lagern dort Gerümpel oder haben Wäsche aufgehängt. In den Dachrinnen und auf den Stufen zur Haustür wächst Unkraut. Die Fenster im Erdgeschoss sind vergittert. Eines ist meistens offen – dort verkauft ein Mann frischgebackenen Strudel mit Mohn-, Quark- oder Apfelfüllung. Ein paar Schritte weiter riecht es auf der Straße abwechselnd nach Urin oder Hundekot und Abwasser. Die Mülltonnen quellen über. Eine Frau sucht darin nach etwas Essbarem. Als sie sieht, dass ich auf sie zukomme, fragt sie mich zahnlos nach einer Zigarette. Ich schüttle den Kopf, später ärgert es mich, dass ich ihr nicht wenigstens ein paar Kronen gegeben habe. Am nächsten Tag wird sie mich wieder nach einer Zigarette fragen, und ich werde wieder den Kopf schütteln und später ein schlechtes Gewissen haben, und in der Woche darauf wieder und wieder. Warum merkt sie sich nicht, dass ich Nichtraucherin bin, warum fragt sie mich nicht nach ein paar Kronen?
Nach unserer ersten Begegnung denke ich wieder an die Frage nach dem Grund meines Aufenthalts. Zemský ráj to na pohled, heißt es in der tschechischen Nationalhymne, als „irdisches Paradies fürs Auge“ bezeichnen diese Worte das Land. Gerade auf dem Hügel habe ich noch geglaubt, diesem Paradies ganz nah zu sein. Aber hier unten? Mir fällt das schaurig-schöne Bild ein, das ich mir damals auf der Karlsbrücke gekauft habe. Bei einem der vielen Umzüge in den vergangenen Jahren muss ich es irgendwo verloren haben.
Jetzt gehe ich weiter bis zur Haltestelle Lipanská, den steilen Berg hoch am Rathaus von Žižkov vorbei. Ich bin außer Atem und steige in die Straßenbahn mit der Nummer 9. Die klangvollen automatischen Ansagen in der Tram habe ich schon im Ohr und freue mich jedes Mal, wenn sie – ein bisschen wie eine kleine Melodie – aus dem Lautsprechern klingen: Příští zastávka heißt „nächster Halt“ und zählt zu den Ausdrücken, die Ausländern nur schwer über die Lippen gehen. Fast so wie der berühmte Satz Strč prst skrz krk, der so viel bedeutet wie „Stecke den Finger durch den Hals“. Das ergibt zwar wenig Sinn, kommt aber in vielen Sprachkursen vor, um zu zeigen: Man braucht im Tschechischen nicht unbedingt Vokale, um Sätze zu bilden.
Will man den Nonsenssatz und alle anderen tschechischen Wörter richtig aufsagen, muss man sich einige wenige Grundregeln merken, zum Beispiel, dass „ě“ wie „jä“ ausgesprochen wird, „č“ wie „tsch“, dass „š“ wie „sch“ klingt und „ž“ die stimmhafte Variante davon ist – in Žižkov kommt sie gleich zweimal vor. Eine Herausforderung ist das „ř“. Es ist eine Mischung aus „r“ und „sch“, wobei beides gleichzeitig erklingen muss – ein Grund, weshalb so viele tschechische Kleinkinder zum Logopäden müssen, wie eine Lehrerin mir einmal verriet.
Als ich bei Lipanská einsteige, wird schon die příští zastávka, die Husinecká angekündigt (ach ja, und Striche auf den Buchstaben machen die Vokale lang – also etwa „prschrschrieschtie sasstaaaafka: Hussinettskaaaa“). Dann kommt der Hlavní nádraží, der Hauptbahnhof („hlawnie naaadraschie“). Dort warte ich auf die nächste Tram, als mich zwei russische Touristen nach dem Weg zum Wenzelsplatz fragen. Ich kann ihnen sofort weiterhelfen, dank der zwei Semester Russisch an der Uni gelingt es mir, sie mit wenigen Worten und vielen Gesten in die richtige Richtung zu schicken. Vor allem aber fühle ich mich plötzlich fast als Einheimische, weil ich gerade eindeutig bewiesen habe, dass ich mich schon sehr viel besser in der Stadt auskenne als die Fremden. Dass es nicht gerade eine große Kunst ist, im Prager Zentrum den Weg zum Wenzelsplatz zu finden, gestehe ich mir nicht ein. Lieber genieße ich noch ein bisschen das Gefühl, zumindest vorübergehend eine echte Pragerin geworden zu sein.
NovemberNä!
Nein, sagte die Frau, eine Monatskarte gebe es nicht. Tief einatmen, befahl ich mir, den Tränen nahe. Ich wusste genau, dass es sehr wohl eine solche Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr gab. Schon viel zu lange kaufte ich mir fast täglich Tickets für den Weg zur Arbeit. Sie sind mit 24 Kronen (nicht mal ein Euro) für dreißig Minuten Fahrtzeit zwar relativ günstig, auf Dauer aber doch teurer und weniger praktisch als die Monatskarten. Noch einmal versuchte ich es mit: „Aber es gibt doch …“. „Nein“, unterbrach mich die Frau am Schalter, ohne eine Miene zu verziehen, „gibt es nicht“, und winkte den nächsten Kunden nach vorn. Mühsam zwang ich mich, meine Wut runterzuschlucken. Ich hatte Hunger, und mir war kalt, außerdem hatte ich den ganzen Tag schon ein ne (im Tschechischen mit kürzerem „e“ als im Deutschen gesprochen, wie „ä“, aber gleicher Bedeutung) nach dem anderen kassiert.
Das erste war von Ondřej gekommen, dem Fotografen mit der Excel-Tabelle. Er wollte einfach nicht das Bild zu meinem Artikel liefern, das ich gerne gehabt hätte. Was ich originell und kreativ fand, war in seinen Augen Unfug, sah aus „wie von einem Betrunkenen nach sieben Bier auf dem Boden liegend aufgenommen“. Ich bevorzugte ungewöhnliche Perspektiven, er gerade Linien, Quadrate und rechte Winkel. Alles musste seine Ordnung haben.
Das zweite ne kam in der Mittagspause, als ich mir beim Bäcker um die Ecke ein belegtes Brötchen holen wollte. Viele Tschechen schwärmen von ihren chlebíčky – was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann: Geschmackloses Weißbrot mit tonnenweise Mayonnaise, zwei bis drei dünnen Scheiben Wurst oder Schinken (oder seltener Käse) und ein bisschen Gurke oder Paprika zur Dekoration ist meiner Meinung nach kein Gericht, das für eine besonders raffinierte Küche spricht. Gereicht werden die Happen aber sowieso vor allem bei Festen und Feiern. Das belegte Brötchen vom Bäcker für die Mittagspause ist nicht sonderlich verbreitet. Ganz zu schweigen von einer guten Butterbrezel. Oder überhaupt einer Brezel.
Ich war also froh, nicht weit von der Redaktion eine Bäckerei zu entdecken, die nicht nur trockenes Brot und süßes Gebäck verkauft. Allerdings erblickte ich in der Vitrine ausschließlich Brötchen mit Fleisch – auch die mit viel Käse waren zusätzlich mit einer Scheibe Schinken versehen. „Haben Sie vielleicht auch etwas Vegetarisches“, fragte ich vorsichtig, als ich an der Reihe war. Ne. „Könnten Sie nicht zum Beispiel so ein Brötchen da nur mit Käse belegen?“ Die Verkäuferin sah mich an, als käme ich vom Mond. Ne. Hungrig und trotzig verließ ich den Laden und kaufte mir um die Ecke eine Tüte Chips.
Das dritte ne gab es in der Bank, als ich versuchte, ein Konto zu eröffnen. Ich hatte alle Daten angegeben, mir den tschechischen Vertrag zweimal mehr oder weniger aufmerksam durchgelesen und mich für die günstigere Option entschieden, als ich kurz vor der letzten Unterschrift nach meiner Handynummer gefragt wurde. Noch hatte ich mir keine tschechische SIM-Karte besorgt, obwohl es sich für ein Jahr gewiss lohnen würde. Aber es standen noch so viele Sachen auf der To-do-Liste, und ich hatte es für wichtiger gehalten, zuerst das Konto zu eröffnen. Ne, sagte die Beraterin, ohne tschechische Nummer sei das nicht möglich, und erklärte irgendwas von Freischalten, PIN und einer Kontrollnummer, die mir per SMS geschickt würde. Also erst zum Handyladen nebenan, später noch einmal zur Bank, das ganze Spiel von vorne. Das alles mit nicht viel mehr als einer Tüte Chips im Magen.
Und nun auch noch die Sache mit der Monatskarte. Hatte die Frau am Schalter mich nicht verstanden? War mein Tschechisch zu schlecht? Ich bekam Heimweh und Lust auf eine Butterbrezel, fuhr nach Hause und wollte mit meinem Freund in Deutschland skypen. Spieleabend mit seinen Kumpels, schrieb er einsilbig zurück, keine Zeit, tut mir leid.
Stattdessen ließ ich mich ins Bett fallen, und wie jeden Abend in diesem Moment fiel mir das ungelöste Matratzenproblem wieder ein. Bisher war zu viel los gewesen. Die Tage hatte ich in der Redaktion damit verbracht, zu verstehen, was in diesem Land gerade Wichtiges geschieht (meistens nichts oder nicht viel), und daraus einigermaßen unterhaltsame Texte zu stricken. Nach Feierabend spazierte ich oft mit Zettel, Stift und Fotoapparat durch die Straßen, um nach neuen Ideen zu suchen. Oder wartete zu Hause (meist vergeblich) auf einen Skype-Anruf.
In den ersten Wochen musste ich außerdem regelmäßig nach Deutschland – was das Einleben in Prag schmerzlich in die Länge zog und mir den Umzug endlos erscheinen ließ. Bei der ersten Busfahrt hatte ich mich noch auf das Wesentliche beschränkt (wer schon einmal auf diese Weise umgezogen ist, der weiß, dass das Wesentliche erstaunlich schwer ist). Beim zweiten Mal durften einige ungelesene deutschsprachige Romane und meine Lieblingsmüslischüssel ebenso wenig fehlen wie ein Multifunktionshobel für Gurken, Käse und Karotten, den mir meine Eltern vor einiger Zeit zu Weihnachten geschenkt hatten. Ab der dritten Fahrt nahm ich Dinge mit, die man nicht unbedingt zum Überleben braucht (Radiowecker, Nudelsieb, Küchenschere, Wörterbuch, Wärmflasche, Hausapotheke).
Am liebsten hätte ich auch jedes Mal ein Dutzend frische Vollkornbrote in meinen Rucksack gestopft. Aber meistens war er schon nach zwei Laiben zu schwer. In Prag machte ich daraus vier Hälften und verstaute drei davon in meinem Gefrierfach. Denn das Brot, das ich bisher hier gekauft hatte, schmeckte spätestens am zweiten Tag, als wäre es eigentlich dazu bestimmt, die Hauswand damit zu isolieren. Es war wie Dämmmaterial, nur mit ein bisschen Kümmel drin, selbst wenn es direkt nach dem Kauf noch gut gerochen und eine knusprige Kruste gehabt hatte. Nicht viel besser waren die rohlíky – geschmacklose, oft zähe Stangen, die vermutlich ausschließlich aus Wasser und Mehl bestehen, dafür aber mit zwei Kronen (etwa sieben Cent) unschlagbar günstig und wahrscheinlich auch deswegen so beliebt sind. Wer sich gerne als Ausländer outen möchte, der sollte übrigens – am besten mit einem stumpfen Messer – unbedingt versuchen, seinen rohlík aufzuschneiden und dann beide Hälften getrennt voneinander zu belegen. Wer ihn auf tschechische Art verzehren möchte, schmiert den Aufstrich einfach direkt auf den ganzen rohlík und beißt rein.
All das wanderte jetzt beim Einschlafen wieder durch meinen Kopf. Ich dachte mal auf Tschechisch, mal auf Deutsch, kaufte in Gedanken Fahrkarten, eröffnete Konten und bestrich einen rohlík. Statt mich weiter von einer Seite auf die andere zu wälzen, beschloss ich, noch einmal in Jeans und Winterstiefel zu schlüpfen. Ich steckte auch den Ring meiner Oma noch einmal an, den ich schon neben mein Bett gelegt hatte, und ging nach draußen. Wenzelsplatz und Karlsbrücke sind zwar zu Fuß keine zwanzig Minuten von meiner Wohnung entfernt. Trotzdem befinden sie sich jenseits einer unsichtbaren Grenze. Bis zum Karlsplatz bewegen sich einige Touristen noch, manche schauen sich das Tanzende Haus ein paar Schritte weiter unten am Moldauufer an und vielleicht noch das Emmauskloster, das die Alliierten im Zweiten Weltkrieg angeblich aus Versehen zerbombten – wahrscheinlich, weil sie Prag aus der Luft mit Dresden verwechselten. Aber nur wenige gehen die paar hundert Meter stadtauswärts in Richtung Albertov, der Straße, in der im November 1989 die Studentenproteste begannen.
„Wann, wenn nicht jetzt? Wer, wenn nicht wir?“, steht auf einer Gedenktafel, darunter das Datum, das an die Samtene Revolution erinnert: 17. 11. 1989. Es war der Tag, an dem tausende Studenten demonstrierten und die Sicherheitskräfte mit Gewalt gegen sie vorgingen. Der Tag, den man heute als Beginn der Samtenen Revolution bezeichnet, ein staatlicher Feiertag, an dem zugleich daran erinnert wird, dass am 17. November 1939 die Nationalsozialisten im damaligen „Protektorat Böhmen und Mähren“ die tschechischen Hochschulen schlossen und tausende Studenten misshandelten, verhafteten, in Konzentrationslager deportierten und töteten. Das ist lange her, und doch frage ich mich, ob ich mich als Deutsche nicht ein bisschen schuldig fühlen sollte, wenn ich mir vorstelle, was hier im November 1939 passiert ist. Und ich frage mich, wie es den Tschechen geht, wenn sie an den November 1989 denken. Ob alle den freien Tag gleichermaßen genießen – die Mittäter und die Verfolgten za komunismu – „im Kommunismus“, wie die Tschechen sagen, als wäre es allein das ihnen übergestülpte System gewesen, das ganz ohne das Zutun von Menschen funktionierte. Feiern sie alle gemeinsam, diejenigen, die nicht studieren oder ihren Beruf nicht ausüben durften, und diejenigen, die sich arrangierten; die, die nach 1989 plötzlich zu Geld kamen, und die, die verbittert sind, weil sie nach der Revolution alles verloren; die, die um die Welt reisen, und die, die keine Arbeit haben oder keine Rente, von der sie leben können?
Ich ziehe meine Mütze tief über die Ohren, der Wind bläst mir kalt ins Gesicht. Es ist kurz vor Mitternacht, das Viertel rund um die Gebäude der Karls-Universität schläft schon. Im Vergleich zu Žižkov, wo ich nach Redaktionsschluss oft spätabends zur Tram laufe und die Menschen um diese Zeit in den 24-Stunden-Läden einkaufen oder nach einer Kneipe suchen, die bis zum Morgengrauen geöffnet bleibt, geht es in den Straßen zwischen Albertov und Moldau-Ufer, am Rand der Neustadt, sehr aufgeräumt zu. Die Häuser sind höher und größer, aber auch älter und hübscher. Hier sind za komunismu kaum Plattenbauten entstanden. Und die Straßen und Gassen sind weniger verwinkelt. Sie führen entweder Richtung Karlsplatz oder runter zur Moldau.
Ich lasse mich treiben und lande am Náplavka-Ufer. Solange die Temperaturen abends noch angenehm waren, bekam man hier nach Einbruch der Dämmerung kaum einen Sitzplatz in Moldau-Nähe. Auf allen Bänken und Mauern, auch auf dem Boden saßen junge Menschen und feierten, dazwischen spielten Bands und legten Boote an, von denen aus den Leuten am Ufer Getränke verkauft wurden. Seit ein paar Wochen ist es ruhiger geworden. Die kleineren Boote sind verschwunden, wahrscheinlich warten sie irgendwo auf den Frühling.





























